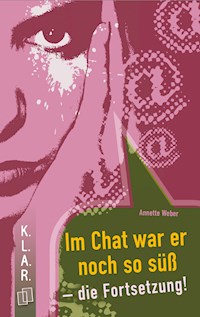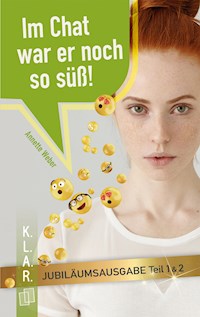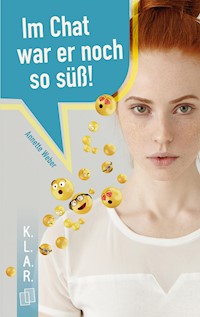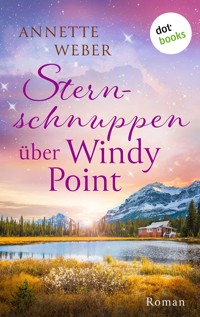
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was tut man, wenn man sich in den eigenen Ehemann verliebt? Freund weg, Job weg, Aufenthaltsgenehmigung weg: In Tränen aufgelöst steht Marlene am Flughafen. Sie soll ihr geliebtes Kanada verlassen, um zurück in die deutsche Heimat zu reisen. Doch bei einer Zufallsbegegnung mit dem jungen Farm-Besitzer Cole, macht er ihr ein Angebot, das genauso verrückt ist wie … perfekt! Marlene und Cole werden heiraten und ein Jahr gemeinsam auf seiner Pferderanch am Windy Point leben. Die Ehe nur auf dem Papier, keine komplizierten Gefühle. So kann Marlene in Kanada bleiben und weiterhin mit Pferden arbeiten, während Cole die Ranch von seinen Eltern überschrieben bekommt. Alles ganz einfach. Doch Marlene hat nicht damit gerechnet, dass sie sich bei Ausritten an der traumhaft schönen Küste und nervenaufreibenden Wildpferderettungen auch in ihren Fake-Ehemann verlieben könnte. Und dass Coles Herz einer anderen zu gehören scheint … Der weite Himmel über Kanada: Große Gefühle vor atemberaubenden Landschaften für Fans von Rebecca Yarros Liebesromanen und der Serie »Virgin River«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Freund weg, Job weg, Aufenthaltsgenehmigung weg: In Tränen aufgelöst steht Marlene am Flughafen. Sie soll ihr geliebtes Kanada verlassen, um zurück in die deutsche Heimat zu reisen. Doch bei einer Zufallsbegegnung mit dem jungen Farm-Besitzer Cole, macht er ihr ein Angebot, das genauso verrückt ist wie … perfekt! Marlene und Cole werden heiraten und ein Jahr gemeinsam auf seiner Pferderanch am Windy Point leben. Die Ehe nur auf dem Papier, keine komplizierten Gefühle. So kann Marlene in Kanada bleiben und weiterhin mit Pferden arbeiten, während Cole die Ranch von seinen Eltern überschrieben bekommt. Alles ganz einfach. Doch Marlene hat nicht damit gerechnet, dass sie sich bei Ausritten an der traumhaft schönen Küste und nervenaufreibenden Wildpferderettungen auch in ihren Fake-Ehemann verlieben könnte. Und dass Coles Herz einer anderen zu gehören scheint …
Originalausgabe Oktober 2025
Copyright © der Originalausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Textbaby Medienagentur, www.textbaby.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Katja Szimmat
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (rb)
ISBN 978-3-69076-455-1
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Annette Weber
Sternschnuppen über Windy Point
Roman
Prolog
Wenn wir fliegen, so sagt man, braucht die Seele Zeit, um nachzukommen. Der Körper reist schneller als der Kopf.
Doch was ist, wenn der Körper reisen muss, aber der Kopf will noch nicht mit, erst recht die Seele nicht? Dann befindet man sich in einem verrückten Zustand: Man fühlt tiefe Trauer und große Angst, weil das Zuhause, das einen erwartet, längst nicht mehr die Heimat ist, die man verlassen hat, und das Zuhause, das man verlassen muss, keine Heimat mehr werden kann. Man fühlt sich heimatlos, fliegt los, weil man muss, aber man will eigentlich nicht ankommen.
Und wenn dann plötzlich jemand auftaucht, der anbietet, einen wieder mit zurückzunehmen, kann man dann in sein altes Leben zurück?
Ich glaubte es wahrscheinlich, als mir der Unbekannte neben mir im Flugzeug dieses seltsame Angebot machte, von dem ich dachte, dass es mich retten würde.
Es rettete mich auch tatsächlich irgendwie – aber nicht so wie gedacht.
Teil 1
Kapitel 1
Brian steuerte mit seinem alten Van die Halteverbotszone direkt vor dem Eingang des Winnipeg Richardson International Airport an. Mir war bewusst, dass er es kurz machen wollte. Brian stand nicht auf Abschiede, erst recht nicht, wenn es dramatische waren, die vielleicht für immer waren. Er hatte Angst davor, dass ich weinen würde und dass ich möglicherweise wissen wollte, wann wir uns wiedersahen. Dass er mich nicht gebeten hatte zu bleiben, tat furchtbar weh. Aber ich wusste, dass er es auch machte, weil er mich vor sich schützen wollte. Dass er mich nicht mit sich ins Unglück stürzen wollte. Was durchaus möglich war, wenn ich seine Frau werden würde. Es war eine ausweglose Situation.
»Du kommst zurecht?«
Das war eine Suggestivfrage. Etwas anderes als ein Ja wollte er nicht hören. Ich nickte. Zu mehr war ich nicht in der Lage. Denn ich hatte Angst, in Tränen auszubrechen.
Ich betrachtete Brian von der Seite. Er sah angespannt aus. Für die Fahrt zum Flughafen hatte er auf ein Onlinespiel verzichten müssen und das hatte ihn finanziell vielleicht noch weiter zurückgeworfen. Vermutlich hoffte er, rechtzeitig wieder zu Hause zu sein, um erneut in das Spiel einzusteigen. Doch ich war mir sicher, er wusste genau wie ich, dass er schon lange keine Gewinne mehr machte. Nicht heute, nicht in den letzten Monaten und garantiert auch nicht in der kommenden Zeit. Es war sein verzweifelter Versuch, wieder festen Boden unter den Füßen zu bekommen.
Brian sah schlecht aus. Um seine Augen lagen dunkle Schatten. Schlief er überhaupt noch?
Brian und ich – das war eine Zeit lang die große Liebe gewesen. Die Liebe meines Lebens, wie ich dachte, als ich ihn zum ersten Mal küsste und danach gleich eine stürmische Liebesnacht mit ihm verbrachte.
Ich hatte mich damals verpflichtet, für ein Jahr auf einer Farm in Kanada zu arbeiten, hatte dafür mein ohnehin unübersichtliches Studium abgebrochen, Schafe geschoren, Pferde zugeritten, Hunde ausgebildet. Es war eine schöne Zeit, die schönste meines Lebens vielleicht. Kein Wunder, dass ich mich Hals über Kopf in Brian Bishop verliebt hatte.
Das Jahr verlief so turbulent weiter, wie es angefangen hatte. Brian und ich träumten bald von einer gemeinsamen Zukunft, kauften eine eigene kleine Ranch und begannen, Pferde zu züchten. Alles ging viel zu schnell, die Entscheidungen waren überwiegend spontan und unklug gewesen – das hatte ich inzwischen längst erkannt. Wir kauften aus dem Bauch heraus Pferde, die uns gefielen, um dann festzustellen, dass sie die eine oder andere Krankheit hatten. Na gut, ein Fehlkauf, dachten wir und investierten in andere Pferde. Aber eigentlich lief schon da alles aus dem Ruder. Ich war so verliebt, dass ich zu spät merkte, wie Brian seine Zeit immer häufiger am Computer verbrachte, dass immer wieder Pferde verkauft wurden, aber keine neuen dazukamen. Sein Wunsch, unsere Zukunft zu retten, wurde zu einem verzweifelten Kampf gegen Windmühlen.
Erst als der Gerichtsvollzieher auf unserer Ranch auftauchte, um die Immobilie zu bewerten, erwachte ich mit einem Schlag aus meinen Tagträumen. Brian hatte alles verspielt! In seinen Roulette-Onlinespielen hatte er sich immer wieder verzockt, diesmal aber waren wir nicht mehr zu retten.
Heute weiß ich, wir hätten darüber reden müssen. Wir waren beide damit beschäftigt gewesen, die Situation zu retten, hatten es aber im Alleingang versucht. Vielleicht hätten wir gemeinsam eine Wende um 180 Grad machen und unserem Leben eine neue Richtung geben können. Dass wir es nicht taten, war wahrscheinlich unser größter Fehler.
Nun lief mein Aufenthaltsvisum für Kanada ab. Ich musste nach Deutschland zurück. Wir hätten es nur verhindern können, indem wir heirateten – und ich mich mitverschuldete. Aber so sah ich es nicht! Ein Paar zu sein, bedeutete für mich auch, ein schweres Schicksal gemeinsam zu meistern. Wahrscheinlich glaubte Brian, an allem allein schuld zu sein, und er schämte sich dafür.
Der Gedanke, Kanada verlassen zu müssen, tat fürchterlich weh. In dieses Land hatte ich mich genauso verliebt wie in Brian. Die heißen Tage im Sommer, die eiskalten im Winter, der verhangene Himmel über den Seen und manchmal – wie ein Wunder – ein atemberaubender Sternenhimmel. Sogar die Sternschnuppen fielen hier häufiger als in Deutschland. Nur, dass sie keine Wünsche erfüllten. Zumindest nicht meine Wünsche.
Nun war es so weit. Meine Maschine nach Toronto ging in zwei Stunden und von dort würde ich weiter nach Frankfurt fliegen. Brian würde nicht einmal die Wartezeit mit mir verbringen. Er konnte diese Traurigkeit noch weniger aushalten als ich.
Er hielt abrupt an. Ein Mann, der hektisch über den Parkplatz rannte und uns ausweichen musste, brüllte: »Hey, können Sie nicht aufpassen?«
»Entschuldigung!«, rief ich ihm hinterher.
Brian holte stumm mein Gepäck aus dem Van und brachte es zum Eingang. Ein Auto parkte hinter ihm. Jemand hupte.
»Halten verboten.«
»Ich bin gleich weg, Mann!«, rief Brian.
Jetzt blieb keine Zeit mehr für große Worte.
»Mach’s gut. Wir sehen uns, Honey. Melde dich, wenn du da bist«, sagte er.
Sein flüchtiger Kuss traf nur meinen Mundwinkel. Ich hatte Mühe, meine Tränen wegzublinzeln.
»Wir sehen uns« – was sollte dieser Satz? Wir wussten genau, dass wir schon am nächsten Tag mehrere 1.000 Meilen voneinander entfernt sein würden und dass es lange dauern würde, bis ich das Geld und die Aufenthaltsgenehmigung für einen weiteren Kanada-Trip zusammenhatte.
Ein letzter Kuss, dann sprang Brian in sein Auto, sah noch ein letztes Mal zu mir und fuhr davon. Das war es also. Das war der Abschied von meiner großen Liebe.
Ich zog mir die Kapuze meines Hoodies tief ins Gesicht, damit niemand sehen konnte, wie elend mir zumute war. Langsam lief ich mit meinem Koffer hinter mir in den Flughafen. Mein Rucksack drückte.
Das Einchecken verlief schneller als gedacht. Mein Koffer wurde mir abgenommen. Kanada gab mich frei für den Weiterflug.
Langsam ging ich mit meinem Rucksack durch die zollfreie Zone.
Am Ende des Terminals führte eine Rolltreppe zu einer Plattform hinauf, von wo aus man den startenden Flugzeugen zuschauen konnte. Im Moment gab es keine Abflüge. Der Flughafen war klein und übersichtlich. Ich fuhr die Rolltreppe zur Plattform hinauf, um für einen Moment allein zu sein.
Dort stand ich nun und schaute auf das leere Rollfeld. Im Hintergrund war die Skyline von Winnipeg zu sehen. Namenlose hohe Gebäude in einer grüngelben Landschaft, 100 Meilen südlich begann schon Amerika.
Brian und ich hatten in der Nähe von Brereton Lake gewohnt, eineinhalb Stunden östlich von Winnipeg entfernt. Er würde zurück auf der Ranch sein, bevor mein Flug startete. Wie es ihm wohl gehen wird, ganz allein auf der Ranch?
Zu Hause in Deutschland erwartete mich auch kein großer Empfang. Seit mein Vater vor drei Jahren gestorben war, hatte sich unsere Familie in alle Winde zerstreut. Jeder führte sein eigenes Leben. Meine Mutter war in eine alternative Lebensgemeinschaft gezogen und hatte sich neu verliebt. Dort würde ich mich erst recht fremd fühlen. Ich plante deswegen, mich für eine Weile bei der Familie meines Bruders einzuquartieren, aber eine perfekte Lösung war das leider nicht.
Ich war in diesem Jahr in Kanada entwurzelt worden. Als ich daran dachte, liefen meine Tränen doch noch. Ich wischte sie schnell fort, lehnte dann meine heiße Stirn gegen das Glas des Aussichtsturmes und versuchte, meine Fassung zurückzugewinnen.
Die Rolltreppe setzte sich in Bewegung. Jemand kam zu mir hinaufgefahren. Ich zog mir die Kapuze noch tiefer ins Gesicht und drehte mich so, dass man nicht sehen konnte, dass ich geweint hatte. Jemand trat kurz auf die Plattform, schien dann aber zu bemerken, dass ich allein sein wollte, und ging wieder. Ich war froh darüber.
Mein Handy klingelte. Brian, dachte ich sofort und zog das Handy hastig aus meiner Jackentasche. Aber er war es nicht. Es war Emma, meine allerbeste Freundin. Sie kam wie ich aus Deutschland, aber wir hatten uns erst auf der Farm in Kanada kennengelernt, wo ich zuerst gearbeitet hatte und wo ich auch Brian begegnet war. Jetzt studierte Emma Kunstgeschichte an der Uni in Winnipeg.
Sie hatte einen Videocall gestartet. Ich verzichtete darauf, meine Kamera anzustellen. Obwohl Emma und ich keine Geheimnisse voreinander hatten, wollte ich ihr mein verheultes Gesicht ersparen.
»Hi, Em«, sagte ich und bemühte mich um eine sichere Stimme.
»Marlene? Oh, Mann, du klingst nicht gut. Wo bist du? Schon am Flughafen?«
Ich räusperte mich. »Genau. Auf der Plattform vom Richardson International.«
»Allein?« Obwohl Emma zunächst nichts weiter sagte, konnte ich ihr Entsetzen heraushören.
»Ja, allein. Brian hat es kurz gemacht. Ein Kuss – ›Wir sehen uns, Honey‹ …«
Ich konnte fast hören, wie Emma mit den Zähnen knirschte.
»Dieser Mistkerl! Ehrlich, wie kann man nur so unglaublich gefühlskalt sein.«
Nun liefen meine Tränen wieder. »Ist schon okay«, tat ich tapfer. »Welcher Mann steht schon auf tränenreiche Abschiede?«
»Oh, Mann, das ist einfach nur furchtbar.«
Emma hatte Brian nie besonders gemocht. Sie hatte uns auch nicht oft auf der Ranch besucht. Viel öfter war ich bei ihr in Winnipeg vorbeigekommen und wir hatten zusammen die Stadt unsicher gemacht. Mit Emma machte einfach alles Spaß und das Leben fühlte sich mit ihr so leicht an. Gleichzeitig war sie aber auch aufmerksam und sensibel. Sie war es auch, die mir in Sachen Brian die Augen geöffnet hatte. »Irgendwas stimmt nicht«, hatte sie gesagt. »Ich glaube, Brian hat Probleme mit Geld.«
Zuerst hatte ich es nicht wahrhaben wollen, aber dann war es auch für mich nicht mehr zu übersehen gewesen.
»Hör zu, Marlene, ich kann in 20 Minuten bei dir sein«, rief Emma nun. »Dann können wir noch einen letzten Kaffee zusammen trinken.«
Das war so lieb von ihr.
»Ich bin schon durch die Sicherheitskontrolle«, sagte ich leise und erneut kamen mir die Tränen. »Mein Flug geht in einer halben Stunde.«
Nun schwiegen wir beide.
»Tschüs, Em. Danke für alles. Ich melde mich bald.«
Und bevor Emma noch etwas sagen konnte, drückte ich das Gespräch weg. Dann begann ich wieder zu weinen.
***
»Entschuldigung, der Platz 38A gehört mir«, wandte sich ein Mann an mich und zeigte mir sein Flugticket. Seine Frau drängelte sich hinter ihn.
»Das ist unser Platz«, nörgelte sie.
Ich hatte bereits mein Handgepäck in dem Fach über meinem Sitz verstaut. Jetzt musste ich erneut nach der Bordkarte suchen. Das Ehepaar wartete währenddessen ungeduldig. Ich brauchte eine Weile, riss einen Reißverschluss nach dem nächsten auf, bis ich die Bordkarte endlich fand.
»Da, 38A!«, triumphierte ich.
Verwundert starrten wir gemeinsam auf die Bordkarte.
»Das kann nicht sein! Die Nummer habe ich auch«, kommentierte der Mann und hielt mir seine Bordkarte unter die Nase.
Er hatte recht – und ich auch. Verärgert starrten wir einander an. Der Mann winkte die Stewardess herbei. Wir verursachten einen Stau in dem schmalen Gang. Ich beschloss schließlich, meinen Sitz freizumachen, weil ich von dem Mann derartig gegen das Fenster gedrückt wurde, dass mir ganz warm wurde. Ich trat in den Gang und stellte mich dorthin, wo das Personal den Kaffee zubereitete. Die Stewardess, die vermutlich für unser Problem zuständig war, telefonierte. Ich wartete. Okay, dann bleibe ich noch einen Tag länger in Winnipeg. Ist ja im Grunde auch egal, dachte ich.
Die Stewardess beendete das Gespräch und lächelte mich an.
»Da muss etwas schiefgelaufen sein. Kommen Sie bitte mit!«, sagte sie. Ich wollte noch etwas fragen, aber sie rannte bereits los. Hastig zog ich meinen Rucksack aus der Gepäckablage und folgte ihr.
Vor dem grauen Vorhang der Businessclass blieb sie stehen.
»Sie fliegen heute Businessclass«, verkündete sie und öffnete einen Vorhang, hinter dem sich ein weiteres Flugabteil verbarg.
Ich war noch nie Businessclass geflogen und war ein wenig eingeschüchtert, als ich in das Abteil trat. Auch wenn es sich nicht sehr von der Economyclass unterschied, sahen die Sessel deutlich bequemer aus und hatten einen größeren Abstand zueinander. Es war genau das, was ich brauchte: Abstand und Ruhe!
»Hier! Dieser Platz wäre noch frei«, sagte die Stewardess und zeigte auf einen Sessel, wo zwar gerade niemand saß, auf dem allerdings ein Laptop und ein Jackett lagen. Der Mann, der auf dem Platz daneben saß, hatte sich gleich über zwei Plätze ausgebreitet. Jetzt sah er zuerst die Stewardess, danach mich mit zusammengekniffenen Augen an. Auf Gesellschaft schien er nicht gerade erpicht zu sein.
»Sir, sind das Ihre Sachen?«, fragte die Stewardess.
Der Mann murmelte eine Antwort. Wie ein Ja hörte es sich nicht an.
»Bitte machen Sie den Platz frei! Diese junge Dame braucht ihn.«
Der Mann zögerte. Doch die Stewardess öffnete kurzerhand die Gepäckablage. Jetzt kam der Typ endlich auf die Beine.
»Kein Problem, ich mache schon Platz«, sagte er. Es hörte sich schon freundlicher an. Er streckte die Hand nach meinem Rucksack aus. »Geben Sie schon her!«
Stumm gab ich ihm meinen Rucksack. Nach Small Talk war mir auch nicht zumute.
Als mein Gepäck verstaut war, klappte er seinen Laptop zu und schob ihn in eine kleine Ledertasche.
Ich schnallte mich an, lehnte mich in meinem Sitz zurück, zog mir die Kapuze wieder über den Kopf und schloss die Augen. Im Hintergrund erklärte die Stewardess die Sicherheitsvorschriften. Ich hörte nicht hin. Vor meinen geschlossenen Augen tauchte Brian auf, wie er über die Ranch lief, um die Pferde zu holen.
Ich hatte ein Lieblingspferd gehabt, Manon, eine weiße Quarter-Horse-Stute mit einer dunklen Mähne. Doch auch sie war Brians Spekulationen zum Opfer gefallen. Vor zwei Wochen hatte er sie verkauft, um die Monatsrate für die Ranch bezahlen zu können.
Ich dachte daran, wie Manon in den Hänger stieg und der junge Mann, der sie kaufte, sie ungeduldig mit der Gerte schlug, weil sie bei mir bleiben wollte. Bei diesem Gedanken kamen mir wieder die Tränen. Sie liefen einfach aus den geschlossenen Augen und ließen sich nicht aufhalten, egal wie viel Mühe ich mir auch gab.
»Wollen Sie einen Sekt?«, hörte ich plötzlich eine Stimme an meinem Ohr.
Ich öffnete die Augen und blinzelte. Der Typ neben mir schien sich plötzlich um Freundlichkeit zu bemühen. Wahrscheinlich machte ich einen mitleiderregenden Eindruck.
»Nein, danke«, antwortete ich.
Dann fuhr ich mir mit dem Ärmel meines Hoodies über die Augen und schloss sie wieder.
»Sie sollten den Sekt nicht ablehnen«, hörte ich wieder die Stimme neben mir. »Immerhin geht er aufs Haus. Das sollte man nicht ablehnen. So einfach kommt man in Kanada nicht an Alkohol.«
Versuchte er sich gerade an einem Witz? Ich öffnete die Augen und musterte den Mann neben mir. Er lächelte tatsächlich. Dabei bildeten sich kleine Falten in seinen Augenwinkeln.
Ich seufzte leise, schob die Kapuze vom Kopf und setzte mich auf. Wie ich wohl auf ihn wirkte? Bestimmt hatte ich verquollene, rote Augen vom Weinen.
»Na gut«, sagte ich.
Sein Lächeln wurde breiter. Er winkte die Stewardess herbei. »Einen Sekt für die Dame hier, bitte«, bestellte er.
Die Stewardess nickte und verschwand. Ich zog ein Taschentuch aus der Tasche und schnäuzte mich kräftig. Er sah mich nicht mehr an, betrachtete stattdessen seinen Sekt und schwenkte ihn hin und her. Wahrscheinlich hatte er Angst, ich könnte meine ganze Lebensgeschichte vor ihm ausbreiten. Aber davor brauchte er sich nicht zu fürchten. Ich gehörte zu den schweigsamen Menschen dieser Welt. Emma hatte immer gesagt: »Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, bei dem ein Geheimnis bis zum Tod in guten Händen ist.« Und so war es tatsächlich. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich Kanada dermaßen liebte. Die Menschen hier waren ruhig und verschwiegen – und so viele lebten dort sowieso nicht auf einem Quadratkilometer.
Der Typ schaute weiterhin auf seinen Sekt.
»Tut mir leid, dass Sie so traurig sind, Ma’am«, sagte er leise und gab mir damit zu verstehen, dass er meine Tränen nicht übersehen hatte. Ich riss mich zusammen.
»Geht schon wieder«, gab ich zurück.
Die Stewardess brachte mir den Sekt.
Kurze Zeit später rollte das Flugzeug auf die Startbahn.
Wieder schwiegen wir für eine Weile. Ich trank meinen Sekt in kleinen Schlucken. Wir schauten einander nicht an, aber wir waren trotzdem in gewisser Weise in Kontakt. Der Sekt hatte eine Art Verbindung zwischen uns hergestellt.
Kapitel 2
»Wohin fliegen Sie?«, fragte mein Sitznachbar. Wahrscheinlich fühlte er sich verpflichtet, mit mir Small Talk zu halten.
»Nach Deutschland«, erwiderte ich. »Frankfurt am Main. Aber erst geht es nach Toronto. Erster Zwischenstopp.«
»Jetzt kann ich Ihren Akzent einordnen«, gab er zurück. »Sie sind Deutsche, nicht wahr?«
Ich nickte. »Meine Mutter lebt in Wiesbaden. Kennen Sie das?«
Er schüttelte den Kopf. »Leider nein. Ich bin noch nie in Deutschland gewesen. Aber es soll ein schönes Land sein.«
Dazu fiel mir nichts ein. Deutschland war für mich so weit weg wie ein ferner Planet. Ich liebte Kanada.
Wir schwiegen kurz.
»Und Sie? Wohin wollen Sie?«, stellte ich dann die Gegenfrage. Ich fragte es nicht, weil es mich wirklich interessierte. Ich wollte nur nicht unhöflich erscheinen.
»Erst mal bis Toronto«, antwortete er. »Aber dann nehme ich mir einen Leihwagen. Ich muss von dort aus in Richtung Norden, in Richtung Barrie. Das liegt etwa eine Stunde entfernt.«
»Ah, okay.«
Im Grunde genommen war es mir egal, ob er nach Toronto, Kalkutta oder Oberkleinohse fuhr. Seine Geschichte interessierte mich nicht und auf Small Talk hatte ich auch keine Lust. Ich trank den Sekt in wenigen Zügen aus und bemühte mich, nicht mehr zu meinem Sitznachbarn hinüberzusehen. Ich hatte das Gefühl, dass es ihm recht war. Er wollte scheinbar auch nichts weiter von mir. Er lehnte sich im Sitz zurück und streckte die Beine aus. Ich drehte mich wieder zum Fenster und schaute auf die Wolken.
Tschüs, Kanada, sagte ich in Gedanken.
Leider liefen meine Tränen wieder. Ich wischte sie mit dem Ärmel meines Hoodies fort.
»Ihnen scheint der Abschied schwerzufallen, oder?«, fragte der Mann neben mir nun behutsam.
Ich drehte mich wieder zu ihm hin. »Oh … ja … na ja«, murmelte ich und bemühte mich, meine Stimme wieder unter Kontrolle zu bekommen.
»Ich muss mich entschuldigen«, gab er zurück. »Ich wollte Ihnen nicht zu nahetreten.«
Er trank seinen letzten Tropfen Sekt, klemmte dann das Glas in das Netz vor sich. Ich tupfte mir vorsichtig die Tränen ab. Dann lehnte ich mich ebenfalls in meinem Sessel zurück und schwieg.
Das Flugzeug hatte nun den Start hinter sich. Die Anzeigen, dass man sich abschnallen durfte, leuchteten auf und ich befreite mich von meinem Sicherheitsgurt. Auch mein Sitznachbar machte sich los. Die Stewardess kam zu unserem Platz und sah mich ein wenig irritiert an. »Alles in Ordnung?«, wollte sie wissen.
Ich nickte ein wenig beschämt. Dann wagte ich, zu dem Mann neben mir hinüberzuschauen. Er sah weiterhin freundlich aus.
»Trinken Sie noch ein Glas Sekt mit mir?«, versuchte er, den Kontakt vorsichtig wiederherzustellen. »Eigentlich bekommt man kein zweites Glas. Aber manchmal machen sie eine Ausnahme.«
Ich atmete tief durch. »Könnte mir guttun«, gab ich zu.
Er winkte die Stewardess noch einmal herbei.
»Bekommen wir wohl noch einen Sekt?«, fragte er so charmant, dass die Stewardess nickte und verschwand. Kurze Zeit später brachte sie uns zwei weitere Gläser. Jetzt bemühte ich mich, meinen Sitznachbarn anzulächeln. Es war nett, dass er sich so um mich kümmerte, und im Grunde genommen tat es mir gut, dass sich jemand für mein Schicksal interessierte.
»Cheers.« Wir stießen die Gläser gegeneinander. Unsere Augen begegneten sich. Es fiel mir schwer, seinen Blick festzuhalten. Schnell nippte ich an meinem Sekt.
»Mein Name ist Cole Marten«, stellte er sich mir vor.
»Marlene König«, gab ich zurück.
»Marleen?«, wiederholte er. Mein Name hörte sich ganz anders an, wenn er ihn aussprach.
Ich nickte.
»Sie haben einen hübschen Akzent«, fügte er hinzu.
Eigentlich konnte er das nicht beurteilen. So viel hatte ich schließlich noch nicht von mir preisgegeben. Aber er wollte mir wohl etwas Nettes sagen und das war höflich von ihm.
»Was haben Sie in Kanada gemacht?«, wollte er wissen. »Waren Sie hier im Urlaub?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich habe ein Jahr in der Provinz Manitoba verbracht. Zuerst als Saisonarbeiterin auf einer Farm bei Stonewall, später auf einer kleinen Ranch am Brereton Lake.«
Er schien plötzlich richtig wach zu sein. Aufmerksam betrachtete er mich. »Auf einer Ranch?«, fragte er nach. »Am Brereton Lake? Das ist nicht weit von Winnipeg entfernt, oder?«
»Genau.« Ich seufzte tief. »Es war wundervoll dort«, fügte ich hinzu.
Vor meinen Augen tauchte wieder das kleine Bauernhaus auf, das Brian von seinen Großeltern geerbt hatte. Es war in einem schlechten Zustand gewesen, aber wir hatten es gemeinsam renoviert. Noch waren nicht alle Zimmer fertig, dazu hatte uns das Geld gefehlt. Doch das Dach war in Ordnung und wir hatten auch die Zäune für die Wiesen und den Paddock auf Vordermann gebracht.
»Da wurden Pferde ausgebildet. Appaloosas und Quarter Horses«, fuhr ich fort und vermied es, zu erzählen, dass Brian und ich das gemeinsam gemacht hatten.
Der Blick meines Sitznachbarn wurde intensiver.
»Ich lebe auch auf einer Ranch«, sagte er. »Sie liegt weiter östlich, in der Provinz Ontario. Windy Point heißt der Ort. Wir züchten dort Curlys, aber wir haben auch einen Appaloosa und ein Quarter Horse.«
Jetzt war ich völlig überrascht. »Das stimmt doch nicht wirklich, oder?«, rief ich.
Er lachte. »Was soll daran nicht stimmen? In jedem kleinen Nest dort gibt es eine Ranch oder eine Farm. Und man züchtet dort entweder Schafe oder Rinder oder Pferde.«
Jetzt hatte der Typ mein volles Interesse. Ich drehte mich ihm ganz zu und musterte ihn neugierig. Vielleicht waren wir uns schon einmal begegnet? Die Züchter trafen sich oft zu gemeinsamen Trails oder um die neugeborenen Fohlen zu begutachten.
»Und warum wollen Sie nach Toronto?«, wollte ich wissen.
»Ich will mir da eine Stute ansehen«, antwortete er. »Angeblich hat sie einen tollen Stammbaum. Vielleicht passt sie in meine Zucht.«
Das klang spannend.
»Ich kann Sie mir gut als Westernreiter vorstellen«, sagte ich. »Wie schön, dass Sie diese Curlys züchten. Sie sind so süß!«
Ich war völlig begeistert. Die kanadischen Curly Horses sind etwas ganz Besonderes. Sie sehen im Sommer aus wie normale Quarter Horses, im Winter aber bekommen sie plötzlich Locken, sodass sie wie riesige Pudel aussehen. Es sind robuste, liebenswerte Pferde, geeignet für die schneereichen und eiskalten kanadischen Winter.
»So ein Pferd bin ich noch nie geritten«, gestand ich ihm. »Sie sollen zäh und ausdauernd sein.«
»Wir haben ungefähr 40 Pferde, mal mehr, mal weniger. Viele von ihnen gehen Curly Shuffle. Wissen Sie, was das ist?«
Natürlich wusste ich es.
»So was wie die Gangart Tölt bei einem Islandpferd, stimmt’s?«
Wir waren jetzt beide in unserem Element. Zucht, Pferde und eine Farm, das schien auch seine Welt zu sein. Er hatte wir gesagt. Ob er die Farm mit seiner Familie betrieb? Kurz blickte ich auf seine rechte Hand. Er trug keinen Ring.
Ob er meinen Blick bemerkt hatte?
»Betreiben Sie die Ranch mit Ihrer Familie?«, fragte ich vorsichtig.
Er zögerte. »Genau genommen gehört sie meinen Eltern«, sagte er dann. Danach machte er eine kurze Pause, als wenn er noch etwas sagen wollte, schwieg dann aber.
»Ob Ihre Eltern oder Sie – das macht doch keinen Unterschied«, erwiderte ich verwundert. »Die Ranch wird Ihnen einmal gehören und darüber können Sie überglücklich sein. Für mich wäre das ein Traum.«
Wieder dieses seltsame Zögern. Fast bildete ich mir ein, dass er mich ein wenig abwägend anschaute.
»Das denkt man so«, sagte er und seine Stimme klang bedrückt. »Meine Eltern sind schon alt und meinem Vater geht es körperlich nicht so gut. Trotzdem wollen sie mir den Hof nicht überschreiben. Und das macht alles sehr schwierig, denn es muss einiges modernisiert werden. Und noch dazu müsste man investieren.«
Er seufzte tief. Ich war überrascht, dass er mir so viel Persönliches anvertraute.
»Eigentlich ist es wichtig, dass ein Hof rechtzeitig an die Kinder überschrieben wird«, gab ich zurück. »Ich weiß das von einer Freundin, die den Hof ihrer Eltern übernommen hat.«
Ich dachte an meine deutsche Freundin Nina, die lange gebraucht hatte, bis sie ihre Eltern davon überzeugt hatte, ihr den Hof zu überschreiben. Ob es ihm auch so ging? Offenbar ja, denn er sah jetzt sehr unglücklich aus.
»Ich weiß. Aber es fällt meinen Eltern äußerst schwer, das zu tun.«
»Echt? Warum?« Ich konnte es nicht verstehen. Ich schaute neugierig zu ihm, aber er wich mir aus. Wahrscheinlich hatte ich diesen Blick, von dem Brian immer behauptete, dass ich die Menschen damit hypnotisiere. Aber vielleicht hatte sich Brian das auch nur eingebildet, weil er mir gerade wieder eine Lügengeschichte aufgetischt hatte.
Mein Sitznachbar hatte nun eine distanzierte Miene aufgesetzt.
»Tja. Das weiß ich auch nicht so genau«, antwortete er langsam.
Ich glaubte ihm nicht. Aber es war okay, dass er mir nicht alles erzählte. Es war sicherlich ein schwieriges Familienthema!
»Und Sie? Warum fliegen Sie nach Hause, wenn es doch so schön für Sie in Kanada war?«, lenkte er das Gespräch wieder auf mich.
Er schaute nun ebenfalls auf meine Hände, als wenn er sie nach einem Ring absuchte.
»Meine Aufenthaltsgenehmigung läuft in einer Woche aus«, berichtete ich. »Keine Chance auf Verlängerung.«
Er musterte mich aufmerksamer. »Und Sie haben niemanden gefunden, der Sie heiratet?«, fragte er nun direkt. »Ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Cowboys um Sie gerissen haben …«
Wieder musterten wir uns aufmerksam. Er hielt meinem Blick stand. Ernst sah er aus und auch ein wenig verwundert.
»So leicht ist das nicht mit dem Heiraten«, sagte ich.
Er nickte. »Das stimmt«, musste er zugeben.
Wir schwiegen eine ganze Weile. Beide hingen wir irgendwelchen Erinnerungen nach.
Dann lenkte ich das Thema erneut auf die Pferde – auf mein und sein Lieblingsthema. Es war unsere Verbindung.
Ich erzählte ihm von Manon, meiner bildschönen und liebevollen Quarter-Horse-Stute. Und ganz plötzlich, mitten in der Erzählung, musste ich abbrechen, weil mir wieder die Tränen kamen. Es war mir peinlich.
»Tut mir leid«, schluchzte ich. »Sie müssen mich für die absolute Heulsuse halten.«
Mein Sitznachbar winkte ab. Die Trauer um ein Pferd konnte er offenbar zu gut verstehen.
»Das muss Ihnen nicht peinlich sein«, beeilte er sich zu sagen. »Ich verstehe, was Sie meinen. Ich habe einen tollen Hengst. Er heißt Road Runner. Er ist ziemlich anstrengend, aber ich liebe ihn über alles und könnte mich niemals von ihm trennen.«
Ich schniefte und wischte mir die Tränen ab. »Und wie ist er so, Ihr Hengst?«, fragte ich, um mich abzulenken. »Was ist das Besondere an ihm?«
Er lachte laut auf. »Der ist so hässlich, das glauben Sie gar nicht.«
»Hässlich? Das … das hätte ich jetzt nicht erwartet«, wunderte ich mich.
Er lachte lauter. »Er sieht aus, als wäre er verschimmelt. Sein Kopf ist rotbraun und der Körper wird immer heller, als wäre er mit weißem Schimmel überzogen. Wie eine verschimmelte Möhre sieht er aus.«
Wir lachten jetzt gemeinsam. Mir ging es plötzlich schon besser. Das Gespräch tat mir gut.
Danach war das Eis gebrochen und wir redeten und redeten und bemerkten nicht, dass das Flugzeug schon wieder zur Landung ansetzte. Die Zeit bis Toronto war in einer unglaublichen Geschwindigkeit vergangen. Und meinen Kummer mit Brian und meinem Pferd hatte ich für einen kurzen Moment in die hinterste Ecke meines Herzens schieben können.
Es kam die Durchsage des Piloten, dass wir gleich zur Landung ansetzen würden. Ich schaute aus dem Fenster. Der Flughafen von Toronto leuchtete in der aufgehenden Sonne unter uns auf. Die erste Etappe meiner Reise hatte ich hinter mich gebracht.
Ich konnte spüren, wie mein Nachbar mich musterte. Darum drehte ich mich wieder zu ihm um. Mir fiel erst jetzt auf, dass er warme braune Augen hatte.
»Es war schön, Sie getroffen zu haben«, sagte ich.
Er nickte. »Das ging mir genauso«, gab er zurück.
Das Flugzeug setzte auf und rumpelte über die Startbahn. In diesem Moment muss ich immer die Luft anhalten. Dann waren wir gelandet und der Pilot bremste die Maschine.
»Bei einer Landung sackt einem das Herz immer in die Knie, oder?«, meinte ich.
Er lächelte. »Das stimmt«, erwiderte er.
Kapitel 3
Wir verließen das Flugzeug gemeinsam, ließen uns dann mit dem Bus über das Rollfeld zum Terminal fahren. Schließlich standen wir beide vor einer Rolltreppe.
Exit zeigte ein Pfeil in eine Richtung, Luggage in die andere. Mein Gepäck hatte man nicht bis Frankfurt durchstellen können. Ich musste es am Gepäckband abholen und erneut durch den Sicherheitscheck gehen. Cole Martin hatte nur einen kleinen Rucksack, außerdem seine Ledertasche mit dem Laptop und einen warmen Anorak.
Nun war der Zeitpunkt des Abschieds für uns gekommen.
»Ich muss jetzt da lang«, sagte ich und deutete auf den Weg nach rechts. Er nickte. Ich reichte ihm die Hand, doch ich bemerkte, dass er zögerte. Auch mir fiel es nicht leicht zu gehen. Wenn ich erst einmal in dem anderen Flieger saß, war mein Ziel Deutschland unausweichlich. Der Gedanke tat weh. Er sah aus, als wenn er mir noch etwas mit auf den Weg geben wollte. Dabei stand er so nahe vor mir, dass er mir fast den Weg versperrte.
»Schön, dass wir uns begegnet sind«, sagte er noch einmal.
Ich nickte. »Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Pferdekauf.«
Es kostete mich große Überwindung, das zu sagen. Viel lieber wäre ich jetzt ebenfalls auf Pferdekauf gegangen, als in die nächste Maschine zu steigen.
»Auf Wiedersehen.« Ich reichte ihm die Hand. Offenbar musste ich dabei sehr traurig ausgesehen haben, denn er nahm meine Hand und hielt sie fest.
»Warum kommen Sie nicht einfach mit?«, fragte er.
Diese Frage kam aus heiterem Himmel. Sie machte mich für einen Moment sprachlos und ein wenig verlegen. Ich holte tief Luft und räusperte mich. »Na ja, das geht nicht«, versuchte ich auszuweichen. »Ich habe in drei Stunden einen Weiterflug. Ich muss nach Frankfurt.«
»Kommen Sie mit zum Pferdekauf. Vier Augen sehen mehr als zwei. Sie würden mir sehr helfen und wenn wir den Kauf erledigt haben, besorge ich Ihnen einen späteren Weiterflug.«
Immer noch hielt er meine Hand fest und wir starrten einander an. Ich war völlig durcheinander. Was er vorschlug, war tatsächlich eine große Verführung, aber es war andererseits auch richtiger Unsinn.
»Ehrlich, ich würde das zu gerne machen«, sagte ich. »Aber das ist sinnlos. Es wird nicht leicht sein, einen Flug zu bekommen, und nachher sitze ich ein paar Tage in Toronto fest. Es hilft einfach nichts. Ich muss zurück nach Frankfurt.«
Er ließ meine Hand immer noch nicht los.
»Sie könnten auch von Toronto aus mit zu mir nach Windy Point kommen«, redete er beharrlich weiter. »Ich könnte Ihnen Road Runner zeigen. Und auch Smarty und Eyecatcher. Sie könnten die Curlys reiten und den Shuffle ausprobieren.«
Allmählich wurde mir dieser Typ unheimlich. Ich entzog ihm jetzt meine Hand. Sie war ganz warm geworden. Er stand immer noch vor mir und schaute auf mich herab. Die Menschen bahnten sich nun einen Weg um uns herum. Wir befanden uns direkt vor der Rolltreppe und versperrten alles.
»Ich sagte doch, meine Aufenthaltsgenehmigung …«
Er sah mich nachdenklich an. Irgendeine Idee schien ihn zu beschäftigen.
»Sie könnten mich heiraten«, sagte er dann plötzlich.
Was hatte er gesagt? War er jetzt völlig durchgeknallt? Bisher hatte er nicht den Eindruck auf mich gemacht. Ich musterte ihn. Er sah immer noch freundlich aus – aufmerksam und mit einem warmen Lächeln.
Jetzt drehte sich ein Ehepaar nach uns um und lachte. Sie hatten seine Worte gehört und fanden uns wahrscheinlich höchst merkwürdig.
»Heiraten? Sie sind ja verrückt!«, rief ich.
Er nickte. »Vielleicht«, erwiderte er. »Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch die beste Idee, die wir an diesem Tag haben konnten.«
Eigentlich war ich nicht auf den Mund gefallen, aber jetzt wusste ich überhaupt nicht, was ich antworten sollte.
»Wie meinen Sie das?«, fragte ich immer noch verwirrt.
»Würden Sie mir noch zehn Minuten geben und mit mir einen Kaffee trinken?«, schlug er vor. »Da oben bei den Internationalen Flügen gibt es ein Bistro. Kommen Sie mit?«
Ich war völlig durcheinander. Ich musste gestehen, der Typ sah gut aus, er hatte diesen aufmerksamen und durchdringenden Blick, von dem ich mir einbildete, dass er in mein Herz schauen konnte. Und er war dazu noch ziemlich sympathisch.
Mein Flieger ging erst in drei Stunden. Was riskierte ich also? Ich konnte meine Wartezeit auch damit überbrücken, dass ich mir seine verrückten Ideen anhörte.
»Na gut«, sagte ich schließlich.
Dabei hatte ich das Gefühl, dass ich auf dem besten Weg war, verrückt zu werden.
Cole Marten begleitete mich zum Gepäckband, um mit mir auf meinen Koffer zu warten. Dann nahm er ihn und ging damit zur Rolltreppe hinüber. Ich schulterte meinen Rucksack und folgte ihm.
Im Bistro stellte er meinen Koffer an einem freien Tisch ab, fragte mich, was ich trinken wollte, und ging zum Tresen, um die Bestellung aufzugeben. Ich starrte ihm hinterher. Dabei kam mir alles vor wie in einem Film.
Hatte er mich tatsächlich gerade gebeten, ihn zu heiraten? Wie merkwürdig war diese Frage? Und was hätte er davon? Na klar, ich hätte damit die Möglichkeit, für immer in Kanada zu bleiben, aber er? Natürlich fiel mir zuerst Sex ein. Vielleicht hatte er Spaß daran, mich in seiner Abhängigkeit zu wissen und die Möglichkeit zu haben, besondere perverse Vorlieben an mir auszuprobieren. Irgendwelche Sklavenspielchen mit Peitsche und Handschellen. Ich beobachtete ihn, wie er mit der Bedienung redete. Er wirkte freundlich. Sein Lächeln war freundlich und die Serviererin erwiderte es. Sie reichte ihm zwei Becher mit Kaffee, er bezahlte, stellte die Becher auf ein Tablett und kam damit zu mir herüber. Dann schob er mir den Milchkaffee zu, nahm sich selbst den schwarzen Kaffee. Anschließend sah er mich an.
»Ich weiß, was Sie jetzt denken«, sagte er. »Sie fragen sich, was ich davon habe, nicht wahr?«
Ich wartete.
»Und wahrscheinlich haben Sie Angst, ich könnte von Ihnen irgendwelche Dinge verlangen, die Sie nicht wollen, oder?«
Besser hätte ich es nicht ausdrücken können.
»Na ja, komisch ist es schon«, gab ich vorsichtig zurück.
Er nickte, rührte in seinem Kaffee. Dabei gab es nichts zu rühren, denn er hatte weder Zucker noch Milch genommen. Aber er schien genauso verwirrt wie ich zu sein. Dann sah er mich wieder mit diesem durchdringenden Blick an.
»Es ist so, dass ich durchaus auch einen Vorteil von meinem Angebot hätte«, begann er und seine Stimme klang klar. Er zögerte einen Moment. Es fiel ihm offenbar nicht leicht, mir davon zu erzählen. »Ich habe Ihnen ja von meinen Eltern erzählt, die mir die Ranch bis jetzt nicht überschrieben haben.«
Ich nickte.
»Sie – wie soll ich das sagen – sie sind sehr konservativ. Sie können es kaum ertragen, dass ich 35 Jahre alt bin und noch immer keine Frau und keine Kinder habe.«
Ich betrachtete ihn aufmerksam. Wenn ich ehrlich war, fand ich das auch schwer nachvollziehbar, aber ich sagte nichts dazu. Er seufzte tief und fuhr dann fort: »Meine Eltern stehen auf dem Standpunkt, dass eine Ranch von einer Familie geführt werden sollte. Sie sind sich auch sicher, dass ich ohne Familie nicht glücklich werde. Dass ich – was weiß ich – anfange, zu trinken oder zu spielen oder mich zu vernachlässigen.«
Bei diesen Worten dachte ich an Brian.
»Und darum wollen Ihre Eltern Ihnen die Farm nur überschreiben, wenn Sie eine Frau und Kinder haben?«, brachte ich den Gedanken zu Ende.
»Eine Frau reicht ihnen fürs Erste«, erwiderte er mit einem gequälten Lächeln.
»Warum setzen Ihre Eltern Sie so unter Druck?«, wollte ich wissen.
Er seufzte. »Wie schon gesagt, meine Eltern sind unglaublich konservativ. Dazu Mitglieder in der christlichen Heartland Church von Kanada. Die Familie geht ihnen über alles.«
Jetzt war ich ziemlich entgeistert. »Das gibt es doch nicht!«, rief ich. »Wie kann man denn so altmodisch sein! Das ist ja tiefstes 19. Jahrhundert. Oder sind Ihre Eltern vielleicht Mormonen? Oder bei den Amish?«
»Na ja, meine Eltern sind keine Fundamentalisten oder so«, winkte er ab. »Aber ihnen ist eine Ehe wichtig. Schließlich haben sie die Ehe als gut für ihr eigenes Leben erlebt.«
Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte.
»Ich weiß, das klingt jetzt alles ziemlich komisch«, fuhr er behutsam fort. »Aber ich habe das Gefühl, wir könnten uns gut mit unseren Problemen zusammentun.«
»Und da dachten Sie, wenn ich Sie heirate, kriegen Sie die Ranch und ich die Aufenthaltsgenehmigung, oder was?«, fasste ich den Plan zusammen.
Er wirkte nun unruhig. Sein Blick wanderte prüfend über mein Gesicht.
»Ganz so leicht ist es nicht. Die kanadischen Behörden haben Angst vor illegalen Einwanderungen. Sie wollen sicher sein, dass wir eine ernsthafte Beziehung führen. Manchmal checken sie sogar die Lage vor Ort. Aber wenn wir meine Eltern überzeugen, glauben uns die Behörden unsere Ernsthaftigkeit erst recht. Und dann haben Sie die Aufenthaltsgenehmigung sicher«, sagte er.
»Also eine klassische Win-win-Situation«, stellte ich fest.
»Exakt«, erwiderte er und lehnte sich zufrieden zurück.
Ich brauchte einen Moment, bis ich diese Informationen verdaut hatte. Er bemühte sich nun, Sachlichkeit in die Situation zu bringen.
»Hören Sie«, redete er weiter. »Das klingt jetzt natürlich alles ziemlich durchgeknallt. Selbstverständlich können Sie mir hier im Bistro nicht sagen, ob Sie mich heiraten werden. Aber sagen Sie mir wenigstens, ob meine Idee eine Option ist, über die Sie nachdenken werden.«
So etwas wie Hoffnung lag nun in seinem Gesicht. Es schien ihm sehr auf dem Herzen zu liegen, dass ich zustimmte. Vielleicht hatte er lange auf eine solche Gelegenheit gewartet.
Ich war inzwischen völlig verwirrt. Es beruhigte mich, dass auch er ein Anliegen an mich hatte. Trotzdem war meine Angst nicht verschwunden. Vielleicht war das alles nur ein Vorwand und wenn er mit mir allein war, ließ er seiner Perversion freien Lauf. Wenn ich erst einmal mit ihm in der Einöde Kanadas wäre, würde ich ihm völlig ausgeliefert sein.
»Ich weiß, das klingt alles sehr seltsam«, bemühte er sich. »Sie haben bestimmt Angst davor, dass ich Ihnen etwas antue.«
Ich spürte, wie sich meine Augenbrauen misstrauisch zusammenzogen.
»Aber natürlich tue ich das nicht«, fuhr er fort. »Na ja … Sie wissen natürlich nicht, ob Sie mir vertrauen können. Wir kennen uns ja gar nicht. Trotzdem könnten wir doch für eine Weile zusammenleben. Meine Eltern planen schon so lange, zu meiner Schwester nach Ottawa zu ziehen. Die Farm ist ihnen zu groß, die Arbeit zu viel. Sie brauchen auch eine gute ärztliche Betreuung und die hat Windy Point nicht zu bieten.«
Ich zögerte und lauschte weiter. Es hörte sich betörend an.
»Sie würden uns sicherlich direkt nach unserer Hochzeit alleinlassen und dann teilen wir mein Haus auf. Einer von uns wohnt im Haupthaus, der andere im Anbau. Wir würden uns gemeinsam um die Pferde kümmern, aber jeder von uns könnte sein eigenes Leben weiterleben.« Er dachte nach. »Die Behörden verlangen von uns, dass wir am Ehepartner-Sponsorship-Programm teilnehmen. Ich muss mich dabei verpflichten, Sie drei Jahre lang zu unterstützen, und das werde ich auch tun. Aber ich biete Ihnen an, dass Sie die Freiheit haben, bereits nach einem Jahr zu gehen. Trotzdem wäre ich weiter für Sie da. Das verspreche ich Ihnen.«
Die Idee war absurd. Aber je länger ich darüber nachdachte, umso größer wurde meine Hoffnung. Vielleicht sagte dieser Typ die Wahrheit! Vielleicht brauchte er genau wie ich eine Hochzeit, damit sich das Leben so entwickelte, wie er es sich wünschte.
»Ich gebe zu, es klingt ein bisschen wahnsinnig«, brach es schließlich aus mir heraus.
»Aber es würde uns beiden den Arsch retten, oder?«
Jetzt lachte er und sah wieder richtig sympathisch aus.
»Das würde es wirklich«, gab ich zu. Ich trank einen Schluck Kaffee, sah, wie er mich dabei nicht aus den Augen ließ.
»Ich muss darüber nachdenken«, versuchte ich, Zeit zu schinden.
Er nickte. »Natürlich. Das sollten wir beide. Darum schlage ich vor, Sie begleiten mich zum Pferdekauf und wenn Sie mich dann unausstehlich finden, kaufe ich Ihnen ein neues Flugticket und Sie können weiter nach Frankfurt reisen. Aber wenn Sie sich auf mein Angebot einlassen können, nehme ich Sie danach mit nach Windy Point, okay?«, versuchte er, Nägel mit Köpfen zu machen.
Ich sah ihn herausfordernd an. »Und was ist, wenn Sie mich nicht ausstehen können?«, wollte ich wissen.
Er grinste. »Dann heirate ich Sie trotzdem, aber Sie müssen im Stall schlafen«, gab er zurück.
Jetzt lachten wir beide. Er war tatsächlich irgendwie … süß.
Ich war vermutlich ziemlich durcheinander, denn eine halbe Stunde später saß ich mit Cole Martin in einem schwarzen Pontiac und fuhr die Landstraße entlang in Richtung Norden. Hätte man mir vor ein paar Monaten gesagt, dass ich so etwas Verrücktes machen würde, hätte ich es nicht geglaubt.
Cole hatte Barrie in das Navi des Leihwagens eingetippt. Der Ort lag eine Stunde vom Flughafen entfernt. Wir mussten quer durch die Stadt fahren. Ich war noch nie in der Hauptstadt gewesen und war überrascht, wie schön sie war. Eine Mischung aus modern und viktorianisch, dazu der breite Fluss, die vielen Parks, das alles beeindruckte mich.
»Wahrscheinlich wird es heute zu spät werden, um noch zurückzufliegen und dann nach Windy Point weiterzufahren«, bemerkte er. »Dann haben wir einen gemeinsamen Abend in Toronto und ich kann Ihnen die Stadt zeigen.«
Ich schwieg irritiert. Es ging schließlich nicht nur um den Abend, sondern auch um die Nacht.
»Vorausgesetzt, Sie bleiben bei mir«, fügte er hinzu.
Wahrscheinlich deutete er mein Schweigen so, dass ich immer noch unsicher war. Aber so war das nicht. Je länger ich über diese seltsame Idee nachdachte, umso besser gefiel sie mir. Die Tatsache, dass ich womöglich in Kanada bleiben konnte, machte mich unglaublich glücklich.
»Wie haben Sie sich das mit dem Heiraten denn konkret vorgestellt?«, fragte ich schließlich.
Er sah mich kurz von der Seite an und lächelte wieder dieses gewinnende Lächeln.
»Also, zunächst mal müssen wir uns duzen«, schlug er vor. »Ich bin Cole.«
»Marlene«, sagte ich und sprach es zunächst deutsch, dann englisch aus. »Marleen.«
Cole nickte und wiederholte die englische Version. »Marleen.«
Jetzt schwiegen wir wieder. Das Navi zeigte nach rechts und er bog ab. Dann redete er weiter.
»Windy Point ist kleiner als ein Ort. Genau genommen besteht Windy Point nur aus unserer Ranch, ein paar Häusern entlang des Sees und einer Lodge, die auf einer Landzunge liegt«, beschrieb er mir seine Heimat. »Unsere Ranch ist also ein verlorener Punkt im Nirgendwo. Außer mir wohnen da nur noch meine Eltern, 40 Pferde, ein Hund und zwei Katzen. Wir haben drei Cowboys, die jeden Tag zu uns kommen. Zwei von ihnen wohnen an der Little Bear Lane, dem Highway, der zu uns führt, der andere ein Stück weiter südlich in Richtung Jameson.« Cole sah kurz zu mir herüber. »Das Problem ist also, dass es bei uns unglaublich einsam ist. Wenn du also mal einen Shoppingbummel machen oder ins Nagelstudio willst, musst du verdammt lange fahren.«
»Okay«, gab ich zurück. »Ich weiß übrigens, dass eine Ranch nicht neben einem Nagelstudio liegt. Ich war schließlich schon am Brereton Lake.«
»Das ist eine gute Voraussetzung«, sagte er. »Und wenn Sie Pferde lieben …« Er unterbrach sich kurz und verbesserte sich »Und wenn du Pferde liebst, kommst du bei uns voll auf deine Kosten.«
Ich zögerte, wagte mich dann aber doch mit meiner Frage vor.
»So ganz verstehe ich dein Problem trotzdem nicht«, begann ich vorsichtig. »Warum hast du bis jetzt keine Frau gefunden? Frauen und Pferde passen eigentlich immer gut zusammen und du machst doch auch einen …« Ich suchte nach dem passenden Wort. »… sympathischen Eindruck.« Ich betrachtete ihn genauer. »Oder magst du etwa eher Männer?«
Er lachte. »Ich mag Frauen«, antwortete er. »Sehr sogar. Aber glaub mir, Frauen stehen nicht auf Einsamkeit. Pferde sind okay, aber Frauen wollen Turniere und Trails reiten, sie wollen sich mit Freundinnen treffen und sie haben keine Lust auf wortkarge Cowboys. Bis jetzt hat es keine Frau länger als zwei Monate auf der Ranch ausgehalten, vor allem nicht, wenn der Winter kommt.«
»Oh«, sagte ich irritiert. Jetzt war ich selbst unsicher geworden, ob ich es dort aushalten würde.
»Hör zu«, sagte er. »Das ist nichts für die Ewigkeit. Nur ein Jahr. Die Zeit, die du auf der Ranch lebst, bezahle ich dir. Du bekommst jeden Monat 2.000 Dollar, außerdem kostenlose Unterkunft und Verpflegung.«
Jetzt war ich noch misstrauischer geworden. »Wo ist der Haken?«, fragte ich. »Was muss ich dafür tun?«
»Es gibt keinen Haken«, antwortete Cole. »Du musst mich heiraten und es muss für meine Eltern und die anderen so aussehen, als wenn wir uns lieben. Also der eine oder andere Kuss, Umarmungen, Händchenhalten.«
Jetzt oder nie, dachte ich und wagte, es auszusprechen. »Und was ist mit Sex?«
Überraschung zuckte über sein Gesicht. Cole hob wie zur Abwehr die Hände. »Nein, so was meine ich nicht. Es wird natürlich eine reine Zweckehe.« Er lächelte ein wenig verlegen. »Wir können das auch gerne in einem Vertrag schriftlich festhalten.«
»In einem Vertrag?«, wollte ich wissen.
Er nickte. »Ein Vertrag, den wir bei einem Anwalt unterschreiben. Der überwacht dann auch die Regeln. Wenn ich gegen die Abmachungen verstoße, hast du die Möglichkeit, sofort zu gehen, und erhältst das volle Jahresgehalt.«
Und ich habe meine Aufenthaltsgenehmigung, dachte ich.
»Ich denke darüber nach«, hörte ich mich zu meiner eigenen Überraschung sagen.
Kapitel 4
Es war eine kleine Ranch, die uns nördlich von Toronto erwartete. Cole berichtete, dass der Züchter im vergangenen Jahr ein paar preisgekrönte Curly Horses verkauft hatte. Auch jetzt bot er wieder eine besondere Stute an, die Tochter eines Worldchampion-Pferdes.
»Ein echtes Ausnahmetalent, das hat mir der Besitzer am Telefon versprochen. Die Abstammungslinie ist tatsächlich beachtlich«, berichtete Cole.
Es machte Spaß, sich mit ihm über Pferde zu unterhalten.
»Okay und was weißt du noch über sie?«
»Sie ist zehn Jahre alt und ist Cutting, Reining und Ranch Riding geritten, angeblich ist sie eine Top-Allrounderin, aber das sagen sie ja alle.« Er seufzte.
»Stimmt«, gab ich zurück und dachte an die Verkaufspferde auf Brians Ranch. Brian hatte auf seine charmante Art einige schwierige Pferde verkaufen können und dabei gutes Geld verdient. Als er aber in finanzielle Schwierigkeiten geriet, verkaufte er die Pferde schließlich deutlich unter Wert, auch Manon. Sie war für 5.000 Dollar über den Ladentisch gegangen, dabei hatte sie fast 10.000 Dollar gekostet. Bloß nicht dran denken!
Cole fuhr auf den Hof und parkte an der Seite, wo die Hänger standen. Ein Mann kam auf das Auto zu, als wir ausstiegen.
»Cole Marten?«, fragte er.
»Genau.« Cole und reichte ihm die Hand. »Und das ist …«
Er zeigte auf mich und sah einen Moment lang nachdenklich aus. »… meine Frau Marlene«, sagte er dann.
Irgendwie hörte sich das seltsam an! Ich schüttelte dem Mann ebenfalls die Hand.
»Ich bin Ted Wilson. Wir haben telefoniert. Sie interessieren sich für unsere großartige Stute, nicht wahr?«
Cole nickte.
»Ich habe sie schon auf den Reitplatz gestellt«, berichtete Ted und machte eine Kopfbewegung zu dem großen Platz hinüber, der hinter einem Gebäude lag.
»Okay, komm, Marlene«, sagte Cole und hakte sich bei mir unter.
Mir war klar, dass wir uns darin übten, in der Öffentlichkeit wie ein Ehepaar aufzutreten.
Die Stute sah nicht schlecht aus. Es war ein Palomino-Pferd mit einem hellbraunen Körper und einer weißen Mähne. Sie hatte eine große helle Blesse von den Augen bis zum Maul, die ihre Nase ziemlich breit erscheinen ließ. Jetzt im Frühsommer hatte sie ein glattes Fell und erinnerte mich an einen Haflinger. Dass sie eine so großartige Abstammung haben sollte, wunderte mich ein wenig.
»Sie ist ein richtiges Familienpferd«, schwärmte Ted. »Auch ganz lieb zu Kindern … wenn Sie Kinder haben …?«
Cole und ich wechselten einen kurzen Blick.
»Noch nicht«, erwiderte Cole.
»Jedenfalls nervenstark bei jeder Gelegenheit, dazu eine gute Springerin, aber auch verschmust und brav. Wollen Sie sie mal reiten?«
»Unbedingt«, gab Cole zurück. »Wie heißt das Mädchen überhaupt?«
»Flower.« Der Mann griff zu einem schönen Westernsattel, der bereits über dem Zaun hing. Er sattelte und trenste das Pferd.
»Okay. Dann fang ich mal an«, meinte Cole.
Ich war gespannt, ihn reiten zu sehen. Mit seinen Jeans und den Stiefeletten, die er trug, war es ihm jederzeit möglich, das Pferd zu reiten, für mich mit meinen Turnschuhen würde es schon etwas schwieriger sein. Aber ich wollte die Stute unbedingt auch ausprobieren.
Cole sah gut auf ihr aus. Flower ging brav los und als Cole die Schenkel anlegte und kurz schnalzte, wechselte sie in einen gemütlichen Jog. Es sah richtig lässig aus.
»Die ist aber eine coole Socke«, sagte ich und lachte. »Die joggt ja, als wenn sie sich auf einen gemütlichen Dauerlauf vorbereitet.«
Cole lachte ebenfalls. In seinen Augenwinkeln bildeten sich sympathische Lachfalten, die am Ende der Wangen fast bis zum Mundwinkel reichten.
An der nächsten Ecke legte Cole das äußere Bein hinter den Gurt und hob die innere Hand, dazu machte er ein Kussgeräusch. Flower begann zu galoppieren. Auch dabei machte sie schöne Bewegungen. Aus dem Galopp heraus ließ Cole sie stoppen und rückwärtsgehen.
»Back, back!«, gab Ted Wilson unterstützend von sich.
Die Stute machte alles, was man von ihr verlangte.
»Okay, wie sieht es mit den Disziplinen aus? Hat sie schon bei Trails im Westernreiten mitgemacht?«, wollte Cole nun wissen. »Beim Reining zum Beispiel, wenn sie Zirkelreiten oder fliegende Galoppwechsel zeigen muss?«
»Oder bei einem Spin?«, ergänzte ich. Diese 360-Grad-Drehung auf der Hinterhand halte ich persönlich für die Königsdisziplin in Sachen Beweglichkeit.
»Klar«, erwiderte Ted Wilson. »Sogar beim Freestyle Reining.«
»Okay«, nickte Cole. »Dann kann sie einen Spin und einen Sliding Stop, oder?«
Und ohne die Antwort abzuwarten, machte er mit Flower einen Sliding Spin.
Sehr elegant sah sie dabei ehrlich gesagt nicht aus, eher wie ein Schiff, das eine Wendung versuchte. Aber gegen die Technik an sich konnte man nichts sagen.
»Wie sieht sie aus?«, wandte sich Cole an mich. »Reiten lässt sie sich jedenfalls leicht.«
»Also, mein Traumpferd wäre es nicht«, musste ich zugeben. »Aber sie scheint sehr freundlich zu sein.«
»Das ist sie«, mischte sich Ted Wilson ein. »Wie gesagt, der kann man auch ohne Bedenken seine Kinder anvertrauen.«
Cole hielt an. »Willst du mal?«, wandte er sich an mich.
Ich nickte und er stieg ab. Ich wusste, dass er jetzt auch sehen wollte, wie gut ich mit Pferden umgehen konnte. Sofort wurde ich ein wenig aufgeregt.
»Hoffentlich geht das mit meiner Jeans und den Turnschuhen. Die Jeans ist ziemlich eng …«, murmelte ich verlegen.
Dennoch stieg ich in den Sattel und ritt los. Auch ich probierte verschiedene Gangarten aus und Cole sah dabei abwechselnd zu mir und zu der Stute.
»Mach mal einen Spin. Kannst du das?«, fragte er mich.
»Natürlich«, erwiderte Ted Wilson, wahrscheinlich, weil er nicht davon ausging, dass Cole tatsächlich nicht wusste, ob ich einen Spin reiten konnte. Er dachte sicherlich, dass sich der Kommentar auf das Pferd bezog.
Ich ritt einen Spin, dann richtete ich das Pferd zu einem Back-up, um rückwärtszureiten. Es fühlte sich aber bei Flower irgendwie steifer an, als ich es von Manon gewöhnt war.
»Hm«, brummte Cole. »Das ist aber noch ausbaufähig.«
Ich musste lachen und auch Cole grinste verschmitzt.