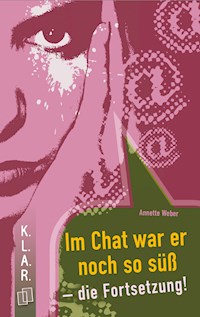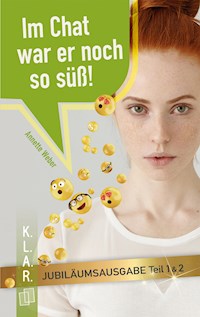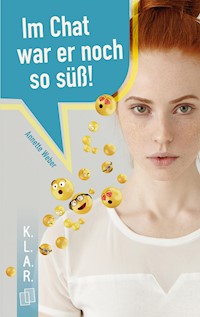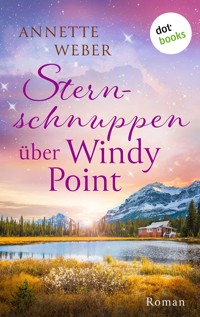Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: dotbooks VerlagHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Isle of Wight
- Sprache: Deutsch
Ein Inselsommer, der alles verändert: Der romantische Wohlfühlroman »Das Cottage in Seagrove Bay« von Annette Weber jetzt als eBook bei dotbooks. Ein altes Cottage in einer kleinen Meeresbucht, eine Strandreitschule – und ein Traummann an ihrer Seite: Mit diesen rosigen Aussichten ist Nele auf die Isle of Wight vor der Küste Englands gekommen. Doch als ihr Freund sie einfach sitzenlässt, muss Nele den Hof plötzlich ganz alleine führen – noch dazu mit jeder Menge Schulden. Da scheint das Angebot eines geheimnisvollen Fremden, ihm für zwei Monate exklusiven Reitunterricht zu geben, wie der rettende Strohhalm – aber natürlich gibt es gleich mehrere Haken: Colin ist nicht nur verflixt attraktiv, sondern scheint Chaos magisch anzuziehen, was schon bald die ganze Insel auf Trab hält. Da kommt es also ganz und gar ungelegen, dass Neles Herz in Colins Nähe plötzlich so verrückt spielt wie das englische Wetter … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Liebesroman »Das Cottage in Seagrove Bay« von Annette Weber vereint den ganz besonderen Zauber britischer Inseln mit sommerlicher Feelgood- Atmosphäre und wird Fans von Jenny Colgan und Holly Hepburn begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein altes Cottage in einer kleinen Meeresbucht, eine Strandreitschule – und ein Traummann an ihrer Seite: Mit diesen rosigen Aussichten ist Nele auf die Isle of Wight vor der Küste Englands gekommen. Doch als ihr Freund sie einfach sitzenlässt, muss Nele den Hof plötzlich ganz alleine führen – noch dazu mit jeder Menge Schulden. Da scheint das Angebot eines geheimnisvollen Fremden, ihm für zwei Monate exklusiven Reitunterricht zu geben, wie der rettende Strohhalm – aber natürlich gibt es gleich mehrere Haken: Colin ist nicht nur verflixt attraktiv, sondern scheint Chaos magisch anzuziehen, was schon bald die ganze Insel auf Trab hält. Da kommt es also ganz und gar ungelegen, dass Neles Herz in Colins Nähe plötzlich so verrückt spielt wie das englische Wetter …
Über die Autorin:
Annette Weber, 1956 in Lemgo geboren, schreibt seit über 20 Jahren Romane, in die sie stets ihre Begeisterung für Pferde einfließen lässt. Annette Weber ist verheiratet, hat drei Söhne, fünf Enkelkinder und lebt in der Nähe von Paderborn.
Die Autorin im Internet: www.annette-weber.com/ und www.sina-trelde.de
Bei dotbooks veröffentlichte Annette Weber auch ihre Familiensaga um »Gut Werdenberg« mit den Bänden »Stürme einer neuen Zeit« und »Hoffnung eines neuen Lebens«.
***
Originalausgabe November 2022
Copyright © der Originalausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Textbaby Medienagentur, www.textbaby.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Sarah Schroepf
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-398-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Seagrove Bay« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Annette Weber
Das Cottage in Seagrove Bay
Roman
dotbooks.
Prolog
In jedem Menschen schlummern Träume. Mein Traum hieß Isle of Wight. Cottage mit Pferdeweide. Meer, Maurice und Mangalarga Marchadores.
Es war Sommer, als wir uns diesen Traum erfüllten. Wir waren verliebt, wir waren glücklich.
Wir hatten das Paradies auf Erden gefunden.
Teil 1
Kapitel 1
Meine Nerven lagen blank. Die drei jungen Frauen streiften nun schon seit fast einer Stunde über den Reitplatz, streichelten die Pferde vom Zaun aus und fotografierten, was das Zeug hielt. Nun endlich kamen sie zu mir rüber. An diesem Morgen hatte ich noch nichts zu tun gehabt, außer ihnen zuzuschauen. Jetzt aber hörte ich endlich die Kasse klingeln.
»Wir wollten uns zu einer Reitstunde anmelden.«
»Natürlich, gerne«, sagte ich so zuvorkommend wie möglich. Geduld und ein 24-Stunden-Lächeln musste man im Tourismusgeschäft aufbringen, und das waren nicht unbedingt meine stärksten Eigenschaften.
»Ihr habt euch ja schon umgesehen. Habt ihr euch bereits für ein Pferd entschieden?«, fragte ich.
Ramon streckte seinen Kopf über den Zaun und schnupperte am T‑Shirt der jungen Frau herum. Das war mal wieder typisch für ihn. Er war immer der Ansicht, dass man vor Touristen keinen Respekt zu haben brauchte. Aber die Frau verstand nichts von Pferden, wusste nicht, dass sie in Rangordnungen dachten und dass, wenn ein Pferd an ihrer Kleidung zupfte, es damit zeigte, dass sie im Rang unter ihm stand. Im Gegenteil, sie bewertete das als Zeichen von Zuneigung. Kreischend warf sie ihre blonden Haare in den Nacken und lachte.
»Ist die süß! Die nehme ich!«
Ich atmete tief durch. »Das ist ein er!«
»Oh, echt? Das ist ein Hengst? Wie cool ist das denn?!«, kreischte ihre Begleiterin. Auch sie hatte ihr langes Haar mit blonden Strähnen aufgehellt, obwohl ihr Ansatz am Scheitel verriet, dass sie eigentlich dunkel waren. Die Haarfarbe, die langen Wimpern, die zu sehr gebräunte Haut und die ausgeflippte Kleidung ließen erkennen, dass sie nicht von hier waren. Sie sprachen Englisch mit Akzent, hatten wahrscheinlich vom französischen Festland aus ihren Urlaub auf der Isle of Wight gebucht. Ich dagegen sah aus wie eine typische Insulanerin, mit dunkelblonden Haaren, die einen leichten Rotstich hatten. »Rauhaardackelbraun«, so hatte Maurice meine Haarfarbe bezeichnet und sich köstlich darüber amüsiert. Damals, als er noch schwer verliebt in mich gewesen war, und stolz darauf, dass ich aussah, als wenn ich eine von ihnen wäre.
Ungefähr 140.000 Einwohner zählte die rautenförmige Kanalinsel, die zwar der britischen Krone unterstand, aber ihre ganz eigenen Gesetze hatte. »Die Insel«, nannten die Einheimischen sie. Wahrscheinlich, weil es ihrer Meinung nach die einzigartigste Insel Englands war. Die Landschaft war abwechslungsreich und änderte sich schon nach wenigen Kilometern. Es gab steile Klippen, Kreidefelsen, Sandstrände, grüne Wiesen und dichte Wälder. Im Grunde war es England auf 381 Quadratkilometern komprimiert, mit Sonnenschein und Botanischen Gärten, die sogar Palmen und Bananenstauden zu bieten hatten.
Viele Menschen lebten schon eine halbe Ewigkeit hier, und es war nicht so einfach, von ihnen akzeptiert zu werden. Auch ich hatte es nicht immer leicht gehabt, aber seit einiger Zeit schon das Gefühl, dass die Isle of Wight mein Zuhause geworden war. Dazu trug auch zu großen Teilen meine Freundin Ruby bei, und auch Fred, der zu unserer kleinen Gruppe gehörte, außerdem meine Pferde, das wunderschöne Cottage und das Meer. Lange Zeit hatte auch Maurice dazugehört. Aber das war einmal …
Im Moment allerdings machte ich eine Krise durch. Genau genommen ging es bei mir, wie man so schön sagte, um das nackte Überleben – um die Existenz. Und da kamen drei Touristinnen gerade recht. Sie brachten nämlich das lang ersehnte Geld, das ich an diesem Tag noch nicht verdient hatte.
»Dieses Pferd ist auch kein Hengst, sondern ein Wallach«, erklärte ich nun. Dann betrachtete ich die jungen Frauen genauer. »Versteht ihr denn etwas vom Reiten?«
Alle drei lachten glockenhell über diesen guten Witz. So quietschend, wie sie kicherten, hatte ich sogar den Verdacht, dass sie ihn zweideutig aufnahmen. Natürlich verstanden sie nichts vom Reiten, wie fast alle Besucher, die zu mir in die Strandreitschule kamen. Sie wollten eben einen lustigen Ritt am Strand machen und stellten sich das einfach und flippig vor. Man konnte tolle Videoclips drehen und Fotos auf Snapchat posten: ein Ausritt auf einem dieser schönen Pferde, dazu der Sonnenuntergang am Osborne House – das war es, was die Welt sehen wollte.
Leider war der Umgang mit Pferden deutlich schwieriger, als sich ein Surfbrett auszuleihen oder sich auf Wasserskiern durch den Ärmelkanal ziehen zu lassen. Pferde hatten einen eigenen Kopf, und sie wussten schnell, wie sie mit Menschen umgehen konnten, die keine Ahnung vom Reiten hatten. Nach kurzer Zeit blieben sie einfach stehen, um am Gras zu knabbern, und störten sich nicht daran, wenn die Touristen ihnen verzweifelt in die Flanken traten. Doch sobald es ihnen zu viel wurde, schüttelten sie sich und warfen die Reiter einfach ab. Dann war der Ausritt plötzlich nicht mehr lustig. Anschließend wurde ich vorwurfsvoll angeschaut, das Pferd beschimpft und die Strandreitschule schließlich im Netz mit einem Stern bewertet.
Aber selbst das war harmlos gegen das, was auch noch geschehen konnte, nämlich, dass die Reiter auf die Felsen fielen und sich tatsächlich ziemlich wehtaten. Dann konnte ich davon ausgehen, dass sie richtig ausfallend wurden. Einer hatte mir sogar mal mit einer Klage gedroht.
Aber diese Touristengruppe war gut gelaunt, und so versuchte ich, das ebenfalls zu sein, auch wenn mir die Frauen wie spätpubertierende Kinder eines Mädcheninternats erschienen. Die Sommergäste waren nun mal mein Geschäft, und es war nicht klug, zu zeigen, wie mich ihre Unwissenheit inzwischen immer stärker nervte.
»Der Gescheckte heißt Ramon«, versuchte ich es noch einmal. »Er ist grundsätzlich freundlich und aufmerksam, allerdings muss man auch aufpassen …«
Die Touristin raschelte mit einer Brötchentüte, und Ramon puffte sie ungeduldig in den Rücken.
»Ich komme schon klar«, behauptete sie und reichte dem Pferd ein trockenes Brötchen. »Wir verstehen uns.«
Das sah Ramon genauso, denn er verschlang das Brötchen mit einem Happs, puffte dann die Frau erneut in den Rücken und forderte mehr. Ich konnte es nicht ausstehen, wenn die Besucher die Pferde mit irgendwas fütterten, nur um sich mit ihnen gut zu stellen. Sie wussten überhaupt nicht, was sie dadurch anrichteten. Ramon verhielt sich jedenfalls immer respektloser, je mehr dieser Leute ihn mit mitgebrachten Leckereien vollstopften.
»Bitte, das solltest du nicht tun. Er denkt dann …«
»Ach, alles gut. Ist doch nur trockenes Brot«, unterbrach sie mich.
Ich wollte etwas erwidern, aber die andere Frau mischte sich ein.
»Kann ich den Hellen da vorne nehmen?«, fragte sie und deutete auf Fee. Damit zeigte sie unmissverständlich, dass sie ebenfalls nichts von Pferden verstand. Fee war nämlich eine Stute. Ich unterdrückte ein Seufzen.
»Ja, klar«, meinte ich. »Das ist allerdings eine sie. Sie heißt Fee.«
»Oh, das klingt ja richtig magisch!«, strahlte die Touristin und fotografierte das isabellfarbene Pferd begeistert.
Fee bleckte die Zähne, und das schien die Frau unglaublich witzig zu finden. Sie fotografierte sie gleich noch einmal.
Oh Gott, bei so viel Naivität bekam ich immer die Krise. Die Frau konnte gar nicht einschätzen, wie viel Kraft Pferde hatten. Es würde für Fee ein Leichtes sein, sie umzustoßen oder ihr auf die Füße zu treten. Wie alle Sommertouristen trug auch diese Möchtegern-Reiterin Flipflops. Das endete dann, wenn es schiefging, in einem Blutbad.
Ich fühlte mich plötzlich so wahnsinnig allein und schrecklich hilflos. Diese Reitschule am Strand war Maurices und mein gemeinsames Projekt gewesen. Jetzt aber war es nur noch meines. Mein einsames und verzweifeltes Überlebensprojekt. Maurice hatte mich im Stich gelassen.
Wir hatten uns in Deutschland kennengelernt, in einer Firma gearbeitet, die Filialen in Deutschland und England besaß. Hals über Kopf hatten wir uns ineinander verliebt und schnell nicht nur das Büro, sondern auch meine Wohnung miteinander geteilt. Wir beide liebten Pferde und träumten den gemeinsamen Traum von einer Reitschule am Strand an einem magischen Ort.
Irgendwann später waren wir durch England gereist und hatten einen Platz gesucht, an dem wir unseren Traum verwirklichen konnten. Leider war das Wetter in England nicht besonders freundlich, und so hatten wir angefangen, die kleinen bildhübschen Inseln vor Englands Küste für uns zu entdecken. Die Isle of Wight hatte uns auf Anhieb verzaubert. Die Insel war grün, hatte Klippen und Sand und berauschte uns durch ihr mildes Klima. Hier gab es nur wenig Autoverkehr, dafür aber Fahrräder, Kühe, Pferde und jede Menge Blumen. Spontan beschlossen wir, uns diesen Ort für unsere Idee auszusuchen. Auf der Isle of Wight gab es bereits Surfschulen, Wellenreiten und die Möglichkeit, Stand-up-Paddling zu erlernen, aber noch keine Reitschule. Es erschien uns fast wie eine Schicksalsprophezeiung, uns hier niederzulassen.
Zuerst hatten wir die Insel mit den Fahrrädern erkundet, die wir am Hafen liehen, anschließend waren wir durch den bunten Sand am Alum Bay bis zu den »Needles« gelaufen, waren dem längsten Pier Englands bis weit ins Meer hinein gefolgt und hatten später im Garten eines strohgedeckten Teahouse gesessen und von einem Cottage am Meer geträumt. Plötzlich war uns klar gewesen, dass diese Insel der Ort war, an dem wir unseren Traum verwirklichen konnten. Den Traum davon, mit Pferden durch Sand und Meer zu reiten.
Schließlich waren wir in Seagrove Bay auf ein altes Cottage mit Pferdeställen gestoßen, das zum Verkauf angeboten wurde – genau das, wovon wir immer geträumt hatten.
Da unsere Firma Stellen abbauen musste, war ihnen eine Kündigung recht, und wir erhielten sogar eine Abfindung. Das Geld ermöglichte uns, das Cottage zu erwerben und zu renovieren, später auch die Ställe. Dann kauften wir Pferde, kleine elegante Mangalarga Marchadores und englische Galopper. Die Marchadores kamen ursprünglich aus Brasilien, aber ein Zuchtbetrieb in der Nähe von Stratford verkaufte einige dieser unerschrockenen Pferde. Sie erschienen uns für unser Vorhaben besonders geeignet, weil sie klug, gelassen und fleißig waren.
Maurice und ich kauften zwei Schecken, eine Stute – Yida – und einen Wallach – Ramon –, außerdem eine isabellfarbene Stute, die ich Fee nannte. Die englischen Galopper holten wir von der Rennbahn; einen braunen Wallach, der Chief hieß, und den jungen Wallach Rainman, der noch ausgebildet werden musste. Diese Pferderasse war eigentlich ein bisschen zu nervös für unser Vorhaben, aber die Tiere waren so very british, außerdem konnten sie ohne Ende galoppieren.
Wir renovierten das kleinere Haus am Strand, erneuerten die Ställe und errichteten einen kleinen Reitplatz. Dann starteten wir unser gemeinsames Projekt.
Die Insel war eine Naturschönheit, und umweltbewusst, wie wir waren, wollten wir sie so erhalten. Darum beschlossen wir, auf ein Auto zu verzichten. Wir kauften einen E-Roller mit Anhänger, mit dem wir es sogar schafften, das Baumaterial für das Cottage und das Heu und Stroh für die Pferde zu transportieren. Natürlich war die ganze Logistik ein etwas lästiges Problem, denn unser Haus lag ein ganzes Stück vom Hafenstädtchen Seaview entfernt, aber das hielt uns nicht ab – wir waren verliebt ineinander und in unser Projekt. Dann, glaubten wir, schafft man so ziemlich alles.
Zunächst war die Strandreitschule für die Touristen tatsächlich eine Goldgrube gewesen. Wir konnten uns kaum vor Anmeldungen retten. Schon morgens, wenn wir die Ställe öffneten, standen die Touristen Schlange.
Im vergangenen Jahr waren jedoch einige neue Reitanlagen in der Mitte der Insel dazugekommen. Ein gutes Geschäft wurde eben schnell kopiert. Viele der Reitschulen waren größer und professioneller als unser kleines Seagrove Cottage.
Und dann hatte Maurice plötzlich diese ganz besondere Reitschülerin gehabt – Charleen Fuller, Tochter eines Hoteliers aus dem Norden der Insel, eine junge Frau mit viel Geld und dem Aussehen von Katy Perry. Blond, große blaue Augen – nach dem Klischee das Schönheitsideal eines jeden Mannes. Sie war verliebt in unsere Reitschule, verliebt in die Pferde … und mich hatte gleich das Gefühl beschlichen, dass ihre hauptsächliche Liebe Maurice galt.
Wenn ich ihn fragte, lachte er nur. Ich immer mit meiner Eifersucht. Die Frau war doch angeblich gar nicht seine Kragenweite. War sie dann aber doch! Denn auf einmal verbrachte Maurice ganz viel Zeit mit Charleen, gab ihr auch Reitunterricht, als die Schule schon geschlossen war und die Pferde sich eigentlich ihren Feierabend verdient hatten. Immer länger wurden die Ausritte, immer verklärter sein Gesicht, wenn er von ihr erzählte. Er konnte mir nichts vormachen. Auch wenn ich so sehr hoffte, ich würde unrecht behalten …
Und dann erklärte mir Maurice eines Abends, dass er die Reitschule aufgeben und mit Charleen ein Hotel betreiben wollte. Ich versuchte, Bedenken anzumelden, die Dinge kritisch zu hinterfragen und Maurice für mich zurückzugewinnen. Aber es war nicht mehr möglich. Er hatte sich längst entschieden.
Charleens Eltern besaßen ein Restaurant mit Hotel am Jachthafen von Cowes im Norden der Insel, und ein zupackender Schwiegersohn, dem sie eines Tages das Unternehmen übertragen konnten, war ihr größter Wunsch.
Damit starb dann unser gemeinsames Projekt, und der Traum von einer Strandreitschule am Meer entwickelte sich zu einem einsamen Albtraum.
An der Trennung hatte ich immer noch zu knacken. Aber nicht nur daran. Ich stand plötzlich auch ganz alleine mit dieser Reitschule da. Fünf Pferde mussten versorgt, das Gebäude abbezahlt werden, und Maurice bedrängte mich, ihm seinen Anteil an der Reitschule auszuzahlen, damit er es in die Hotelanlage mit Charleen stecken konnte. Ich wusste überhaupt nicht, woher ich das Geld nehmen sollte. Wie viele schlaflose Nächte mich diese Situation schon gekostet hatte, mit meiner Verzweiflung und meiner Wut klarzukommen.
Und nicht nur das. Diese Ritte mit den Touristen überforderten mich auch. Maurice und ich hatten die Gruppe immer zu zweit begleitet. Jetzt allein mit drei überheblichen Anfängern unterwegs zu sein, war nicht ungefährlich. Die Insel hatte viele Felsen und steile Küsten. Schnell konnte man die steinigen Wege unterschätzen und dann Pferd und Mensch in riskante Situationen bringen. Das aber kümmerte meine Gäste nicht. Bei ihnen war das alles ein Spaß, ein cooler Ferientag auf dem Rücken der Pferde.
»Kann ich den Braunen hier nehmen? Der hat so eine Mähne wie ich?«, fragte die dritte Touristin und strich Chief über die Ohren.
Ich sah, dass er zusammenzuckte und die Ohren anlegte.
»Vorsicht, bitte!«, warnte ich sie. »Das mag er nicht. Siehst du? Er legt die Ohren an.«
»Oh, hat das was Schlimmes zu bedeuten?«, kreischte die Touristin und sprang erschrocken zurück. Sie sah sich um und entdeckte Yida. »Dann nehme ich lieber den Gescheckten.«
Ich verzichtete darauf, ihr zu erklären, dass auch Yida eine Stute war. Die Situation lief nämlich ohnehin gerade aus dem Ruder. Die eine Touristin versuchte bereits, auf den Pferderücken zu steigen, obwohl der Sattel noch gar nicht festgeschnallt war. Die andere fuchtelte immer noch mit ihrer Brötchentüte herum. Ich war kurz davor, laut zu schreien und alle zur Hölle zu schicken.
»Soll ich dir helfen, Darling?«
Das war Fred, mein rastazopfiger Nachbar aus der Mermaid-Bar direkt neben uns. Im Sommer reichte seine Strandbar fast bis ans Wasser, während der anderen Jahreszeiten zog sie sich bis zu dem gemütlichen Kachelofen im Inneren des urigen Pubs zurück. Das Beste aus zwei Welten, so, wie es nur auf der Isle of Wight möglich war.
»Dich schickt der Himmel«, seufzte ich.
Fred war ein echter Freund. Er wusste zu gut, wie schwer mir gerade alles fiel.
Jetzt zwinkerte er mir zu, und seine dunklen Augen blitzten. Mit seinem klaren Sachverstand schaute er sich zu den Touristinnen um und begriff sofort, was zu tun war. Ich hätte ihn küssen können für diese selbstverständliche Hilfsbereitschaft.
»Augenblick«, wandte er sich an die eine, die schon im nicht befestigten Sattel saß. »Würdest du wohl dein süßes Hinterteil noch mal aus dem Sattel heben. Ich muss noch nachgurten.«
Die junge Frau lachte und zwinkerte Fred zu. Der sah ihr nun tief in die Augen und strahlte dabei.
Er hatte so viel Leichtigkeit. Konnte locker flirten und doch nebenbei so verantwortungsvolle Sachen machen, ohne dass man ihm anmerkte, dass alles längst nicht so einfach war, wie es aussah. Neben ihm wurde mir noch mal bewusst, wie ratlos und überfordert ich oft war. Doch jetzt war keine Zeit, zu jammern und die Welt zu beklagen. Die Gäste waren ungeduldig und wollten ihren Spaß.
Schnell half ich auch den anderen Frauen dabei, die Pferde zu satteln und aufzutrensen.
»Wollen wir los?«, fragte Fred dann und zog sich auf Rainmans Rücken.
Ich hatte mir Chief gesattelt, das schönste, aber auch schwierigste unserer Pferde.
»Ich bin so weit«, sagte ich. Dann sah ich mich nach den Touristinnen um. »Es gibt beim Ausritt ein paar Regeln zu beachten«, begann ich und achtete darauf, streng zu klingen. »Bitte achtet darauf, dass ihr mich nicht überholt. Wenn die Pferde stehen bleiben und Gras zupfen wollen, nehmt die Zügel wieder auf und treibt die Pferde an. Treiben bedeutet, wenn man die Beine –«
»Und los!«, rief die eine Touristin und trieb Fee an. Mir blieb echt die Spucke weg. So etwas hätte sie sich bei Maurice sicherlich nicht getraut. Der war dann immer sehr streng und klar gewesen. Ich war einfach zu zaghaft.
Jetzt aber wurde Fred deutlicher. »Nein, nein«, rügte er sie und stellte sich mit seinem Pferd so vor die Touristin, dass sie anhalten musste. »So geht das leider nicht. Du musst dich schon an die Regeln halten, sonst kannst du nicht mitreiten.«
Die Touristin sah jetzt tatsächlich etwas sauer aus.
»Na gut«, murmelte sie. »Was muss ich machen?«
»Erkläre es ihnen, Darling«, gab Fred die Autorität an mich weiter.
Ich schluckte. Alle sahen mich ungeduldig an. Aber immerhin, sie hörten zu. Ich erklärte allen noch mal in Ruhe die Regeln – dass ich voran und Fred am Ende reiten würde. Dass wir zunächst im Schritt und später erst etwas schneller reiten würden. Und dass wir an der Stelle, wenn die Felsen anfingen, hintereinandergehen müssten.
Ich sah aufmerksam in die Runde.
»Habt ihr alles verstanden?«, fragte ich.
Sie nickten.
Auch wenn ich dem Frieden nicht ganz traute, ritt ich los, und sie folgten mir.
Kapitel 2
Wir brachten diese Reitstunde tatsächlich ganz gut zu Ende, aber das lag eben auch daran, dass Fred so lustig war und die Damen bei Laune hielt. Es gab Momente, in denen ich die Luft anhalten musste, einmal, als Ramon plötzlich einen Satz nach vorne machte und die eine Touristin beinahe aus dem Sattel gefallen wäre, ein anderes Mal, als eine Dose über den Weg rollte und Yida sich panisch umdrehte und in die andere Richtung davonstürmen wollte. Fred stellte sich ihr in den Weg, beruhigte sie und achtete darauf, dass sie wieder mit uns ging. Danach verlief alles ohne Probleme. Ich war sehr erleichtert, als wir nach einer Stunde wohlbehalten wieder auf der Farm ankamen.
Die Touristinnen zahlten, bedankten sich und legten sogar ein gutes Trinkgeld für Fred auf den Tisch. Dann machten sie sich lachend aus dem Staub – natürlich nicht ohne das übliche Selfie mit Fred und mir vor der Pferdewiese. Ich war froh, als sie weg waren. Dann wandte ich mich an meinen Freund.
»Danke dir, Fred«, sagte ich. »Ohne dich hätte ich das nicht geschafft.«
Ich reichte ihm sein Trinkgeld und legte noch ein paar Geldscheine darauf, aber er winkte ab.
»Bitte nicht. Alles gut. Die trinken bestimmt gleich noch einen Cocktail bei mir.« Er zwinkerte mir zu. »Sex on the beach.«
Fred wusste, dass ich mit meinem Reiterhof ums Überleben kämpfte. Nur zu oft hatte ich in letzter Zeit abends an seiner Bar gesessen, hatte ihm mein Herz ausgeschüttet und Tränen vergossen. Die Abende endeten oft damit, dass mir Fred einen Pfefferminztee mit ganz viel Zucker kochte und mich ins Bett schickte. Auch dafür, dass er mir nie Avancen gemacht hatte, war ich dankbar. Er war und blieb einfach ein guter Freund, zu weiteren komplizierten Gefühlen hatte ich keine Kraft.
Jetzt sahen wir, dass die jungen Frauen tatsächlich bis zu seinem Pub weiterzogen und es sich dort auf den Stühlen im Vorgarten gemütlich machten. Fred grinste und pfiff leise durch die Zähne. »Da sind sie ja, meine Schönen«, flüsterte er. Ich musste lachen. Fred hatte keine Probleme damit, Frauen in sein Bett zu kriegen. Hier am Strand waren sowieso alle gut drauf, und die wohlbetuchten Touristinnen nahmen es leicht mit der Liebe und den Beziehungen. Von ihnen konnte ich sicherlich noch eine Menge lernen.
Während Fred zu seinem Pub hinüberging, die Frauen fröhlich begrüßte und lautes Lachen zu mir herüberscholl, band ich die Pferde am Anbindehaken fest und sattelte sie ab. Dann brachte ich sie auf den Paddock und blieb eine Weile am Zaun stehen, um ihnen beim Wälzen zuzuschauen. Diesen Anblick liebte ich immer sehr. Rainman war meist der Erste, der sein verschwitztes Fell in den Sand drückte und sich genüsslich von einer Seite zur anderen wälzte. Auch die beiden Schecken Ramon und Yida genossen das Sandbad. Fee dagegen suchte lange nach einem Platz, auf dem sie sich wälzen konnte, und Chief begnügte sich meist damit, sich auf den Bauch zu legen.
Als ich mich zufällig umdrehte, fiel mir ein Typ auf, der auf dem Hof herumstand und offenbar auf jemanden wartete. Er hatte mir den Rücken zugedreht. Er war groß, hatte welliges dunkelblondes Haar und eine gerade Haltung. Ein selbstbewusster Typ. Jetzt betrat er die Stallgasse. Im ersten Moment glaubte ich, meinen Augen nicht zu trauen. Was machte der da? Wie unverschämt war das denn!
»Hallo?«, sprach ich ihn auf Englisch etwas ungehalten an, aber er drehte sich nicht um. Im Gegenteil. Er ging weiter in den Stall hinein, als wenn er hier zu Hause wäre.
Ich hatte mich hier an vieles gewöhnt. Touristen nahmen sich oft überraschende Sachen heraus, aber wenn jemand einfach so einen Stall betrat, reagierte ich allergisch. Schnell lief ich zu ihm hinüber.
»He, was fällt Ihnen ein?«, rief ich empört.
Ich stand an der Tür und verfolgte, wie er langsam die Stallgasse entlang bis zu der Heuluke ging. Dabei merkte ich ihm an, dass er mich am liebsten weiter ignoriert hätte, aber das war leider nicht mehr möglich. Langsam drehte er sich um und sah mich an. Dann kam er zurück, hielt direkt auf mich zu und blieb vor mir stehen, den Blick leicht spöttisch.
»Wollte mich hier nur mal umgucken«, sagte er in perfektem Englisch
Ich schluckte. Seine Blasiertheit war unverschämt.
»Ach so!«, rief ich aufgebracht. »Und dann kommen Sie nicht auf die Idee, um Erlaubnis zu fragen?«
Immer noch dieser Blick, herablassend, arrogant.
Er ließ nun seinen Blick langsamer über meinen Körper gleiten, musterte mein graues Schlabber-T-Shirt, das am Halsausschnitt schon kleine Löcher aufwies, weil ich es so oft gewaschen hatte, betrachtete dann meine curryfarbene Reithose und die staubigen Stiefeletten.
Seinen Augen schien nichts zu entgehen, und an seinem überheblichen Gesichtsausdruck und der Falte auf der Stirn konnte ich erkennen, dass der Stall nicht seinen Ansprüchen entsprach. Und ich mit meinem Outfit offenbar auch nicht.
»Gehört Ihnen das?«, fragte er nun.
»Wenn Sie mit das mein Cottage meinen, ja, das gehört mir«, schnappte ich und merkte, dass ich so richtig sauer wurde. Offenbar hatte er keine besonders gute Erziehung genossen. Zeit, den Pädagogen in mir heraushängen zu lassen. »Und stellen Sie sich vor, da wo ich herkomme, hat man gelernt, dass man nicht einfach irgendwas betritt, was einem nicht gehört«, erklärte ich ihm. »Sie haben sicherlich auch was dagegen, wenn ich plötzlich in Ihrem Schlafzimmer stehe.«
Jetzt glitt ein Grinsen über sein Gesicht, und ich bereute meine Worte sofort wieder.
»Kommt drauf an«, meinte er. Wieder diese Überheblichkeit in seinem Blick. Ein spöttischer Zug umspielte seine Mundwinkel. Ich merkte, wie mir heiß wurde. Dieser Typ ärgerte mich maßlos. Was bildete er sich eigentlich ein?
»Was wollen Sie?«, zischte ich ihn an.
Er machte eine Kopfbewegung zu unserem Schild am Eingang.
»Reitschule Seagrove Cottage. Sind Sie das?«
Ich nickte. »Allerdings.«
»Ich hätte gerne Reitunterricht«, meinte er.
Jetzt war ich zugegebenermaßen überrascht.
»Reitunterricht? Sie?«, fragte ich irritiert.
Seine Mundwinkel zuckten. Einen kurzen Moment bildete ich mir ein, Unsicherheit in seinen Augen zu erblicken. Aber als er merkte, dass ich ihn genauer beobachtete, vertiefte sich der arrogante Zug um seinen Mund.
»Oder haben Sie gar keine Reitschule? Hoppeln Sie nur mit den Feriengästen am Strand entlang?«, wollte er wissen.
Ah, so war das also. Wenn man seiner Unsicherheit auf der Spur war, schoss er umso gemeiner zurück. Solche Typen kannte ich, sie beschworen direkt ein ungutes Gefühl in mir herauf. Ich bemühte mich jetzt um Sachlichkeit.
»Je nachdem, was Sie wünschen«, meinte ich. »Ich mache Strandritte, aber ich gebe auch Reitunterricht.«
»Was können Sie?«, fragte er nun. »Dressur? Springen? Vielseitigkeit? Military?«
Mit dieser blasierten Art glaubte er, mich aus der Fassung bringen zu können. Aber da konnte ich ihm klar die Stirn bieten.
»Ich habe den Trainer-C-Schein im Basissport«, gab ich zurück. »Außerdem einen Trainerschein im Distanzreiten.«
Er nickte, aber ich war mir nicht sicher, ob er mir glaubte.
»Zeigen Sie es mir!«, forderte er.
Es nervte mich, dass er mich wie sein Dienstmädchen behandelte. Ich spürte so viel Widerstand in mir, dass ich nur noch einen Wunsch hatte: den Typen schnell wieder loszuwerden.
»Warum sollte ich das tun?«, konterte ich selbstbewusst. Dabei bemühte ich mich, ihn genauso herausfordernd anzuschauen wie er mich.
Er hielt meinem Blick mühelos stand. »Sie könnten mir damit imponieren«, erwiderte er.
Au Mann, so viel Arroganz tat weh! Wenn er nicht so ernst und so herablassend gewesen wäre, hätte ich tatsächlich gelacht. Aber bei diesem stechenden Blick blieb mir der Lacher im Halse stecken. Was glaubte er denn, was jetzt passieren würde? Er bildete sich doch wohl nicht ein, dass ich ein Pferd sattelte und ihm eine hochkarätige Dressurlektion vorführen würde. Vielleicht noch mit Piaffe und Passage an allen Seiten des Reitplatzes.
Ich verdrehte die Augen. »Ich glaube nicht, dass jemand Ihnen imponieren kann«, behauptete ich. »Sie finden sich doch nur selbst toll.«
Ich beglückwünschte mich dafür, endlich mal eine schlagfertige Antwort parat zu haben. Eigentlich fielen mir solche guten Kontermöglichkeiten erst Stunden später ein. Aber diesmal hatte ich wirklich mal zur rechten Zeit am rechten Ort die passenden Worte gefunden. Ich sah ihm an, dass er überrascht und irgendwie auch beeindruckt war. Offenbar hatte er tatsächlich damit gerechnet, dass ich nichts lieber getan hätte, als ihm mit meinen Reitkünsten zu imponieren. Was für ein Typ! Eingebildet, aufdringlich – und hochgradig von sich selbst überzeugt.
Jetzt drehte ich mich um und ging zum Reitplatz zurück. Dabei war ich allerdings einen Moment unsicher, ihn allein am Stall zurückzulassen. Andererseits – was sollte er dort anstellen? Die Boxen waren leer, die Pferde auf dem Paddock, und die Sattel und das Zaumzeug hatte ich im Blick.
Immer noch kochte mein Blut auf Hochtouren. Ich war auf Touristen angewiesen, das stimmte, aber ich musste mir so eine unverschämte Behandlung nicht gefallen lassen. Wer war ich denn, dass ich brav meine Runden drehte, wenn ein aufgeblasener Schönling mit dem Finger schnippte?
Ich lehnte mich wieder an den Zaun und sah den Pferden zu. 90 Pfund hatte ich bis jetzt durch die Touristen verdient. Es wäre schön, wenn sich noch weitere finden würden. Aber weit und breit war niemand mehr zu sehen.
Vorsichtig drehte ich mich zu der Stelle um, an der ich den Typen zuletzt gesehen hatte. Er war verschwunden. Zunächst war ich erleichtert, dann aber kamen mir Bedenken. Vielleicht hätte ich doch freundlicher zu diesem arroganten Kerl sein sollen. Vielleicht hätte er ja doch eine Geldquelle sein können? Andererseits – wer solche unverschämten Anforderungen stellte, war nur selten bereit, zu zahlen. Schön, eingebildet, reich und geizig. Damit konnte ich meinen Stall nicht sanieren.
Noch eine ganze Weile harrte ich aus, doch dann gab ich mich seufzend geschlagen. Ich brachte die Pferde in den Stall und legte mein mühsam verdientes Geld in die Kasse. Heute würden keine Gäste mehr kommen. Und den unverschämten Kerl hatte ich sicher für immer vergrault.
***
Doch ich hatte mich getäuscht. Als ich am nächsten Tag zum Stall hinunterging, wartete er dort auf mich. Ich schluckte.
Freundlich sein, freundlich sein, beschwor ich mich.
»Hallo«, sagte ich und bemühte mich um ein Lächeln. »Da sind Sie ja wieder.«
Auch er schien sich vorgenommen zu haben, freundlicher zu sein.
»Hallo«, grüßte er zurück und grinste ein wenig verlegen. »Ja, ich bin wieder da.«
Wir musterten einander. Sein Blick war aufmerksamer, irgendwie respektvoller als gestern.
»Tut mir leid, dass wir uns gestern missverstanden haben«, begann er.
Missverstanden? An dem, was er gesagt hatte, war nichts missverständlich gewesen. Aber ich beschloss, mich zurückzuhalten. Er versuchte, versöhnlich zu klingen, und das sollte ich akzeptieren.
»Schon gut«, winkte ich ab. »Was kann ich für Sie tun?«
»Ich bin auf der Suche nach einem guten Reitlehrer«, sagte er.
Na bitte, geht doch!, dachte ich und gratulierte mir insgeheim, dass ich ihn gestern so scharf angegangen war. Ich hatte mir offenbar damit Respekt verschafft. Doch jetzt musste ich vorsichtiger sein und mehr auf ihn eingehen.
»Okay«, meinte ich. »Eine gute Reitlehrerin bin ich.« Dabei war ich selbst erstaunt, wie selbstbewusst ich klang.
Er nickte. Sein Blick hatte etwas Lauerndes. »Ich weiß«, entgegnete er. »Ich habe Sie vorgestern reiten gesehen. Und gestern auch. Sie reiten gut.«
Jetzt war ich überrascht. Er war mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber das war auch kein Wunder. Im Sommer waren viele Menschen am Strand und in den Wäldern unterwegs. Und bei meinen Ausritten musste ich mich immer ganz auf die Gäste konzentrieren.
»Können Sie das beurteilen, wenn ich mit den Touristen über den Strand reite?«, fragte ich verwundert.
Er nickte, schüttelte dann den Kopf. »Ich habe Sie auch gestern auf dem Reitplatz gesehen. Und in der vergangenen Woche waren Sie morgens am Strand und sind durch die Dünen galoppiert. Sie reiten gut.« Er hielt plötzlich inne, als hätte er zu viel gesagt.
Dann beobachtete er mich also schon länger. Ich war unsicher, ob ich mich dadurch geschmeichelt fühlen sollte oder ob es eher unheimlich war.
Sein Gesichtsausdruck wurde für einen kurzen Moment weicher. »Ich kann leider nicht sehr gut reiten«, fügte er hinzu. »Aber ich möchte es verbessern.«
Es schien ihn Überwindung zu kosten, das zuzugeben. Aber das machte ihn ein klitzekleines bisschen sympathisch. Jedenfalls für eine Nanosekunde. Dann hatte er schon wieder diese leicht überhebliche Miene aufgesetzt, die sein Alltagsgesicht zu sein schien. Doch jetzt war ich bereit, ihm eine Chance zu geben. Diese Nanosekunde Unsicherheit hatte den Ausschlag gegeben. Na ja, und das Geld reizte mich zugegebenermaßen auch.
»Ich gebe Ihnen gerne Reitunterricht«, hörte ich mich sagen. »Das mache ich sogar viel lieber, als mit Touristen über den Strand zu reiten.«
Sein Blick fixierte mich. Jetzt wieder kühl und abschätzig.
»Dann könnten wir also ins Geschäft kommen?«, wollte er wissen.
Ehrlich gesagt, hörte sich seine Frage nach Reitunterricht nicht schlecht an. Ich war dringend darauf angewiesen, ein paar Pfund mehr zu verdienen.
»Von mir aus«, sagte ich und bemühte mich, zu lächeln, was gar nicht so leicht war. Er schien eher von der knallharten Sorte zu sein, und ich war nicht besonders gut im Verhandeln.
»Sie kommen für mich allerdings nur in Frage, wenn Sie sich an verschiedene Bedingungen halten«, erklärte er dann.
Ich zuckte die Achseln. Im Grunde hatte ich erwartet, dass es kompliziert wurde. »Bedingungen?«, wiederholte ich. »Und die wären?«
Er zögerte. »Ich möchte in einem Monat so reiten können wie Sie«, erwiderte er.
Beinahe hätte ich laut gelacht. Das hörte sich nach echten Managerkonditionen an. In einem Monat? Fehlte nur noch, dass ich ihm das vertraglich garantieren musste.
Ich musste jetzt vorsichtig im Verhandeln sein. Diese Typen machten schnell einen Rückzieher, wenn man ihnen klarmachte, dass man solche Erwartungen nicht erfüllen konnte.
»Hmm«, gab ich behutsam zurück. »Das kann ich natürlich nicht versprechen. Lernen braucht seine Zeit. Und ich weiß ja gar nicht, wie viel Sie schon können, wie geschickt Sie sich anstellen und wie einfühlsam Sie mit Pferden umgehen.«
Er ließ mich nicht aus den Augen.
»Kennen Sie sich denn mit Pferden aus?«, hakte ich nach.
Er sah nun für einen kurzen Moment in die Ferne. »Mein Großvater hatte einen Bauernhof mit zwei Haflingern«, sagte er. »Auf denen bin ich manchmal geritten.«
Ich wusste nicht, ob das ein Witz sein sollte.
»Und wahrscheinlich haben Sie auf der Kirmes mal mit einem Pferd ein paar Runden gedreht«, fügte ich hinzu.
Nun lachte er. Er sah nett aus, wenn er lachte.
»Ein bisschen mehr war es schon«, meinte er. »Ich war oft bei meinem Großvater und den Haflingern, aber sie hatten ihren eigenen Kopf. Eigentlich machten sie immer nur das, was sie wollten, und nahmen mich dabei mit.«
Jetzt lachten wir beide. »Das ist ein typisches Problem von Haflingern«, erklärte ich. »Sie sind im Grunde die Dackel unter den Pferden.«
Wenn wir über Pferde redeten, kamen wir besser miteinander klar, stellte ich fest.
»Aber im Grunde stehen Sie noch ziemlich am Anfang, oder?«, fragte ich vorsichtig.
Er nickte.
»Dann wird es eine Zeit lang dauern, bis Sie gut reiten können. In einem Monat ist das kaum zu schaffen. Ich kann Ihnen aber versichern, dass ich Ihnen eine Menge beibringen kann«, fügte ich schließlich hinzu.
Ich betrachtete ihn aufmerksam. Das schien ihm als Versprechen zu genügen.
»Das klingt gut«, war er einverstanden. »Es ist wichtig, dass Sie mich ehrgeizig betreuen. Ich will gut sein, und ich muss es schnell lernen. Aber ich kann Ihnen auch versprechen, dass ich mich anstrenge.«
Ob er sich wohl kritisieren lässt, wenn er etwas falsch macht?, schoss es mir durch den Kopf.
Als wenn er meine Gedanken gehört hätte, setzte er hinzu: »Ich lasse mich auch kritisieren und korrigiere mich dann.«
Sein Blick durchbohrte mich fast.
»Also, was ist?«
Ich nickte. »Ich denke, auf diese Bedingung kann ich mich gerade noch einlassen.«
»Es gibt noch weitere«, fuhr er fort.
»Ich habe befürchtet, dass Sie das sagen.« Allmählich bekam ich das Gefühl, dass es sich bei dem Typen um jemanden von der superanstrengenden Sorte handelte. Ein ehrgeiziger Manager, der nicht eher aufgab, bis er alles so ausgehandelt hatte, wie er es wollte. Und es würde nicht einfacher werden, wenn er auf dem Pferd saß.
»Also, was für Bedingungen?«, fragte ich argwöhnisch.
»Ich will in der Zeit Ihr einziger Reitschüler sein«, sagte er.
Plötzlich war ich mir unsicher, ob sich dieser Typ nicht doch eher als Zeitvergeudung entpuppte. Was glaubte er, wovon ich leben sollte?
»Vergessen Sie’s«, lehnte ich verärgert ab. »Ich lebe von den Reitstunden. Wenn Sie einmal am Tag eine Stunde lang ein Pferd reiten –«
»Ich will jeden Tag acht Stunden reiten«, unterbrach er mich.
Acht Stunden? Das war ja lächerlich.
»Nehmen wir mal an, Sie meinten das ernst. Trotzdem kann ich nicht davon leben, dass Sie ein Pferd –«
»Und ich zahle Ihnen das Ausfallhonorar für die Touristen oder anderen Schüler«, warf er ein.
Der hatte echt einen Schuss. Wusste er, was ihn der Spaß kosten würde?
Seine Augen taxierten mich. Mir wurde klar, dass er mehr über mich wusste, als ich gedacht hatte.
Und man musste sich ja nur umsehen.
Natürlich war ihm nicht entgangen, dass sich die Geldscheine hier nicht gerade in Dreierreihen stapelten. Man brauchte nur einen Blick auf das vergammelte Holz der Stalltür zu werfen, auf die abgewetzten Sattel der Pferde, auf mein eigenes Outfit … Aber wusste der Typ auch, dass ich die Reitschule allein betrieb? Wusste er, dass ich jeden Tag um den Hof und alles, was mir etwas bedeutete, kämpfen musste? Dass ich so von Maurice bedrängt wurde, dass ich nicht mehr wusste, wie ich das alles irgendwie noch retten sollte?
Auf keinen Fall wollte ich, dass er das von mir erfuhr. Er sollte mich selbstbewusst, mutig und vor allem verhandlungsstark erleben.
»Okayyyy«, sagte ich und zwang mich, ihm standhaft in die Augen zu blicken. »Was zahlen Sie also?«
Mein Herz klopfte. Hoffentlich spürte er nicht, wie aufgeregt ich war. Doch keine Chance. An dieser Klarheit, mit der er mich beobachtete, konnte ich erkennen, dass er tatsächlich mehr wusste, als mir lieb sein konnte.
»Sie verlangen 30 Pfund für eine Stunde Strandreiten. Wenn ich Sie acht Stunden in Anspruch nehme, sind das 240 Pfund. Außerdem werde ich in den Stunden alle fünf Pferde beanspruchen. Das sind 1.200 Pfund.«
»1.200 Pfund«, wiederholte ich murmelnd. Ich hätte mich am liebsten gegen den Zaun gelehnt. Wollte er das tatsächlich jeden Tag zahlen? Das musste ein schlechter Scherz sein. So viel verdiente ich manchmal noch nicht mal im Monat.
»Jeden Tag?«, fragte ich nach. Ich hörte selbst, wie piepsig und gequetscht meine Stimme klang. Bei solchen Summen blieben mir die Vorsätze für knallharte Verhandlungen im Halse stecken. Wahrscheinlich sah ich jetzt ganz fassungslos aus, denn er lächelte ein wenig mitleidig.
»Einen Monat lang«, fügte er hinzu.
Seine Augen wurden ganz schmal. Er ahnte, dass mir schwindelig wurde. So viel Geld hatte mir noch nie jemand geboten. Plötzlich kamen mir Zweifel. Stimmte das auch, was er mir anbot? Wollte er vielleicht etwas ganz anderes als nur Reitstunden?
Er schien meine Gedanken zu durchschauen, denn er grinste plötzlich wissend. Und immer noch auf diese herablassende Art. Jetzt ärgerte ich mich wahnsinnig. Er wusste genau, dass ich auf sein Geld angewiesen war. Das brachte mich plötzlich in diese Situation, dass ich mir Unverschämtheiten wie seine gefallen lassen musste. Insgeheim verfluchte ich Maurice dafür, dass er mich in diese Situation gebracht hatte.
Als ob er auch meinen wachsenden Unmut gespürt hätte, schlug der Kerl nun einen versöhnlicheren Ton an. Offenbar war ihm auch daran gelegen, es sich nicht mit mir zu verscherzen.
»Keine Angst, ich will nichts weiter von Ihnen«, sagte er und lächelte ein Prinz-Charming-Lächeln. »Ich will nur gut reiten können. Ehrenwort. Dressur, Hindernisspringen, Geländesicherheit. Mehr nicht.«
Mehr nicht! Es hörte sich so an, als wenn er es ehrlich meinte. Ich atmete erleichtert aus.
»Ist das okay für Sie?«, fragte er.
»Ich denke schon«, stieß ich hervor.
Er nickte. »Ich komme morgens um acht, und um sechs Uhr verschwinde ich wieder. Okay?«
Es sah aus, als wenn er es ernst meinte. Ich konnte es kaum glauben und atmete tief durch.
»Kein Problem«, meinte ich schließlich. »Wenn Sie das aushalten. Es ist ganz schön anstrengend, acht Stunden auf dem Pferd zu sitzen.«
Er nickte. »Das krieg ich hin«, versicherte er mir.
Natürlich! So selbstbewusst, wie der war, kriegte der alles hin. Wie konnte ich mir anmaßen, daran zu zweifeln.
»Also dann, abgemacht«, sagte ich. Einen Moment lang überlegte ich, ihm die Hand entgegenzustrecken, doch er hatte seine in der Tasche seiner Jeans vergraben und sah nicht aus, als wenn er an einer Berührung mit mir interessiert wäre.
»Sie kriegen jetzt einen Vorschuss, nach zwei Wochen die Hälfte und am Ende den Rest«, schlug er vor. »Einverstanden?«
Das war so verdammt viel Geld, mehr, als ich mit allen durchgeknallten Touristen der Welt verdienen konnte.
»Wow. Klar. Natürlich«, sagte ich sofort.
Jetzt sah er mir streng ins Gesicht.
»Ich habe noch eine letzte Bedingung«, meinte er.
Natürlich. Wie hatte ich so naiv sein können, zu glauben, dass das alles war?
Sein Blick war durchdringend. »Dies hier ist ein ganz klares dienstliches Verhältnis. Ich lerne reiten, und Sie geben mir Unterricht.«
»Natürlich.«
»Sie stellen keine persönlichen Fragen, und Sie machen auch keine Fotos oder Filme von mir wie bei den ganzen Touristen, die hier so antanzen.«
Vor Erleichterung lachte ich auf. Als wenn ich Interesse an einem Foto von diesem Typen hätte! Oh Mann.
»Das ist in Ordnung«, erwiderte ich, und am liebsten hätte ich noch gesagt: Das ist wirklich das geringste Problem, was ich habe.
»Also einverstanden«, sagte er zufrieden. »Dann komme ich morgen zum ersten Reitunterricht.«
»Alles klar«, gab ich nur zurück.
Er nickte mir noch einmal zu, drehte sich dann um und ging. Und ich ließ mich schwer gegen den Zaun sinken und atmete tief ein und aus. Ich hatte schon viele verrückte Menschen erlebt, aber dieser war der Durchgeknallteste, der mir bislang in meinem Leben begegnet war.
Abends tat mir mein Versprechen fast schon wieder leid. Meine beste Freundin Ruby kam nämlich vorbei. Sie arbeitete im Teahouse Cottage in Newport. Dienstags hatte sie immer frei, und das war der Tag, an dem wir uns in Freds Pub niederließen, um zu schwatzen, oft bis spät in die Nacht.
Ruby war frisch verliebt, sie wusste es nur noch nicht. Aber ich konnte es sofort an ihrem Gesicht ablesen, denn ihre grünen Augen funkelten hinter ihren Brillengläsern wie glänzende Saphire. In aller Ausführlichkeit erzählte sie die neuesten Übeltaten von Matthew, ihrem Chef. Ich hatte von Anfang an gewusst, dass zwischen den beiden eine ganz besondere Energie herrschte, nur hatte die sich bisher eher in Reibereien entladen. Das schien sich nun langsam zu verändern.
»Meist war er ja nicht auszuhalten«, vertraute sie mir an. »Aber allmählich kriegt er das Prädikat Erträglich«, fügte sie mit einem schelmischen Lächeln hinzu.
»Das hört sich gut an«, bestätigte ich. »Eigentlich sogar ziemlich spannend.«
Ruby grinste. »Spannend wäre es, wenn ich ihn erwürgt und im Garten unter den Pflanzen des Assam-Tees verbuddelt hätte …«
Ich musste lachen. »Aber das machst du natürlich nicht, weil so viel böses Blut den Pflanzen schaden würde«, ergänzte ich.
»Exakt!« Ruby grinste. »Und du weißt, wie mir unser Tee am Herzen liegt.«
Wir prusteten beide los. Ruby war als Kaffeetrinkerin nicht unbedingt aus Überzeugung in diesem Teehaus gelandet, aber sie arrangierte sich. Vor allem offenbar mit ihrem Chef.
»Und wie geht es dir?«, wollte sie wissen.
»Nichts Neues«, behauptete ich. »Ich habe Maurice auch noch nicht ermordet.«
»Aber auch bei dir wäre Handlungsbedarf angebracht«, stellte Ruby amüsiert fest.
»Wir sollten zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und beide auf einmal um die Ecke bringen«, witzelte ich.
So redeten wir eine Weile hin und her. Zu gerne hätte ich ihr jetzt von dem Unbekannten und der wahnsinnigen Summe Geld erzählt. Aber ich sagte Ruby nichts und fühlte mich deshalb ein bisschen schlecht. Allerdings wusste ich auch, dass sich Ruby genauso verhalten hätte. An Versprechen, und seien es auch die idiotischsten, hatten wir uns immer gehalten.
Kapitel 3
Ich hatte bis zuletzt gezweifelt, ob er kommen würde. Aber er kam pünktlich um acht Uhr und parkte seinen silbernen E-Roller neben meinem rosafarbenen. Dann stieg er ab. Wie alle leichtsinnigen Rollerfahrer der Insel hatte er keinen Helm auf. Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Reithose und braune Stiefeletten – schlicht und irgendwie gut aussehend. Und er schien sich vorgenommen zu haben, nett zu sein – jedenfalls so nett, wie es ihm bei seiner leicht herablassenden Art möglich war.
»Da bin ich«, sagte er.
»Freut mich«, meinte ich und streckte ihm die Hand entgegen. »Ich bin übrigens Nele Schumacher …«
Er wich einen Schritt zurück und machte ein Gesicht, als wenn er sagen würde, dass ihm das jetzt alles viel zu persönlich wäre, darum lenkte ich schnell ein. »Nur für den Fall, dass Sie mich anreden möchten.«
Entweder nahm er die Ironie nicht wahr, oder er wollte sie nicht bemerken. Jedenfalls nickte er nur kurz.
»Colin Porter«, sagte er dann.
Er zögerte. Dann reichte er mir tatsächlich die Hand. Es fühlte sich kühl und distanziert an. Wieder war da dieser durchdringende Blick. Mir fiel erst jetzt auf, dass seine Augen leuchtend grün waren. So grün wie die von Ruby.
Sind Sie Amerikaner?, wollte ich erst fragen, aber Gott sei Dank fiel mir rechtzeitig ein, dass er ja keine persönlichen Fragen wünschte. Und eine Frage nach der Herkunft war auf alle Fälle viel zu privat. Darum biss ich mir schnell auf die Lippen und verkniff mir jede persönliche Äußerung.
Jetzt setzte er den Rucksack ab, den er über die Schultern gehängt hatte, öffnete ihn und zog eine Mappe heraus, in der sich einige DIN-A4-Blätter befanden.
»Ich habe einen Vertrag vorbereitet«, meinte er und reichte mir die Mappe. »Hier, lesen Sie ihn sich in Ruhe durch. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie.« Er machte ein Gesicht, als wenn es ihm nicht besonders passen würde, wenn ich Einwände hätte. »Ansonsten unterschreiben Sie. Danach erhalten Sie den ersten Vorschuss.«
Das klang alles ziemlich mysteriös und erinnerte mich an einen schlechten Krimi. Aber natürlich war ich auch an einem Vertrag interessiert, schließlich brachte mir nur der das heiß ersehnte Geld. Also wollte ich das Spiel mitspielen.
»Alles klar, danke«, reagierte ich so gelassen wie möglich.
Ich nahm den Vertrag mit zur Sattelkammer hinüber, in der sich auch ein kleiner Tisch und zwei Stühle befanden. Porter folgte mir nicht. Lässig lehnte er am Zaun und betrachtete die Pferde nachdenklich. In der Zwischenzeit las ich mich so konzentriert, wie es mir möglich war, durch den Vertrag. Er enthielt genau das, was wir verabredet hatten: ein Monat Reitunterricht à acht Stunden, 1.200 Pfund täglich, keine persönlichen Gespräche, keine Fotos. Es gab nichts Kleingedrucktes, keine mehrdeutigen Formulierungen, alles war klar und einfach ausgedrückt. Es war ein Leichtes für mich, den Vertrag zu unterschreiben.
Als der Typ sah, dass ich nach einem Stift suchte, kam er zu mir.
»Alles in Ordnung so weit?«, fragte er.
»Ja, wunderbar«, antwortete ich. Unruhig wühlte ich nach einem Kuli, der schrieb, probierte drei aus, die bereits nach den ersten Buchstaben versagten, und fand endlich einen vierten, der funktionierte. Er sah zu, wie ich Ort, Datum und Unterschrift auf die vorgezeichnete Zeile setzte, gab mir dann eine Kopie, die ich ebenfalls unterzeichnete und für mich behalten konnte. Die durchdringende Art, wie er mich dabei beobachtete, führte dazu, dass meine Hand zitterte. Ich ärgerte mich darüber, denn ich wusste genau, dass er es bemerkt hatte.
Lässig reichte mir Porter den Vorschuss, zählte einen Geldschein nach dem anderen auf den Tisch. Ich wollte nicht nachzählen, aber er bestand darauf. So viel Geld hatte ich schon lange nicht mehr auf einen Schlag in der Hand gehalten.
»Danke«, murmelte ich, nahm die Scheine und ging damit in die Sattelkammer hinüber, um sie in meine Geldkassette zu stecken. Als ich zurückkam, lehnte er an der Wand der Stallgasse und wartete.
»Kommen Sie«, forderte ich ihn auf und zeigte auf die Pferde, die noch im Stall standen. Er kam mit mir. Vor Fees Box hielt ich an.
Ich hatte beschlossen, meine Reitstunden mit ihr zu beginnen. Sie war das schönste und sanfteste Pferd, das ich hatte, mein Liebling und gleichzeitig das Pferd, das am besten ausgebildet war. Wenn er sie ritt, konnte ich mir ein gutes Bild von seinen Fähigkeiten machen.
»Für den Anfang nehmen wir Fee«, schlug ich vor.
Er warf einen Blick in die Box. »Die isabellfarbene Stute?«, fragte er.
Dann verstand er also tatsächlich was von Pferden. Einen Moment starrte ich ihn nur an. Er grinste amüsiert. Ob er wohl mitgekriegt hatte, wie sehr mich die Naivität der Touristen oft nervte?
»Genau«, bestätigte ich. Dann zeigte ich auf die Sattelkammer, in der Fees Sattel und das Zaumzeug hingen. »Können Sie satteln und trensen?«
»Ich bin nicht sicher, ob ich es noch kann«, gestand er ehrlich. »Aber ich versuche es mal, und Sie helfen mir, wenn ich nicht weiterweiß, okay?«
»Alles klar.«
Auch damit unterschied er sich von allen anderen Reitschülern. Eigentlich war es immer meine Aufgabe gewesen, den Touristen alles abzunehmen, damit sie nur noch auf den Pferderücken steigen und losreiten konnten. Und oft konnten sie noch nicht mal das ohne meine Hilfe. Jetzt also hatte ich offenbar tatsächlich jemanden an meiner Seite, der alles von Anfang an lernen wollte. Das war eine riesige Erleichterung.
Ich zeigte ihm, wo der Sattel und das Zaumzeug hingen, und ließ ihn machen. Dabei bemühte ich mich, ihn nicht so auffällig zu kontrollieren, schaute nur immer mal wieder kurz zu ihm, während ich außerdem die anderen Pferde auf den Paddock brachte.
Er legte den Sattel an die richtige Stelle, zog dann den Bauchgurt fest.
»Lassen Sie ihn noch locker«, riet ich ihm. »Wir gurten nachher nach.«
Mit der zweigeteilten Trense verknotete er sich, legte sie so, dass sie über Fees Augen lag, und traute sich dann nicht, ihr das Gebiss in den Mund zu schieben. Ich musste lachen, als ich sah, wie ratlos mich Fee und er anschauten.
»Ich helfe Ihnen mal«, schlug ich vor.
Dann zeigte ich ihm, wie man es umlegte und wie man ein Pferd dazu kriegte, das Maul zu öffnen, damit es die Trense annahm. Er beobachtete mich genau, machte es dann nach. Es war toll, dass er so schnell lernte. Kurze Zeit später stand Fee gesattelt und getrenst neben ihm. Er strich ihr kurz durch die Mähne. Dabei sah er für einen Augenblick richtig freundlich aus, fast liebevoll gegenüber der Stute.
»Was sind das für Pferde?«, wollte er wissen.
»Mangalarga Marchadores«, erklärte ich. »Sie sind bei uns in Europa nicht sehr bekannt. Es sind ganz besondere Pferde, aber das werden Sie noch bemerken.«
Er sah Fee voller Respekt an. Auch das kannte ich von den Touristen nicht. Es gefiel mir, dass er so ein großes Interesse an den Pferden hatte.
»Auch der gescheckte Wallach und die weiße Stute mit der schwarzen Mähne sind Mangalarga Marchadores. Die anderen beiden sind englische Galopper.«
Er sah nun zu Chief und Rainman und nickte.
»Vollblutpferde, nicht wahr? Sie laufen Pferderennen, oder?«
»Das stimmt«, erwiderte ich. »Woher wissen Sie das?«
Er zögerte einen Moment.
Ups, war diese Frage schon wieder zu privat? Ich schaute ihn besorgt an. Aber er zuckte die Achseln.
»Nur aus Büchern. Ich bin noch nie welche geritten«, sagte er.
»Ich mag sie sehr gerne«, berichtete ich. »Sie sind ein wenig nervös, aber sie haben einen unglaublich schönen Galopp.« Es schien ihn zu interessieren, was ich sagte. »Die Marchadores sind ruhiger und ausgeglichener. Wissen Sie, dass sie neben Trab und Galopp noch einen ganz besonderen Gang haben?«
»Nein, keine Ahnung. Was anderes als Schritt, Trab und Galopp? Tölt vielleicht?«
Er verstand offenbar tatsächlich ein bisschen was von Pferden. Trotzdem war es nicht richtig. »So ähnlich wie Tölt. Man nennt es Marcha.«