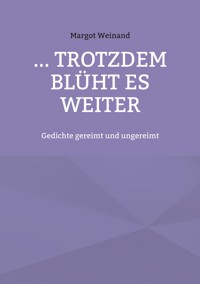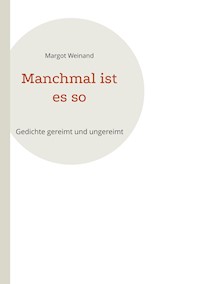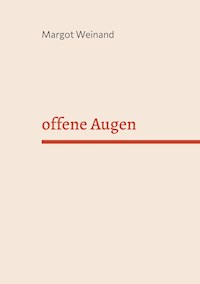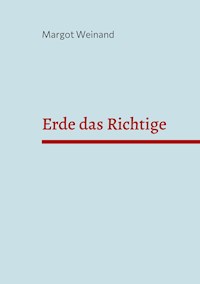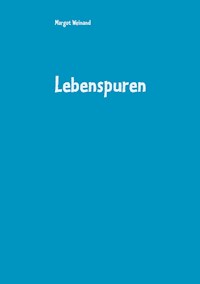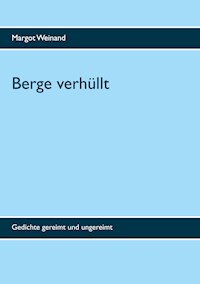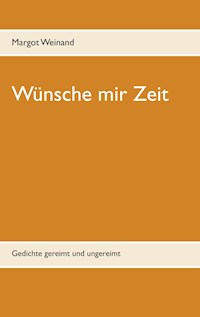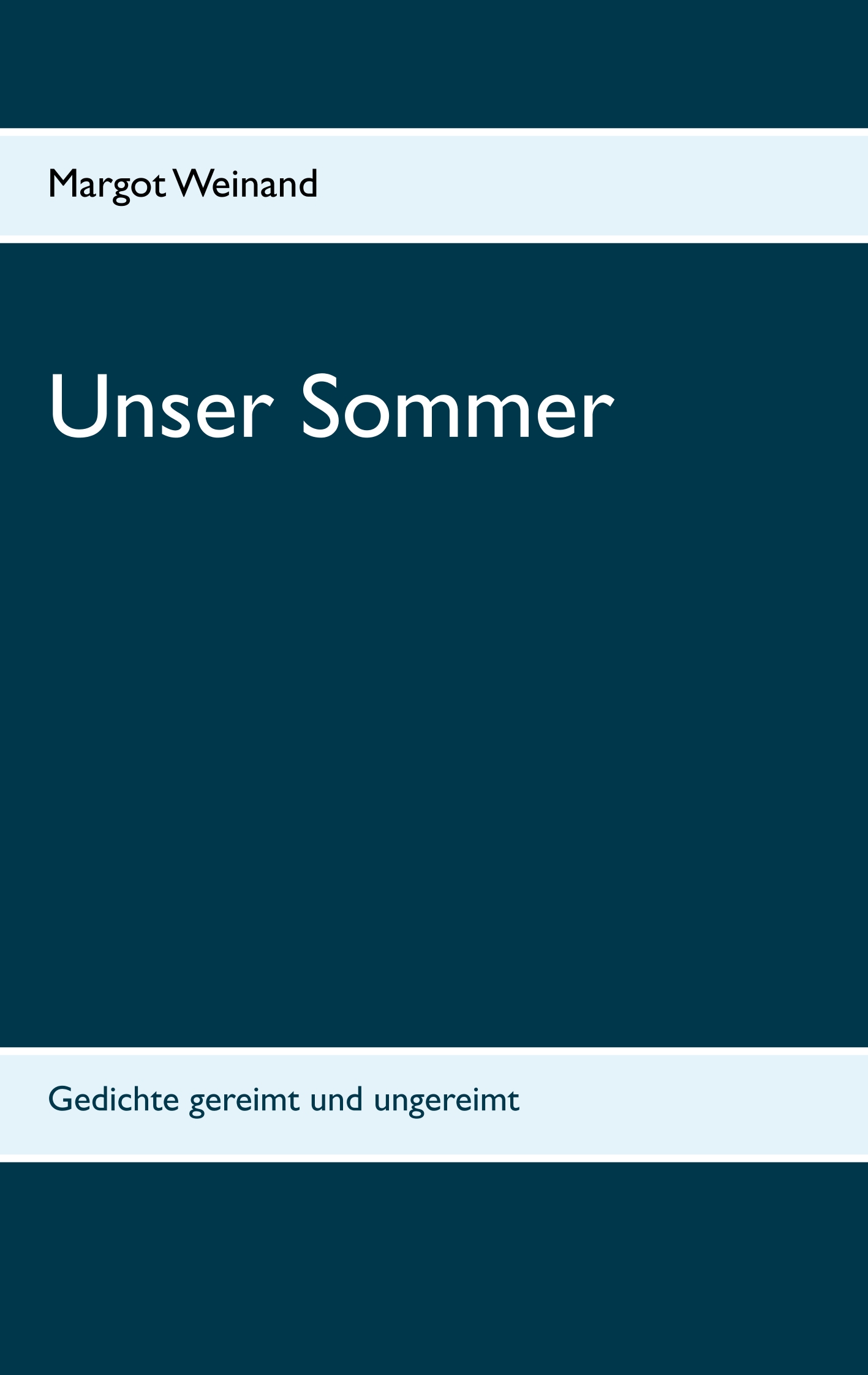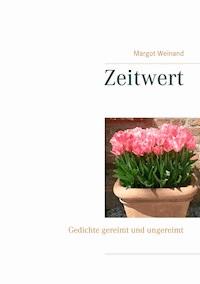Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Es beginnt mit einer Kindheit im Krieg: Da ist die Freude auf Weihnachten, die Angst vor Bomben und die Trauer darüber, während der „Kinderlandverschickung“ von den Eltern getrennt zu sein. Dann das Glück, mit der Familie wiedervereint zu sein, auch wenn die Not groß ist und selbst die Kinder Steine klopfen müssen. In solchen Zeiten ist für ein junges Mädchen keine Ausbildung vorgesehen, doch die Autorin geht ihren Weg und findet schließlich zu ihrer Berufung – als Leiterin der „Kinderheimat“ in Neukirchen. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren eigenen beiden Kindern stellt sie ihr Leben in den Dienst von Jugendlichen, die Halt und Orientierung brauchen. In ihrer Autobiographie blickt Margot Weinand zurück auf ihre Kindheit, Beruf und Reisen, den Schlaganfall ihres Mannes und ihre eigene Krankheit. Halt in schwierigen Zeiten findet sie in ihrem Glauben, ihrer Familie und in ihrem Hobby, dem Schreiben. Das Ergebnis ihrer Schreib-Leidenschaft sind viele Gedichte, die mit den Lebenserinnerungen veröffentlicht werden – ebenso wie die dankbaren Erinnerungen einiger ihrer ehemaligen Schützlinge aus der „Kinderheimat“.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Danksagungen für die Begleitung zu meiner Autobiographie
Vorwort
Weihnachten 1942, Krieg seit 1939
Kinderlandverschickung
Weihnachten 1944 – Kriegsende – Rückführung nach Essen
Schulabschluss 1947 – Konfirmation
Selbstständig, klein, aber fein
Berufsveränderung
Unvergessene Gedanken an meine Mutter
Katjas Einschulung
Berufung zur Heimleiterin
Tagebuchaufzeichnungen vom 3. 1. 1993 bis 25. 12. 1994
Jubiläumsfeier
In den wohlverdienten Ruhestand, aber was geschah dann?
Es ist des Festhaltens wert
Schiffsreisen Holland, Belgien, Österreich, Ungarn und Tschechien. Das Schiff Katharina von Bora
Erzählungen von Landausflügen verschiedener Schiffsfahrten
Landausflug zum Elbsandsteingebirge und Dresden
Herbstreise mit dem Auto zur nördlichsten Insel des Landes
Rückwärts schauen im Überblick
Meine dritte Lebensphase
Grußworte
Überblick über unsere Arbeit mit den Jugendlichen
Ein Wort zur Nachbarschaft
Kronenkreuz
Berichte der ehemaligen Heimkinder
Erinnerung an meinen Mann zum Gedenken:
Mein Leben als Witwe mit einer Spinalkanalstenose
Meine Zeit im Krankenhaus und Kurzzeitpflege
Einladung zur Kinderheimat, zur Christusgemeinde und zurück in meine Wohnung
Mein Leben in Kohlstetten
Tagebucheintragungen vom 9. 11. 2015–15. 4. 2016
Mein 83. Geburtstag
Meine Sommerreise 2016
Letzte Zusammenfassung
Danksagungen für die Begleitung zu meiner Autobiographie
Mein besonderer Dank gilt Frau Utta Goerlich. Sie war geduldig, verständnisvoll und immer wieder unterstützend. Mit Klarheit und Sorgfalt hat sie mich und mein Buchprojekt auf wunderbare Weise begleitet. Ihre Kommentare zu meinem Manuskript waren mir sehr willkommen. Durch sie fand ich oft die richtigen Formulierungen.
Frau Utta Goerlich hat sehr zu dem Entstehen meiner Autobiographie beigetragen.
Herzlichen Dank an meine Kinder Katja und Markus.
Katja ist die eigentliche Urheberin des Gedankens, mich überhaupt an meine Autobiographie heranzuwagen. Sie hat mich immer wieder motiviert, wenn ich einen Durchhänger hatte. Sie hat mir in ihrer ruhigen und lieben Art einen Anstoß gegeben. Sie hat auch einen großen Anteil daran, dass ich immer wieder die nötige Ruhe haben konnte.
Markus hat, wie schon in früheren Zeiten, bei den Gedicht-Bänden, auch bei der Autobiographie die Technik des Druckens übernommen. Auch er hat mir mit ruhigen, stärkenden, zusprechenden Worten beigestanden, wenn das in der Länge der Zeit nötig geworden ist. Die Zusammenarbeit mit ihm hat mir genau wie in früheren Zeiten Freude bereitet.
Gleichzeitig danken möchte ich meiner Therapeutin Tatjana Hagg, denn sie half mir in vielen technischen Fragen. Die Vorgehensweisen mit meinem Computer musste ich mir erst aneignen. Außerdem hat sie mich bei der Schilderung meines Krankheitsbildes unterstützt und gestärkt.
Meinen Dank schulde ich auch meiner Familie, die gerne und oft mit mir über das Buch gesprochen hat. Sie hat mich, wenn ich ihren Rat brauchte, stets in liebevoller Weise unterstützt und dann auch den Weg in die richtige Richtung gewiesen.
Ich danke auch meinen Freunden und Freundinnen hier auf der Alb und am Niederrhein, die durchgehalten haben, mir in der Auseinandersetzung mit meinem Leben beizustehen.
Eine wichtige Person in meinem Leben ist meine Freundin Vera, wir sind gleichaltrig und befreundet seit unserem achtzehnten Lebensjahr. Wir haben einander nie aus den Augen verloren. Wir hatten hin und wieder sporadisch, dann wieder engeren Austausch und engere Begegnungen. Besonders intensiv sind nach der Jugendzeit die letzten fünfundzwanzig Jahre. Vera konnte, weil sie so viel aus meinem Leben wusste, gewisse Erinnerungslücken füllen. Mit ihr zusammen hat mir das Schreiben besondere Freude gemacht. Wir bedauern es sehr, dass wir uns seit drei Jahren wegen der räumlichen Trennung immer nur einmal im Jahr bei meiner Sommerreise nach Neukirchen sehen können. Aber wir haben die Möglichkeit zu telefonieren und nutzen dies immer wieder – mal mehr, mal weniger – aus. Wir hoffen, dass uns das auch noch einige Jahre geschenkt wird.
Falls dieses Buch Fehler enthält, so ist das allein meine Schuld. Falls ich vergessen habe, mich bei jemand zu bedanken, so entschuldige ich mich dafür.
Vorwort
Seit 1999 lebe ich im Ruhestand. Die viele gewonnene Zeit hat mich dazu gebracht, Gedichte und kurze Erzählungen zu schreiben, die auch anderen Freude bereitet haben. Jetzt lebe ich bei meiner Tochter auf der Schwäbischen Alb. Katja ist eigentlich die Urheberin des Gedankens, dass ich einmal mehr schreiben sollte. Sie kennt viele meiner Gedichte und meinte: »Mutter, schreib doch einmal einen Roman.« Dazu hat es noch nicht gereicht, aber eine Autobiographie liegt jetzt vor.
Ich bin eine vierundachtzigjährige Witwe mit einem großen Erinnerungsschatz und will als Zeugin erzählen von einer Zeit, die sich in den letzten achtzig Jahren rasant verändert hat. Ich möchte darüber berichten, wie innerhalb der deutschen Geschichte mein Leben sich gestaltete.
1933 geboren, bekam ich von der Entwicklung unseres Landes bis zum Ausbruch des Krieges im September 1939 wenig mit. Von der Einweisung in die Volksschule auf der Beisingstraße an spürte ich den begonnenen Krieg. Erlebte Fliegeralarm, Luftschutzkeller und Hochbunker, musste infolgedessen Unterrichtsausfälle in Kauf nehmen. Das Gedicht »Kinderspiele im Krieg« habe ich geschrieben, um aufzuzeigen, wie wir als Kinder Spielzeug suchten und fanden. Die Bombensplitter, ein Zeichen von Gewalt und Zerstörung, hatten in uns Sammlerfreude geweckt, denn Spielzeug gab es zu der Zeit kaum. Es gab keine Lehrer und keine Schulen. In Rollenspielen haben wir unsere Ängste abgebaut.
Durch die von der NSDAP ins Leben gerufene »Kinderlandverschickung« kam ich, mit meinen zwei jüngeren Geschwistern Ilse und Klaus, nach Vorpommern. Wir wurden im gleichen Dorf zu Pflegefamilien gebracht. Ilse wurde dort eingeschult. Nach kurzer Zeit wurden wir, wegen politischer Unruhen im Osten, von unserer Mutter nach Essen zurückgeholt. Dort erlebten wir die beiden schweren Bombenangriffe vom 5. auf den 6. März und vom 12. auf den 13. März 1943. Es war das Bombeninferno über Essen. An einen geregelten Schulbesuch war nicht mehr zu denken, so wurden wir in ein weniger bedrohtes Gebiet ins Allgäu, zwischen Kempten und Immenstadt, verschickt. Wir drei Geschwister wurden auch diesmal getrennt, konnten aber zusammen in einem Dorf »Bräunlings« wieder bei Pflegefamilien unterkommen. Im nahegelegenen Dorf »Stein« befand sich die Dorfschule, in der Klaus jetzt eingeschult wurde. Somit wurden wir drei vom 1., 2. und 4. Schuljahr in einem Klassenraum unterrichtet.
In den Sommerferien 1944 fuhren wir nach Essen, um mit unseren zwei kleineren Geschwistern Bernd und Jürgen die Sommerferien zu verbringen.
Weil ich in dieser Ferienzeit an Gürtelrose erkrankte, fuhren wir nicht zurück ins Allgäu. Im Dezember 1944 mussten wir, um dem Bombenhagel zu entkommen, die Stadt Essen verlassen. Vater war inzwischen als Soldat eingezogen worden, so fuhr unsere Mutter mit uns fünf Kindern mit dem letzten Evakuierungstransport in Richtung Baden-Württemberg. Im Kriegsjahr 1944 näherten sich die Fronten der alliierten Streitkräfte den Grenzen unseres Landes. Wir erlebten die Besatzung durch die französischen Siegermächte.
Wir spielten Krieg, echte Panzer, und keiner hat geschossen. In Rollenspielen nahmen wir einander gefangen und sperrten einander gegenseitig ein. Von farbigen Soldaten bekamen wir im Stahlhelm Schokolade und Würfelzucker. Dann der 8. Mai, ein wunderbarer Sonnentag. Vater, der in russische Gefangenschaft gekommen war, floh, wurde versteckt und wurde gefunden, kam dann in die französische Gefangenschaft und wurde von dort krank entlassen.
Mit späterer Rückführung unseres Vaters nach Essen durchlief er alle Instanzen der Entnazifizierung. Bald danach folgte die gesamte Familie. Allerdings in eine Wohnung im Trümmerfeld unserer Heimatstadt Essen. Nach 5 Jahren lebten wir als Familie alle sieben Personen wieder in einer Wohnung zusammen. Ein Glück, das wir alle mit Freuden festhielten.
Im März 1947 wurde ich aus der achten Volksschulklasse mit dreizehn Jahren nach vollendeter Schulpflicht entlassen. Es folgte das soziale Pflichtjahr, Steine-Klopfen, Trümmerbeseitigung, Hamsterfahrten und Tauschhandel durch ganz Deutschland. Wiederaufbau, Währungsreform und Wirtschaftswunder.
Ausbildung als Verkäuferin bei Kaiser᾽s Kaffee. Weiterbildung Stenografie –Schreibmaschine, zeitgleich ein Anlernvertrag als Telefonistin, Fernschreiberin und Kontoristin. Danach in die Selbstständigkeit in Schreib- & Spielwaren, fünfzehn Jahre lang. Zeitgleich Heirat, Familiengründung, Umschulung und Berufung in die Jugendhilfe. Heimerzieherinnen wurden dringend gesucht, Fachschulen für diesen Beruf gab es viele. Es wurde im März 1972 beschlossen, die gesetzliche Volljährigkeit von 21 auf 18 zu senken. In den Heimen lebten überwiegend Frauen mitunter bis 21 Jahre und drüber. Die Bewerberinnen für diesen Beruf waren nicht viel älter. Es galt zu überlegen, wer erzieht wen? Ich war damals, 1970, dem Aufruf der Presse gefolgt, den Beruf der Heimerzieherin zu erlernen, war damals 37 Jahre, ein Alter, in dem man gerne wieder die Veränderung liebt. Nach langen Überlegungen hatten wir es beschlossen, in diese Veränderung einzusteigen. Nach meiner Ausbildung sind wir als Familie in die Arbeit eines Kinderheimes eingestiegen. Erst ich als Praktikantin und dann weiter mit der ganzen Familie in einer Fortführungsgruppe, die 1973 begann. Die Jugendhilfe, die um diese Zeit viele Veränderungen mitgemacht hat, hat sehr viel leisten müssen.
Zwölf Jahre vor meinem Ruhestand wurde ich als Heimleiterin berufen. In dieser Position habe ich oft erlebt, dass Kinder und Jugendliche die Biografie ihrer Eltern schrieben. Dennoch gelang es Einzelnen, diesen Kreis zu durchbrechen. Mit großer Freude, viel Veränderung und viel Kraft waren wir bis 1998 in dieser Arbeit. Im Ruhestand haben mein Mann und ich, solange wir noch in der Lage waren, Reisen unternommen. Nach dem Tode meines Mannes wurde ich krank und musste deshalb lange Zeit zu Hause gepflegt werden.
Durch eine Kette glücklicher Umstände konnte ich im Dezember 2014 zu meiner Tochter auf die Schwäbische Alb ziehen. Dort habe ich im Hause ihrer Familie eine kleine Wohnung. Meine Tochter übernimmt seit dieser Zeit die nötig gewordene Pflege und kümmert sich in liebevoller Weise um meine Bedürfnisse.
Ich erfahre viele Zuwendungen, die mir guttun. Seit meiner Jugend habe ich versucht, nach christlichem Glauben zu leben. Ich blicke heute mit meinen vierundachtzig Jahren zurück auf eine Zeit, die vom lebendigen Glauben an Jesus Christus und Gott, unseren himmlischen Vater, erfüllt war und ist. Hin und wieder wird das in meiner Autobiographie deutlich. Ich danke Gott für meine Lebensführung zu allen Zeiten. Besonderen Dank für die fünfundzwanzig Jahre in der Kinderheimat. Bis heute hält die Verbindung zu einigen meiner früheren Knaben, Burschen und Jungens, die mittlerweile auch schon ein Alter erreicht haben, das sich sehen lassen kann. Wir sind bis heute in Kohlstetten durch E-Mail, Telefon, Word-App und Post verbunden. Auch darüber steht einiges in meiner Autobiographie.
Ich wünsche Ihnen beim Lesen meines Buches die gleiche Freude, wie ich sie beim Schreiben hatte. Namen und Orte in den Erzählungen habe ich hin und wieder geändert.
Mit Ihrem Verständnis rechnend, verbleibe ich
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Margot Weinand
Überblick der Schilderung:
Kindheit und Jugend
Ausbildung – Berufstätigkeit
Frau und Mutter
Ruhestand – Autorin
Erster Guss
Profil
Messerscharfe Formen entstehen
Auf deren Spuren leichter gehen
Sie sind nie so glatt wie rauer Stein
Weil Erdenhaftung sinnvoll soll sein
Höhen und Tiefen, Schatten und Licht
Diesen Eindruck man niemals vergisst
Habt Mut, Spuren zu hinterlassen
Sinnvoll Einzelner kann erfassen
Durch rechtes Profil auch Haftung greift
Werden viele zum Leben befreit
Haben die Jahreswende im Blick
Dann zählt für uns jeder Augenblick
Bis zur Wende der tausend Jahre
Viel verändert in Wochentagen
Die Zeit wird eng, die wir durchleben
Werden geprägt, das Ziel erstreben
Wenn einer da ist, dem durch Profil
Dynamik entstand, Liebe und Spiel
Wir brauchen Menschen, die mit Profil
Erdenhaftung haben für ein Ziel
»Einen Sonntag im Pyjama wünsch ich mir«, dieser Schlager klingt mir oft in den Ohren. Einmal richtig abschalten und die Gedanken wandern lassen. Sie gehen weit zurück. Dabei wundere ich mich und staune, was da alles noch gespeichert ist. Vieles habe ich sehr klar vor Augen. Deshalb möchte ich mit diesem Schreiben nicht nur meiner Familie etwas hinterlassen, sondern will auch anderen als Zeuge einer Zeit erzählen, die sich in den achtzig Jahren rasant verändert hat. Eine Erklärung: Meine Eltern habe ich immer mit Papa und Mutti angeredet, werde in dieser Autobiographie stets bei Vater und Mutter bleiben.
Zu meiner jetzigen Situation. Das Wir kann ich leider nicht mehr sagen, weil mein lieber Mann vor mir gehen musste, aber die Erinnerung leuchtet. Das ist ein Trost, der mich hält. Meinen Beruf als Erzieherin habe ich geliebt: Seit 1999 lebe ich im Ruhestand, der hat mich dann zum Schreiben von Gedichten und kurzen Erzählungen gebracht, die auch anderen Freude bereitet haben. Jetzt lebe ich bei meiner Tochter auf der Schwäbischen Alb. Freunde haben mich angeregt, mehr, am besten meine Autobiographie zu schreiben. Alles festzuhalten, sehe ich als schwierig an, aber ich werde es versuchen und nun auch gleich anfangen. Mein Leben planen zu können, dazu fehlt mir jene Energie, die meine Kinder bei ihrem Auszug mitgenommen haben. Ich wage mich an etwas heran, woran ich im Grunde nie gedacht und was ich auch noch nie gemacht habe. Ich sehe eine Autobiographie als eine Vorstufe eines Romans.
Wenn mein Lebensalter nicht reicht, dann reicht es dazu, etwas für meine Familie, Freundinnen und Freunde zu hinterlassen. Alles festzuhalten sehe ich als schwierig an, denn ich habe sporadisch dann und wann einmal ein Tagebuch geführt. Mir fehlten Zeit und Ruhe, allein durch meine lange Berufstätigkeit mit den dazugehörenden Aus- und Weiterbildungen. Die Zeit als Ehefrau und Mutter ließ mir keinen Freiraum, Lebensberichte festzuhalten. Während meiner Berufstätigkeit als Erzieherin habe ich lange Zeit pädagogische Tagebücher führen müssen. Wenn ich diese abrufen kann, dann freue ich mich natürlich, was alles gespeichert wurde, und mache einfach weiter. Ich habe mir Bücher gekauft, um zu lesen, wie man das Ganze anfangen kann. Aber ich denke, eine Autobiographie wird durch das Leben diktiert, darum plane ich viel Zeit in der Stille. Ich bin eine vierundachtzigjährige Witwe mit einem großen Erinnerungsschatz, der wohlbehütet schlummert. In keinem Lebensabschnitt habe ich mich mit meiner gelebten Vergangenheit so viel beschäftigt wie jetzt im Alter. Mein Motiv: Ich will die Zeit füllen mit erlebter Geschichte.
Verschiedenes habe ich klar vor Augen und möchte alle Leserinnen und Leser auf eine Reise der Gedanken mitnehmen. Ich will als Zeuge erzählen von einer Zeit, die in den letzten achtzig Jahren Realität in unserem Land war.
Ich wurde als erstes Kind meiner Eltern ins Leben gerufen. Bei der Taufe gab es Schwierigkeiten um meine Namensgebung.
Margot, diesen Namen trage ich über achtzig Jahre. In meinem Ausweis steht Annemarie Margot. Damals war es schlimm, wenn Ehepartner verschiedenen Konfessionen angehörten. Meine Eltern führten nach damaligen Verhältnissen eine Mischehe. Die väterliche Seite, katholisch, wünschte für den Täufling Maria, genau wie die Patentante. Die mütterliche Seite, evangelisch, Annemarie – Margot. Der Wunsch der Mutter: Margot.
Der Rufname Margot wurde in vielen Jahren unterstrichen. Ich habe alle Zeugnisse auf Margot, alle Prüfungen (auch Führerschein), Examen und Operationen mit Margot bestanden und überlebt.
Wir wohnten im Salkenbergsweg, einer Eisenbahner-Siedlung. Weil Vater bei der Bahnpolizei arbeitete, wurde uns diese Wohnung zugewiesen. Erst als wir eingezogen waren, wurden die Häuser mit sanitären Anlagen, kleinen Anbauten, versehen, die wir Kabüffchen nannten. Die Wohnung besaß Kinderzimmer, Schlafzimmer und eine große Küche. Wohnzimmer und Esszimmer gab es für unsere Verhältnisse nicht. Wir drei Ältesten hatten dort eine wunderschöne und gute Zeit, einen großen Hof zum Spielen, einen Hund und eine Katze.
Morgens wurden uns vom Bäcker frische Brötchen aus einem großen Korb gebracht. Vormittags kam der Milchbauer, der vor jedem Haus anhielt und die Milch verteilte. Nachmittags gingen wir den Weg bis zum Bäcker, der uns dann eine große Freude bereitete, weil er uns einsteigen ließ, auf andere Wege mitnahm und im Auto mit drei Rädern nach Hause fuhr. Es bereitete uns immer viel Freude, mit dem Auto zu fahren. Ich erinnere mich noch an unseren Gemüsehändler, der mit einem großen Auto kam, das vor dem Kühler mit einer Kurbel gezündet wurde. Für uns war das Auto sehr interessant, aber auch seine Waage. Diese besaß auf der einen Seite eine Platte zum Aufstellen der Gewichte. Auf der anderen Seite die große Waagschale, die am Wochenende immer blank geputzt war. Meine Eltern hatten 1935 mit einem Nutriapelztier-Paar eine Zucht begonnen, um sich einen Nebenerwerb aufzubauen. Die wertvollen Pelze dieser Tiere boten einen lukrativen Nebenverdienst.
Geburtsurkunde
Die Eltern legten viel Wert auf guten Zuchterfolg. Diese Pelztiere lebten in Außengehegen, die nach den Lebensgewohnheiten der Tiere gebaut wurden. Hinten ein Holzverschlag mit einer Schlaf- und Wurfkiste, dann daran anschließend ein zweieinhalb Meter langer Zementgang für Auslauf und Beschäftigung der Tiere und eine 1 qm große Wasserfläche. Bei Kriegsausbruch hatten meine Eltern bereits mehrere Gehege. Es kamen später zwei Schafe, ein Schwein, einige Hühner mit Hahn, Enten, Gänse, zwei Puten und ein Truthahn dazu. Regelmäßig wurden die Tiere geschlachtet und junge Geflügel-Nachkommen großgezogen verkauft und bei Bedarf auch wieder geschlachtet. Einmal, ich war etwa sechs Jahre alt, hatten meine Eltern mich in eine Hühnerfarm mitgenommen und dort dreißig kleine Entchen mit flauschigem Federkleid gekauft. Mich hat das alles als Kind sehr beeindruckt. Diesen kleinen Enten wurde dann ein besonders schönes Reich mit einem dazu passenden Teich angelegt. Im Kriege galten wir dann als Selbstversorger. Für Fleisch und Fett sorgten wir selbst, erhielten nur die Marken zur Zuteilung von Nährmitteln: Brot, Mehl, Nudeln, Reis, Haferflocken, Zucker und Käse. Für Kinder gab es dem Alter entsprechend Milchmarken.
Dazu bekamen wir eine Zuteilung von Futtermitteln für die Tiere. Weil wir eine große Familie waren, mussten wir von unseren Schlachtungen nichts abgeben. Dadurch standen wir uns besser als die Allgemeinheit, die während des Krieges durch die Zuteilung auf Marken sehr eingeschränkt lebte, aber nicht hungern musste. Es gab immer pro Kopf drei Zentner Kartoffeln in Säcken zum Einkellern. Dann pro Kopf und pro Woche: 2.400 Gramm Mehl (Brot), 500 Gramm Fleisch und Käse, 240 Gramm Fett, 250 Gramm Zucker und Marmelade, 100 Gramm Kaffee-Ersatz, 1,75 Liter Milch und ein Ei. Den schrecklichen Hunger erlebten die Menschen erst nach dem Kriege. Im Allgemeinen wurde das alles kontrolliert.
Mit den Tieren zu leben hat mich als Kind sehr begeistert. Ich habe viele schöne Tiergeschichten erlebt. Als unser Nutzgarten, der zu unserer Wohnung gehörte, wegen der Tierhaltung nicht mehr ausreichte, nahmen meine Eltern Land und Wiesen als Pachtland dazu. Die Arbeit bewerkstelligten sie zunächst alleine, danach halfen meine Großeltern. Später wurden meine Schwester und ich zu kleineren Arbeiten herangezogen.
Einschulung 1939, ich hatte Glück, durfte mit fünf Jahren schon zur Schule, weil ich im Juni erst sechs Jahre wurde, die Einschulung aber bereits nach den Osterferien erfolgte. Wie habe ich diesen Tag herbeigesehnt. Eine Woche vorher war der Tornister gepackt. Ich wusste, was darin war: eine doppelte Schiefertafel mit einem Holzrahmen.
Eine Seite mit Linien zum Schreiben und eine Seite mit Kästchen zum Rechnen. Beide Außenseiten waren aus schwarzem Schiefer ohne jegliche Liniatur, darauf konnten wir malen. Diese Tafel kam in einen Tafelschoner aus Pappe, der auf beiden Seiten mit schönen Bildern bedruckt war. Immer wieder habe ich nachgesehen, bis meine Mutter es leid war und sagte: »So, jetzt kommt er weg!« Oma hatte einen Tafellappen gehäkelt, der wurde an der Tafel mit einer Häkelschnur festgemacht. Dieser Tafellappen hing immer aus dem Tornister, weil er dann an der Luft schneller trocknete. In Holzkasten lagen zwei Schiefergriffel und dazu Griffelanspitzer. Bei dem Griffelkasten konnte man den Deckel herausnehmen und durch Klopfen auf die Fingerspitzen strafen. Das war beschämend, schmerzte außerdem. Eine andere Bestrafung für Störung war, dass man in einer Ecke neben der Lehrerin, mit dem Gesicht zur Wand stehen musste. Das waren anerkannte Strafen. Als auch ich einmal an der Wand stehen musste, kam ich weinend nach Hause, schilderte Mutter völlig aufgelöst, was mir geschehen war, und suchte Trost bei ihr. Sie fragte nur: »Warum ist das passiert?« »Ich habe doch nur gelacht«, jammerte ich. Ihre Antwort: »Du lachst dann eben nicht mehr im Unterricht. Dann bekommst du auch keine Strafe.« Weil ich bei ihr Trost gesucht hatte, trafen mich diese Worte wie eine kalte Dusche.
Ich bemühte mich in der Schule nicht mehr albern zu sein. Kam es dennoch zu einem Fehlverhalten mit Bestrafung, habe ich Mutter nie wieder davon erzählt. Mutter hatte mir ein Schulkleid genäht, kariert mit einem gekräuselten Rock und mit einem breiten Taillenband. Ich wurde stolz, als Mutter mir sagte: »Für die Schule kannst du nicht mehr das Spielkleidchen tragen, zur Schule musst du auch keine Schürze mehr anziehen.«
Größere Nachbarskinder nahmen mich später, wenn der Unterricht aus war, mit nach Hause.
Wie lange der erste Unterricht gedauert hat, weiß ich nicht mehr. Es war einfach alles nur schön. Nie mehr in allen späteren Schuljahren ist mir der Unterricht so schnell vergangen wie damals am ersten Tag. Oma stand vor der Schule mit einer riesengroßen Schultüte. Die war bis obenhin mit Papier ausgestopft und darüber lagen Obst und Bonbons. Die Tüte war nicht schwer. Zu Hause erzählte ich, wie schön es in der Schule sei, und breitete eifrig Details aus, zum Beispiel, dass wir ein Fräulein als Lehrerin hatten, und zwar Fräulein Grenzheuser. Sie trug ein hellbraunes Kostüm und eine weiße Bluse. Jedes Kind hatte einen festen Platz, auf der rechten Bankreihe mussten die Jungens und auf der linken Seite die Mädchen in Schulbänken sitzen.
Die Zeit bis zum nächsten Tag wurde mir sehr lang. Es gefiel mir gut in der Schule, das Schönste war, dass ich Freundinnen fand, mit denen ich etwas unternehmen konnte. Irgendwann 1939 war für uns plötzlich unsere Mutter nicht da. Mein Vater erzählte uns, wir hätten jetzt ein Brüderchen, und unsere Oma wollte zu uns kommen, denn wir konnten nicht alleine sein. Aber es wurde nichts daraus. Vater brachte uns in ein Kinderheim im Münsterland. Die Erinnerungen sind lückenhaft und traurig. Das Schlimmste blieb für mich, dass wir nachmittags in einem großen Schlafsaal schlafen mussten und dieser Schlafsaal durch ein kleines Fenster von Schwestern beobachtet wurde.
Für unseren dreijährigen Bruder Klaus war es sehr schwer, denn er weinte mittags und auch abends, weil er in dem großen Schlafsaal uns, seine beiden Schwestern, nicht in der Nähe hatte. Diese Zusammengehörigkeit war eine Frucht der Geschwisterliebe, die auch noch später zum Durchbruch kam.
Es war gut, dass es nicht lange dauerte, bis Vater uns abholte. Zu Hause dann die große Überraschung, wir hatten wieder ein Brüderchen bekommen. Bernd hieß es. Schwach kann ich mich daran erinnern, dass wir in dieser Zeit hohen Besuch bekamen. Zwei Beamte kamen an einem Vormittag zu uns, brachten meiner Mutter eine kleine Schatulle mit einem Mutterkreuz in Bronze, das an einem blau gestreiften Band lag. Es war eine Anerkennung, dass Mutter jetzt vier Kinder hatte. Diese Schatulle hat Mutter lange offen zur Dekoration im Schlafzimmer auf die Spiegelkommode gelegt.
In den ersten Ferien, es war noch Frieden, kam es 1939 zu einem verwandtschaftlichen Schulaustausch zwischen meiner Cousine Gerda und mir. Gerda ging damals in Holland schon ins dritte Schuljahr. Meine Cousine kam nach Essen zur Mutter und ich durfte zur Tante Alli nach Holland, in der Nähe der Heerler Heide. Tante Alli und Onkel Willi bewohnten ein kleines Holzhaus, wie es seinerzeit in den Niederlanden viele gab. Hinter dem Haus gab es einen kleinen Hügel, auf dem Tannen eingepflanzt waren. Viele Möglichkeiten hatte ich zum Klettern und Spielen. Tante Alli war immer in meiner Nähe. Es gefiel mir auch sehr, dass ich meiner Tante beim Putzen helfen durfte. Sie hatte dazu extra einen kleinen Eimer und Putzlappen besorgt. Stolz war ich, wenn sie meinen Fleiß lobte. Prompt kam dann von mir der Ausspruch: »Onkel Willi ist faul, der geht einfach weg.« Ich habe dieses Erlebnis nie vergessen, weil meine Tante das bei jedem Besuch wieder zum Besten gab.
Ich fand es toll, da als Einzelkind sein zu können, weil sich alles um mich drehte. Dort habe ich zum ersten Mal bewusst erlebt, was es heißt, verwöhnt zu werden. Aber jäh kam auch die schmerzliche Erfahrung des Abschieds. Großvater brachte meine Cousine zurück und holte mich ab. Tante Alli und Opa waren sehr aufgeregt, mir hat man gesagt, dass ich schnell heimmuss. Es sei Krieg ausgebrochen. Ich freute mich natürlich, meine Eltern und Geschwister wiederzusehen, aber der Abschied fiel mir doch schwer.
Plötzlicher Regen überraschte uns, da hatte ich Angst um meinen Strohhut, den Tante Alli mir gekauft hatte, womit sie mich enorm stolz gemacht hatte. Opa hatte offensichtlich Verständnis für meine Angst, nahm den Strohhut und packte ihn in seinen Koffer. Er nahm ein großes Taschentuch, mit dem er meinen Kopf bedeckte und dem er durch vier Knoten an den vier Ecken Halt gab. Später im Zug legte Opa meinen Hut ins Gepäcknetz.
Als er, um frische Luft zu atmen, das Fenster öffnete, flog mein geliebter Hut aus dem Fenster. Er flog weg und ward nie mehr gesehen. Eine große Traurigkeit überfiel mich. Geweint habe ich nicht. Opa umarmte mich und tröstete mich.
Als wir zu Hause ankamen, war es schon dunkel. Ich schlief bei meinen Großeltern. Nachts wurde ich von Oma geweckt und ging schlaftrunken übers Treppenhaus in den Keller, wo auch andere Bewohner sich aufhielten. Ich schlief auf dem Schoß von Oma ein und wurde in ihrem Bett am anderen Morgen wach.
Ich wollte von meinen Großeltern dann wissen, was es heißt, Krieg zu haben. Sie erzählten nicht viel, nur dass der Krieg mit Polen nicht lange dauern würde. Hin und wieder mussten wir auch nachts bei Alarm in den Luftschutzkeller oder tagsüber in den Keller der Schule. Es wurde immer schlimmer, gerade im Ruhrgebiet erlebten wir Angriffe.
Vor allem Essen, bekannt durch die Kruppwerke, die Kriegswaffen herstellten. Außerdem war es wegen der Bahnstrecken über Essen ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Nicht zuletzt wurden die vielen Zechen oft von Bomben getroffen. Zwei Flakstationen versuchten sich in der Abwehr.
Vater, der Bahnpolizist, wurde im Krieg zu Rettungs- und Bergungsarbeiten nach Angriffen eingesetzt. Als Kind habe ich seine Schilderungen ungewollt mitbekommen und war danach oft traumatisiert. Immer wieder beteuerte er meiner Mutter, dass sie keinesfalls in den Luftschutzkeller gehen, sondern direkt schon bei Voralarm durch die Sirene mit uns Kindern in den Bunker oder in den Stollen gehen solle.
Die Bunker, über der Erde, mit meterdicken festen Wänden waren bei Bombardierungen sicher. Sie waren für zweihundert Personen ausgebaut und besaßen verschiedene Durchgänge. An allen Wänden gab es Bänke für Schutzsuchende. In der Mitte des Raumes gab es Notsitze und Stehplätze. Bei Großangriffen konnten wir dumpfe Einschläge hören.
Der Stollen wurde in eine Schlackenhalde, die mit Lehm und Schotter gemischt war, gebaut, und zwar in der Nähe eines Zechengeländes oder eines Hüttenwerkes. Der Eingang führte in die Halde. In unterirdischen Gängen standen auf beiden Seiten Bänke für Schutzsuchende. Die Entfernung von unserer Wohnung zum Bunker und Stollen betrug in gegensätzlicher Richtung jeweils 400 Meter. Wir mussten zum Bunker nach Westen und zum Stollen nach Osten rennen. Im Innern des Stollens war ein Raum für das Rote Kreuz. Im Eingangsbereich des Raumes dann auch der Empfang über das Radio. Der Sender informierte über die Situation der Angriffe über der Stadt. Die Plätze für den Empfang der Informationen wurden freigegeben, damit an vielen Stellen im Stollen der Informationsfluss durchgängig blieb. Nach Kriegsende wurde ich, als ich bereits in der Lehre war, angesprochen und gefragt, ob ich »nicht das Mädel sei, das sich in der Zeit der Angriffe über Essen im Stollen informiert hatte«.
Die Angriffe nahmen zu, die Luftschutzräume reichten nicht mehr aus. Schließlich blieben uns nur noch Bunker oder Stollen. Das Ruhrgebiet blieb wegen der Stahlwerke und Waffenherstellung ständig das Ziel vieler Angriffe. Es war grausam. Viele Lehrer wurden als Soldaten zum Einsatz an die Front geschickt, kinderlose Frauen als Flakhelferinnen und Krankenschwestern zum Dienst in Lazaretten. Die Schulpflicht konnte in vielen Gebieten nicht mehr eingehalten werden. Ältere Schülerinnen und Schüler wurden in verschiedene Jugendlager in bombenfreien Gebieten verschickt. Diese gab es in Österreich, Württemberg und Bayern. Viele Frauen mit kleinen Kindern fuhren zu Verwandten oder befreundeten Familien. Jüngere schulpflichtige Kinder wurden über das Rote Kreuz zu Pflegefamilien vermittelt. Wir drei Geschwister, acht, sechs und fünf Jahre alt, durch die Kinderlandverschickung nach Pommern in ein kleines Dorf namens Flehmendorf an der Ostsee. Dort kam jeder von uns in eine andere Bauernfamilie. Ilse, meine Schwester, erlebte dort in einer kleinen Dorfschule mit wenigen Kindern ihre Einschulung. Ohne Tüte, ohne Mutter und ohne Oma, aber mit zwei ihrer Geschwister. Es war schön, Geschwister zu haben, uns wurde das hier immer mehr bewusst. In der Schule gab es nur zwei Lehrer und viel mehr zugereiste als einheimische Kinder. Mein Bruder Klaus war noch gar nicht schulpflichtig. Weil für ihn die Zeit ohne Bombenangriffe wichtig war, kam er mit.
Ilse erhielt zur Einschulung von ihrer Pflegemutter, einer Bauersfrau, einen leckeren Kuchen und Kakao. Wir hatten dort in dem Dorf eine schöne Zeit mit den Dorfkindern. Die Erinnerung an diese Zeit, die eigentlich schön sein sollte und auch schön war, ist aber schmerzlich, weil ich unter Heimweh litt. Ich nahm an, dass es meinen Geschwistern genauso ging. Wir drei haben wohl jeder für sich das Heimweh auf die ganz persönliche Art und Weise in der Stille durchlebt.
Im Ort gab es viele Kleintiere, Hühner, Enten, Gänse, auch kleine Schafe. Meine Liebe zu den Tieren hat mich das Heimweh tagsüber vergessen lassen. Ich war auch gerne draußen in der Natur und beobachtete die Erntearbeiter. Dabei konnte ich mein Heimweh vergessen. Eine Bäuerin zeigte uns, wie der Flachs geerntet wird. Mit großem Fleiß zogen wir die einzelnen Pflanzen aus dem Boden und stellten sie in Büscheln zusammen. Das hat mir ungeheuren Spaß gemacht.
Starkes Heimweh hat mich getrieben, abends heimlich am Fenster zu sitzen. Mutter hatte mir den Rat gegeben, auf den Sonnenuntergang zu achten. Essen liegt im Westen. Wenn ich abends von Pommern den Sonnenuntergang sehen konnte, dann sollte ich wissen, dass Mutter in Gedanken bei mir war.
Froh war ich, als Mutter kam und uns nach Hause holte, denn der Krieg wurde gefährlicher. Aber ich war zu Hause, wir waren alle zusammen. Wir lebten in Angst und rannten um unser Leben. Wir wollten aber nicht mehr weg. Wir sammelten Bombensplitter nach den Angriffen und tauschten sie mit unseren Spielkameraden. Ich war eingeübt im Radiohören, verfolgte die Meldungen, wenn feindliche Bomber das Ruhrgebiet anflogen. Ich konnte zu Hause warten. Wenn die Bomber ihr Ziel veränderten, rannte ich mit dem Wecker in der Hand und half der Mutter, die kleinen Geschwister zu wecken und sie an die Hand zu nehmen und zu rennen. Wir konnten uns auf die Nachrichten verlassen, wenn sie über Geldern in Richtung Ruhrgebiet flogen. Verstanden habe ich diese Zusammenhänge nie, aber wir haben uns darauf verlassen können. Mittlerweile war der Winter eingezogen. Es war kalt, aber Schnee hatten wir nicht. Ich weiß gar nicht, warum wir eigentlich die Schlitten im Keller hatten. Wir kannten Schnee nur von Bildern. Wir haben manchmal unsere Eltern gefragt, warum es bei uns keinen Schnee gab. Stets haben sie erklärt: »Es liegt daran, dass hier unter der Erde die Kohle liegt, dadurch schmilzt der Schnee immer.« Mein Vater war ein Verfechter dieser Erklärung. Im Grunde habe ich ihm das nicht geglaubt, auch nicht die Geschichte mit dem Nikolaus, Weihnachtsmann, Christkind und Osterhasen. Aber ich habe das meinen Geschwistern nicht verraten.
Einmal habe ich Mutter versprochen, vor den Kleineren das Spiel des Glaubens mitzumachen. Mutter schien erleichtert. In der Zwischenzeit hatten wir noch ein Brüderchen bekommen. Wir waren jetzt fünf Kinder und lebten in einem Sieben-Personen-Haushalt. Mein Vater sprach dann immer von einer Glückszahl, was ich auch nicht verstand!
In dieser Zeit fielen wieder mehrere Unterrichtsstunden wegen Alarm aus, aber wir waren alle froh, dass wir zu Hause bleiben konnten. Essen war stark zerstört. Die Angriffe wurden mehr und stärker. Wir bekamen Gasmasken, mit denen wir fleißig üben mussten. Ich mochte diese Masken nicht, weil es mir oft schlecht wurde und ich darunter geschwitzt habe. Für die beiden Kleinen gab es noch keine Masken. Die bekamen einen weißen, durchsichtigen Anzug ähnlich wie ein Schlafsack mit Kapuze über den ganzen Körper. Die Übung galt für uns als Pflicht, weil es zum Einsatz von Gasbomben kommen konnte. Ich habe immer nur gehofft, dass dies nicht geschehen würde. Unsere Hälfte des Wohnhauses war gerettet. Die Hälfte des Nachbarhauses wurde behelfsmäßig hergestellt, sodass die Nachbarn kochen und sich aufhalten konnten. Geschlafen haben sie dann im Keller. Hin und wieder hat Mutter sie zu uns eingeladen. So ist auf unserem Hof eine zusätzliche Kellerwohnung entstanden. Es wurde kalt und es ward Adventszeit.
Mutter traf Vorbereitungen für Weihnachten. Wenn die Geschwister im Bett waren, durfte ich ihr helfen. Das waren Stunden, die ich besonders liebte und auf die ich mich am Nachmittag schon freute. Am Tag vorher hatte Mutter den Teig für die Spekulatius-Plätzchen vorbereitet. Ilse und Klaus durften am Nachmittag beim Plätzchenausstechen helfen. Mit den Kleineren Bernd und Jürgen habe ich in der Küche gespielt und aufgepasst. Der Duft der gebackenen Plätzchen hat uns alle gefreut. Ich wartete auf den Abend, denn Mutter wollte mit mir Marzipan herstellen. In diesem Jahr gab es kein Marzipan und keinen Puderzucker. Ich versuchte, den einfachen Zucker, den ich auf das Backbrett ausstreute, mit einer Teigrolle zu bearbeiten. Mit meiner ganzen Kraft drückte ich diese rollend über den Zucker. Aber der Zucker wurde nicht pulverig. Mutter half mir und bei ihr klappte alles. Der Zucker wurde fein wie Pulver. Jetzt stellte sie einen Teig aus etwas Bittermandelaroma und dem Puderzucker her, danach durfte ich Wurst, Pralinen, Kugeln und irgendwelche Figuren formen, rollte das dann in Kakao und Mutter packte alles weg.
Für mich war die Zeit gekommen, ins Bett zu gehen. Ich schlief schnell ein, denn Ilse hatte das Bett schon angewärmt.
Es war die Zeit, wieder ein Badefest zu haben. Vater holte samstags die große Zinkwanne aus dem Keller und stellte sie in die Küche. Mutter füllte den Einkochkessel, der auf dem Ofen stand, mit Wasser. Wenn das Wasser anfing zu summen, schüttete es mein Vater in die Wanne und brachte kaltes Wasser dazu. Danach wurde der zweite Kessel aufgesetzt. Die drei kleineren Brüder, zwei, drei und fünf Jahre alt, kamen zuerst in die Wanne und wurden von den Eltern gewaschen. Die Herdplatten glühten. Mutter nahm nacheinander die Brüder aus der Wanne, wickelte jeden in ein Badetuch, öffnete die Ofentür und trocknete die Kinder in strahlender Wärme ab. Wir hatten immer Freude an den Bildern, die das Ofenfeuer an die Decke zauberte. Ilse und ich, als die beiden großen Schwestern, zogen die Kleineren für die Nacht an und setzten sie aufs Sofa. Selbstgebackener Stuten und Kakao standen schon auf dem Tisch.
Vater schüttete das schmutzige Badewasser ins Klo. Wir Mädchen bekamen frisches Wasser und wuschen uns selbst. Vor der Ofentür durften wir nicht lange sitzen, weil das Abendbrot schon auf uns wartete. Wir zogen schnell unsere Nachthemden an und freuten uns, dass wir wieder ein Badefest gehabt hatten.
Von einer befreundeten Familie bekamen wir jedes Jahr nach der Apfelernte eine Kiste Boskop-Äpfel. In der Adventszeit durften wir jeden Sonntag einen Apfel in den Backofen legen. Wenn er dann gar war, konnten wir ihn mit einem kleinen Löffel aushöhlen und essen. Manchmal dauerte es uns zu lange, bis der Apfel abgekühlt war. Dann verbrannten wir uns die Zungenspitze. So haben wir übers Fühlen gelernt, dass geduldiges Warten besser ist.
Nüsse gab es selten, aber unser Lebensmittelhändler Ranneberg kannte seine Kunden und hatte für jeden Haushalt, je nach Personenzahl, eine Tüte mit Wal- und Haselnüssen bereit. Viel Gebäck wurde mit dem Marzipan für fünf Weihnachtsteller verteilt. Je näher die Zeit auf Weihnachten zuging, desto aufgeregter wurden wir.
Manchmal, bei rotem Himmel erzählte Mutter, dass jetzt im Himmel Hochbetrieb sei, weil die Engel beim Backen seien. Ilse und ich lernten unsere Weihnachtsgedichte. In der Vorweihnachtszeit kam der Nikolaus mit dem Knecht Ruprecht. Der Nikolaus hat aus einem großen Buch vorgelesen und Knecht Ruprecht hat manchmal geschimpft.
Als ich größer war, habe ich in Absprache mit der Mutter mitgespielt, wenn Knecht Ruprecht mich mit der Rute gestraft hat. Ich habe dann oft geschrien, obwohl das gar nicht weh tat.
Zu Weihnachten kamen der Weihnachtsmann und das Christkind nachts, während wir schliefen, dann konnten wir nach einer aufregenden Nacht die Bescherung erleben und hatten Zeit zu spielen oder zu lesen, ohne müde zu werden.
Weihnachten 1942, Krieg seit 1939
Nach reichlichen zwei Wochen nahte der Heilige Abend. Wir Kinder mussten im Elternschlafzimmer schlafen, weil in unserem Kinderschlafzimmer der Weihnachtsbaum stand und dort die Bescherung stattfand. Mir als der Ältesten, damals neun Jahre alt, hat es Spaß gemacht, meinen vier jüngeren Geschwistern etwas vom Weihnachtsmann zu erzählen. Ich griff nach Ereignissen, an die ich mich noch erinnerte. Ich gab das weiter, was mir selbst viel Freude gemacht hatte. In meinem Kopf entwickelte ich zusätzlich Fantasiegeschichten und erzählte, dass der Weihnachtsmann außerirdische Fähigkeiten besitze und deshalb nicht von Bomben getroffen werden könne.
Es kamen auch andere in unseren Keller, denn von der Nachbarschaft waren die Besucher schon da. Meine Gedanken gerieten durch Krachen und Pfeifen durcheinander. Vielleicht war in unserer Nähe eine Bombe eingeschlagen, das leichte Beben des Kellers war mir bekannt, und das alles zu Weihnachten. Alle meine Sinne waren auf diesen Angriff konzentriert. Die Erwachsenen unterhielten sich darüber, dass zu Weihnachten die Waffen eigentlich schweigen sollten. Manchmal verstand ich die Welt der Erwachsenen nicht. Wir hörten, wie es ein paarmal krachte, das war aber weit weg. Vielleicht waren bei uns wieder Fenster und Türen kaputt, wie so oft. Die Flak schoss nicht mehr, es wurde leiser. Nach kurzer Zeit gab es Entwarnung. Wir gingen rauf und wollten gleich einen Blick ins Weihnachtszimmer werfen, es gelang uns nicht. Wir sahen auf Fenster und Türen, es war nichts zerstört. Wir mussten in unsere Betten, dann schliefen wir schnell ein und wurden durch Mutters Glöckchen geweckt. Da gingen wir mit großer Erwartung ins Bescherungszimmer. Ein Tannenbaum war bunt geschmückt. Ilse, Klaus und ich kannten unsere Geschenke. Die wurden jedes Jahr neu gestaltet. Der Kaufladen ward neu aufgefüllt. Die Puppe bekam neue Kleider und der Puppenwagen wurde neu ausgestattet. Das Holzauto glänzte mit neuen Rädern und diesmal statt in roter in blauer Farbe. Bernd bekam einen Bären auf vier Rädern, auf dem Rücken hatte der eine Schlinge. Wenn man daran zog, brummte der Bär, das ängstigte Bernd, und so dauerte es lange, bis Bernd zu seinem Geschenk Vertrauen fand. Jürgen, der Kleinste, erhielt einen Teddy, den er sofort mit ins Bett nahm.
Wir spielten noch lange. Erst als wir Hunger bekamen und es draußen hell geworden war, haben wir uns gewaschen, angezogen und gegessen. Die Zeit war ausgefüllt mit Spielen, Malen und Lesen. Nach dem Mittagessen wurden wir alle müde. Auch wir Großen waren bereit, einen Mittagsschlaf zu halten. Am Nachmittag kamen Oma und Opa. Ilse und ich waren stolz, als wir unsere Gedichte aufsagen konnten, danach haben wir gesungen, bis die Kerzen am Baum abgebrannt waren. Ein Gedicht, das ich in meinem Ruhestand 1999 geschrieben und 2009 veröffentlicht habe, möchte ich an dieser Stelle einfügen.
Auf dem Schulhof sitzen im Kreise
Mädchen und Jungen, tauschen Eisen
Dies noch neu, schimmert es blau
Nach Bombenangriff genau
Formen der Fantasie entfalten
Flugzeuge und Menschengestalten
Blumen schöner als die aus dem Garten
Früchte, auf die wir lange schon warten
Unter uns viel Eifer entstand
Splitter gingen von Hand zu Hand
Auf Bombensplitter fixiert waren wir
Wir waren Kinder vom Kohlerevier
Wir erlebten ständig bei Tag und Nacht
Was Bomber aus unserer Stadt gemacht
Den Ernst erkannten wir Kinder selten
Trümmerfelder waren unsre Welten
Zu Hause lebte ich trotz des Krieges auf. Die Angriffe wurden stärker. Dadurch fielen Schulstunden aus. Es war abzusehen, dass wir bald wieder mit einem Transport der Kinderlandverschickung in ruhigere Gegend gebracht werden müssten. Den Satz »Es muss sein, wir haben Krieg! Der dauert nicht mehr lange!« hatte ich zu oft schon gehört. Ich wollte nicht mehr weg, hatte Freundinnen und viele Spielkameraden.
Schön waren besonders die Sonntage zu Hause. Wenn unsere Eltern aufgestanden waren, durften wir in die Ehebetten zum Spielen. Wir nahmen die steife Gummidecke des Kleinsten, bauten mit den Kissen ein Radio und stellten die Gummidecke, die aus Hartplastik war, als Schalttafel davor. Ich als Älteste spielte die Durchsagen im Radio. Ilse und Klaus spielten mit den Puppen und dem Teddy die Zuhörer, die dann in den Luftschutzkeller mussten, das hieß, unter die Betten zu kriechen. Wir spielten immer Bombenangriffe. Der Sender gab z. B. folgende Nachrichten: »Die feindlichen Flieger nehmen Kurs über Düren, Bergisch Gladbach zum Ruhrgebiet.« Dann hörte man die Sirene. Nachdem in der Nähe die Bomben eingeschlagen waren, kam die Entwarnung. Das geschah meistens dann, wenn Mutter mit den Worten »Jetzt ist Schluss, waschen und anziehen, wir haben Sonntag« ins Zimmer kam. Aus dem Wissen meiner heutigen Sicht ist mir klar, dass wir seinerzeit mit diesen Spielen unsere Ängste abgebaut haben. Das Anziehen zog sich im Allgemeinen in die Länge, weil wir uns nicht einigen konnten, welche Sachen für wen passten, obwohl für jeden die Sachen bereitlagen. Mutter kam meistens noch einmal ins Schlafzimmer, mit den Worten: »Wenn ihr nicht sofort fertig seid, kommt Vater.« Der Satz zeigte Wirkung.
Als wären wir drei Geschwister die besten Freunde, halfen wir einander schnell gegenseitig, schüttelten die Kissen und legten die Gummidecke ins Kinderbett. Wir stellten dann die gepolsterten Stühle nebeneinander vor die Betten, so wie sich das gehörte, und gingen in die Küche. Unser Frühstück am Sonntag waren Stutenbrot und Kakao. Nach dem Frühstück zeigte uns Mutter, was wir nach dem Mittagessen anziehen sollten.
Mich ärgerte das, ich wollte mich selbst schick anziehen und zu meinen Freundinnen gehen und zwar alleine. Immer sollte ich dann auch noch mit den Kleinen gehen. Das fand ich blöd.
Wir brauchten sonntags keine Schürzen, aber wir durften uns nicht schmutzig machen, weil es eben Sonntag war. Nach dem Mittagessen halfen wir zwei Mädchen, neun und sieben Jahre alt, meiner Mutter beim Spülen.