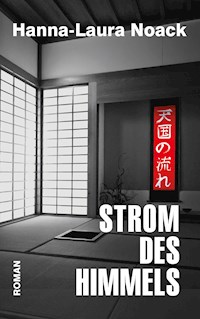
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine ungewöhnliche Geschichte aus der Nachkriegszeit. Eine leidenschaftliche Beziehung zwischen einer deutschen Krankenschwester und einem japanischen Journalisten. Die Machenschaften eines korrupten Politikers. Die seltsamen Spielregeln eines zensierten Pressesystems und ein wahrer Strudel von Intrigen und Verleumdungen. Ein persönliches Inferno, aus dem sich eine junge deutsche Psychologin selbst befreien muss. „... Das alles so spannend und unterhaltsam zu erzählen, macht das Buch zu einem lebendigen Stück aufklärender Literatur. Erfrischend, wie diese Autorin an dem deutschen Dogma rüttelt, dass ernste, ja schwierige Literatur nicht unterhaltend sein dürfe.“ (Widmar Puhl, SWR2 Kultur) „Knapp, präzise, engagiert, kurz: ausgezeichnet! ... Zusammengenommen ergibt das einen runden und in sich stimmigen Roman hoher Güte und mit hohem Unterhaltungswert, den ich nur empfehlen kann.“ (Michael Lang, MILATEXT, München). Jahrespreis des BVjA (Bundesverband junger Autoren) 2015 bei „Leipzig liest“, Leipziger Buchmesse 2015
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorin
Hanna-Laura Noack studierte in Paris, Berlin und Bonn. Im Ausland war sie nacheinander an einer britischen, pakistanischen und iranischen Botschaft als Privatsekretärin und Dolmetscherin der Botschafter tätig. Bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete, arbeitete sie viele Jahre als Psychotherapeutin in Köln. Parallel zu ihrem Beruf, leitete sie ein Berufsverbandsfachteam für Diplom-Psychologen, führte von ihr entwickelte Trainingsseminare bei WDR, NDR und dem Kabelfunk Dortmund durch und trat vielfach als Expertin in Funk und Fernsehen auf (WDR, VOX, RTL).
Sie lebt und arbeitet in der Nähe von Köln und in der Bretagne.
Weitere Informationen unter www.Hanna-Laura-Noack.de und Facebook: Hanna-Laura Noack
Für Lesungen kontaktieren Sie bitte die Autorin per email: [email protected]
Die Handlung dieses Buches ist frei erfunden. Personen, Unternehmen, Institutionen und Organisationen sind fiktiv oder, falls doch real, rein fiktional verwendet, ohne deren tatsächliche Handlungen beschreiben zu wollen.
„Wie wunderschön doch
Im Loch der Tür aus Papier
Der Strom des Himmels!“
Issa (1763 – 1827)
“The history of the human race: the ruthless and the defenseless.”
Philip Roth
Am schwersten verstehe ich die Steine. Ich habe von ihnen am meisten zu lernen.
Hanna-Laura Noack
Inhaltsverzeichnis
Die Autorin
Prolog
Alice, 1978
Überraschung
Der Entschluss
Teresa
Hochzeit 1943
Alice
In der Strömung
Tokio 1978
Teresa
Hals über Kopf
Alice
Reisen auf Japanisch
Tadashi Yamamoto
Chimären
Alice
Einkaufswahnsinn und Delikatessen
Theater
Das Versprechen
Tadashi Yamamoto
Alice
Tadashi Yamamoto
Alice
Tenimotsuakari
Im Vorortzug
Teresa
Teresas Entscheidung
Alice
Hiroshima 1978 – Tekito und Matisse
Friedensmuseum
Hunger in Hiroshima
Ein japanisches Bad
Miyajima-Guchi
Japanische Ehrlichkeit
Ishigura Koïchi
Zwei verselbstständigte Gewissen
Alice
Wenn es Nacht wird im Ryokan
Ishigura Koïchi
Koïchis Liebesgeschichte
Alice
Tadashis weißer Schatten
Etsuko
Der Umschwung
Presseklubs
Teresa
Alice
Etsukos Bericht
Tadashis Geschichte
Zurück in Tokio
Dr. Fukuda
Abflug
Dämmerung
Der Strom des Himmels
2010
Epilog
Ein Tag im Jahr 2010
Recherche
Danksagung
Prolog
Sommer 1945 und 1946
I.
Sie nannten den Mann „Fool on the hill“. Er dachte anders als sie, und es war zu befürchteten, dass er eines Tages so handeln würde. Unerbittlichkeit ging von ihm aus, Entschlossenheit, etwas wie Gefahr. Das erschreckte sie, und so zogen sie sich vor ihm zurück. Niemand verstellte ihm seinen Weg.
Der Mann hieß Tadashi Yamamoto, war Pressefotograf und noch nicht lange aus China zurück. Zerstörerische Bilder, tief in ihm eingebrannt, verletzten ihn mit der Wucht einer Abrissbirne: Erinnerungen an den Horror von Nanking. Doch davon wussten die anderen nichts.
Vor jenem Tag hatte er stundenlang an den Rädern einer nicht enden wollenden Nacht gehangen und sich die bange Frage gestellt, wieso das Unheil seine eigene Stadt noch nicht ereilt hatte. An eine endgültige Verschonung glaubte er nicht. Erst als der Fliegeralarm, kurz nach dem Einsetzen wieder abbrach, schlief er erleichtert noch für kurze Zeit wieder ein.
Der Tag wird brüllend heiß, wusste er nach dem Erwachen, verwundert über das darin mitschwingende Gefühl der Beklemmung. Aber noch stand die Sonne tief hinter den Kiefern. Durch Nadelkissen gefiltert sickerten ihre Strahlen auf seine Terrasse. Mit schweren Lidern trat Yamamoto in die Helligkeit der Veranda. Unter ihm lag die Stadt, noch im flirrenden Dunst von der Hitze der Nacht. Über ihr dehnte sich der Himmel, wolkenlos und von einem leuchtenden Blau. Wie automatisch tasteten Yamamotos Finger über die rauen Holzfasern der Balustrade, schweifte sein Blick über das Häusermeer. Genau in diesem Moment unterbrachen die Vögel ihren Gesang. Für wenige Sekunden war Yamamoto einer vollkommenen Stille ausgesetzt. Einer verhöhnenden Stille, gemessen an dem, was darauf folgte.
II.
Wie jeden Morgen wachte Koïchi um punkt sechs Uhr auf. Er hörte die Tür zuschlagen, die sich entfernenden Schritte der Mutter und seiner älteren Schwester. Seit dem Vorabend stand die Hitze wie eine Säule über seiner Schlafstatt. Selbst die Morgenwäsche erfrischte ihn nicht. Kaum angezogen, klebten ihm Hemd, Hose und sogar die muffig riechenden Stoffschuhe wie nasses Papier auf der Haut. Ein spartanisches bento zum Mitnehmen stand auf dem Tisch, ein wenig Reis, ein paar sauer eingelegte Kürbisscheiben, wie üblich. Früher gab es gebratene Eierspeisen, an besonderen Tagen sogar ebi dazu. Er wickelte das Essen in Zeitungspapier ein und verstaute es in seiner Umhängetasche.
Immer wieder schlossen sich seine Lider, seine brennenden Augen verrieten, wie sehr ihm der Schlaf fehlte. Auch in dieser Nacht hatten die Sirenen gegellt, in den ersten Stunden des Tages. Zitternd vor Angst hatte Koïchi sich auf seinem Futon zusammengerollt. In anderen Städten, das wusste er, waren ganze Stadtviertel ausgelöscht worden. Nach Bombenabwürfen verbrannten Menschen in ihren Häusern. Durch umstürzende Wände getroffen, waren sie nicht in der Lage gewesen, zu fliehen. Mit solchen Bildern vor Augen hatte er sich wach im Bett herumgewälzt. Die Zeit war ihm unendlich lang vorgekommen. So, wie die träge vertrödelte Stunde nach dem Aufstehen, bevor er, von Müdigkeit noch wie betäubt, in das blendende Tageslicht trat.
Er war zwölf Jahre alt. Eine Erwachsenenehre sei es, hatte sein Lehrer gesagt, in den Schulferien dem Kaiserreich, dem Tenno persönlich zu dienen. Die Poststation lag am Rande der Stadt, er musste sich sputen.
Kurz nach acht schleppte er einen prallen Postsack über der Schulter stadteinwärts und hielt vergeblich nach einer Wolke am Himmel Ausschau. Der Tag versprach keinerlei Abkühlung. Er lauschte dem Knirschen des Sandes unter den Füßen. Bei jedem Schritt rollten sich Staubfähnchen um seine Sandalen. Dösig beobachtete er, wie sich die Wölkchen einen Augenblick lang in der Luft hielten, bevor sie zu Boden sanken. Die plötzliche, vollkommene Lautlosigkeit über der Stadt, die verstummenden Vögel, nahm der Junge nicht wahr.
III.
An diesem Morgen fand Etsuko nichts mehr zu essen vor. Mit trockenem Mund bückte sie sich über das steinerne Becken. Das Wasser war immer noch warm. Sie trank es direkt aus dem Hahn, so gierig, als wolle sie sich bis oben hin damit anfüllen.
.Ihre Mutter war am Vortag aufs Land gefahren und hatte versprochen bis zum Frühstück zurück zu sein. Nun war es zu spät, noch zu warten. Etsuko musste los. Obwohl es im ungelüfteten Hause schlecht roch, hielt sie die Fenster und Türen verschlossen, um so wenig wie möglich von der Tageshitze hereinzulassen. Das Geräusch der Flugzeugmotoren rumorte in Etsukos Ohren. Es hing über den Häusern der Stadt, durchdrang die dünnen Hauswände. Im Gegensatz zu ihrem Bruder, den das Gedröhne seit seiner Rückkehr aus China verstörte, hatte sie sich daran gewöhnt. Tadashi besuchte sie selten, aber am Vorabend war er vorbeigekommen, das hätte die Mutter erfreut. Deshalb notierte Etsuko es ihr in Schönschrift auf einem Papierstreifen und legte ihr die Mitteilung auf den Tisch, bevor sie hinaus auf die Straße hüpfte.
Die im Asphalt gespeicherte Hitze brannte sich durch ihre Strohsandalen. Sie ignorierte es, wie die meisten lästigen Gegebenheiten dieser Tage. Weder das Wetter noch der Krieg sollten ein Mädchen wie sie entmutigen. Sie trug den Kopf hoch, denn für die Zeit der Schulferien traute man ihr eine Tätigkeit in einer Krankenstation zu. Die Einsatzstelle befand sich unweit des Stadtzentrums. Dort war es wesentlich kühler als in ihrem Elternhaus, und bestimmt würde eine Mittagsmahlzeit für sie abfallen. Der Tag versprach Gutes.
Etsuko hatte das Hospital beinahe erreicht, als sie eine seltsame Stille bemerkte. Sie stutzte. Die Vögel, wunderte sie sich, was war mit den Vögeln? Sie sangen auf einmal nicht mehr. So eine tödliche Ruhe, dachte sie.
IV.
Ein Jahr später betrachtete Teresa, eine junge deutsche Krankenschwester, den Himmel über Hiroshima. Grauschwarze, schnell vorbeifliegende Wolkenfetzen gaben flüchtige Einblicke frei, begrenzt und von seltsamer Farbe. Gucklöcher entstanden, die sich sogleich wieder schlossen, um sich an anderer Stelle zu öffnen. Die Ströme des Himmels, dachte Teresa. Zerrissen, wie ihre Gefühle, die mit dem Mann auf dem Hügel untrennbar verwoben waren.
Alice, 1978
Die Psychologin
Alice sieht aus dem Fenster. Der Himmel ist grauschwarz und unbemerkt hat sich Dunkelheit in das Zimmer gefressen. Alice Amberg ist müde. Sonntage wie dieser rauben einem die Seele. Sie hebt ihren Blick von dem eingespannten Formular und reibt sich die Augen. Unter dem Schreibtisch tasten ihre Füßen nach ihren Slippern. Spätestens morgen Abend muss der Bericht abgeschickt werden, die Patientin braucht dringend die Bewilligung. Zu einer Verzögerung will Alice nicht beitragen, sie nicht. Spätestens morgen, nach Dienstschluss, geht der Antrag zur Post. Notfalls wird sie ihn in ihrer Mittagspause fertigstellen. Das Blatt mit dem Durchschlagpapier lässt sie in der Maschine.
Ihre Aufgaben zehren an ihren Kräften. Deshalb taucht sie ab. Sie muss selbst dafür sorgen, kreativ und gesund für die Arbeit zu bleiben. Selbst jetzt, im noch kühlen Frühjahr wäre sie lieber an ihrem See, wo die Rohrweihe mit kiebitzähnlichen Schreien im Schilf auf der Suche nach dem versteckten Weibchen balzt, und dann unter Wasser, nah bei den Brückenpfeilern, wo der Hecht heute vergeblich auf Fütterung wartet.
Alice ist Taucherin. Ihr sorgfältig geführtes Logbuch bescheinigt ihr dreihundertfünfundzwanzig – vereinzelt gefährlich tiefe – Tauchgänge. An arbeitsfreien Wochenenden zwängt sie sich in eine schützende Zweithaut und flieht. Ihre Flucht geht hinab in die Kälte, knapp über die goldgelben Böden umgekippter Gewässer, in die beruhigende Schwärze vollgelaufener ehemaliger Steinbrüche oder künstlich angelegter Seen, unweit der Umgebung jener rheinischen Metropole, die nicht ihre Heimatstadt ist.
Rückzüge sind es, doch nur ein Ersatz für die Orte, von denen sie träumt. In Wirklichkeit zieht es sie, gleich einem Küstenfahrer, zu entlegenen Gestaden, unter die Spiegel der Meere der Welt, wo sie sich beim Tauchen so leicht wie auf Wolken fühlt. Angesprochen auf das Paradoxe ihrer Aussage, weil sie sich dabei ja unter Wasser befindet, hebt sie verwundert die Brauen. Menschen, die solche Fragen stellen, suchen nicht nach Verborgenem, ahnen nichts von den Schätzen, dem paradiesischen Zauber unter den Oberflächen der Welt, schweben niemals bei Nacht durch elysische Gärten unter einem auf der Wasserfläche gespiegeltem Sternenbanner. Und niemals gewahren sie, wie Alice, das feurige Aufblitzen der die Korallen nährenden Sonnenstrahlen im glasklaren Element.
Alice deckt eine Plastikhaube über die Schreibmaschine, räumt die Akten beiseite, schlurft zur Tür und knipst das Deckenlicht aus. Sie sieht auf die Uhr. Fast fünf. Sie muss sich noch abschminken.
Lustlos schleppt sie sich ins Badezimmer, entkleidet sich, schlüpft in Badeschlappen, einen hellgelben Bademantel und steckt ihr teerschwarzes Haar mit zwei Spangen auf. In diesem Moment klingelt es auch schon an der Tür.
Eine halbe Stunde später breitet sie ihr Saunatuch auf der mittleren Liege neben Margot aus. Sie tupft sich den Schweiß von Armen und Beinen und wirft einen kurzen Blick auf das Thermometer.
„Fünfundneunzig Grad“, stöhnt sie, „viel zu heiß eingestellt.“ Gleich darauf entweicht ihr ein Gluckser. „Weißt du, was meine Mutter immer behauptet? Die Sauna sei eine japanische Erfindung.“
Alice schüttelt den Kopf, dann überschattet sich ihr Gesicht, als wolle sie eine Erinnerung verscheuchen.
Margot blickt neugierig auf. „Eher wohl eine arabische, oder?“, forscht sie abwartend.
Alice zwingt sich zu einem Lächeln und nickt zustimmend.
„Denk mal an die Hammams in der Alhambra von Granada. Da
merkt man, wie überlegen der Orient dem Okzident schon im 7. Jahrhundert war. Die damals von den Arabern produzierten Seifen waren denen, die wir heute kennen, schon ähnlich.“
Margot murmelt etwas Unverständliches. Alice fragt nicht nach Sie zwingt sich zu einem Lächeln, nickt der Freundin unmerklich zu, doch ihre Gedanken driften zurück zu ihrer Arbeit der vergangenen Woche. So wird es sich wiederholen, Woche für Woche, geht ihr durch den Kopf, die nächsten vierzig Jahre lang, so lange ich gerade sitzen und mich konzentrieren kann. Wenn mein Körper funktioniert und mein Kopf das mitmacht.
Ihr Lieblingsmöbel, ein viktorianischer Ledersessel, wird das nicht schaffen, das ist schon jetzt abzusehen. Fast ein Jahrhundert hat er unversehrt überstanden, nach seiner Geburt in der Zeit von Charles Dickens. Dann kaufte Alice ihn für ihre Patienten.
Er steht für ein Gleichnis, denkt Alice, ein Gleichnis für die Wahrnehmung alter Menschen. Der Rückblick mag noch so gut gelingen, bis weit in die Vergangenheit mag alles noch nah sein und präsent, die Gegenwart jedoch scheint zu rasen, zunehmend kürzer zu werden.
Bei dem Sessel macht es die Aufregung, der saure Angstschweiß an den Händen der Patienten in den ersten Behandlungsstunden. So viele hilflose, klammernde Hände. Obwohl sich doch jeder an sich selbst festhalten und aufrichten muss. Sie sorgten dafür, dass sich mäandernde Risse im Leder der Armstützen gebildet haben. Das vormals cognacfarbene Leder changiert jetzt ins Grünliche. Von Säure zerfressen werden sich die Risse vertiefen, werden einreißen und irgendwann aufreißen. Nervöse Finger werden an dem herausquellenden, staubtrockenen Futter herumzupfen, bis Alice, beschämt, niemanden mehr bitten kann, auf diesem Sessel noch Platz zu nehmen.
Zerstörungen im menschlichen Leben sind das, was Alice beschäftigen, ihr Herausforderung und ständige Mahnung sein wird, die nächsten fünfunddreißig bis vierzig Jahre lang. Wenn sie verkraftet, was die Menschen auf dem ledernen Sessel ihr offenbaren.
So viel Verlorenheit zerbrechlicher Seelen, so viel kristallene Fragilität, empfindsam wie Glas, erschüttert, verletzt oder bereits zersprungen. Daneben Verbogenheit, Verlogenheit, Abschaum, der Rotz einer verrohten Gesellschaft in fünfzigminütigem Wechsel, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Oft nicht einmal freiwillig: „Ich? Nä, et es der Richter, dä meint, Se künne mer helfe, ich moot jo zo Uch, weil ich söns ...“ – „Sie glauben, dass Sie die Therapie gar nicht brauchen?“ – “Ich? Nä, woför och? Äwer wat soll mer maache, frog ich Se.“
Doch jetzt sollte sie sich endlich entspannen! Der Saunabesuch ist ein Zugeständnis an Margot, die sagt, dass es keinen besonderen Grund gibt, weshalb sie sich unbedingt mit ihr treffen will. Doch nach Verlautbarungen stellt Margots Mann einer seiner Patientinnen nach, wogegen deren streng katholische Kölner Familie offensichtlich nichts einzuwenden hat. Wer partout einen ärztlichen Schwiegersohn für die Tochter begehrt, nimmt diesen selbst mit Schmerbauch, irgendwann endlich geschieden und als Vater zweier Kinder in Kauf. Somit hat Margot ein Anrecht auf Mitgefühl und Alice verzichtet auf den Trost ihres entspannenden, sonntäglichen Tauchgangs.
Halb geöffnet schweifen Alices Augen umher, entfernen sich, fliehen durch getöntes Glas in den gestreckten Saunavorraum, an dessen Ende ein Lichtkegel durch eine zum Balkon geöffneten Fenstertür fällt. Ihre Gedanken schweifen zu einem Artikel in der Tageszeitung. Alice hat ihn am Vormittag gelesen. Jetzt hat sie Zeit, ihn zu überdenken.
Es grenzt an ein Wunder, dass man überhaupt einmal Presseinformationen aus Japan bei uns findet, schießt es ihr durch den Kopf. Verglichen mit Berichterstattungen über Vorkommnisse im Nahen Osten hat das geradezu Seltenheitswert. Also auch in Japan, stellt sie erbittert fest, protegiert man die Mächte, die nur ihr Image, ihren politischen Vorteil, nicht aber das volkswirtschaftliche Wohl ihres Landes und erst recht nicht das leibliche ihres Volkes verfolgen. Trotzdem: Einen so peinlichen Korruptionsskandal hätten die Japaner der Weltöffentlichkeit sicher lieber verheimlicht.
Alices Augen werden schwer.
„Es hilft alles nichts, früher oder später werde ich das Rätsel um Yamamoto lösen müssen.“
Moment! Sie beißt sich auf die Unterlippe. Ohne Zweifel, aus ihrer Versunkenheit heraus hat sie laut gedacht.
„Was murmelst du denn da?“
„Was? Ach, nichts Wichtiges.“
„Komm, spuck es schon aus, Alice, was ist los?“
„Hast du die Sache mit dem Lockheed-Skandal in der Presse verfolgt?“, startet Alice einen Ablenkungsversuch.
„Nein, worum geht‘s?“
„Schmiergeldaffäre, in Japan.“
„Und wer ist der glückliche Nutznießer?“
„Tanaka, der ehemalige japanische Ministerpräsident.“
„Gerade hast du aber doch einen anderen Namen genannt, Java-Motor, oder so ähnlich, hat das was damit zu tun?“
Alice muss lachen. Java-Motor, auch so etwas böte sich für einen Betrug sicher an. Sie wischt sich über ihr rotes, überhitztes Gesicht. Ach, was soll‘s.
„Yamamoto, sagte ich, aber das ist eine andere Sache. Hat irgend etwas mit Teresas Vorleben zu tun. Etwas, das sie mir vorenthält.“
Margots kritischer, abschätziger Blick entgeht Alice nicht. Sie hat recht, denkt Alice, meine Gefühle sind merkwürdig überspannt in letzter Zeit, eigentlich bräuchte ich Urlaub.
Sie wirft einen weiteren Blick auf das Saunathermometer, breitet ihr Handtuch auf er untersten Liege aus und hievt sich schweißtriefend eine Bank tiefer.
Auf ihre stämmigen Ellenbogen gestützt, schüttelt Margot den Kopf. „Und was für ein Geheimnis soll das bitteschön sein?“
Der Knochen, den sie nicht benennen kann, existiert für sie nicht, denkt Alice. Margot ist Orthopädin. Sinnlos, ihr romantisch verklärte Kinderträume zu erklären, Jugendfantasien oder heimliche Sehnsüchte, geboren und versteckt unter dem Schleier von Teresas Japanschwärmerei. Und dann noch dieser Name, den sie nicht einordnen kann. Aber es hat keinen Zweck, mit Margot darüber zu reden. Alice weiß schließlich selbst nicht, warum Teresa Japan so plötzlich verlassen musste und welche Rolle der „Held“ aus Alices Kindheit, dieser Yamamoto, dabei gespielt hat. Was das angeht, muss Alice sich an ihre eigene Nase fassen. Seit Jahren hat sie nichts unternommen, um der Sache auf den Grund zu gehen.
„Unwichtig, Margot, da hast du vollkommen recht.“
„Und dass du sie beim Vornamen nennst! Meine hätte mir das niemals erlaubt. Eine Mutter ist doch keine Freundin …“
„Sag bloß! Hat sich diese Binsenweisheit bis zu euch Sehnenflickern herumgesprochen?“ Alice greift nach der Saunabürste und schrappt sich damit über die Oberschenkel. Dabei blickt sie zu Margot auf, die so erschrocken zu ihr herüberstarrt, als habe sie eine Zecke auf ihrer Wange entdeckt. Alice braucht keine bigotte Gouvernante, aber ihr Tonfall kommt ihr nun selbst übertrieben vor.
„Sorry, Margot, ich bin überarbeitet, bitte nimm‘s mir nicht krumm!“
„Ja, aber ..., seit wann nennst du sie denn schon so?“
„Seit meinem sechzehnten Lebensjahr.“
„Euer Verhältnis scheint nicht gerade entspannt, oder? Gib es zu!“ Alice prüft Margots Mienenspiel, wehrt ihr aufgekommenes Misstrauen ab. Ach was, Margot sagt, was ihr in den Kopf schießt, und manchmal hat ihre kommunikative Knochenbrechermentalität sogar Vorzüge. Warum sie sich gerade jetzt mit Yamamoto beschäftigt, muss sie ihr nicht erklären, wirklich nicht.
Sie eröffneten vor drei Jahren fast gleichzeitig ihre Praxen im gleichen Ärztehaus. Margot in der ersten, Alice in der zweiten Etage. Was sie verbindet, ist vor allem der geteilte Ärger über die für sie zuständige Honorarverteilungsstelle der Vereinigung der Kassenärzte. Dabei, findet Alice, sitzt Margot darin wie die Made im Speck. Sie ist nicht von unkooperativen Ärzten abhängig, die sie weder respektieren noch Ahnung von ihrem Fach haben. Frauen wie Alice, mit ihren Bitten um Zusammenarbeit oder Medikamentenreduktion bei den Patienten, stehlen den meisten ärztlichen Kollegen nur unnötige Zeit. Auch Margot hat wenig Muße für ihre Patienten – schließlich verschreibt sie ihnen ja Arzneimittel! Zumindest aber stellt sie, falls die nicht helfen, Überweisungen aus. Manchmal auch an Alice. Gerade bei Privatpatienten ist vielen Ärzten das Risiko, dass sie danach nicht mehr wiederkommen, zu groß. Dabei haben viele mit Medikamenten behandelte Störungen psychische Ursachen und könnten von Psychologischen Psychotherapeuten wesentlich besser therapiert werden als von unausgebildetenHausärzten unter Zeitdruck.
Untersuchungen belegen längere Behandlungszeiten, häufigere und höhere Medikamentendosierungen und frühere Verabfolgung bei Patienten der unteren sozialen Schichten. Gleichzeitig belegen sie kürzere Behandlungszeiten, vorsichtigere Medikamentendosierung, häufigere Überweisungen zur Kur oder Psychotherapie bei Patienten mittlerer bis höherer sozialer Schichten. Solche Diskriminierungen ärgern Alice.
Aber es ist nicht nur die Zwei-Klassen-Medizin, die sich auch bei den psychotherapeutischen Leistungen bemerkbar macht, über die sich Alice aufregt. Sie will mehr Gerechtigkeit. Nicht nur für die psychotherapeutisch unterversorgten, mit Antidepressiva überfütterten Patienten, sie denkt auch an sich. Sie will eine eigene Kammer und ein Versorgungswerk für Psychologische Psychotherapeuten im Alter, so wie es die Ärzteschaft hat. Sie will die offizielle Anerkennung ihres Berufsstandes. Dafür kämpft sie in ihrer Freizeit, wenn sie nicht gerade Anträge schreibt oder taucht. Sie schreibt Pamphlete, stellt Flugblätter her, kommuniziert mit Anwälten, kontaktiert gezielt falsch informierte Journalisten, die glauben, zu Demonstrationen von Psychologen gar nicht erst erscheinen zu müssen.
So wie vor drei Tagen vor dem palastähnlichen Gebäude der Vereinigung der Kassenärzte. Ihr Berufsverband hatte eine Demonstration organisiert.
Ich tu‘s für 50 Mark die Stunde“, stand auf Alices Schild. Sie trug pinkfarbene, zwölf Zentimeter hohe Stilettos in denen sie sich nur mühevoll vorwärtsbewegen konnte schwarze Netzstrümpfe und einen kurzen, schwarzen Lederrock Leihgaben einer Kollegin vom letzten Karneval. Derart milieugetreu ausstaffiert, passend dazu mit leuchtend grellrosa geschminkten Lippen und ebenso lackierten Finger- und Fußnägeln, stakste sie zwischen grinsenden Kollegen und Kolleginnen und vor Vorstandsvorsitzenden der VdK einher. Aber Letztere brachten kein müdes Lächeln auf, kurbelten nicht einmal ihre Scheiben herunter, um Alices Flugblatt entgegenzunehmen. Dickfellig glitten sie ungerührt in ihren S-Klasse-Wagen an ihr vorüber und wendeten die Köpfe ab. Warum sollten sie sich das auch durchlesen? Ihr Jahresgehalt beträgt fast eine halbe Million Mark, neben ihren Praxiseinnahmen. Es wird gespeist aus Verwaltungskosten, die automatisch von den Honoraren der niedergelassen Ärzte und Psychotherapeuten abgezogen werden.
Kein Installateur repariert Alice für fünfzig Mark auch nur einen tropfenden Wasserhahn, der schlägt noch Anfahrtskosten darauf. Dem wird auch kein gottverdammter Numerus Clausus von 1,3 als Ausbildungsvoraussetzung abgefordert. Der hat weder ein Einserdiplom an der Universität, noch eine auch nur annähernd kostenintensive Zusatzausbildung im Anschluss an ein Studium absolviert. Den Handwerker schützt seine Handwerkskammer vor willkürlichen Kürzungen, und bei Zahlungsversäumnissen hilft ihm jedes Gericht bei der Eintreibung seines Honorars. Alice weiß nie, welche Vergütung sie für den Aufwand der ersten fünf von ihr geleisteten Therapiesitzungen erhält.
Kein Fachfremder würde für möglich halten, wie niedrig die Sätze sind, die Alice dafür erst sechs Monate nach den erbrachten Leistungen vergütet bekommt. Ein Stundenlohn, den Alice nicht einmal der Reinigungskraft ihrer Praxisräume anbieten würde. Doch daran denkt sie nicht bei ihrer Arbeit. Die Demütigung würde ihr die Kehle zuschnüren.
Alices ist Verhaltenstherapeutin und auf die Mitarbeit der Patienten angewiesen. Gemeinsam mit ihnen arbeitet sie auf konkret bestimmte Ziele hin. Bewegen sich ihre Patienten in die gewünschte positive Richtung, empfindet Alice es als Belohnung für ihr Engagement.
Es ist nicht die Arbeit mit ihren Patienten, die Alice belastet. Es sind die Widrigkeiten eines Systems, in dem sie sich gefangen fühlt und dem sie nicht entfliehen kann. Ihren Frust kompensiert Alice beim Tauchen.
„He, Alice, hörst du mir nicht zu? Bist du mal wieder abgetaucht? Ich habe dich etwas gefragt!“
„Was? Oh, Entschuldigung ... ob es Probleme mit Teresa gibt? Nein, gibt es nicht.“
„Nein?“
Margots Mundwinkel zucken in Richtung Saunabank.
Alice will sie nicht brüskieren. Sie rückt ihr Handtuch unter der Kopfstütze zurecht, streckt sich auf ihrer Liege aus. Ihre Füße ragen Margot bis fast an den Kopf.
„Du hast meine schöne Teresa ja einmal kennengelernt. Da gibt es etwas, das bis heute nicht geklärt ist. Etwas Ungreifbares. Das hängt mit einem Japaner zusammen, Yamamoto, aber was genau dahintersteckt, weiß ich bis heute nicht“, erklärt sie beschwichtigend.
Margot steht auf. „Ist mir zu diffus. Versteh‘ ich alles nicht. Mir ist zu heiß, ich geh‘ raus.“ Doch sie setzt sich ein weiteres Mal auf die Saunabank. „Wenn du so oft von Japan oder diesem Japaner geträumt hast, warum bist du nicht einfach mal hingeflogen?“
„Das fragst du? Du weißt doch, wie wichtig mir das Tauchen ist. Japan ist teuer. Für eine Reise ergab sich nie eine Gelegenheit. Außerdem gibt‘s dort kaum noch Fische. Japaner fressen sogar die Korallenfische von ihren wenigen, zerstörten Riffen.“
Ach was! Zeitliche Engpässe, unpassende Gelegenheiten, alles Ausflüchte. Der Name Tadashi Yamamoto schwimmt wie ein öliger Teppich auf der Oberfläche von Alices Gedanken. Es reicht. Viel zu lange schon hat sie es aufgeschoben. Das Öl muss endlich abgesaugt werden. Und noch etwas beschäftigt Alice. Ein latenter, sie seit Jahren verunsichernder Verdacht, der, falls ihre Vermutung zuträfe, ihr ganzes Leben umkrempeln würde.
Margot erhebt sich. Statt es sich um die Hüften zu legen, presst sie ihr Saunatuch gegen die Glastür, die sie mit einem Flankenstoß öffnet und mit bloßem Fuß hinter sich schließt. Draußen dreht sie den Wasserhahn auf und lässt bei der Berührung durch den eiskalten Wasserstrahl kurze, abgehackt klingende Schreie durch den Vorraum gellen. Margots unverhüllte Behäbigkeit erscheint Alice wie eine Entsprechung: Das kompakte Bild einer soliden Sportärztin, mit einem Körper so robust wie das Gemüt.
Sie registriert das sich Heben und Senken der ausladenden Brüste ihrer Freundin, beobachtet die sich über die Dellen ihrer Orangenhautschenkel windenden Rinnsale, die gluckernd im Abfluss versickern, bis Margots Arme mit dem Wasserschlauch auffällig in ihre Richtung rudern.
Der Wink weckt Alice aus ihrer schläfrigen Dösigkeit. Sie erhebt sich so schnell, dass ihr für einen kurzen Moment schwindelig wird und tritt hinaus.
Die kalte Außenluft hat innen die Fensterscheiben beschlagen, Kondenstropfen rinnen in Fäden an ihnen hinab.
„Schön“, sagt Alice, „dass es dich gibt. Deine Freundschaft hat etwas Handfestes.“
„Ach komm“, kontert Margot und senkt fast verschüchtert den Kopf.
Im Hintergrund läuft der Fernseher, als Teresa abhebt.
„Alice! Um diese Zeit rufst du sonst doch nicht an, ist was passiert?“
Alice stockt für einen Moment doch dann gibt sie sich einen Ruck:
„Tut mir leid, ist auch vielleicht der falsche Moment, aber mir fiel etwas ein, worüber ich seit längerer Zeit mit dir reden will ...“
„Ja? Worum geht es, schieß los!“
„Ich habe es immer wieder aufgeschoben, dich danach zu fragen. Heute fiel es mir durch einen Bericht in der Zeitung wieder ein, und damit ich es nicht wieder vergesse …“
„Ich höre dir zu, Alice.“
„Es betrifft diesen Japaner, Tadashi Yamamoto, … irgendwann wolltest du mir etwas über ihn erzählen. Ich habe dich damals abgewürgt, das tut mir leid. Bis heute weiß ich nicht einmal, worum es dir dabei ging.“
Vor dem Fenster stiebt laut tschilpend eine Schar Spatzen auf. Die Äste der Bäume biegen sich im Wind.
Alice hört Teresa tief einatmen.
„Hallo Teresa, bist du noch da?“
Alice schiebt einen Teebecher auf dem Tisch hin und her.
Ihre Mutter räuspert sich. „Ja, natürlich, aber du hattest schon recht, es war auch nicht der Rede wert.“
„Schien dir damals aber ziemlich wichtig zu sein.“
Alices Ungeduld kriecht in den Hörer hinein. Groß wie ein Segel bläht Teresa es auf, ihr Geheimnis.
„Also gut, wenn du meinst …“, Teresas Stimme vibriert.
„Genau, lass uns darüber sprechen. Ein vertrauliches Gespräch unter Frauen. Vielleicht zu Papas Geburtstag, im Februar, wenn ich euch besuchen komme.“
„Dann haben wir aber doch Gäste …“
„Ich weiß. Aber es gibt auch eine Küche, einen Flur, den Morgen danach, bevor ich abreise. Ich möchte das klären, Teresa.“
Ein Murmeln, es klingt wie: „dann lass es uns bis dahin verschieben“, erinnert Alice an einen versiegenden Bach.
„Gut, dann also bis Februar, da tschilpen die Spatzen ganz bestimmt auch noch.“
„Jedenfalls werde ich das Futterhäuschen regelmäßig auffüllen.“
Alice ist sich sicher, dass ihre Mutter gerade gelächelt hat. Sie streckt ihre Beine unter dem Tisch aus, lehnt sich zurück und streicht sich zufrieden die Haare aus der Stirn.
Alice grübelt. Ihre frühe Verklärung Yamamotos kommt ihr jetzt seltsam vor. Welche Projektionsfläche dieser Unbekannte ihr in der Kindheit bot! Das hing nicht nur mit einem Foto im Wohnzimmer ihrer Eltern zusammen, vor dem sie als Kind oft gestanden hatte: Teresa, auf jenem Berg, vor der Inlandsee, mit dem Blick auf ein Meer kleiner Inseln. Wie oft sie das Land Japan auf dem beleuchteten Globus gesucht, und was sie nicht alles in das Bild hineinprojiziert hatte, das jetzt versteckt in einer Ecke ihres Flurs hängt. Teresa hatte es ihr beim Auszug aus dem Elternhaus geschenkt.
Etwa bis zu ihrem zwölften Lebensjahr hatten Teresas Erzählungen das tagsüber vaterleere Haus gefüllt.
Undurchsichtige Geschichten wie aus einem Märchenbuch, die heute auf dem Boden von Alices Erinnerung liegen. Und so waren sie in ihr gewachsen: diffuse Gefühle von Fernweh und eine unbewusste Sehnsucht, die untrennbar mit dem Namen Yamamoto verbunden ist.
Alice ist sich heute nicht mehr sicher: Entsprangen ihre Erinnerungen einer vergangenen Realität oder waren es Fantasiegebilde aus längst vergessenen Träumen, unrealistische Abbilder einer verwunschenen Kinderwelt?
In Abständen tauchten Blitzlichter auf, kurze Abrisse aus Curts und Teresas Eheleben, diesem absolut schussfesten Kastell. „Wieso streitet ihr euch eigentlich nie?“, hatte Alice sie einmal gefragt.
Teresa hatte lächelnd geschwiegen, wie so oft, wenn sie die Antwort von Curt erwartete, und er, seine Augen vage auf sie gerichtet, sagte: „Es bringt doch nichts, Probleme lange hinauszuschieben, die löst man am besten sofort.“
Alice misstraut einem so einfachen Glück. Im Nachhinein erscheint ihr die ruhige, konstante Beziehung ihrer Eltern zueinander – regelmäßig, wie ein Schweizer Chronometer – sonderbar. Was zwingt Menschen über Jahre hinweg in eine symbiotische Partnerbeziehung, vergleichbar mit der stummen Übereinkunft zwischen einem Putzer- und einem Napoleonfisch? Gibt es womöglich ein Geheimnis, das Teresa mit Curt teilt? Alice will es endlich herausfinden.
Nur einen Monat später verschließt sie ihre Haustür hinter einem Polizeibeamten. Dabei quietschen die Türscharniere wie ein weinendes Kind, und genauso fühlt sich Alice.
Sie füllt ihr Waschbecken mit eiskaltem Wasser und taucht ihr Gesicht darein, vier, fünf Mal hintereinander. Mit einem angefeuchteten Handtuch vor dem Gesicht schlurft sie aus dem Bad über den Flur in ihr Schlafzimmer. Die Stimme des Polizisten noch immer im Ohr, wirft sie sich auf ihr Bett. Von innerer Unruhe gepeinigt, steht sie kurz darauf wieder auf und begibt sich ans Fenster. Ihr Atem beschlägt die Scheibe, das Bild des Beamten taucht immer wieder auf.
Ein Maschinenmensch, mit einem Schutzschild gegen Schmerz. Ein verschlossen wirkendes Gesicht, sein ungepflegtes Erscheinungsbild, der Geruch, mit dem sich der Flur sofort angefüllt hatte, die schmierigen Haare und seine schmutzigen Schuhe. Normalerweise hätte das Reflexionen über die oft bedauernswerte soziale Situation von Polizisten bei ihr ausgelöst. Aber etwas in seinem Auftreten hatte jeden Gedanken sofort erstickt. Die Worte, mit denen er sein Anliegen herunterspulte, hieben wie Fäuste auf sie ein. Sie fürchtete, in den Knien einzuknicken, stützte die Arme auf die Lehne eines Stuhls.
„Aber doch nicht alle beide?“, stammelte sie entsetzt. Teresas Lächeln. Hilflos starrte Alice auf das Bild von der Inlandsee, diesem Meer zwischen den Inseln Honshu, Shikoku und Kyushu. „Beide“, antwortete er. „Der Lastwagen scherte aus, drehte sich auf der Autobahn, ein Herzinfarkt des Fahrers, er fuhr praktisch auf sie drauf.“
„Und … waren sie wirklich … sofort tot?“
„Ihre Mutter am Unfallort, Ihr Vater noch bevor er im Krankenhaus ankam.“
Eiszeit. Alice friert, als hätte man sie nackt den Schneehang hinter ihrem Haus hinabgerollt. Unbeweglich starrt sie aus dem Fenster, blickt auf froststarre Zweige, auf denen sich an diesem Tag nicht einmal eine Krähe niederlässt. In der vergangenen Nacht war das Thermometer bis auf fünf Grad unter null gesunken und bis jetzt, um die Mittagszeit, kaum angestiegen. Unbesetzt schwingen die Futterkugeln für die Meisen in der Luft. Eiszeit.
In den folgenden drei Tagen braucht sie eine Vorratspackung Papiertaschentücher auf. Sie sagt ihre Termine für die kommende Woche ab, vergräbt sich in ihrer Wohnung.
Als ihre Augen wie entzündet aus ihrem Gesicht quellen, legt sie morgens eine Kühlmaske darüber, verordnet sich die Entspannungsübungen, die sie sonst bei Patienten durchführt, setzt ein Pokerface auf und beginnt wieder zu arbeiten.
Indes, ihre Gedanken rotieren weiter. Tausend Fragen, und auf einmal ist alles zu spät. Was wollte Teresa ihr sagen? Was hatte sie ihr bisher verheimlicht? Was war der Grund ihrer Anspannung, als sie sie zuletzt darauf ansprach? Alice findet keine Antwort.
Anderthalb Monate vergehen. Noch immer lebt sie wie unter einer Glasglocke, die nur manchmal von Margot, die regelmäßig in der Mittagspause zu ihr heraufkommt, gelüftet wird. Margot spricht Klartext mit ihr: „Verdammt noch mal, jetzt reiß dich zusammen, das Leben geht weiter!“ Ihre Ratschläge erweisen sich als überflüssig. Wie soll sie auch wissen, was Alice seit Tagen durch den Kopf geht?
Damals wie heute prasselte der Herbstregen auf die Dachziegel, der Wind brachte die Dachluke zum Klappern. Alice war sechs, gerade dabei, lesen zu lernen. An solchen Tagen verkroch sie sich auf dem Speicher, einer Schatzkammer, in der aufregende Dinge lagen, von denen ihre Mutter erklärt hatte, sie stammten alle aus dem Krieg. Der alte Holzkasten, der früher wohl Weinflaschen enthalten haben musste, existiert bestimmt immer noch irgendwo. Fliegerabzeichen lagen darin, solche wie sie der Vater im Krieg am Revers trug, und Briefumschläge, die Unmengen von Schwarz-Weiß-Fotos enthielten. Bis auf einen einzelnen braunen, waren die anderen weiß und geöffnet.
Das zugeklebte braune Kuvert lag unter einem Kästchen aus Blech, in dem silberne Kreuze, auf denen sich kleine roten Adler befanden, aufbewahrt wurden. „Kriegszeug alles, dummes Männerzeug“, kommentierte Teresa später Alices Fragen. Unter dem Wort Krieg subsumierten sich für Alice höchst widersprüchliche Situationen. Einerseits schienen sich alle davor zu grausen, andererseits erzählten sie sich spannende Geschichten aus dieser Zeit, von Reisen in ferne Länder.Sie staunten und lachten manchmal sogar dabei, was die Kriegsfotos mit den uniformierten Männern bewiesen. Gut, auf manchen sahen sie tieftraurig und ernst aus, irgendwie passte das alles nicht zusammen.
Der dicke braune Umschlag, auf dem das Wort „Tadashi“ geschrieben stand, war halb zugeklebt. Jedes Mal, wenn Alice auf den Speicher ging, hockte sie sich vor den Kasten und riss den Umschlag ein kleines Stück weiter auf. Irgendwann war es dann soweit. Ein Stapel Schwarzweißfotos rutschte auf den Rock ihres Matrosenkleidchens. Grauschwarze Trümmerlandschaften versanken im schneeweißen Plissée ihres Rockes, eine Häufung furchtbarer Zerstörungen, ausgebreitet in ihrem Schoß. Gequält aussehende Menschen mit schwarzen Gesichtern starrten sie an. Zweifellos waren es Fotos vom Krieg.
Alice erinnerte sich. Ihre Mutter hatte ihr einmal Fotos von anderen Kindern gezeigt, solchen mit dunkler Gesichtsfarbe und merkwürdigen Augenstellungen, solchen, die sie Rothäute nannte, obwohl ihre Haut gar nicht rot war, und solchen, die angeblich gelb waren und ebenfalls gar nicht so aussahen, aber „schlitzäugig“ sein sollten. Alice wusste genau, wie asiatische Kinder aussehen. Sie ähnelten den etwa gleichaltrigen Kindern auf diesen Fotos nur bedingt. Voller Entsetzen starrten sie um sich, schienen verzweifelt um Hilfe zu bitten. Und von den schwarzfleckigen Körpern der Erwachsenen hingen Haut- und Stofffetzen herab. Alle diese Menschen hatten entstellte, zerstörte Gesichter und streckten schwarze, verbrannt aussehende Hände von sich.
Diesen Schrecken galt es zu bannen. „Ta-da-schi“, buchstabierte Alice sich durch den Namen auf dem Kuvert, um ihn sich einzuprägen. Diese Silben triumphierend krakeelend, sprang sie die Treppe hinunter.
„Ta-da-schi, Tadaschi, Tadaschi!“ Sie rief es in einem eigenartigen Singsang, um das Wort von seiner Bedeutung zu trennen, ihr aufgekommenes Entsetzen zu vertreiben, während sie auf der Suche nach ihrer Mutter durch das Haus stolperte.
Mit einem feuchten Geschirrtuch in der Hand trat Teresa aus der Küche in den Flur.
„Ta-da-schi, Ta-da-schi“, krähte Alice übermütig.
Teresa schwenkte ihr Geschirrtuch durch die Luft. „Hör‘ sofort damit auf! Sei still!“
Wie ein Rumpelstilzchen hüpfte Alice in der Diele herum.
„Was hattest du da oben zu suchen?“
„Ta-da-schi, Tadaschi, Tadaschi …“
„Sei endlich still!“, schrie ihre Mutter sie an.
Alice sprang in die Höhe und stellte sich breitbeinig auf. „Tadaschi!“, rief sie ein weiteres Mal, ausgelassen und laut. „Was soll denn das überhaupt sein, ein Tadaschi?“
Teresa knüllte ihr feuchtes Tuch zu einer Kugel, warf es nach ihr, wandte sich ab und verschwand in der Küche. Doch bevor sie die Küchentür hinter sich schloss, fuhr sie sich mit dem Handrücken über die Augen.
Wie angewurzelt verharrte Alice erschrocken im Flur. Sie überlegte, warum Teresa wütend und so traurig war und fand keinen Grund. Sie hatte erwartet, dass ihre Mutter sie wie gewohnt in die Arme nehmen, ihr alles in Ruhe erklären würde. Sie verstand nicht, wieso sie sich plötzlich ganz anders verhielt.
Die verbrannten Gesichter ließen sich nicht aus ihrem Gedächtnis vertreiben. Sie schlichen sich nachts in ihr Zimmer, genau wie auch der gekreuzigte Jesus aus dem Klassenzimmer ihrer Grundschule, wenn sie im Dämmerlicht in die Kuhle ihrer Handflächen starrte und ihre Fingernägel tief in sie hineingrub. Sie stellte sich den Schmerz vor, den rostige, durch die Hände getriebene Nägel oder am Körper herabhängende Hautfetzen verursachen würden. Die Bilder setzten sich vor ihre Augen, in den Wochen der Vorbereitung auf die Kommunion, sonntags im Hohenzollernpark, auf ihrem einsamen Weg zur Beichte. Ihre Eltern gingen nicht in die Kirche. Sie durften zu Hause im Bett liegen bleiben.
Ihren ersten Liebeskummer erlebte Alice mit fünfzehn.
Daran, was ihre Mutter ihr damals offenbarte, erinnert sie sich noch heute. „Leidenschaften misshandeln die Lebenskraft“, erklärte Teresa, „das bisschen Verstand, das man hat, kann man dann auch noch verlieren. Gerade wenn Leidenschaften wüten, sollte man in Liebesdingen einen klaren Kopf behalten.“
Sie streckte die Hand nach ihr aus und streichelte Alice übers Haar. „Glaub' mir, das geht vorbei. Denk nicht, dass das von mir oder Opa ist. Der erste Satz ist von Schiller, der zweite von Goethe. Die Worte waren vielleicht anders, aber so ähnlich jedenfalls.“ Sie zog ihre Tochter an sich, umarmte sie und sagte: „Ich weiß, wie es sich anfühlt, verlassen zu werden. Ich musste das dreimal erleben.“
„Dreimal? Wieso?“
„Zuerst verstarb meine beste Freundin Ina, da war ich erst zwölf …“
„Und dann?“
„Dann starb Herbert, mein erster Mann.“
„Aber du hast doch dreimal gesagt.“
Nach einigem Zögern gestand Teresa:
„Beim dritten Mal war es besonders schrecklich. Ich war völlig verzweifelt, noch dazu weit weg von zu Hause, in Japan. Dabei war ich am Anfang so unendlich glücklich wie du vielleicht auch. Allerdings war ich damals schon dreiundzwanzig.“
„Hast du damals auch so gelitten wie ich?“
„Ganz furchtbar, ja.“
„Wegen wem denn, wer war das?“
„Das ist es ja. Der Mann war etwas Besonderes, er war …“
„Besser als Papa?“
„Ganz anders, viel eigenwilliger und verschlossener. Ein Idealist, der gegen bestehende Missstände ankämpfte. Das war sehr ungewöhnlich für einen Japaner zum damaligen Zeitpunkt. Er hat …“ Teresa stockte, betrachtete ihre Fingernägel, steckte ihren Zeigefinger in den Mund und biss an einem Hautfitzel herum.
„Mama, nicht. Das reißt ein und blutet. Nachher sieht das wochenlang hässlich aus.“
Teresa hob ihre Hüfte, schob die verletzte Hand unter den Schenkel und setzte sich darauf.
„War das der mit den Fotos, oben unterm Dach?“
Nachdenklich betrachtete Teresa die Fingernägel ihrer wieder hervorgezogenen Hand und schwieg.
„Also der, der muss völlig verrückt sein, die Leute krümmen sich vor Schmerzen in irgendwelchen Trümmern und der fotografiert die dabei auch noch? Wer macht denn sowas!“
„Das mit den Fotos, Alice, das ist eine ganz andere Sache.“
„Wieso?“
Teresa schwieg.
„Und? Warum sagst du jetzt nichts?“
„Jetzt nicht, Alice. Eines Tages werde ich dir alles erklären.“
So sehr Alice auch in sie drang, aus Teresa war nichts mehr herauszubringen.
Alice konnte sich nicht vorstellen, dass ihre Mutter, eine brünette Schönheit, die wunderbar singen und sich wie ein Mannequin bewegen konnte – „Versuchs mal, Alice, immer zwei Bücher auf dem Kopf“ – jemals unter einem auch nur annähernd so furchtbaren Liebeskummer gelitten haben könnte, wie sie selbst in diesem Moment. Teresa doch nicht!
Eines Nachmittags, etwa zwei Jahre später, mochte Teresa sich gedacht haben, es sei an der Zeit, sie ins Vertrauen zu ziehen. Alice war gerade siebzehn geworden. Sie waren allein zu Haus. Alice lag dösend auf ihrem Bett, als Teresa an ihre Zimmertür klopfte.
„Hast du kurz Zeit? Ich würde gern mit dir reden.“
Unentschlossen vor sich hin grummelnd erhob sich Alice und folgte ihrer Mutter ins Wohnzimmer. Es war einer jener schwer erträglichen Tage kurz vor ihrer Menstruation, an denen sie besonders leicht reizbar war. Sie litt unter Bauchkrämpfen und ärgerte sich, dass ihre Mutter alles, worüber sie sich in solchen Zeiten aufregte, auf ihr prämenstruelles Syndrom schob. Was, fragte sie sich, hat das mit meinen Gedanken zu tun?
„Erinnerst du dich noch an den schlimmen Liebeskummer, wegen dieses Jungen …, dieser Lange, Dunkelhaarige aus deiner Klasse, wie hieß er noch mal?“
„Siggi“, brummte Alice.
„Siggi, genau“, sagte Teresa. Ihre Stimme klang belegt. „Damals hielt dich für zu jung, war noch nicht bereit, mit dir über meine Erfahrungen in Japan zu sprechen …“
Teresa saß neben dem Fenster, das sie nach dem Betreten des Zimmers verschlossen hatte, hielt ihre Augen gesenkt und fummelte an dem Gardinenstoff herum. Der Boden vibrierte leicht und von unten drang das Geräusch eines vorbeifahrenden Lastwagens herauf. Alice blick fiel auf das gerahmte Foto an der Wand: Teresa im Kimono, vor einer dunstigen Seenlandschaft, inder Inseln wie verwehte grüne Moosmützen schwammen.
„Wieso weiß ich eigentlich bis heute nicht“, lenkte Alice ab, „wo genau das ist? Auf meinem Globus finde ich die Inseln nie, obwohl ich mir Japan so oft darauf ansehe!“
„Du hast mich nie danach gefragt, Kind. Wenn es dich interessiert, zeige ich sie dir nachher, kann ich jetzt nicht einfach mal erzählen?“
Alices Tonfall hatte den Charme eines stacheligen Igelfisches, als sie sagte: „Klar doch, nur zu, du bist es doch, die das will.“
Teresas Blick wurde glasig. Sie schluckte.
„Ich möchte mit dir über etwas im Zusammenhang mit Tadashi Yamamoto reden“, begann sie erneut.
„Also mich interessiert eher, wie du es fertiggebracht hast, Papa kurz nach deiner Rückkehr aus Japan so schnell einzuwickeln, dass er dich gleich geheiratet hat. Ich kenne nämlich niemanden, den ich nach so kurzer Zeit heiraten würde.“
In Wirklichkeit ärerte sie sich über etwas anderes. Der Grund für ihre schlechte Laune war, dass der einzige Junge in ihrer Schule, für den sie sich gerade interessierte, ausgerechnet ihre Erzfeindin, eine rothaarige Klassenkameradin, zum Abschlussball der Tanzschule eingeladen hatte.
„Ich kannte Papa schon von früher“, erklärte Teresa, „ich meine, bevor ich nach Japan fuhr. Willst du jetzt hören, was ich dir erzählen will?“
„Auf einmal? Als Kind durfte ich das Wort Tadashi nicht einmal aussprechen. Ein Handtuch hast du nach mir geworfen! Am nächsten Tag hast du mich angeschrien, weil ich diesen blödsinnigen Namen gesummt habe. Lass dir nicht einfallen, dein Gesinge auch noch in Papas Gegenwart zu produzieren, hast du gebrüllt.“
„Ich habe bestimmt nicht gebrüllt. Aber was macht dich eigentlich so sauer, was habe ich dir getan?“, fragte Teresa mit pikiertem Gesichtsausdruck.
„Es ist ganz einfach: Der Typ interessiert mich jetzt nicht mehr, so simpel ist das, erst recht nicht, wenn er dein Lover war.“
Noch einmal versuchte Teresa, auf die verstockte Alice einzugehen.
„Ich verstehe nicht, was dich plötzlich so wütend macht. Er war ein weltbekannter Fotograf, ein ungewöhnlich verantwortungsvoller, aufrichtiger und mutiger Mensch, ein Idealist, aber gleichzeitig …“
Alices Augen verengten sich. Weltbekannt, wenn sie das schon hörte. Sie würde sich von Teresa nicht zur Komplizin gegen den Vater machen lassen! Ihre Mutter wollte ihr doch nur wieder einmal beweisen, dass auch sie einmal jung war, wie unvergleichlich und einzigartig sie war, über wie viel mehr an Erfahrung sie verfügte! Was glaubte sie, wen sie vor sich hatte?
Ein kleines Kind? Sie stierte Teresa herausfordernd an.
„Deine Liebhaber interessieren mich nicht die Bohne!“
Ein flüchtiger Blick auf ihre verdutzte Mutter und Alice stürmte zur Wohnzimmertür hinaus, warf sie geräuschvoll hinter sich zu und zog sich in das angrenzende Zimmer zurück. Sie sonnte sich in dem erhebenden Gefühl ihrer Selbstgerechtigkeit. Eine kurzsichtige, verbockte Elektra, die sich leidend ihrem unkontrollierten Eigensinn hingab. Sie war weder bereit, die Gefühle ihrer Mutter wahrzunehmen, noch auf sie einzugehen.
Teresa würde sowieso eines Tages noch einmal mit der Geschichte ankommen.
Aber sie tat es nie wieder.
„Endlich rückst du mit der Sprache heraus“, sagt Margot nachdenklich, „ich habe ja geahnt, dass da was nicht stimmt! Und ihr habt wirklich nie mehr darüber geredet? Übrigens lecker, deine Pistazien.“
Alice erhebt sich, öffnet eine Schublade, greift nach der Tüte mit den Pistazien und kippt den Rest in das vor Margot stehende Keramikgefäß. Margot fasst sofort hinein.
„Danke, die sind köstlich! -- Dass du das schleifen lässt, hätte ich dir gar nicht zugetraut, so gründlich, wie du sonst immer bist.“
„Bei meinen Patienten, aber bei mir selbst? Ich war verwöhnt und egoistisch. Es nervte mich, dass Teresa mir alles verzieh. Ich nahm ihr das insgeheim übel, trieb die Situation auf die Spitze und während der Studienzeit, bei meinen kurzen Besuchen zu Hause, gab es immer einen triftigen Grund, das nicht anzusprechen.“
„Ist doch normal. Als Gör hast du deinen Widerstand ausgetestet, na und? Du schämst dich doch nicht etwa dafür?“
„Hätte ich vielleicht tun sollen, aber ich glaubte ja, ich hätte noch unendlich viel Zeit.“
„Und was ist mit Japan, um das du so viel Brimborium machst?“
„Ich gebe zu, dass das merkwürdig ist. Halt‘ mich für verrückt, aber
… seit dem Tag meines ersten Liebeskummers trage ich das Land – lach jetzt nicht – wie eine Art warmes, beglückendes Licht in mir.“
„Also ehrlich! Du findest aber schon selbst, dass das ziemlich schwülstig klingt!“
„Mag sein, aber genau so war es. Ich verband Japan und den Namen Yamamoto mit romantischen Liebesgeschichten und intensiven Gefühlserfahrungen. Japan war zum Ziel meiner kindlichen Sehnsüchte geworden. Hast du nie etwas Ähnliches erlebt?“
Margot grinst.
„Nee, bedaure, ganz ehrlich, nein. Du kommst mir vor wie …“
Margot grinst.
„…meine bekloppten Patienten?“
Margot lacht auf. „So könnte man es ausdrücken. Aber wenn du dich weiter von denen anstecken lässt, was soll ich tun? Dich überweisen? Du weißt genau, dass ich mich damit nicht auskenne!“
Alice seufzt. „Hat sich dein Vorrat an Sarkasmus jetzt langsam erschöpft? Du bist eine so gute Seele, aber lass besser meine Patienten in Ruhe. Die sind meist weniger irre als deine raffgierigen Kollegen.“
Mit der flachen Hand streicht sie über ihren maisgelben Paschminaschal. Teresa hatte ihn ihr geschickt, einfach so, nach dem letzten Telefonat.
„Ach komm, Alice, du kennst mich doch.“
„Eben. Ein Fuhrwerk gezogen von Ackergäulen. Nur dass die Karosse eine ganz andere Farbe als meine hat.“
Margot versteht. Alice meint Toleranz von Unterschiedlichkeiten. „Ich will deine heiligen Kühe nicht schlachten, aber was dich an Japanern interessiert, habe ich noch nie verstanden. Für mich sind die so spießig und festgefahren wie die Blümchenmuster ihres Modezars Kenzo.“
„Immerhin bewahren sie ihre Traditionen und vertreten ihr Land geschlossen nach außen. Mich ärgert der Verfall unserer moralischen Gerüste. Und die ewige Selbstbeschimpfung der Deutschen halte ich mittlerweile für würdelos!“
„Jajaja, und die instrumentalisierte Lebensführung, die Verlogenheit der Politiker, das kulturelle Desinteresse, die politische Trägheit der Bevölkerung, was noch?“
„Unsere Vereinigung der Kassenärzte …“
„Ach, Alice, sei nicht so naiv. Glaubst du, in einem hochzivilisierten Land wie Japan gäbe es weniger Schmierentheater als bei uns?“
„Weiß ich nicht. Irgendwann hab‘ ich mir geschworen, in bestimmten Punkten naiv bleiben zu wollen und zu kämpfen, bis ich siebzig bin. Nenn‘ es meinetwegen die kitschige Suche nach der blauen Blume der Romantik, nach einem ausgestorbenen Helden vielleicht.“
„Mal was anderes“, fragt Margot, „wann warst du eigentlich zum letzten Mal zu Hause?“
„Du meinst, bei meinen Eltern?“
„Was sonst?“
„Anlässlich der Beerdigung, nur für drei Tage. Sie waren umgezogen, wohnten zum Schluss in der Nähe von München. Es war furchtbar, mich in dem Haus zu bewegen. Meine Mutter schlich noch in jeder Hausecke herum, mein Vater schien sich hinter jeder Staude zu verstecken. Früher ging er in der Gartenarbeit auf. Ständig dachte ich: Gleich kommt er mit seiner Heckenschere hinter irgendeinem Rhododendronbusch hervorgeschossen und ruft ‚Guckuck!‘, ausgelassen und gutgelaunt wie früher. Ich habe das Telefon gekündigt und der Post einen Nachsendeauftrag an meine Adresse erteilt. Ich vermeide bis heute, mir Gedanken über das Haus zu machen. Es zum Kauf anzubieten, bringe ich nicht übers Herz.“
Überraschung
Alice hat einen Apfelkuchen in den Backofen gestellt, die Küche ist das reinste Schlachtfeld. Alles ist schmierig, die Schüsseln, der Boden, und der Mehlstaub hängt ihr noch in den Wimpern. Sie säubert gerade die mehlverklebte Arbeitsplatte, als es an der Haustür klingelt. Wie immer im unpassendsten Moment. Kurz überlegt sie, den Besuch zu ignorieren, aber schließlich hält sie ihre Hände doch unter den Wasserhahn, trocknet sie sorgfältig ab, streicht sich eine aufsässige Haarsträhne aus der Stirn und öffnet die Haustür. Den Mann davor kennt sie bisher nur in Anzug und Krawatte. Wie lange ist das jetzt her, zwei oder schon drei Jahre? Kräftig und hoch aufgeschossen – ein betagter Student in Jeans und Pullover – stemmt er sich zwanglos gegen den Türrahmen. Damals war zuerst Frida, seine Frau, in die Praxis gekommen, hat er jetzt Probleme? Und da sucht er sie in ihrer Privatwohnung auf? Um diese Zeit?! Alice ist zu überrascht, um Jason hereinzubitten. Er fängt ihren irritierten Blick auf, sieht unschlüssig auf die Fußmatte. Dann überrollt er sie, hastig und dröhnend. So hat sie ihn Erinnerung: ein vorpreschender Mercedes beim Überholmanöver.
„So, wie du mich ansiehst, Alice, hast du vermutlich deinen Anrufbeantworter nicht abgehört. Ich habe mehrfach versucht, dich zu erreichen, fliege aber morgen zurück, deshalb …“
Alice zieht die Haustür weiter auf und reicht ihm die Hand.
„Hallo, Jason, entschuldige bitte. Komm erst mal herein. Trinkst du einen Tee mit mir?“
„Gern, wenn es kein japanischer grüner ist. Aber nur kurz, ich muss morgen ziemlich früh raus.“
Alice schaut ihn verwundert an. Sie geht vor, um die Tür zur Küche zu schließen.
„Seid ihr umgezogen?“, fragt sie und führt Jason ins Wohnzimmer.
„Die Firma hat mich vorübergehend nach Tokio versetzt. Das war auch der Grund meines Anrufs. Um dich zu fragen, ob du uns dort nicht besuchen willst.“
Alice macht große Augen. Mit geöffnetem Mund bleibt sie einen Moment lang sprachlos vor ihm stehen. Ausgerechnet Japan?
„Ist nicht dein Ernst!“ Dann, etwas gefasster, fügt sie hinzu: „Tokio! Du machst tüchtig Karriere, stimmt‘s?“
„Wie man‘s nimmt“, antwortet Jason, der noch immer mitten im Raum steht. „Ich leite vorübergehend die Kautschukabteilung an unserem dortigen Firmenstandort, zusammen mit einem Japaner. Wir wissen nicht, wie lange wir noch bleiben müssen, bis der Japse die Abteilung allein übernehmen kann.“
Japse? Alice horcht auf.
„Von den Japanern musst du mir gleich mehr erzählen“, sagt sie und verschwindet in der Küche.
Dort stellt sie das Teegeschirr auf ein Tablett, kramt ihre Teedosen durch, zögert kurz und gießt dann einen Darjeeling auf. Als sie ins Wohnzimmer zurückkehrt, steht Jason nach wie vor aufrecht mitten darin herum.
„Warum setzt du dich nicht?“
Mit ausgestreckter Hand nickt sie Jason zu, stellt das Geschirr auf den Couchtisch und beschließt, ihre Antennen für das von ihm nicht Gesagte stärker auszufahren.
„Japan, mal ehrlich, der Geldbote einer Lottogesellschaft käme weniger überraschend.“
„Naja, alternativ hätte man uns nach Südamerika geschickt. Spielst du Lotto?“
„Ich? Um Gottes willen!“
Alice ist verwundert. Weniger darüber, dass ein ehemaliger Patient sie zu sich einladen möchte oder dass er sie nach so langer Zeit und um diese Uhrzeit in ihrer Privatwohnung stört. Aber dass jemand sie zu sich ins Ausland, noch dazu nach Japan einlädt, das kommt ihr seltsam vor. Außer von ihren Eltern ist ihr bisher nichts geschenkt worden. Ihren Patienten erklärt sie, dass man für das Positive in seinem Leben selbst verantwortlich ist, dafür etwas tun muss.
„Und um von Japan zu reden, hör mal, ich bin doch kein Krösus, das Land soll doch wahnsinnig teuer sein.“
„Stimmt. Aber erstens, für dich ist uns gar nichts zu teuer – und zweitens kann man das, was wir dir schulden, mit Geld ohnehin nicht wieder gutmachen.“
Jason, welch‘ wohltuende Galanterie! „Habt ihr doch schon. Und zwar nicht zum Kassensatz!“ Sie grinst vielsagend und zwinkert ihm zu.
Jason geht nicht darauf ein. „Ich mache es kurz“, entgegnet er stattdessen bestimmt, „die Firma zahlt satte achttausend Mark monatlich für unsere Unterkunft, mitten in Tokio. Erwarte nicht zu viel, es ist nur ein kleines Reihenhaus, für Tokio nicht anders zu erwarten, aber wir haben ein Gästezimmer, so günstig kommst du nicht mehr nach Japan, es ist also eine einmalige Gelegenheit.“ Alice sieht an die Decke und geht ihre Optionen durch. Kindheitsträume von rotleuchtendem Ahorn und blühenden Kirschbäumen werden wach und außerdem … Aber es verbietet sich von selbst: Bei ehemaligen Patienten kommt man aus seiner Rolle letztlich doch nicht heraus. Das weiß jeder Therapeut, und sie wird sich keine grauen Haare holen, weil sie gegen ihr besseres Wissen agiert.
„Super Idee, Jason, wirklich schade, aber im August fliege ich für eine Woche auf die Malediven, das lässt sich auch nicht verschieben, die Reise ist bereits bezahlt. Und Ende Oktober gehts mit dem Tauchclub für zwei Wochen nach Kuba. Irgendwann muss ich auch arbeiten.“
Er reagiert mit einer abwehrenden Handbewegung auf ihre Absage.
„Ach komm, Alice, Kuba kannst du sicher verschieben! Du sollst bei uns auch weder den Onkel Doktor noch den Beichtvater spielen, versprochen.“
Alice ist keine Berufsanfängerin und kann den Wert ihrer Arbeit realistisch einschätzen, klar, aber die Einladung scheint allzu durchdacht. Da steckt doch noch etwas anderes dahinter!
Andererseits hat sie Jason als einen realistisch denkenden, offen und ernsthaft argumentierenden Menschen kennengelernt, der Schmeicheleien vermeidet. Sicher, er war dominant, konservativ, hartnäckig und oft etwas festgefahren, aber hinterhältig war er nicht.
„Also geht es euch beiden so richtig gut?“
„Wenn du das meinst, was ich denke, ja. Andererseits … Frida kommt derzeit kaum aus dem Haus, weil wir jetzt zu dritt sind.“
„Ehrlich? Ein Baby? Und das sagst du erst jetzt? Herzlichen Glückwunsch!“
„Du kannst Marc-Antoine besichtigen, wenn du kommst.“
„Marcus Antonius? Da hätten sie dich wohl besser nach Rom statt nach Tokio geschickt.“ Alice lacht.
„Machst du es wie die Japaner?“ Jason grinst. „Ständig hängen sie uns ihre bildungsstrotzenden Kommentare vor die Nase.“
„Dann befürchten sie bei dem Namen vielleicht, dass euer Kronsohn sich eines Tages des Staatsschatzes bemächtigt, gegen böse Kaisermörder zu Felde zieht und …“
„Komm, Alice, sag ja! Die beste Gelegenheit, dich selbst mit dem Bildungskomplex der Japaner herumzuschlagen. Übrigens brauchen wir selber Urlaub und würden zusammen mit dir eine Woche nach Miyakojima, einer Insel südlich von Okinawa, fliegen. Kannst du deine Kubareise nicht noch absagen?“
„Okinawa? Wow! Dort müssen doch noch jede Menge Wracks von amerikanischen und japanischen Kriegsschiffen unter Wasser liegen!“ Schon die Vorstellung, die Reste dieser stählernen, toten Riesen zu sehen, berauscht Alice. „Bisher habe ich nur ein vor Male liegendes Handelsschiffswrack, die Victory, betaucht.“
„Ich erkundige mich danach, Alice, wenn du dich für Kriegsschiffe interessierst.“
„Doch nicht für Kriegsschiffe, nicht so schnell, Jason.“ Alice beißt auf ihrer Unterlippe herum. „Es geht wirklich nicht, Jason. Ich will die Kubareise nicht absagen, das gäbe Ärger im Tauchverein, die mögen kein Hin und Her. Außerdem arbeitete ich nebenbei noch als Mitherausgeberin einer Zeitschrift, für die ich mich verpflichtet habe, regelmäßig Beiträge zu liefern. Mehr kann ich mit meiner Praxistätigkeit und den überfälligen Fortbildungsveranstaltungen beim besten Willen nicht kombinieren.“
Tausend Gründe, warum es nicht geht. Keine Chance.
Jason erhebt sich und sagt:„Jedenfalls haben wir dich, wie du siehst, nicht vergessen. Wenn du wüsstest, wie oft wir an dich denken! Überleg dir das noch mal mit Kuba! Wenn Danielle Mitterrand erst mal aufgehört hat, für den bärtigen Mann zu schwärmen, hast du den sogar für dich ganz allein. Naja, abgesehen von all den kubanischen Revolutionärinnen …“ Er grinst.
„He, du bist ja ganz schön aufgekratzt! So kenne ich dich gar nicht.“
„Dann wird es Zeit. Wer sprach denn davon, wie wichtig es für Therapeuten ist, ständig dazuzulernen? Also – Frida und ich, wir rechnen fest mit dir!“
Er steckt ihr eine mit japanischen Schriftzeichen bedruckte Karte zu und weist mit dem Finger darauf. „Diese unzeitgemäßen Hieroglyphen hier nennt man kanji“, erklärt er spöttisch, „aber auf der Rückseite steht die Adresse und Telefonnummer für unsereins lesbar, in romaji.“
„Danke dir, Jason, ich betrachte eure Einladung als ein dickes Geschenk.“
„Genau! Du kommst also!“
Alice japst lachend nach Luft.
„Nein wirklich Jason, mich freut die Idee. Aber ich werde euch anrufen, ok? Moment mal, wann ist denn bei euch Abend?“
Kurz darauf weiß Alice Jasons Antwort nicht mehr, so sehr beschäftigt sie die Möglichkeit der so lange ersehnten Japanreise.
Von dem Tee, obwohl weder grün noch japanisch, haben beide nichts getrunken.
Der Entschluss
Das Telefon hört nicht auf zu klingeln. Auf keinen Fall wird sie jetzt aufstehen, sich abtrocknen, zum Telefon hasten, nur um dann festzustellen, dass der Anrufer gerade aufgelegt hat. Sie atmet den wohltuenden Dampf des beruhigenden Badezusatzes ein und schließt ihre Augen dabei.
Endlich. Das Klingeln verstummt. Zufrieden gleitet Alice bis zum Hals unter Wasser. Sie überlegt, noch heißes Wasser nachlaufen zu lassen, da unterbricht das Telefon erneut ihre Entspannung. Der nachhaltig schrille Ton zerrt an ihrer Ruhe.
„Das muss ja etwas furchtbar Wichtiges sein“, grummelt sie vor sich hin, „wehe, wenn nicht!“ Widerwillig steigt sie aus der Wanne, wickelt sich ein Badetuch um den Körper und tastet mit den Füßen nach ihren Frotteepantoffeln. Wo nur hat sie das verdammte Telefon bloß wieder versteckt? Ach ja, zwischen den Sitzkissen der Couch, eine Decke hat sie auch noch darübergelegt.
„Ja bitte?“
„Frau Amberg?“
„Am Apparat!“
„Stefan Ferency hier – störe ich? Ich dachte, tagsüber hätten Sie erst recht keine Zeit.“
„Oh, guten Abend Stefan, wie geht es Ihnen und unserem ‚Kind‘?“
Alice denkt an das gemeinsame, von ihm initiierte Projekt, die „Zeitschrift für Kindheit“.
„Es gibt Erfreuliches. Mit Wirkung vom ersten Februar des nächsten Jahres kooperieren wir mit dem Juveniles-Verlag. Das beendet die Unsicherheit mit unserem bisherigen Verlag, vor allem natürlich hinsichtlich des Vertriebs. Und das Beste: Juveniles kümmert sich auch um die Werbung.“
Seine Stimme verrät Erleichterung.
„Das freut mich, Stefan, ich weiß ja, welche Sorgen Sie sich gemacht haben. Aber deswegen rufen Sie doch nicht an?“
Mit angewinkeltem Arm presst Alice ihr nasses Badetuch fester
gegen die Brust.
Ferency lacht.
„Sie haben recht. Erstens freue ich mich, die Kontinuität unseres Projektes in der Autorengemeinschaft mit Ihnen wahren zu können. Alice Miller hat uns für die nächste Ausgabe wieder einen Artikel zur Verfügung gestellt, für die übrigens auch Ihr Text ‚Himmlisches Loch‘ vorgemerkt ist. Überhaupt, es geht aufwärts.“s
Wachgerufen fragt Alice:„Und sonst?“
„Das ist der nächste Punkt. Wo unser Baby nun fast in trockenen Tüchern liegt“, sagt Ferency übertrieben vergnügt, „denke ich, dass es nicht zu früh für die langfristige Planung eines Themas ist, das mir am Herzen liegt: Die Kinder von Hiroshima. In knapp zwei Jahren jährt sich der Abwurf der Atombombe in Hiroshima und Nagasaki zum 35. Mal. Ich habe vor, dem Thema eine ganze Ausgabe zu widmen. Was halten Sie davon? Ich möchte Sie rechtzeitig darauf einstimmen, denn ich hätte gern auch von Ihnen einen Artikel dazu.“
Alice schweigt, wie vom Donner gerührt.
„Alice? Sind sie noch dran?“
„Ja doch, ja.“
„Mein Vorschlag kommt wohl sehr überraschend?“
„Ja …, nein, mich verwirrt etwas anderes“, in Alices Stimme liegt ungläubiges Staunen. „Eine Duplizität der Ereignisse sozusagen. Ich erhielt kürzlich eine private Einladung nach Japan …“
„Na, das ist doch großartig!“
„Ich habe sie allerdings abgelehnt.“
„Eine Einladung nach Japan? Da sagen Sie nein?“
„Von irgendwas muss ich auch leben. Wer kann denn ständig verreisen, bei laufender Praxis? Andererseits …“ Alice denkt angestrengt nach, „wenn Sie Japan als Schwerpunkt für eine Ausgabe planen … Wissen Sie was? Geben Sie mir eine Woche Zeit. Bis dahin versuche ich, etwas zu klären.“
„Ja, bitte, tun Sie das.“ Seine Stimme wird plötzlich kleiner, betroffener. „Die Wahrheit ist, dass ich doch ziemlichen Ärger mit dem alten Verlag hatte, der sich ständig über die mangelnde Expansion unserer Zeitschrift beschwerte. Bei den Jugendämtern und Kindergärten, in denen unsere Adressaten sitzen, hat ja keiner mehr Geld. Andererseits gieren die Fachreferenten, unsere Leserschaft dort, immer nach zugkräftigen, aktuellen Themen. Die Kinder von Hiroshima, zum Jahrestag des Atombombenabwurfs, das wäre ein Aufhänger, finden Sie nicht?“ Es klingt wie eine dringende Bitte.
„Ich muss zunächst abklären, ob sich die Einladung zum Arbeiten zweckentfremden lässt.“
„Sollten Sie sich entschließen, hätten Sie meine volle Unterstützung. Auch bei der Suche nach weiteren Veröffentlichungen, sogar, falls erforderlich, durch einen anderen Verlag. Versprochen!“ Begeistert von der Perspektive einer kostenfreien Recherche vor Ort erreicht Ferencys Stimme jetzt ungewohnte Höhen.
Mit der rechten Hand zieht Alice ihr heruntergerutschtes Duschtuch wieder hoch.
„Ich werde darüber nachdenken.“
Der Grund, weshalb sie Artikel für Stefan Ferencys Projekt, die „Zeitschrift für Kindheit“ schreibt, ist eine unterbewusste Suche nach Erfolgserlebnissen. Anders als die ermüdende Abfassung von Krankenkassenberichten, macht diese Arbeit ihr Spaß. Das spärliche Honorar, das Ferency ihr dafür zahlen kann, bezeichnet sie lächelnd als ihr „kleines Zubrot“. Sie weiß, dass die Zeitschrift Schwierigkeiten hat, sich auf dem Markt durchzusetzen. Aber vorne, im Inhaltverzeichnis steht ihr Name neben dem von Alice Miller. Alles eine Frage des Niveaus. Aber davon, denkt Alice, hat die Psychoanalytikerin mehr als sämtliche Bonzen der VdK ihrer Stadt zusammen. Alice ahnte von Anfang an, dass der Verlag, der seit seiner Gründung versuchte, seinen Leserstamm zu vergrößern, immer mehr in Bedrängnis gerät. Kinder haben eben keine Lobby.
Ob sich Yamamoto für Kinder eingesetzt hat? Für die Kinder von Hiroshima?
Nach Ferencys Anruf quellen Überlegungen zu dem Japanprojekt wie Seiten aus einem Faxgerät in ihr hervor. Alice überdenkt die sich ihr bietenden Perspektiven. Würde sie tatsächlich mit Jason und Frida nach Miyakojima fliegen, wäre sie tagsüber mit dem Tauchschiff unterwegs und käme erst am Abend zurück? Nach dem Abendessen würden sich die beiden bestimmt früh zurückziehen, wegen des Babys, weil sie, genau wie sie selbst, am nächsten Tag wieder früh aufzustehen müssten. Nach dem gemeinsamen Rückflug nach Tokio könnte sie sich preiswerte Hotelunterkünfte für ihre weiteren Ziele in Japan besorgen. Jason, mit seinen Beziehungen, würde ihr vielleicht dabei helfen, Kontakte zu geeigneten Interviewpartnern herzustellen.
Besser geht es doch gar nicht! Auf diese Weise würde sie sich die aktuellsten Untersuchungsergebnisse zum Verhalten von Kindern und Jugendlichen der Nachkriegsgeneration beschaffen.
Dann, wie ein Leitblitz, trifft sie der Gedanke an Tadashi Yamamoto.





























