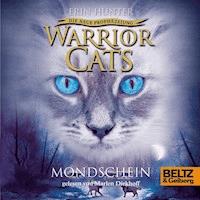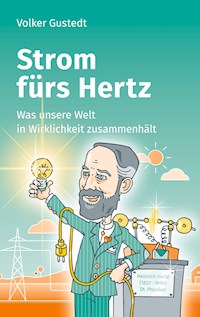
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Es ist merkwürdig. Unser modernes Leben ist ohne ein "Produkt" undenkbar, dass man weder sehen, riechen, hören oder schmecken kann: Elektrizität. Dieses kleine Buch soll dabei helfen, auf unterhaltsame Weise einen Einblick in die Welt der Stromerzeugung, des Stromtransportes und auch des Stromhandels zu bekommen. Darin wird keine einzige Formel und keine Gleichung verwendet. Versprochen! Stattdessen nutzt der Autor sportliche, soziologische, historische, religiöse und anekdotische Erklärungen für das Phänomen Strom.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
1.
Woraus besteht Strom?
1.1 Eine funkensprühende Göttin
1.2 50 Hertzchen für Heinrich Hertz
1.3 Heiße Haare und viel Watt
1.4 Spannung wie im Kino
1.4 AC/DC, Beyoncé und das IKEA-Kinderparadies
1.5 Ampere als Sättigungsbeilage
1.6 Das Ohmsche Kindheitstrauma
1.7 Mega-, Giga- und Teramäßig
2.
Wer macht Strom?
2.1 Malocher im Kraftwerk
2.2 Einfach mal Sonne tanken
2.3 Viel Wind um den Wind
3.
Wie kommt Strom von A nach B?
3.1 Rechte Masche, linke Masche
3.2 Der neue Smog
3.3 Strommasten zum Mitraten
3.4 Hightech im Mantel
3.5 Ausflug zum Umspannwerk
3.6 Konvertiten und Konverter
3.7 NICHTS
3.8 Nähen, flicken, kaufen
3.9 Netze im Vergleich
3.10 Tour der Blindleister
3.11 Muttis Türsteher
4.
Strom als Ware
4.1 Oma Krause kauft Tomaten
4.2 Ist der Strom wirklich »Bio«?
4.3 Schock, Terror, Abzocke
4.4 Im Stromplanschbecken
4.5 Strom auf Vorrat
4.6 Geisterstrom und Flaschenhälse
4.7 Zugenähte Hühnerhintern
4.8 Und die Sünder müssen zahlen
5.
Der Strom und die Paragrafen
5.1 Meine Top 10 des Energierechts
5.2 Belohnung statt Prügel
6.
Wird der Strom auch digital?
6.1 Internet of good Energy
6.2 Herr Tur Tur und die Blockchain
7.
Abspann
7.1 Herz und Hertz
Danke
Vorwort
Es ist merkwürdig. Unser modernes Leben ist ohne ein »Produkt«, das man weder sehen, riechen, hören oder schmecken kann, undenkbar. Und natürlich sollte man dieses »Produkt« auf keinen Fall anfassen. Das lernen wir schon als Kleinkind. Hätte man diese Ware vor 500 Jahren auf einem mittelalterlichen Markt feilgeboten, man wäre wegen Blasphemie geteert, gefedert und aus der Stadt gejagt worden. Oder Schlimmeres.
Heute leben wir in einer total elektrifizierten Welt. Strom ist einfach immer da, rund um die Uhr, ständig. Wir brauchen nur einen Stromanschluss wie eine Steckdose – schon werden wie von Zauberhand Millionen Dinge möglich. Frei nach Goethes Dr. Faust, der an der Wissenschaft verzweifelte und in der Magie seine Erlösung suchte, ist Strom der Stoff, der unsere heutige Welt im Innersten zusammenhält.
Ohne eine dauerhafte Stromversorgung und eng gewebte Netze zu dessen Transport würde das zivilisierte Leben zusammenbrechen. Wir hätten kein Licht, kein fließendes Wasser, keine Heizung, kein Telefon und keine Medieninformationen. Wir könnten nirgendwo bezahlen, weil Geldautomaten und Kassen ihren Dienst verweigern würden. Unternehmen und öffentliche Einrichtungen würden allenfalls im Notbetrieb arbeiten, Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser inbegriffen. Der Nachschub an Nahrungsmitteln, Medikamenten und anderen Dingen des täglichen Bedarfs würde versiegen, weil ohne Strom nichts produziert und auch nichts transportiert werden kann. Eine Welt ohne Strom wäre eine Welt des Chaos und des Elends, zumindest bei uns in der sogenannten industrialisierten modernen Welt.
Und obwohl die Menschen an diesem lebensnotwendigen Stoff hängen wie der Junkie an der Nadel, kennen sich die wenigsten damit aus. Die meisten, so wie ich auch, haben sich letztmals im Physikunterricht in der Schule mit der »Elektrizitätslehre« beschäftigt. Danach überließen sie diese Disziplin den Fachleuten (früher nannten wir sie Streber), die komplexe Gleichungen und Formeln aus nicht nachvollziehbaren Gründen interessant oder spannend fanden.
Aber es ist nie zu spät, das Mysterium Strom halbwegs zu begreifen. Unnütz ist ein solches Halbwissen jedenfalls nicht. Denn die Art und Weise, wie die Industriegesellschaften heute und in Zukunft Strom erzeugen und verbrauchen, hat unmittelbare Auswirkungen auf unsere Lebensgrundlagen. Sie hat massive Auswirkungen auf den Ausstoß von Treibhausgasemissionen und darauf, ob das Abbremsen des Klimawandels gelingt. Dazu haben sich – zumindest auf dem Papier – fast alle Staaten dieser Erde verpflichtet. Wer bei den politischen Themen Energiewende und Klimaschutz mitreden will, sollte daher in Ansätzen wissen, wie ein Stromsystem aufgebaut und was zu dessen Aufrechterhaltung technisch notwendig ist.
Dieses kleine Buch soll dabei helfen, auf unterhaltsame Weise einen Einblick in die Welt der Stromerzeugung, des Stromtransportes und auch des Stromhandels zu bekommen. Ich verwende darin keine einzige Formel und keine Gleichung. Versprochen! Mangels (elektro)technischer Ausbildung mache ich aus der Not eine Tugend und benutze vorwiegend sportliche, soziologische, historische, religiöse und anekdotische Erklärungen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Entdecken der wundersamen Welt des Stroms.
1 Woraus besteht Strom?
1.1 Eine funkensprühende Göttin
Strom ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für Elektrizität. Wenn Strom fließt, dann bedeutet das eine Bewegung von elektrisch aufgeladenen Teilchen. Der Begriff geht auf die griechische Göttin Elektra zurück, die im Olymp für Wolken und Gewitter zuständig war. Wenn sie von Zeus & Co. mal wieder gemobbt wurde, ging sie nicht zur Psychotherapie, wie das heute üblich wäre, sondern ließ ihrer Wut in Form von fürchterlichen Blitzen freien Lauf. Das soll angeblich reinigend wirken. Elektrizität hat also etwas mit Blitzentladungen zu tun.
Und außerdem hat es etwas mit Bernstein zu tun. Tatsächlich heißt das altgriechische Wort »Elektron« übersetzt Bernstein. Warum? Weil beim Aneinanderreiben von Bernstein die Träger von Elektrizität, die Elektronen, in Aufruhr geraten und auf schnellstem Weg zu ihrem Mutterschiff, dem Atomkern, zurückkehren wollen. Dabei sprühen sie Funken, sie sind elektrisch aufgeladen. Offenbar hat dieses Phänomen die alten Griechen inspiriert, ihrer Gewittergöttin den schönen Namen Elektra zu verleihen – die Bernsteingöttin.
Diese Entladungen auch nutzbar zu machen, das wurde erst viel später entdeckt. Es gibt auch nicht einen einzigen Entdecker der Elektrizität, sondern zahlreiche. Otto von Guericke publizierte 1672 Experimente mit einer Elektrisiermaschine, mit deren Hilfe er elektrische Aufladungen sichtbar machen konnte. Doch erst 100 Jahre später ging es mit den Forschungen richtig los. Forscher wie Benjamin Franklin, Luigi Aloisio Galvani, Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, Charles Augustin de Coulomb, Hans Christian Oersted, André-Marie Ampère, Michael Faraday, Werner von Siemens und viele, viele andere schufen die Grundlagen für die Nutzbarmachung von Elektrizität.
Und 1882 wurde erstmals eine Elektrizitätsübertragung über eine große Entfernung möglich, eine 57 Kilometer lange Gleichstromverbindung zwischen Miesbach und München in Bayern. Seither war klar: So wie Wasser durch Wasserrohre strömt, so kann Elektrizität durch Kabel oder Freileitungen strömen. Daher der Begriff Strom.
Im Englischen ist übrigens ein anderes Synonym für Elektrizität gebräuchlich: Power. Über diesen Umweg kam noch ein weiterer Begriff in den technischen deutschen Sprachgebrauch: Kraft. Daher sprechen wir von »Kraftwerken« anstatt von »Stromwerken« oder von »Windkraftanlagen« statt von »Windstromanlagen«. Also nicht verwirren lassen. Elektrizität, Strom, Kraft – es ist alles das gleiche physikalische Phänomen.
1.2 50 Hertzchen für Heinrich Hertz
Wenn man einen Small Talk schnell beenden möchten, spricht man am besten über Stromnetze. Garantiert herrscht dann für einen Moment peinliches Schweigen, während das Gegenüber krampfhaft nach einem neuen Thema sucht. Über Strom zu plaudern, ist für viele Menschen ungefähr so interessant, wie über Zusatzklauseln bei Rentenversicherungsverträgen oder IP-Adressen im Internet zu sprechen. Das bestätigte mir auch eine junge, charmante und sehr schlaue Kollegin, die als promovierte Mathematikerin Wahrscheinlichkeitsberechnungen zur Stromversorgungssicherheit modelliert. Ein sehr komplexes Thema für echte Spezialistinnen und Spezialisten. Sie gab es inzwischen auf, bei Partys über ihren Beruf zu sprechen.
Mir selbst geht es ähnlich. Wenn ich im privaten Gespräch auf die Frage nach meinem Arbeitgeber mit »50Hertz« antworte, blicke ich in Gesichter voller Fragezeichen. Was könnte 50Hertz wohl bedeuten? Hat das vielleicht etwas mit einer Datingplattform für Menschen ab 50 aufwärts zu tun? Oder mit Ü-50-Partyveranstaltungen? Manch einer denkt vielleicht auch an eine kardiologische Arztpraxis. Schließlich soll man mit 50 Jahren ganz besonders an sein Herz denken. Oder, vierte Variante, den Leuten fällt der »gelbe« Autovermieter ein.
Aber: Mit alldem und auch mit dem US-Amerikaner John D. Hertz, dem Gründer der gleichnamigen Fahrzeugvermietung, hat 50Hertz natürlich nichts zu tun. Der Namensgeber meines Unternehmens ist Heinrich Hertz aus Hamburg. Beide Hertzens, der Hamburger Erfinder und der amerikanische Autovermieter, waren weder miteinander verwandt noch verschwägert.
Heinrich Rudolf Hertz (1857–1894) war einer der berühmtesten deutschen Physiker. Leider starb er mit nur 37 Jahren nach einer Migräneattacke an Gefäßrheumatismus, sonst hätte er wahrscheinlich noch weitere bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Sein Meisterstück gelang ihm 1886, als er nicht nur die Existenz elektromagnetischer Wellen nachwies, sondern diese auch experimentell erzeugte. Und damit war der Grundstein gelegt für all die großartigen Erfindungen wie Telefon, Radio, Fernsehen, Computer und eben auch Stromnetze. Dank Heinrich Hertz wurde es möglich, Stimmen, Bilder, Texte und Elektronen wellenförmig über große Distanzen hinweg zu transportieren.
Aber warum heißt der Stromübertragungsnetzbetreiber 50Hertz und nicht zum Beispiel 1000Hertz, was wesentlich eindrucksvoller klingen würde? Ganz einfach: 50 Hertz ist nun einmal die normierte Netzfrequenz, auf der in Europa und in weiten Teilen der Welt Strom mit Wechselspannung übertragen wird. Nur in Mittel- und Nordamerika sowie in Teilen Asiens und Ozeaniens sind es 60 Hertz.
Als Frequenz bezeichnet man ein periodisch wiederkehrendes Ereignis. In der Physik definiert die Frequenz die Anzahl bestimmter Schwingungen oder Wellen in einer Sekunde. Heinrich Hertz entdeckte als Erster, dass sich über elektromagnetische Wellen Informationen transportieren lassen, zum Beispiel Töne. Das war die Geburtsstunde der »Funktelegraphie«, des Radios und letztlich auch der elektrischen Stromübertragung mittels schwingender Wellen. All diesen Anwendungen wurden bestimmte Frequenzbänder zugewiesen.
Eines der bekanntesten Frequenzbänder ist der UKW-Bereich bei Radiosendern, also der Ultrakurzwellenbereich. Deutschlandfunk zum Beispiel sendet in Berlin auf der Frequenz 97,7 Megahertz, also mit einer Frequenz von 97,7 Millionen Schwingungen pro Sekunde. Nur wenn man das Radio auf diese Frequenz einstellt, kann man das Programm in Berlin hören. Fährt man mit dem Auto Richtung Leipzig, fängt es irgendwann an zu knistern und man muss auf eine neue Frequenz wechseln.
So ähnlich ist es auch beim Strom, der sich am besten im Niederfrequenzband übertragen lässt. Allerdings möchte man natürlich nicht, dass man die elektrischen Geräte ständig auf eine neue Frequenz nachjustieren muss, sobald man von einem Stromnetzgebiet ins andere fährt. Das würde Chaos bedeuten. Es ist also praktischer, wenn alle auf derselben Frequenz Strom »senden«, bei uns eben auf der Frequenz 50 Hertz. Das sind 50 Schwingungen pro Sekunde.
Diese Norm sorgt dafür, dass der Strom wirklich immer und ohne Störungen bei den Verbrauchern ankommt. Abweichungen von mehr als 0,2 Hertz nach oben oder unten deuten auf ein Über- oder Unterangebot von Strom im Netz hin und müssen durch Zuschalten von Kraftwerken oder Abschalten von Stromverbrauchsstellen ausgeglichen werden. Anderenfalls könnte es zu einem Spannungsabfall und damit zu Stromausfällen und Schäden an elektrischen Geräten kommen. Das passiert immer mal wieder. Allerdings sehr, sehr selten.
1.3 Heiße Haare und viel Watt
Die Erfahrungen aus dem Berufsleben und der Freizeit lehren uns: Arbeit und Leistung sind nicht immer identisch. Im Fitnessstudio kann man das sehr gut beobachten. In der Abteilung Muckis geht es um Leistung. Mal locker 100 Kilogramm auf der Bank drücken. Geil, Alter! Aber hat schon mal jemand diese Muskeltypen auf einem Stepper gesehen?
Und dann gibt es diese kleinen drahtigen Frauen und Männer, die wie ein Hamster stundenlang übers Laufband joggen, ohne schlappzumachen. Ich wette, Letztere verrichten mehr Arbeit in Form von Kalorienverbrauch als die Bankdrücker. Am besten ist natürlich, wenn man beides sportlich miteinander kombiniert. Sixpack plus Ausdauer ist die Traumkombination, mit der man es halb- oder ganz nackt sogar auf das Cover von Hochglanzmagazinen schafft.
Auch in der Elektrotechnik unterscheidet man zwischen Leistung und Arbeit, also wie stark zum Beispiel ein Kraftwerk ist und wie viele Stunden im Jahr es wirklich arbeitet. Der Faktor Zeit spielt die entscheidende Rolle. Es gelten ähnliche Gesetze wie im Fitnessstudio.
Für fast jede Maßeinheit in der Physik gibt es einen berühmten Namensgeber. Bei der Leistung ist es der schottische Erfinder James Watt (1736–1819). Watt selbst benutzte zur Definition von Leistung noch den Begriff »Horsepower«, also »Pferdestärke«. Noch heute ist PS im Automobilbereich gebräuchlich, um die Muskeln unter der Kühlerhaube zu beschreiben.
Den Zusammenhang von Leistung und Arbeit kann man ganz anschaulich am Beispiel eines Föhns beschreiben. Ein Föhn mit 2.000 Watt hat ordentlich Power und die Haare werden schnell trocken. Hätte der Föhn 20.000 Watt, wären die Haare sehr viel schneller trocken – aber leider der ganze Kopf verbrannt. Hätte der Föhn nur 200 Watt, würde man garantiert jeden Tag mit nassen Haaren zur Arbeit kommen.
Nicht nur beim Verbrauch, auch bei der Energieerzeugung hat Watt als Kennzahl für die Leistung von Kraftwerken oder anderen Erzeugungsanlagen eine wichtige Bedeutung. Aber nur in Kombination mit Arbeit, also der Zeit, in der diese Anlagen ihre Leistung erbringen, ergibt sich daraus oft ein sinnvoller Zusammenhang. Insbesondere beim Einsatz von Sonne und Wind zur Stromerzeugung ist es wichtig, den Faktor Zeit zu betrachten. Denn es nutzt ja wenig, wenn die volle Leistung nur alle Nase lang zur Verfügung steht – man braucht sie ja eigentlich rund um die Uhr. Aber Wind- und Solarenergie sind eben stark vom Wetter abhängig, die Fachleute sprechen von »Volatilität«.
Nun scheint die Sonne nur tagsüber und ist auch häufig von Wolken verdeckt, die Sonnenscheindauer liegt in Deutschland bei durchschnittlich 1.500 Stunden pro Jahr – im Norden weniger, im Süden tendenziell mehr. Da die Sonne aber morgens und abends im schrägen Winkel und manchmal auch diffus auf die Solarmodule trifft, zählen nur etwa zwei Drittel dieser Zeit als sogenannte Volllaststunden. Multipliziert man also die Höchstleistung der PV-Anlage mit den Volllaststunden, so kommt man auf rund vier bis fünf Millionen Wattstunden, die eine Dachanlage so erzeugt. Damit kann man rein rechnerisch den Jahresstrombedarf einer einzigen mehrköpfigen Familie mit relativ hohem Stromverbrauch abdecken.
Bei der energiewirtschaftlichen Stromerzeugung hat man es natürlich mit ganz anderen Dimensionen zu tun. Der Windpark Baltic 2 zum Beispiel, der weit draußen vor der Küste Rügens Strom erzeugt, hat eine Leistung von 288 Millionen Watt. Wenn sich dessen 80 Windräder 4.000 Stunden pro Jahr mit dieser Leistung drehen, dann erzeugen sie ein Jahr lang Strom für etwa 350.000 private Haushalte.
Das größte Kraftwerk der Welt befindet sich übrigens, wo sonst, in China. Das Wasserkraftwerk am Drei-Schluchten-Staudamm hat eine Leistung von 22 Milliarden Watt. Es erzeugt beinahe ununterbrochen Strom und könnte ganz Ostdeutschland inklusive Berlin mit Strom versorgen.
1.4 Spannung wie im Kino
Spannung wird in der Einheit Volt gemessen. Der Name geht auf einen Italiener zurück, Graf Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (1745–1827). Er erfand übrigens auch die Batterie.
Damit Strom in einer Leitung fließen kann, ist elektrische Spannung erforderlich. Vereinfacht gesagt: Erhöht man die Spannung, kann viel Strom fließen. Reduziert man die Spannung, fließt weniger Strom. Für hohe Spannungen braucht man entsprechend starke Leitungen, bei niedrigen Spannungen reichen spindeldünne Kabel aus.
Dabei gibt es unterschiedliche Spannungsebenen. Der Transport von Strom ist ähnlich organisiert wie der Postverkehr. Man schmeißt einen Brief in den Briefkasten. Ein kleines Postauto kommt vorbei und nimmt viele Briefe mit. Im Briefverteilzentrum werden sehr, sehr viele Briefe sortiert und in Lkw verladen und zum nächstgrößeren Verteilzentrum gefahren. Von dort geht es im Sattelschlepper weiter auf die Autobahn und am Ende der Kette wird ein Brief in ein kleineres Fahrzeug umgeladen, dann in die Taschen des Briefträgers und zum Schluss hinein in den Briefkasten.
So ähnlich ist die Pyramide auch beim Strom. Dort ist der Transport über vier Spannungsebenen organisiert. An den jeweiligen Schnittstellen gibt es Trafos und Umspannwerke. Für die Abholung und Zustellung von Strom sind die lokalen Verteilnetzbetreiber zuständig, die auch die Stromzähler ablesen. In kleineren Trafohäuschen wird diese Niederspannung auf Mittelspannungsniveau und in Umspannwerken auf Hochspannung bzw. auf Höchstspannung über Transformatoren angehoben. Umgekehrt wird die Spannung auch wieder nach demselben Schema reduziert.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)