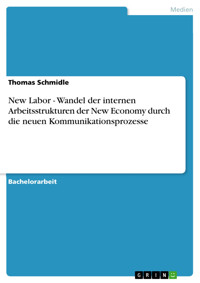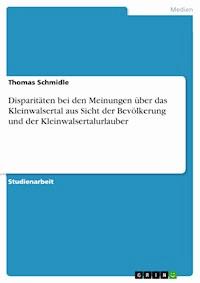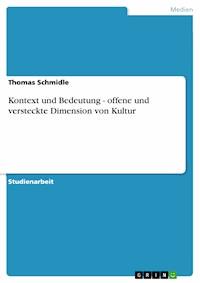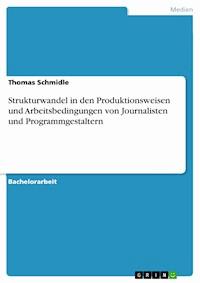
Strukturwandel in den Produktionsweisen und Arbeitsbedingungen von Journalisten und Programmgestaltern E-Book
Thomas Schmidle
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Medienökonomie, -management, Note: 1,0, Universität Salzburg (Institut für Kommunikationswissenschaft), Veranstaltung: Strukturwandel in der Medienindustrie, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Veränderungen durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien und deren revolutionäres Spektrum an neuen Möglichkeiten in den 70er und 80er Jahren haben auch im journalistischen Alltag massiv ihre Spuren hinterlassen. Vor allem die Computerisierung und die Innovationen in der Telekommunikation führten zu einem Strukturwandel im journalistischen Arbeitsfeld und Arbeitsumfeld. Dieser Wandel wurde schon in einigen Publikationen dokumentiert. Daher soll in dieser Arbeit zusätzlich eine mögliche Ursache für diese Veränderungen eruiert werden. Neben den ständig wachsenden Bedürfnissen der westlichen Gesellschaft nach immer schnellerer und konkreterer Information war auch die Medienpolitik ein ausschlaggebender Punkt für den Umbruch im journalistischen Alltag, da sie die Maßnahmen für den Fortschritt und die Technisierung mitgeprägt hat und somit zur Verwirklichung dieser entscheidend beitrug. So soll in dieser Arbeit nicht nur der Strukturwandel der Arbeitsbedingungen und der Produktionsweisen von Journalisten und Programmgestaltern selbst, sondern auch die medienpolitische Mitverantwortung, d.h. medienpolitische Neuerungen, Veränderungen und Voraussetzungen, die mit zu diesem Strukturwandel im Zeitalter der Computerisierung und Digitalisierung beitrugen, beschrieben werden. Das Motto der österreichischen Regierungen zum Thema Medienpolitik lautete jedoch jahrzehntelang „die beste Medienpolitik, ist keine Medienpolitik“, daher wird sich die folgende Arbeit in all ihren Punkten am Beispiel Deutschland orientieren. Darauf aufbauend werden die tatsächlichen Veränderungen und Neuerungen in den Produktionsweisen und Arbeitsbedingungen von Journalisten und Programmgestaltern dargelegt, wobei hierbei ein besonderer Augenmerk auf wirtschaftliche und technische Veränderungen geworfen werden soll. Schließlich werden die Konsequenzen dieses Strukturwandels auf die medialen Inhalte untersucht und dargestellt. Nachdem die Forschungsfragen, wie sich der Strukturwandel in den Arbeitsbedingungen und Produktionsweisen von Journalisten/Programmgestaltern im Zeitalter der Computerisierung und der Digitalisierung in Deutschland vollzogen hat, inwieweit dafür medienpolitische Vorentscheidungen der deutschen Bundesregierung mitverantwortlich gemacht werden können und welche Auswirkungen dieser berufsspezifische Wandel auf die medialen Inhalte hatte, [...]
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Page 1
Page 3
1.Einleitung
Die Veränderungen durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien und deren revolutionäres Spektrum an neuen Möglichkeiten in den 70er und 80er Jahren haben auch im journalistischen Alltag massiv ihre Spuren hinterlassen. Vor allem die Computerisierung und die Innovationen in der Telekommunikation führten zu einem Strukturwandel im journalistischen Arbeitsfeld und Arbeitsumfeld. Dieser Wandel wurde schon in einigen Publikationen dokumentiert. Daher soll in dieser Arbeit zusätzlich eine mögliche Ursache für diese Veränderungen eruiert werden. Neben den ständig wachsenden Bedürfnissen der westlichen Gesellschaft nach immer schnellerer und konkreterer Information war auch die Medienpolitik ein ausschlaggebender Punkt für den Umbruch im journalistischen Alltag, da sie die Maßnahmen für den Fortschritt und die Technisierung mitgeprägt hat und somit zur Verwirklichung dieser entscheidend beitrug. So soll in dieser Arbeit nicht nur der Strukturwandel der Arbeitsbedingungen und der Produktionsweisen von Journalisten und Programmgestaltern selbst, sondern auch die medienpolitische Mitverantwortung, d.h. medienpolitische Neuerungen, Veränderungen und
Voraussetzungen, die mit zu diesem Strukturwandel im Zeitalter der Computerisierung und Digitalisierung beitrugen, beschrieben werden. Das Motto der österreichischen Regierungen zum Thema Medienpolitik lautete jedoch jahrzehntelang „die beste Medienpolitik, ist keine Medienpolitik“, daher wird sich die folgende Arbeit in all ihren Punkten am Beispiel Deutschland orientieren. Darauf aufbauend werden die tatsächlichen Veränderungen und Neuerungen in den Produktionsweisen und Arbeitsbedingungen von Journalisten und Programmgestaltern dargelegt, wobei hierbei ein besonderer Augenmerk auf wirtschaftliche und technische Veränderungen geworfen werden soll. Schließlich werden die Konsequenzen dieses Strukturwandels auf die medialen Inhalte untersucht und dargestellt. Nachdem die Forschungsfragen, wie sich der Strukturwandel in den Arbeitsbedingungen und Produktionsweisen von Journalisten/Programmgestaltern im Zeitalter der Computerisierung und der Digitalisierung in Deutschland vollzogen hat, inwieweit dafür medienpolitische Vorentscheidungen der deutschen Bundesregierung mitverantwortlich gemacht werden können und welche Auswirkungen dieser berufsspezifische Wandel auf die medialen Inhalte hatte, beantwortet worden sind, sollen in einem abschließenden Resümee die gewonnen Ergebnisse zusammengefasst werden,
Page 4
worin auch ein Blick auf künftig mögliche oder bereits bestehende Strukturwandelerscheinungen gewagt werden wird.
2. Medienpolitische Vorentscheidungen und der technisch-ökonomische Wandel
2.1. Die medienpolitischen Vorentscheidungen
Die Kommunikationspolitik der Bundesregierung sah bereits im Jahre 1973 vor, die Ausbildung von Journalisten auf die neuen Medien auszurichten. Daraufhin wurde die „Gemischte Kommission für Fragen der journalistischen Aus- und Fortbildung“ gegründet, die bereits am 12. Dezember 1973 einräumte, dass die Planung von Ausbildungsgängen zum Journalistenberuf versäumt wurden, dass dieser journalistischen Ausbildung jegliche wissenschaftliche Orientierung fehlt und dass man in Zukunft mehr praxisorientierte Studiengänge nach dem Münchner Vorbild anbieten will. Nur wenige Monate später im Februar 1974 kommt es zu einer weiteren Neugründung mit medienpolitischem Gewicht. Der damalige Bundespostminister Horst Ehmke gründet die „Kommission für den Ausbau des technischen Kommunikationssystems“ (KTK), deren Aufgabe es sein sollte, Vorschläge für ein wirtschaftlich vernünftiges und gesellschaftlich wünschenswertes technisches Kommunikationssystem zu erarbeiten. Zusätzliche Arbeitsplätze und eine neue Art der journalistischen Arbeit versprach man sich von einem Versuch des Videotextes, der am 01. September 1975 von ARD und ZDF in Verbindung mit dem Bundesverband der deutschen Zeitungsverleger BDZV vorgestellt wurde. Realität für die Bundesbürger wurde der Videotext allerdings erst am 01. Juni 1980 mit einem Umfang von 78 Grundtafeln. Die Redaktion saß in Berlin. Arbeitsbedingungsveränderungen befürchtete man bei der Frequenzverteilung in den Lang- und Mittelwellenbereichen im Oktober und November des Jahres 1975, wodurch mehr Sender in Deutschland zugelassen wurden. (vgl. Kopper 1992, S. 294ff)
Schon am 16. Dezember 1976 heißt es in einer Regierungserklärung zum Thema neue Kommunikationstechnologien unter Ziff. 64, dass auch trotz neuer Technologien die Meinungsvielfalt erhalten bleiben und darüber hinaus sogar noch gestärkt werden müsse und dass auch neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Fernsehen und Presse erprobt