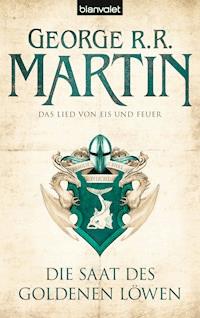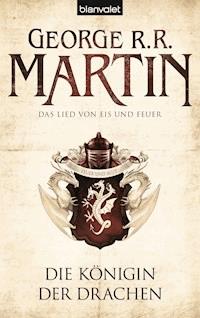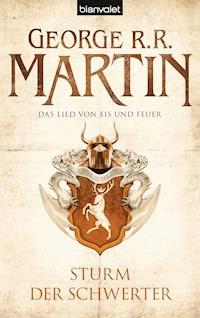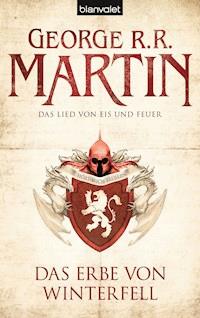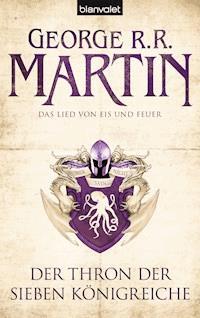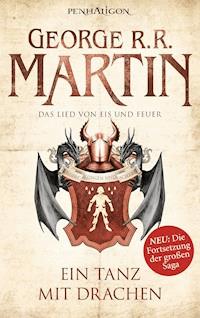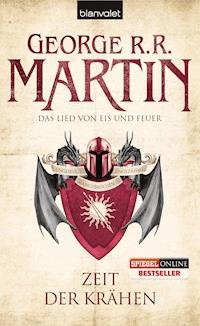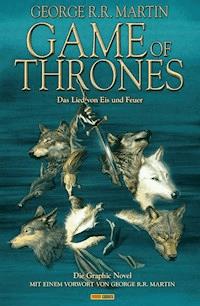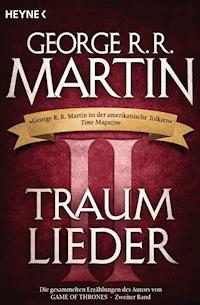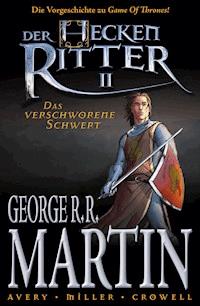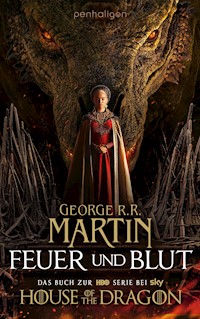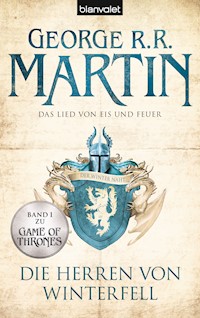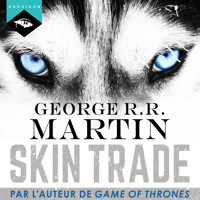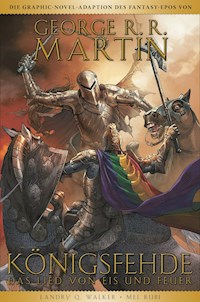11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Menschheit hat ihre Wurzeln vergessen, nur an eines erinnert sie sich noch: das Fliegen.
Windhaven – eine wunderschöne Wasserwelt, doch geplagt von gewaltigen Stürmen. Die Menschen leben verstreut auf vielen kleinen Inseln, und es ist fast unmöglich, Kontakt zueinander aufzunehmen. Dennoch – oder deswegen – ist auf Windhaven ein alter Traum wahr geworden: Menschen können fliegen. Doch die Flügel sind kostbar, und die Gilde der Flieger ist eine streng abgeschottete Elite. Trotzdem will sich Maris von Amberly ihren Traum vom Fliegen nicht nehmen lassen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 613
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Windhaven – eine wunderschöne Wasserwelt, doch geplagt von gewaltigen Stürmen. Die Menschen leben verstreut auf vielen kleinen Inseln, und es ist fast unmöglich, Kontakt zueinander aufzunehmen. Dennoch – oder deswegen – ist auf Windhaven ein alter Traum wahr geworden: Menschen können fliegen. Doch die Flügel sind kostbar, und die Gilde der Flieger ist eine streng abgeschottete Elite. Trotzdem will sich Maris von Amberly ihren Traum vom Fliegen nicht nehmen lassen …
Autoren
George Raymond Richard Martin wurde 1948 in New Jersey geboren. Sein Bestseller-Epos Das Lied von Eis und Feuer wurde als die vielfach ausgezeichnete Fernsehserie Game of Thrones verfilmt. George R. R. Martin wurde u. a. sechsmal der Hugo Award, zweimal der Nebula Award, dreimal der World Fantasy Award (u. a. für sein Lebenswerk und besondere Verdienste um die Fantasy) und dreimal der Locus Poll Award verliehen. 2013 errang er den ersten Platz beim Deutschen Phantastik Preis für den Besten Internationalen Roman. Er lebt heute mit seiner Frau in New Mexico.
Lisa Tuttle veröffentlichte ihre erste Story in den 1970ern. Sturm über Windhaven war ihr erster Roman. Sie hat als Fernsehkritikerin und Journalistin gearbeitet und hat kreatives Schreiben unterrichtet. Ihre Kurzgeschichten wurden mehrfach international ausgezeichnet.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
GEORGE R. R. MARTIN&LISA TUTTLE
STURM ÜBERWINDHAVEN
ROMAN
Ins Deutsche übertragen von Angelika FuchsVollständig durchgesehen und überarbeitet von Catherine Beck
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Windhaven« bei Pocket Books, New York.1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 1981 by George R. R. Martin & Lisa Tuttle
Published by agreement with the authors and the authors’ agent, The Lotts Agency, Ltd.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2017 by Penhaligon in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Catherine Beck
Umschlaggestaltung und Artwork: Isabelle Hirtz, Inkcraft unter Verwendung eines Bildes von Helle/Shutterstock.com
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-21890-4V001www.penhaligon.de
Wer einmal erlebt hat, was Fliegen heißt, der wird auf Erden wandeln mit himmelwärts gerichtetem Blick; denn dort ist er gewesen, und dorthin sehnt er sich zurück.
Leonardo da Vinci
Prolog
Der Sturm hatte nahezu die ganze Nacht gewütet. In dem breiten Bett, das es sich mit seiner Mutter teilte, lag das Kind unter einer kratzenden Wolldecke und lauschte. Gleichmäßig und unablässig prasselte der Regen auf die dünnen Zitronenholzbretter der Hütte. Manchmal hörte es das entfernte Grollen des Donners, und wenn der Blitz herabfuhr, drangen feine Lichtstrahlen durch die Fugen in den Fensterläden und erleuchteten den kleinen Raum. Wenn sie verschwanden, war es wieder dunkel.
Das Kind hörte, wie das Wasser auf den Fußboden tröpfelte. Das Dach war undicht, der Regen würde den fest gestampften Boden in Schlamm verwandeln – seine Mutter würde wütend sein, aber man konnte es nicht ändern. Die Mutter war im Ausbessern von Dächern nicht sehr geschickt, und sie konnten es sich nicht leisten, dass jemand diese Arbeit für sie übernahm. Eines Tages, hatte die Mutter gesagt, wird die alte Hütte unter der Gewalt des Sturms zusammenbrechen. »Dann werden wir deinen Vater wiedersehen.« Das Mädchen konnte sich kaum an den Vater erinnern, obwohl die Mutter oft von ihm sprach.
Ein heftiger Windstoß rüttelte an den Fensterläden, das Kind lauschte dem furchterregenden Geräusch brechenden Holzes und dem Trommeln des Regens auf dem Ölpapier, das ihnen als Fensterscheibe diente. Plötzlich hatte es Angst. Seine Mutter schlief ahnungslos weiter. Der Sturm dauerte an, aber die Mutter hatte von alldem nichts mitbekommen. Das Mädchen wagte nicht, sie zu wecken, denn die Mutter war leicht erregbar und mochte es nicht, wenn man sie wegen solcher Kleinigkeiten wie kindlicher Ängste aus dem Schlaf riss.
Die Wände knarrten und bewegten sich wieder. Blitz und Donner folgten unmittelbar aufeinander. Zitternd lag das Kind unter der Decke und überlegte, ob es vielleicht nicht schon heute Nacht seinen Vater wiedersehen würde.
Aber dem war nicht so.
Endlich ließ der Sturm nach, und der Regen hörte auf. Der Raum war dunkel und ruhig.
Das Mädchen rüttelte seine Mutter wach.
»Was?«, fragte sie. »Was ist los?«
»Der Sturm ist vorüber, Mutter«, sagte das Kind.
Die Frau nickte und stand auf. »Zieh dich an«, befahl sie dem Mädchen, während sie selbst im Dunkeln nach ihren Kleidern suchte. Es würde frühestens in einer Stunde zu dämmern beginnen, aber es war wichtig, so schnell wie möglich am Strand zu sein. Das Kind wusste, dass die Stürme Schiffe zerschmetterten; kleine Fischerboote, die zu lange draußen geblieben waren oder sich zu weit hinausgewagt hatten. Manchmal fielen ihnen sogar große Handelsschiffe zum Opfer. Wenn man nach einem Sturm hinausging, fand man oft an den Strand getriebene Dinge. Einmal hatten sie ein Messer mit einer gehärteten Metallklinge gefunden. Nachdem sie es verkauft hatten, konnten sie zwei Wochen gut essen. Wenn man etwas Wertvolles finden wollte, durfte man jedoch nicht faul sein. Ein fauler Mensch würde bis zur Dämmerung warten – und nichts finden.
Bevor sie nach draußen gingen, hängte sich seine Mutter einen leeren Leinensack für die Fundstücke über die Schulter. Das Kleid des Mädchens hatte große Taschen. Sie trugen beide Stiefel. Die Frau nahm auch eine lange Stange mit einem geschnitzten Holzhaken am Ende mit, falls sie etwas sahen, das außerhalb ihrer Reichweite im Wasser trieb. »Komm, Kind«, sagte sie. »Trödele nicht herum.«
Der Strand war kalt und dunkel. Ein frischer Wind blies beständig aus Westen. Sie waren nicht allein. Drei oder vier andere waren bereits auf und suchten den nassen Strand ab. In ihren Stiefelabdrücken sammelte sich sofort das Wasser. Gelegentlich bückte sich jemand, um irgendetwas genauer zu betrachten. Einer von ihnen trug eine Laterne. Früher, als ihr Vater noch lebte, hatten sie auch eine Laterne besessen, aber später hatten sie sie verkaufen müssen. Ihre Mutter hatte sich oft darüber beklagt. Nachts konnte sie nicht so gut sehen wie ihre Tochter. Manchmal stolperte sie in der Dunkelheit umher und übersah Dinge, die sie eigentlich hätte bemerken müssen.
Sie trennten sich, wie sie es immer taten. Das Kind suchte den Strand in nördlicher Richtung ab, während seine Mutter ihre Suche im Süden aufnahm. »Mach dich auf den Rückweg, wenn es dämmert«, sagte die Mutter. »Du hast viel vor dir. Nach der Dämmerung wird nichts mehr zu finden sein.«
Das Kind nickte und begann eilig mit der Suche.
Die Beute heute Nacht war recht mager. Lange Zeit ging das Mädchen, die Augen auf den Boden gerichtet und angestrengt suchend, am Wasser entlang. Zu gern hätte es etwas gefunden. Wenn es mit einem Stückchen Metall oder vielleicht einem gelben, gebogenen und schrecklich anzusehenden Szylla-Zahn nach Hause käme, würde ihm die Mutter vielleicht ein Lächeln schenken und ihm sagen, was für ein gutes Kind es war. Das geschah nicht oft. Meistens schalt die Mutter, weil es zu verträumt war und törichte Fragen stellte.
Als sich der Himmel unmerklich aufhellte und gerade die Sterne zu schlucken begann, hatte es nur zwei Stücke milchiges Seeglas und eine Muschel in den Taschen. Die Muschel war schwer und so groß wie seine Hand. Die raue, genarbte Schale verriet, dass sie schwarzes, butterweiches Fleisch haben würde, das vorzüglich schmeckte. Aber es hatte eben nur eine gefunden. Alle anderen angespülten Gegenstände waren wertloses Treibgut.
Das Kind wollte gerade umkehren, so, wie es die Mutter befohlen hatte, als es das Aufblitzen von Metall am Himmel sah – einen plötzlichen Silberglanz, als wäre ein neuer Stern geboren, der alle anderen überstrahlte.
Es war nördlich von ihm, weit draußen über der See. Es starrte in die Richtung, wo es erschienen war, da blitzte es einen Augenblick später etwas links wieder auf. Es wusste, was es war: Die Flügel eines Fliegers hatten die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne gefangen, noch bevor sie die Erde erreichten.
Das Kind wollte hinunterlaufen und alles weiter beobachten. Es sah gern dem Flug der Vögel zu, dem kleinen Regenkuckuck, den unbändigen Nachtfalken oder den Aasvögeln mit ihren großen Silberflügeln, aber die Flieger waren schöner als alle anderen Vögel. Doch die Dämmerung brach an, und die Mutter hatte befohlen, bei Tagesanbruch umzukehren.
Es rannte. Wenn es sich beeilte, so dachte es, und den ganzen Weg hin und den ganzen Weg zurück rannte, würde es vielleicht noch ein bisschen Zeit zum Zusehen haben, bevor die Mutter es vermissen würde. Deshalb rannte und rannte es, vorbei an den faulen Langschläfern, die gerade erst aufgestanden waren, um den Strand abzusuchen. Die Muschel in der Tasche sprang hin und her.
Der östliche Himmel war in blasses Orange getaucht, als es die Stelle erreichte, wo der Flieger kreiste. Hier war der Strand besonders breit. Die Stelle lag gleich unterhalb der Klippen, von denen die Flieger starteten. Das Kind kletterte gern die Klippen hinauf, um von oben alles sehen zu können. Der Wind spielte ihm dann im Haar, und die Beine baumelten über den Rand der Klippen. Aber heute hatte es keine Zeit. Es musste bald umkehren, sonst würde die Mutter böse sein.
Es war sowieso zu spät gekommen. Der Flieger setzte zur Landung an.
Er flog noch einen eleganten Bogen über dem Strand, und seine Flügel rauschten in nur dreißig Fuß Höhe über seinen Kopf. Mit großen Augen beobachtete das Kind ihn. Er legte sich über dem Wasser in die Kurve, einen silbernen Flügel nach unten, den anderen nach oben gerichtet. Plötzlich kam er in weitem Bogen heran. Dann änderte er die Richtung ein wenig und kam nun direkt auf es zu, senkte sich anmutig herab und berührte bei seiner Landung kaum den Boden.
Am Strand waren auch noch andere Leute – ein junger Mann und eine ältere Frau. Sie rannten dem Flieger entgegen und halfen ihm anzuhalten. Dann machten sie etwas an seinen Flügeln, woraufhin diese zusammenklappten. Anschließend falteten sie die Flügel langsam und sorgfältig, während der Flieger die Gurte löste, mit denen die Schwingen an seinem Körper befestigt waren.
Während das Mädchen die Szene beobachtete, erkannte es, dass es der Flieger war, den es besonders mochte. Es gab viele Flieger, und das Mädchen hatte gelernt, sie zu unterscheiden, aber nur drei von ihnen kamen häufig. Jene drei, die, wie es selbst, auf der Insel lebten. Das Kind stellte sich vor, dass sie oben auf den Klippen lebten, in Häusern, die Vogelnestern glichen, deren Wände aber aus unschätzbar wertvollem Metall bestanden. Einer der Flieger war eine ernste, grauhaarige Frau mit mürrischem Gesicht. Der zweite war ein dunkelhaariger, unglaublich hübscher Junge mit einer angenehmen Stimme. Ihn mochte sie lieber. Aber am liebsten mochte sie den Mann am Strand. Ein großer, starker Mann mit breiten Schultern, wie ihr Vater sie gehabt hatte. Er war glatt rasiert, hatte braune Augen und lockige, rötlich-braune Haare. Er lächelte viel und schien häufiger zu fliegen als die anderen.
»Du«, sagte er.
Das Kind blickte erschrocken auf. Er lächelte es an.
»Hab keine Angst«, sagte er, »ich tue dir nichts.«
Ängstlich wich es einen Schritt zurück. Oft hatte es die Flieger beobachtet, aber noch nie hatte man es bemerkt.
»Wer ist das?«, fragte der Flieger seine Helfer, die hinter ihm standen und seine Flügel falteten.
Der junge Mann zuckte mit den Schultern. »Eine kleine Muschelsucherin. Was weiß ich. Ich habe sie schon öfter hier gesehen. Soll ich sie verjagen?«
»Nein«, sagte der Mann. Wieder lächelte er das Kind an. »Warum bist du so ängstlich?«, fragte er. »Ich habe nichts dagegen, dass du zuschaust, kleines Mädchen.«
»Meine Mutter hat mir verboten, die Flieger zu stören«, sagte sie.
Der Mann lachte. »Oh, du störst mich nicht. Eines Tages, wenn du größer bist, kannst du den Fliegern helfen, so wie meine Freunde hier. Würde dir das gefallen?«
Das Mädchen winkte ab. »Nein.«
»Nein?«, fragte er erstaunt lächelnd. »Was würdest du denn gern tun? Fliegen?«
Das Kind nickte schüchtern.
Die ältere Frau kicherte, aber der Flieger warf ihr einen missbilligenden Blick zu. Er ging auf das Kind zu, beugte sich zu ihm herab und nahm seine Hand. »Na«, sagte er, »wenn du fliegen möchtest, musst du aber viel üben, nicht wahr? Würdest du es gern einmal probieren?«
»Ja.«
»Du bist jetzt noch zu klein für die Flügel«, sagte der Flieger. Er fasste sie mit seinen starken Händen und hob sie auf seine Schultern. Seine Beine lagen auf seiner Brust, und die Hände fassten unsicher in sein Haar. »Nein«, sagte er, »du darfst dich nicht festhalten, wenn du ein Flieger sein willst. Deine Arme müssen deine Flügel sein. Kannst du die Arme ausstrecken?«
»Ja«, sagte es. Es hob die Arme und hielt sie wie ein Flügelpaar.
»Deine Arme werden müde«, warnte der Flieger, »aber du darfst sie nicht sinken lassen, nicht, wenn du fliegen willst. Ein Flieger braucht kräftige Arme, die niemals müde werden.«
»Ich bin stark«, sagte das Mädchen mit Nachdruck.
»Gut. Bist du bereit?«
»Ja.« Es begann mit den Armen zu schlagen.
»Nein, nein, nein«, sagte er. »Nicht schlagen. Wir sind doch keine Vögel. Ich dachte, du hättest uns beobachtet?«
Das Kind versuchte sich zu erinnern. »Drachen«, sagte es plötzlich, »ihr seid wie Drachen.«
»Manchmal«, sagte der Flieger erfreut. »Aber auch wie Nachtfalken und andere Gleitvögel. Weißt du, wir fliegen nicht richtig, wir gleiten wie Drachen. Wir reiten auf dem Wind. Deswegen darfst du nicht mit den Armen schlagen, du musst sie ausstrecken und versuchen, den Wind zu fühlen. Kannst du den Wind schon fühlen?«
»Ja.« Es war ein warmer, scharfer Wind, der nach See roch.
»Nun, versuche ihn mit deinen Armen zu fangen, lass dich treiben.«
Das Mädchen schloss die Augen und versuchte, den Wind auf den Armen zu fühlen.
Es fing an, sich zu bewegen.
Der Flieger lief über den Sand, als würde er vom Wind getrieben. Wenn der Wind umschlug, änderte er die Richtung. Das Mädchen hielt die Arme ausgestreckt. Der Wind schien stärker zu werden. Der Mann rannte, und das Mädchen hüpfte auf seinen Schultern auf und ab, es ging immer schneller.
»Du fliegst mich ins Wasser!«, rief er. »Dreh um!«
Sie neigte ihre Flügel, so, wie sie es oft bei den Fliegern beobachtet hatte. Eine Hand nach oben, die andere nach unten gerichtet. Der Flieger machte eine Drehung nach rechts und begann im Kreis zu laufen, bis sie ihre Arme wieder waagerecht hatte. Jetzt lief er wieder geradeaus, den Weg zurück, den sie gekommen waren.
Er lief und lief, und sie flog, bis beide atemlos waren und lachten.
Er hielt an. »Genug«, sagte er, »ein Anfänger sollte nicht zu lange fliegen.« Er hob das Mädchen von den Schultern und setzte es auf den Sand.
Die Arme der Kleinen schmerzten, aber sie war aufgeregt und überglücklich, obwohl sie wusste, dass zu Hause eine Tracht Prügel auf sie wartete. Die Sonne stand jetzt über dem Horizont. »Danke«, sagte sie, immer noch außer Atem.
»Ich heiße Russ«, sagte er. »Wenn du wieder fliegen möchtest, komm hierher. Ich habe sonst keine kleinen Flieger, um die ich mich kümmere.«
Das Kind nickte begeistert.
»Und du«, sagte er und klopfte sich den Sand von der Kleidung, »wer bist du?«
»Maris«, antwortete das Mädchen.
»Ein hübscher Name«, erwiderte der Flieger freundlich. »Nun, Maris, ich muss jetzt gehen. Aber vielleicht werden wir wieder einmal gemeinsam fliegen?« Er lächelte sie an, drehte sich um und ging den Strand entlang. Die beiden Helfer begleiteten ihn; einer trug seine gefalteten Flügel. Sie begannen zu sprechen, als sie sich von ihm entfernten, und sie hörte sein Lachen.
Plötzlich rannte sie hinter ihm her, hatte aber Mühe, seinen gewaltigen Schritten zu folgen und ihn einzuholen.
Er hörte das Mädchen kommen und drehte sich zu ihm um. »Ja?«
»Hier.« Sie griff in die Tasche und reichte ihm die Muschel.
Überraschung spiegelte sich auf seinem Gesicht, die dann einem freundlichen Lächeln wich. Er nahm die Muschel feierlich entgegen.
Das Mädchen legte die Arme um ihn und drückte ihn überschwänglich. Dann lief es davon. Es hielt die Arme ausgestreckt und rannte so schnell, dass es zu fliegen schien.
Teil EinsStürme
Maris ließ sich von den Sturmböen über das Meer treiben. Sie zähmte die Winde mit breiten Flügeln aus Metallfolie. Waghalsig flog sie über die Wellen, die Gefahr und die Gischtspritzer bereiteten ihr Vergnügen, die Kälte störte sie nicht im Geringsten. Der Himmel hatte eine ominöse kobaltblaue Färbung angenommen, der Wind frischte auf, und sie hatte Flügel, das reichte ihr. Sie hätte jetzt sterben können und wäre glücklich gestorben, im Flug.
Sie flog besser als jemals zuvor. Sie wirbelte und glitt sorglos zwischen den Luftströmungen dahin und überließ sich geschickt den Aufwinden oder Fallwinden, die sie weiter oder schneller tragen konnten. Sie machte keinen Fehler, wurde nicht zu einem hektischen Gekurve dicht über dem aufgewühlten Ozean gezwungen. Es wäre sicherer gewesen, wie ein Anfänger höher zu fliegen, hoch und sicher vor ihren eigenen Fehlern über die Wellen zu gleiten. Aber Maris streifte wie ein Flieger über die See, wobei ein kurzes Absacken, ein sanftes Berühren des Wassers mit der Flügelspitze unweigerlich einen plumpen Sturz ins Wasser nach sich ziehen würde. Und den Tod, denn mit einer Flügelspannweite von zwanzig Fuß schwimmt man nicht besonders weit.
Maris war kühn, aber sie kannte die Winde genau.
In einiger Entfernung entdeckte sie den Hals einer Szylla. Wie ein gewundenes dunkles Tau zeichnete sie sich gegen den Horizont ab. Ohne lange nachzudenken, reagierte sie. Ihre rechte Hand zog den ledernen Flügelgriff herunter, die linke drückte nach oben. Sie verlagerte ihr gesamtes Körpergewicht. Die großen Silberschwingen – hauchdünnes und federleichtes, aber ungeheuer zähes Material – veränderten ihre Stellung entsprechend ihrer Bewegung. Eine Flügelspitze streifte beinahe die Schaumkronen unter ihr, die andere hob sich. Maris gelang es, sich voll in den Aufwind zu legen; sie begann zu steigen.
Tod, der Himmelstod – oft dachte sie an ihn, aber so wollte sie nicht enden, nicht wie eine unaufmerksame Möwe, die ins Wasser stürzte und einem hungrigen Ungeheuer als Mahlzeit diente.
Minuten später hatte sie die Szylla erreicht. Spöttisch flog sie eine Schleife um das Tier, jedoch außerhalb seiner Reichweite. Aus der Höhe konnte sie den nur teilweise vom Wasser bedeckten Körper sehen, die Reihen schlüpfriger, schwarzer Flossen, die rhythmisch durch das Wasser schaufelten. Der kleine Kopf am Ende ihres langen Halses pendelte langsam hin und her und ignorierte sie. Vielleicht hat es schon früher mit Fliegern Bekanntschaft gemacht, dachte sie, und kann sich mit ihrem Geschmack nicht anfreunden.
Die Winde waren kälter geworden und schwer vom Salz. Ein Unwetter braute sich zusammen. Sie spürte ein Zittern in der Luft. Fast berauscht flog Maris weiter und ließ die Szylla schon bald weit hinter sich zurück. Dann war sie wieder allein. Ohne Mühe flog sie durch eine leere, dunkle Welt aus Meer und Himmel, in der nur das Rauschen des Winds vernehmbar war.
Einige Zeit später erhob sich die Insel aus dem Meer: ihr Ziel. Mit einem Seufzer bedauerte sie das Ende ihrer Reise. Maris ließ sich hinabgleiten.
Gina und Tor, zwei einheimische Landgebundene – Maris hatte keine Ahnung, was sie taten, wenn sie nicht gerade Fliegern halfen –, warteten pflichtbewusst auf der Landzunge, die als Landebahn diente. Um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, kreiste sie kurz über ihnen. Die beiden erhoben sich und winkten ihr zu. Als sie ein zweites Mal zur Landung ansetzte, waren sie bereit. Maris glitt immer tiefer, bis ihre Füße nur noch wenige Zentimeter über dem Boden schwebten. Gina und Tor rannten neben ihr, jeder parallel zu einer Flügelspitze, über den Sand. Ihre Zehen berührten den Boden, und in einer Wolke aus aufgewirbeltem Sand wurde sie langsamer.
Schließlich hielt sie an und blieb ausgestreckt auf dem kühlen, trockenen Sand liegen. Sie kam sich albern vor. Ein gelandeter Flieger gleicht einer Schildkröte, die auf dem Rücken liegt. Sie konnte allein aufstehen, wenn die Situation es erforderte, aber es war ein schwieriger, unwürdiger Vorgang. Dennoch war die Landung gut gelungen.
Gina und Tor begannen, die Flügel Stück für Stück zusammenzufalten. Als jede Verstrebung gelöst und auf das nächste Segment gelegt wurde, hing das dünne Gewebe zwischen ihnen schlaff herunter. Nachdem alle Streckstützen herausgezogen waren, hingen die Flügel in zwei losen Falten kraftlosen Metalls von der Mittelachse, die an Maris’ Rücken festgeschnallt war.
»Wir haben Coll erwartet«, sagte Gina, während sie die letzte Verstrebung zusammenlegte. Ihr kurzes dunkles Haar stand von ihrem Kopf ab wie Stacheln.
Maris schüttelte den Kopf. Vielleicht war Coll an der Reihe gewesen, aber sie hatte sich verzweifelt nach Luft gesehnt. Sie hatte sich die Flügel genommen – es waren immer noch ihre Flügel – und war hinausgegangen, bevor er aufgewacht war.
»Ab nächster Woche wird er ausreichend Gelegenheit zum Fliegen haben, glaube ich«, sagte Tor aufmunternd. Seine blonden Haare waren immer noch voller Sand, und er zitterte im kühlen Seewind, aber er lächelte. »So viel er will.« Er stellte sich vor Maris, um ihr beim Ablegen der Flügel zu helfen.
»Ich werde sie tragen«, erwiderte Maris abweisend. Sie war ungeduldig und ärgerte sich über seine Worte. Wie konnte er das verstehen? Wie konnte einer von ihnen das verstehen? Sie waren Landgebundene.
Sie ging über die Landzunge auf die Hütte zu. Gina und Tor folgten ihr. Sie nahm die üblichen Erfrischungen zu sich und stellte sich vor den offenen Kamin, um sich zu trocknen und aufzuwärmen. Sie antwortete nur einsilbig auf die höflichen Fragen und versuchte, ruhig zu bleiben und nicht daran zu denken, dass dies vielleicht ihr letzter Flug gewesen war. Die anderen akzeptierten ihr Schweigen, weil sie ein Flieger war, aber sie waren enttäuscht.
Für die Landgebundenen waren die Flieger die einzige Möglichkeit, etwas über die anderen Inseln zu erfahren. Die Meere, in denen die Szyllas, Meerkatzen und andere Räuber ihr Unwesen trieben und die täglich von Stürmen heimgesucht wurden, waren für längere Schiffsreisen zu gefährlich. Lediglich zwischen den Inseln einer Gruppe gab es einigermaßen regelmäßigen Schiffsverkehr. Die Flieger stellten somit die einzige Verbindung zur Außenwelt dar, deshalb erwartete man von ihnen den neuesten Klatsch, die neuesten Balladen, Ereignisse und Romanzen.
»Der Landmann möchte dich sprechen, wenn du dich ausgeruht hast«, sagte Gina und berührte Maris vorsichtig an der Schulter. Maris wandte sich ab. Dir genügt es, einem Flieger zu dienen, dachte sie. Du hättest gern einen Flieger zum Ehemann, Coll vielleicht, wenn er erwachsen ist – du hast ja keine Ahnung, was es für mich bedeutet, dass Coll der Flieger sein wird und nicht ich. Aber sie sagte nur: »Ich bin jetzt fertig. Es war ein leichter Flug, der Wind hat die ganze Arbeit gemacht.«
Gina führte sie in ein anderes Zimmer, wo der Landmann bereits auf ihre Botschaft wartete. Ein loderndes Feuer prasselte in einem großen Steinofen. Auch dieses Zimmer war lang und schmal und kaum möbliert. Der Landmann saß in einem bequemen Sessel am Feuer. Als Maris eintrat, erhob er sich. Flieger wurden immer wie Gleichwertige begrüßt, sogar auf den Inseln, wo die Landmänner über göttliche Macht verfügten und wie Götter verehrt wurden.
Nach dem Begrüßungsritual schloss Maris die Augen und übermittelte die Botschaft. Sie wusste nicht, was sie sagte, und es war ihr auch gleichgültig. Man bediente sich ihrer Stimme, ohne ihr Bewusstsein zu belasten. Etwas Politisches, wenn sie sich nicht täuschte. In jüngster Zeit ging es meist um Politik.
Als Maris fertig war, öffnete sie die Augen und lächelte den Landmann an – auch aus Trotz, denn sie hatte gemerkt, dass ihre Botschaft ihn irgendwie beunruhigt hatte. Aber er hatte sich sofort wieder in der Gewalt und erwiderte ihr Lächeln. »Danke«, sagte er ein wenig schwach. »Du hast gute Arbeit geleistet.«
Man lud sie ein, über Nacht zu bleiben, aber sie lehnte ab. Es war möglich, dass der Sturm gegen Morgen abflaute, außerdem liebte sie Nachtflüge. Tor und Gina begleiteten sie nach draußen und führten sie den felsigen Pfad zur Fliegerklippe hinauf. Alle paar Fuß waren Laternen aufgestellt, um den Aufstieg in der Nacht sicherer zu machen. An der höchsten Stelle der Klippe befand sich ein natürlicher Sims, den Menschenhände verbreitert hatten. Der Felsen fiel achtzig Fuß ab, in der Tiefe dröhnte die Brandung. Gina und Tor entfalteten die Flügel und befestigten die Streben. Die dünne Metallfolie spannte sich glatt und silbrig. Maris sprang in die Tiefe.
Der Wind fing sie auf und trug sie höher. Sie schwebte wieder zwischen der dunklen See und dem Sturmhimmel. War sie erst einmal gestartet, sah sie sich niemals nach den sehnsüchtigen Blicken der Landgebundenen um, die ihr folgten. Zu bald würde sie eine von ihnen sein.
Sie dachte nicht daran, nach Hause zu fliegen. Stattdessen ließ sie sich von heftigen Sturmböen nach Westen tragen. Wenn das Gewitter losbrach, musste sie höher steigen, über die Wolken, wo die Gefahr gering war, dass ein Blitz sie traf. Zu Hause würde es ruhig sein, der Sturm war dort längst vorüber. Am Strand würden einige Leute nach Treibgut suchen, ein paar Fischer ruderten vielleicht in der Hoffnung hinaus, dass der Tag nicht ganz verloren war.
Der Wind sang ihr in den Ohren und riss an ihr. Anmutig glitt sie durch die Weite des Himmels. Dann aber kam ihr Coll in den Sinn, und plötzlich geriet sie aus dem Gleichgewicht. Sie sackte ab, kam ins Trudeln, fing sich dann und gewann wieder an Höhe. Sie verfluchte sich. Es war alles so gut gelaufen – sollte es jetzt so enden? Wahrscheinlich war dies ihr letzter Flug, und er sollte der schönste sein. Aber es hatte keinen Zweck, sie hatte ihre Sicherheit verloren. Der Wind und sie waren kein Paar mehr.
Sie fing an, verbissen gegen die Strömung anzukämpfen, und wehrte sich, bis sich ihre Muskeln verkrampften und schmerzten. Dann versuchte sie, Höhe zu gewinnen. Wenn man nicht das richtige Gefühl für den Wind besaß, war es besser, die Nähe des Wassers zu meiden.
Sie war erschöpft und des Kampfes müde, als sie die Felswand von Eyrie erblickte. Erst jetzt wurde ihr bewusst, welche Strecke sie zurückgelegt hatte.
Eyrie war lediglich ein gewaltiger Felsen, der aus dem Meer ragte, ein zerklüfteter, den wütenden Angriffen des Wassers ausgesetzter Gesteinsturm, an dessen mächtigen, steilen Wänden sich die Wellen brachen. Es war keine richtige Insel, hier wuchsen nur ein paar harte Flechten. In den zerborstenen Nischen und Spalten nisteten Vögel, und auf der höchsten Spitze hatten sich die Flieger ein Nest gebaut. Hier, wo kein Schiff festmachen konnte, hier, wo nur Flieger – seien es Vögel oder Menschen – hingelangten, hier stand die dunkle Felshütte.
»Maris!«
Als sie ihren Namen hörte, blickte sie auf. Dorrel glitt ihr lachend entgegen. Seine Flügel zeichneten sich dunkel gegen die Wolken ab. Im letzten Augenblick tauchte sie unter ihm weg. Er jagte sie um Eyrie herum. Die unbändige Freude des Fliegens ließ sie Müdigkeit und Schmerzen vergessen.
Als sie endlich landeten, fegte von Osten ein Regenschauer über sie hinweg. Er peitschte in ihre Gesichter und schlug hart gegen die Flügel. Maris spürte, dass sie beinahe starr vor Kälte war. Ohne fremde Hilfe landeten sie in einer weichen Sandkuhle, die zwischen den Felsen aufgeschüttet worden war. Maris rutschte zehn Fuß durch den Schlamm, bevor sie endgültig anhalten konnte. Vorsichtig befestigte sie die Flügel an einem Halteseil und begann, die Flügel nach und nach zusammenzufalten.
Als sie endlich fertig war, klapperten ihre Zähne, und ihre Arme waren schwer wie Blei. Dorrel sah sie skeptisch an.
Er hatte seine Flügel bereits gefaltet und über die Schulter gelegt. »Warst du lange unterwegs?«, fragte er. »Wir hätten sofort landen sollen. Schwieriges Flugwetter. Ich selbst habe nur die Ausläufer mitbekommen. Bist du in Ordnung?«
»Na klar. Etwas müde zwar, aber ich fühle mich gut. Ich bin froh, dass wir uns getroffen haben. Es war ein aufregender Flug, so was habe ich jetzt gebraucht. Der letzte Teil der Reise war etwas ungemütlich, ich dachte schon, ich würde abstürzen. Aber ein guter Flug ist mehr wert als eine Ruhepause.«
Dorrel lachte und legte ihr den Arm um die Schultern. Seine Körperwärme machte ihr bewusst, wie entsetzlich sie fror. Er drückte sie fest an sich. »Lass uns hineingehen, bevor du erfrierst. Garth hat einige Flaschen Kivas von Shotan mitgebracht. Eine davon ist inzwischen bestimmt heiß. Wir und der Kivas werden dich sicher wieder auf die Beine bringen.«
Der Gemeinschaftsraum der Hütte war wie immer warm und einladend, aber fast leer. Nur Garth, ein gedrungener, muskulöser Flieger, etwa zehn Jahre älter als Maris, saß am Feuer. Er blickte auf und hieß sie willkommen. Maris wollte antworten, aber sehnsüchtiges Verlangen schnürte ihr die Kehle zu, ihre Zähne waren zusammengepresst. Dorrel führte sie ans Feuer.
»Wie ein Idiot habe ich sie in der Kälte herumgejagt«, sagte Dorrel. »Ist der Kivas heiß? Schenk uns ein.« Behände zog er sich seine nassen, schmutzigen Sachen aus und holte zwei Handtücher von einem Stapel neben dem Kamin.
»Warum sollte ich meinen Kivas an dich vergeuden?«, polterte Garth. »Bei Maris mache ich natürlich eine Ausnahme, sie ist wunderschön und eine ausgezeichnete Fliegerin.« Er verbeugte sich schwungvoll vor ihr.
»Du müsstest froh sein, dass ich das Zeug überhaupt trinke«, sagte Dorrel und rubbelte sich trocken, »oder wäre es dir lieber, wenn ich es auf den Fußboden gieße?«
Das Geplänkel ging weiter, aber Maris achtete nicht darauf. Sie kannte die raue Sprache der Flieger. Sie rieb ihr Haar trocken und beobachtete dabei das Muster, das durch die herabfallenden Tropfen auf dem Fußboden entstand und wieder verschwand.
Sie sah Dorrel an und versuchte, sich sein Aussehen einzuprägen: den muskulösen Körper – der Körper eines ausgezeichneten Fliegers – und das lebhafte Mienenspiel, wenn er auf Garth einredete. Als er merkte, dass sie ihn anstarrte, drehte er sich um. Garth hörte auf zu sticheln. Dorrel streichelte Maris und zeichnete sanft die Linie ihres Kinns nach.
»Du zitterst ja immer noch«, sagte er und wickelte sie in ein Handtuch. »Garth, nimm die Flasche vom Feuer, bevor sie explodiert, und gib uns zu trinken.«
Der Kivas, ein heißer Gewürzwein, der nach Rosinen und Nüssen schmeckte, wurde in großen Steinkrügen serviert. Der erste Schluck gab Maris das Gefühl, als flösse Feuer durch ihre Adern. Ihr Schüttelfrost ließ nach.
Garth lächelte ihr zu. »Das tut gut, nicht wahr? Eigentlich viel zu schade für so einen Banausen wie Dorrel. Ich habe die Flaschen einem ekligen alten Fischer abgeluchst, der sie in einem Wrack fand und nicht wusste, welche Kostbarkeit er besaß. Seine Frau hat sich geweigert, das Zeug in der Hütte aufzubewahren. Ich gab ihm dafür ein paar lumpige Metallperlen, die ich für meine Schwester besorgt hatte.«
»Und was bekommt nun deine Schwester?«, erkundigte sich Maris und nahm noch einen Schluck.
Garth zuckte die Schultern. »Sie? Es sollte eine Überraschung sein. Ich bringe ihr eben von meinem nächsten Flug nach Poweet etwas mit. Vielleicht bemalte Eier.«
»Wenn du sie auf dem Heimflug nicht wieder verhökerst«, sagte Dorrel. »Falls deine Schwester jemals ein Geschenk von dir bekommt, wird ihr Schreck größer sein als ihre Freude. Du bist eine echte Krämerseele. Ich glaube, wenn dir jemand ein gutes Angebot macht, verschacherst du sogar deine Flügel.«
Garth räusperte sich empört. »Halt den Schnabel, du Plappergans.« Er wandte sich Maris zu. »Wie geht es deinem Bruder? Man sieht ihn so selten.«
Maris nahm noch einen Schluck und presste die Hände um den Krug. »Nächste Woche wird er flugjährig«, sagte sie zögernd. »Dann gehören die Flügel ihm. Ich kümmere mich nicht darum, was er treibt. Vielleicht will er nichts mit dir zu tun haben.«
»Hu«, machte Garth. »Aber warum?« Seine Stimme klang gekränkt.
Maris winkte ab und zwang sich zu lächeln. Sie hatte ihn bloß hänseln wollen.
»Ich mag ihn gern«, fuhr Garth fort. »Wir alle mögen ihn, nicht wahr, Dorrel? Er ist jung und ausgeglichen. Vielleicht ein bisschen zu vorsichtig, aber er wird sich verbessern. Er ist irgendwie anders als wir, aber er kann Geschichten erzählen und singen. Die Landgebundenen werden beim Anblick seiner Flügel in Ekstase geraten.« Garth schüttelte verwundert den Kopf. »Wo lernt er all diese Lieder? Ich bin viel weiter herumgekommen als er, aber …«
»Er dichtet sie selbst«, sagte Maris.
»Selbst?«, wiederholte Garth beeindruckt. »Er wird unser Sänger sein. Beim nächsten Sängerwettstreit werden wir den Östlichen Inseln den Preis abnehmen. Die Westlichen Inseln haben zwar immer die besten Flieger«, sagte er stolz, »aber unsere Sänger haben noch keine Furore gemacht.«
»Beim letzten Treffen habe ich die Westlichen Inseln vertreten«, widersprach Dorrel.
»Ja eben.«
»Du kreischst wie eine Seekatze.«
»Ja«, sagte Garth, »ich behaupte ja auch nicht, dass ich Talent besitze.«
Maris hatte Dorrels Antwort überhört. Ihre Gedanken richteten sich nicht auf das Gespräch. Sie hatte die Hände um den Krug gelegt und sah nachdenklich in die Flammen. Hier oben in Eyrie hatte sie ihren inneren Frieden wiedergefunden, obwohl Garth Coll erwähnt hatte. Sie fühlte sich seltsam geborgen. Hier oben auf dem Fliegerfelsen lebte niemand, und doch strahlte er eine heimelige Atmosphäre aus. Es war ihr Zuhause. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass sie nie wieder hierherkommen sollte.
Sie erinnerte sich an den Tag, an dem sie das erste Mal nach Eyrie gekommen war. Es war vor sechs Jahren gewesen, einen Tag nachdem sie flugjährig geworden war. Sie war ein schüchternes dreizehnjähriges Mädchen gewesen und stolz darauf, so einen weiten Flug allein gewagt zu haben, aber auch verängstigt und scheu. Als sie angekommen war, hatte gerade ein Fest stattgefunden. Mehr als ein Dutzend Flieger waren am Feuer versammelt gewesen und hatten in ausgelassener Stimmung getrunken. Nachdem sie eingetreten war, waren alle verstummt und hatten sie angelächelt. Garth war damals ein stiller Bursche und Dorrel ein magerer Junge gewesen, kaum älter als sie selbst. Sie hatte niemanden gekannt. Helmer, ein Flieger mittleren Alters von den Nachbarinseln, war dabei gewesen und hatte sie einander vorgestellt. Noch heute erinnerte sie sich an die Gesichter und Namen. An die rothaarige Anni von Culhall, Foster, der später das Fliegen aufgab, weil er zu fett wurde, Jamis senior und besonders an einen mit dem Spitznamen Rabe, ein junger Angeber, stets in schwarzes Fell und schwarze Metallfolie gekleidet, der den Fliegerwettstreit schon dreimal für die Östlichen Inseln gewonnen hatte. Auch konnte sie sich an eine schlanke Blondine von den Äußeren Inseln erinnern. Ihr zu Ehren hatte das Fest stattgefunden, denn es geschah selten, dass jemand von so weit herkam.
Alle hatten Maris begrüßt, und bald war es ihr vorgekommen, als kümmerten sich alle nur um sie. Obwohl sie damals noch so jung gewesen war, hatten sie ihr Wein zu trinken gegeben, und sie hatte mit ihnen singen müssen. Dann hatten sie ihre Fliegergeschichten zum Besten gegeben. Die meisten davon hatte sie zwar gekannt, aber sie hatte sie noch nie von den Fliegern selbst gehört. Später, als sie gespürt hatte, dass sie dazugehörte, ließ man wieder von ihr ab, und das Fest ging seinen normalen Gang.
Es war ein fremdartiges, unvergessliches Fest gewesen, und ein Ereignis hatte sich ganz besonders in ihr Gedächtnis gegraben. Rabe, der als Einziger von den Östlichen Inseln stammte, hatte eine Menge Sticheleien zu hören bekommen. Als ihm dann der Wein zu Kopf gestiegen war, hatte er sich zur Wehr gesetzt. »Ihr nennt euch Flieger«, hatte er in herausforderndem Ton gesagt, den Maris nicht vergessen würde, »los, kommt mit. Ich zeige euch, was ein richtiger Flieger kann.«
Die ganze Gesellschaft war auf die Sprungklippe, die höchste von allen, hinausgegangen. Sechshundert Fuß fiel sie senkrecht ab, bis ganz unten die Felsen wie Raubtierzähne aus dem Wasser ragten. Rabe war mit zusammengefalteten Flügeln auf den Sims getreten. Dort hatte er die ersten drei Abschnitte eines jeden Flügels geöffnet und sie an den Armen festgeschnallt, ohne jedoch die Streben zu arretieren. Die Flügelgelenke hatten sich bei jeder Regung von ihm bewegt. Die anderen, noch nicht ausgebreiteten Abschnitte hatte er mit den Händen festgehalten.
Maris hatte nicht geahnt, was er vorhatte, es aber kurz darauf erfahren. Er hatte Anlauf genommen und war mit einem gewaltigen Satz von der Klippe gesprungen, ohne die Flügel zu entfalten.
Sie hatte geschrien und war an den Klippenrand gelaufen. Die anderen waren gefolgt, einige blass, andere grinsend. Dorrel hatte neben ihr gestanden.
Rabe war in die Tiefe gefallen wie ein Stein, die Arme an den Körper gelegt. Seine Flügel hatten sich aufgebauscht, als wären sie ein Cape. Kopfüber war er in die endlose Tiefe gestürzt.
Als er die Felsen fast erreicht hatte – als sie schon den Aufprall zu spüren glaubte –, hatten seine Silberflügel im Sonnenlicht aufgeblitzt. Flügel aus dem Nichts. Der Wind hatte sich darin verfangen, und Rabe war dahingeglitten.
Maris war tief beeindruckt gewesen. Aber Jamis senior hatte nur gelacht. »Rabes Kunststück«, hatte er abwertend kommentiert. »Ich habe ihm schon zweimal dabei zugesehen. Er ölt seine Flügelgelenke sorgfältig. Wenn er tief genug gefallen ist, öffnet er die Flügel mit dem größtmöglichen Ruck. Sobald eines der Gelenke eingerastet ist, gibt es den Impuls an die nächsten weiter. Sieht großartig aus. Er hat sicherlich lange geübt, bevor er den Trick in der Öffentlichkeit vorgeführt hat. Aber eines Tages wird sich etwas verklemmen, und wir sind von seinem Gerede erlöst.«
Doch seine Worte hatten den Zauber nicht zerstören können. Maris hatte schon oft Flieger gesehen, die ungeduldig die fast geöffneten Flügel über den Kopf gehoben und mit einem Ruck ganz ausgespreizt hatten. Das war meist geschehen, wenn die Helfer am Sprungfelsen zu langsam gearbeitet hatten. Aber gegen Rabes Kunststück war das nichts gewesen.
Als sie ihn später an der Landekuhle abgeholt hatten, hatte er nur herablassend gelächelt. »Wenn ihr das könnt«, hatte er sie herausgefordert, »könnt ihr euch Flieger nennen.« Gewiss, Rabe war ein arroganter, leichtsinniger Bursche gewesen, aber von diesem Moment an hatte Maris jahrelang geglaubt, wahnsinnig in ihn verliebt zu sein.
Traurig schüttelte sie den Kopf und trank den letzten Kivas. Das alles schien jetzt so albern. Rabe war zwei Jahre nach dem Fest gestorben, einfach spurlos verschwunden. Jedes Jahr starben ein Dutzend Flieger und nahmen ihre wertvollen Flügel mit ins Grab. Die einen stürzten durch Ungeschick ins Meer, andere, die sich zu nah an die Wasseroberfläche wagten, wurden von Szyllas in die Tiefe gezerrt. Stürme konnten sie vom Himmel fegen, Blitze verfolgten ihre metallhaltigen Flügel – ja, ein Flieger konnte auf viele Arten sterben. Die meisten, vermutete Maris, verirrten sich einfach und verfehlten ihr Ziel. Blindlings flogen sie weiter, bis die Erschöpfung sie übermannte. Einige wenige fielen wohl auch der größten Gefahr des Himmels zum Opfer: der Windstille. Maris wusste heute, dass Rabe von Anfang an ein Todeskandidat gewesen war, ein Flieger, der aus Angeberei die Grundregeln der Vernunft außer Acht ließ.
Dorrels Stimme riss sie aus ihren Erinnerungen. »Maris«, sagte er, »he, schlaf uns nicht ein.«
Maris stellte den leeren Krug auf den Tisch zurück. Noch immer suchten ihre Hände die Wärme des rauen Steins. Energisch zog sie die Hand zurück und griff nach ihrem Pullover.
»Er ist noch nicht trocken«, protestierte Garth.
»Ist dir kalt?«, fragte Dorrel.
»Nein, aber ich muss zurück.«
»Du bist viel zu müde«, sagte Dorrel, »bleib über Nacht.«
Maris entzog sich seinem Blick. »Ich muss. Sie werden sich Sorgen machen.«
Dorrel seufzte. »Dann zieh dir wenigstens trockene Sachen an.« Er stand auf, ging in die gegenüberliegende Ecke des Gemeinschaftsraums und öffnete die Türen eines hölzernen Kleiderschranks. »Komm her und such dir etwas aus.«
Maris rührte sich nicht. »Ich nehme besser meine eigenen Sachen. Ich komme nicht mehr zurück.«
Dorrel fluchte leise. »Maris, stell dich nicht an … du weißt doch … sei vernünftig, nimm die Sachen. Du weißt, dass du sie behalten kannst, außerdem haben wir ja deine als Ersatz. Ich lasse dich nicht in nassen Kleidern gehen.«
»Schon gut«, sagte Maris.
Garth lächelte sie an, während Dorrel auf sie wartete.
Langsam erhob sie sich und zog das Handtuch fester, während sie sich vom Feuer entfernte. Die Spitzen ihrer kurzen, dunklen Haare fielen feucht und kalt gegen ihren Hals. Gemeinsam mit Dorrel suchte sie etwas Passendes aus dem Kleiderstapel heraus. Endlich fand sie eine Hose und einen braunen Wollgraspullover, die ihrer schlanken, drahtigen Figur entsprachen. Dorrel sah ihr beim Anziehen zu und ergriff schnell seine eigenen Sachen. Dann nahm sie ihr Fluggestell vom Ständer neben der Tür. Prüfend fühlte Maris mit ihren langen, starken Fingern über die Streben. Die Flügel versagten selten, aber wenn ein Schaden auftrat, dann meist an den Scharnieren. Die Metallfolie schimmerte weich und stark, wie zu jener Zeit, als die Sternensegler sie auf diese Welt gebracht hatten. Zufrieden schnallte sie die Flügel fest. Sie waren in gutem Zustand. Coll würde sie jahrelang tragen können, und auch seine Nachkommen konnten sie übernehmen.
Garth war neben sie getreten. Sie sah ihn an.
»Mir fällt es nicht so leicht, die richtigen Worte zu finden, wie Coll oder Dorrel«, begann er. »Ich … also. Leb wohl, Maris.« Er errötete und sah jämmerlich drein. Flieger sagten sich nicht Lebewohl. Aber ich bin kein Flieger, dachte sie, umarmte und küsste Garth und sagte ihm Lebewohl, den Abschiedsgruß der Landgebundenen.
Dorrel begleitete sie nach draußen. Hier oben blies immer ein kräftiger Wind, aber der Sturm war vorüber. Ein feiner, salziger Sprühnebel lag in der Luft, und die Sterne blinkten.
»Bleib wenigstens zum Essen«, bat Dorrel. »Garth und ich würden darum kämpfen, dich bedienen zu dürfen.«
Maris schüttelte den Kopf. Sie hätte nicht kommen dürfen. Sie wäre besser gleich nach Hause geflogen, ohne Garth und Dorrel Lebewohl zu sagen. Es wäre leichter gewesen, einfach so zu tun, als würde nichts geschehen, als bliebe alles beim Alten, und dann zu verschwinden. Als sie die steile Sprungklippe erreichten, dieselbe, von der sich Rabe vor so langer Zeit in die Tiefe gestürzt hatte, griff sie nach Dorrels Hand. Eine Weile standen sie schweigend da.
»Maris«, begann er stockend. Er starrte auf das Meer, während er ihre Hand in seiner hielt. »Maris, du könntest mich heiraten. Wir könnten uns die Flügel teilen, dann müsstest du nicht gänzlich auf das Fliegen verzichten.«
Maris ließ seine Hand los. Schamesröte stieg ihr ins Gesicht. Dazu hatte er kein Recht; es war grausam, so etwas vorzuschlagen. »Nicht«, flüsterte sie. »Du darfst die Flügel mit niemandem teilen.«
»Tradition«, sagte er verzweifelt.
Sie spürte seine Enttäuschung. Er wollte ihr helfen, stattdessen machte er alles noch viel schlimmer.
»Wir könnten es wenigstens versuchen. Die Flügel gehören mir, aber du könntest sie tragen …«
»Hör auf, Dorrel. Der Landmann, dein Landmann, würde das niemals gestatten. Es ist nicht nur Tradition, es ist Gesetz. Sie würden dir die Flügel wegnehmen und sie jemandem geben, der das Gesetz respektiert. Erinnere dich an Lind, den Schmuggler. Angenommen, wir fliehen an einen Ort, wo es weder Gesetz noch Landmänner gibt, an einen einsamen Ort – wie lange könntest du es ertragen, deine Flügel mit jemandem zu teilen? Mit mir zu teilen? Verstehst du nicht? Wir würden uns hassen. Ich bin kein Kind, das üben darf, während du dich ausruhst. So könnte ich nicht leben, angewiesen auf das Mitleid eines anderen Fliegers und doch zu wissen, dass die Flügel niemals mir gehören. Du könntest es nicht aushalten zu sehen, wie ich dich beobachte … wir würden …« Sie hielt inne und suchte nach Worten.
Dorrel schwieg einen Moment. »Es tut mir leid«, sagte er. »Ich wollte etwas tun, um dir zu helfen, Maris. Der Gedanke, dass du nie mehr fliegen wirst, ist unerträglich. Ich wollte dir etwas geben. Ich kann es nicht fassen, dass du fortgehst und dann …«
Sie nahm wieder seine Hand und hielt sie ganz fest. »Ja, ja. Psst.«
»Du weißt, dass ich dich liebe, Maris. Du weißt es doch?«
»Ja, und ich liebe dich, Dorrel. Aber … ich werde niemals einen Flieger heiraten. Ich könnte es nicht. Ich würde ihn umbringen, um seine Flügel zu bekommen.« Sie versuchte, ihre düsteren Worte durch ein Lächeln abzumildern. Es misslang.
Am Rand der Klippe umarmten sie einander und versuchten, durch den Druck ihrer Körper all das auszudrücken, was sie nicht zu sagen vermochten. Mit Tränen in den Augen rissen sie sich los.
Maris zerrte an ihren Flügeln. Plötzlich fror sie wieder. Dorrel wollte ihr helfen, aber seine Finger behinderten sie nur. Beide lachten unsicher über ihre Ungeschicklichkeit. Sie ließ ihn die Flügel entfalten. Als er den ersten ausgebreitet hatte und mit dem zweiten fast fertig war, fiel ihr plötzlich Rabe wieder ein. Sie winkte Dorrel zur Seite. Verwirrt beobachtete er, wie Maris den Flügel über den Kopf hob und mit einem Ruck zur Seite schleuderte. Sie war fertig zum Absprung.
»Guten Flug«, sagte er schließlich.
Maris wollte etwas sagen, nickte aber nur. »Und du«, sagte sie endlich, »pass auf dich auf, bis …« Aber diese letzte Lüge brachte sie nicht über die Lippen, ebenso wenig konnte sie ihm Lebewohl sagen. Sie drehte sich um, rannte davon und stieß sich von Eyrie ab, hinein in die Nachtwinde eines kalten, schwarzen Himmels.
Es war ein langer, einsamer Flug über das sternenbeleuchtete Meer. Nichts regte sich. Der Wind blies unaufhörlich von Osten.
Maris musste gegen ihn anfliegen, wodurch sie Zeit und Geschwindigkeit verlor. Als sie endlich den Leuchtturm ihrer Heimatinsel Klein Amberly erspähte, war Mitternacht längst vorbei.
Unten am Landestreifen war noch ein anderes Licht. Als sie leicht und anmutig über die Küste flog und zur Landung ansetzte, wunderte sie sich darüber. Sie dachte, es wäre einer der Helfer, aber die waren um diese Zeit normalerweise nicht am Strand. Unvermittelt schlug sie auf dem Boden auf.
Maris fluchte und beeilte sich aufzustehen. Hastig begann sie, die Schwingen zu lösen. Sie hätte wissen müssen, wie gefährlich es war, sich im Augenblick der Landung ablenken zu lassen. Das Licht kam näher.
»Hast du dich also doch zur Rückkehr durchgerungen«, hörte sie eine harte, zornige Stimme. Es war Russ, ihr Vater – eigentlich ihr Stiefvater. Mit der gesunden Hand hielt er eine Laterne, seine rechte Hand hing bewegungslos herab.
»Ich habe auf Eyrie Zwischenstation gemacht«, sagte sie entschuldigend. »Hast du dir Sorgen gemacht?«
»Coll sollte den Flug übernehmen, nicht du.« Grimmige Linien durchzogen sein Gesicht.
»Er hat noch geschlafen«, sagte Maris. »Er war viel zu langsam, er hätte den besten Flugwind verpasst. Er wäre in den Regen gekommen und hätte eine Ewigkeit für den Rückflug gebraucht. Falls er überhaupt hier angekommen wäre, denn er fliegt nicht gut im Regen.«
»Er muss es lernen. Der Junge muss seine eigenen Erfahrungen sammeln. Du warst seine Lehrerin, aber bald gehören die Flügel ihm. Er ist der Flieger und nicht du.«
Maris zuckte zusammen, als habe er sie geschlagen. Das war derselbe Mann, der sie fliegen gelehrt hatte, der so stolz darauf gewesen war, dass sie instinktiv das Richtige zu tun schien. Wie oft hatte er ihr versichert, dass ihr die Flügel gehören würden, obwohl sie nicht seine leibliche Tochter war. Zu einer Zeit, als es sicher schien, dass sie keine eigenen Kinder haben konnten, hatten er und seine Frau Maris zu sich genommen. Auf diese Weise hatten sie einen Erben für die Flügel. Durch einen Unfall für immer vom Himmel verbannt, war es wichtig für ihn gewesen, einen Nachfolger zu finden. Seine Frau hatte sich geweigert, das Fliegen zu erlernen. Damals hatte sie bereits fünfunddreißig Jahre als Landgebundene gelebt und nicht die Absicht, von einer Klippe zu springen. Außerdem war es schon zu spät gewesen, denn das Fliegen musste in frühester Jugend erlernt werden. Darum hatte er Maris das Fliegen gelehrt, sie adoptiert und an Kindes statt geliebt, Maris, die kleine Fischerstochter, die nicht mit anderen Kindern spielte, sondern immer hoch oben auf der Sprungklippe saß und die Flieger beobachtete.
Aber dann, entgegen aller Wahrscheinlichkeit, kam Coll zur Welt. Seine Mutter war gleich nach der langen, schwierigen Geburt gestorben. Maris, damals selbst noch ein Kind, erinnerte sich an jene dunkle Nacht. Leute waren ein und aus gegangen, und später hatte ihr Stiefvater allein in der Ecke gesessen und geweint. Coll hatte überlebt. Maris, plötzlich zu einer Kindmutter geworden, liebte und versorgte ihn. Anfangs glaubte niemand, dass Coll durchkommen würde. Maris war glücklich, als der Kleine seine Schwäche überwunden hatte, und jahrelang liebte sie ihn als Bruder und Sohn. Nebenbei übte sie unter den wachsamen Augen des Vaters das Fliegen.
Bis zu jenem Abend, als der Vater ihr erklärte, dass Coll, das Baby Coll, ihre Flügel bekommen würde.
»Ich fliege viel besser, als er jemals fliegen wird«, sagte Maris jetzt unten am Strand, und ihre Stimme zitterte.
»Das streite ich nicht ab. Aber das spielt keine Rolle. Er ist mein Fleisch und Blut.«
»Das ist ungerecht!«, schrie sie. Zum ersten Mal sprach sie aus, was sie seit jenem Tag empfand, als ihr Vater ihr gesagt hatte, dass Coll die Flügel erben würde. Seit damals war Coll herangewachsen, dennoch war er noch zu jung. Aber der Tag seiner Flugjährigkeit rückte näher. Maris besaß nicht den mindesten Anspruch. Das Fliegergesetz galt seit Generationen und ging zurück bis zu den Sternseglern selbst, den legendären Flügelschmieden. Das erstgeborene Kind aus einer Fliegerfamilie übernahm die Flügel von seinen Eltern. Talent spielte dabei keine Rolle, es handelte sich um ein reines Erbfolgerecht. Und Maris kam aus einer Fischerfamilie.
»Ungerecht oder nicht, das Gesetz verlangt es so, Maris. Du weißt es seit Langem, auch wenn du es nicht wahrhaben wolltest. Sechs Jahre lang hast du den Flieger gespielt, und ich ließ dich gewähren, weil du es liebtest und weil Coll einen fähigen Lehrmeister brauchte und weil unsere Insel für nur zwei Flieger zu groß ist. Aber du wusstest, dass dieser Tag kommen musste.«
Er könnte ruhig etwas freundlicher sein, dachte sie verbittert. Er sollte doch wissen, was es bedeutet, den Himmel zu verlieren.
»Komm jetzt«, sagte er. »Du wirst nie wieder fliegen.«
Ihre Flügel waren noch voll ausgespreizt. Sie hatte lediglich einen Gurt gelöst. »Ich werde fortgehen«, sagte sie erregt. »Du wirst mich nie wiedersehen. Ich werde eine Insel suchen, die keinen eigenen Flieger besitzt. Sie werden mich mit offenen Armen empfangen und nicht danach fragen, wie ich an meine Flügel gekommen bin.«
»Niemals«, sagte ihr Vater traurig. »Die anderen Flieger würden die Insel meiden, so wie sie es getan haben, als der verrückte Landmann von Kennehut den Flieger-Der-Schlechte-Nachrichten-Brachte exekutiert hatte. Man würde dir die gestohlenen Flügel abnehmen, ganz gleich, wohin du gehst. Kein Landmann würde dieses Risiko eingehen.«
»Dann zerstöre ich sie!«, sagte Maris, der Hysterie nah. »Dann kann auch Coll niemals mehr fliegen … dann …«
Glas klirrte auf Stein. Ihr Vater hatte die Laterne fallen gelassen. Das Licht erlosch. Er packte ihre Hände. »Das brächtest du nicht fertig. So etwas könntest du Coll nicht antun. Gib mir jetzt die Flügel.«
»Ich würde nie …«
»Ich weiß nicht, wozu du fähig wärst oder nicht. Ich dachte, du wärst heute Morgen hinausgeflogen, um dich zu töten, um im Flug zu sterben. Ich kenne das Gefühl, Maris. Deshalb hatte ich solche Angst und war so wütend. Du darfst Coll nicht die Schuld geben.«
»Nein. Ich würde auch niemals verhindern, dass er fliegt, aber ich würde selbst so unendlich gern fliegen, bitte, Vater.« In der Dunkelheit liefen ihr die Tränen über die Wangen, sie schmiegte sich an ihn.
»Ja, Maris«, sagte er. Er konnte den Arm nicht um sie legen, die Flügel waren im Weg. »Ich kann nichts für dich tun. So sind die Dinge nun einmal. Du musst wie ich lernen, ohne Flügel zu leben. Wenigstens durftest du sie eine Zeit lang tragen – du weißt, was Fliegen bedeutet.«
»Das reicht mir aber nicht!«, sagte sie dickköpfig. »Früher, als ich noch nicht in deinem Hause gelebt habe, als du der berühmte Flieger von Amberly warst und ich ein kleines, unbekanntes Mädchen, da dachte ich, es sei genug. Ich habe dich und die anderen Flieger beobachtet und gedacht, wenn ich nur einmal die Flügel haben dürfte, nur für einen winzigen Augenblick, dann wäre mein Lebenswunsch erfüllt. Aber so ist es nicht. Ich kann nicht auf sie verzichten.«
Die strengen Linien waren jetzt aus dem Gesicht des Vaters verschwunden. Er streichelte sie zärtlich und trocknete ihre Tränen. »Vielleicht hast du recht«, sagte er langsam und schwerfällig. »Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ich dachte, wenn du wenigstens eine Weile fliegen könntest, wäre das besser als gar nichts. Ich dachte, es wäre ein wunderbares Geschenk. Aber ich habe mich geirrt. Du kannst nun niemals mehr glücklich sein. Du wirst nie eine Landgebundene, denn du bist geflogen. Du wirst dir immer eingesperrt vorkommen.« Er schwieg plötzlich, und Maris begriff, dass er auch von sich sprach.
Er half ihr beim Abnehmen und Falten der Flügel, dann traten sie gemeinsam den Heimweg an.
Ihr Haus war ein einfacher Holzbau, umgeben von Wiesen und Bäumen. Hinter dem Haus plätscherte ein Bach. Flieger konnten gut und sorglos leben. Russ wünschte ihr eine gute Nacht und nahm die Flügel mit nach oben. Vertraut er mir nicht mehr?, dachte Maris. Was habe ich getan? Und wieder brach sie in Tränen aus.
In der Küche fand sie Käse, kalten Braten und Tee. Sie nahm alles mit ins Esszimmer. Eine kugelförmige Sandkerze stand mitten auf dem Tisch. Sie zündete sie an, und während sie aß, sah sie dem Spiel der Flamme zu.
Als sie sich eben zum Gehen anschickte, trat Coll ein. Unschlüssig blieb er in der Tür stehen. »Hallo Maris«, sagte er leise. »Ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich habe auf dich gewartet.« Für einen Dreizehnjährigen war er recht groß. Er hatte einen schlanken, geschmeidigen Körper, lange, rotblonde Haare und den ersten Anflug eines Schnurrbarts.
»Hallo Coll«, sagte Maris. »Steh nicht so rum. Es tut mir leid, dass ich die Flügel genommen habe.«
Er setzte sich. »Du weißt, dass es mir nichts ausmacht. Du fliegst viel besser als ich und … na ja, du weißt schon. War Vater sehr wütend?«
Maris nickte.
Coll sah betrübt und ängstlich aus. »Noch eine Woche, Maris. Was sollen wir tun?« Er starrte in die Kerze und wagte nicht, Maris in die Augen zu schauen.
Sie seufzte und legte zärtlich die Hand auf seinen Arm. »Uns bleibt keine Wahl.« Sie hatten schon oft darüber gesprochen, sie und Coll. Sie kannte seinen Kummer so gut wie ihren eigenen. Sie war seine Schwester und seine Mutter, und der Junge teilte seine Sorgen und Geheimnisse mit ihr. Das war die größte Ironie.
Auch jetzt schaute er hoffnungssuchend zu ihr auf wie ein hilfloses Kind, obwohl er wusste, dass sie ebenso hilflos war wie er. »Warum bleibt uns keine Wahl? Ich begreife das nicht.«
Maris seufzte. »Das ist das Gesetz, Coll. Wir können nicht gegen die Tradition verstoßen, das weißt du genau. Wir müssen der Pflicht nachkommen. Wenn die Entscheidung bei uns läge, würde ich die Flügel behalten und der Flieger sein. Du wärst der Sänger. Wir könnten beide stolz auf uns sein, weil wir unser Talent optimal einsetzten. Das Leben als Landgebundene wird schwer werden. Ich sehne mich so nach den Flügeln. Ich habe sie besessen, und es ist nicht gerecht, dass man sie mir wegnimmt. Aber vielleicht steht eine höhere Gerechtigkeit dahinter, die ich nicht erkenne. Klügere Leute als wir haben die Entscheidung getroffen, und vielleicht bin ich zu jung, um es zu verstehen, oder zu egoistisch.«
Nervös fuhr sich Coll mit der Zunge über die Lippen.
Sie sah ihn fragend an.
Uneinsichtig schüttelte er den Kopf. »Das ist nicht richtig, Maris, so geht es einfach nicht. Es ist alles so idiotisch. Ich will nicht fliegen, ich will dir deine Flügel nicht nehmen. Ich tue dir weh, obwohl ich es nicht will, aber ich will auch Vater nicht kränken. Wie kann ich ihm die Wahrheit sagen? Ich bin sein Erbe und so. Ich bin dazu bestimmt, die Flügel zu übernehmen. Er würde mich hassen. Die Lieder handeln nicht von Fliegern, die sich vor dem Himmel fürchten. Flieger haben keine Angst – aber ich bin nicht zum Flieger geboren.«
Seine Hände zitterten sichtlich.
»Mach dir keine Sorgen, Coll. Es wird sich alles zum Guten wenden, wirklich. Zuerst hat jeder Angst. Mir ist es nicht anders gegangen.« Sie musste lügen, um ihm die Angst zu nehmen.
»Aber es ist nicht gerecht!«, schrie er. »Ich möchte den Gesang nicht aufgeben, und wenn ich fliege, kann ich nicht singen, nicht so wie Barrion, nicht so, wie ich es gern täte. Warum verlangen sie es von mir? Warum kannst du nicht der Flieger sein, wie du es dir wünschst? Warum?«
Sie sah ihn an. Er war den Tränen nah. Auch sie konnte das Weinen kaum noch unterdrücken. Sie wusste keine Antwort. »Ich weiß es nicht, Kleiner. So war es bisher, und so wird es immer sein.«
Sie starrten sich an. Beide Gefangene eines Gesetzes, das älter war als sie, und einer Tradition, die sie nicht verstanden. Hilflos und verletzt saßen sie im Kerzenlicht und sprachen immer wieder alles durch. Erst spät in der Nacht gingen sie zu Bett, ohne das Problem gelöst zu haben.
Als sie allein in ihrem Bett lag, stieg der Groll erneut in Maris auf, das Bewusstsein, etwas verloren zu haben, und die damit verbundene Schande. Sie weinte sich in den Schlaf und träumte von purpurfarbenen Sternhimmeln, die sie niemals mehr durchfliegen würde.
Die Woche schien eine Ewigkeit zu dauern.
Nahezu ein Dutzend Mal ging Maris in diesen endlosen Tagen auf die Sprungklippe und blickte mit den Händen in den Taschen über das weite Meer. Sie beobachtete Fischerboote und Möwen, und einmal sah sie weit draußen ein paar Seekatzen auf Beutezug. Die plötzliche Enge ihrer Welt erschreckte sie. Der Horizont schien immer näher zu rücken, aber sie konnte ihn nicht aufhalten. Sehnsüchtig spürte sie den Wind in ihren Haaren spielen.
Einmal hatte sie Coll erwischt, als er sie aus der Ferne beobachtete. Später erwähnte es jedoch keiner von ihnen.
Russ bewahrte die Flügel auf. Seine Flügel, die immer ihm gehört hatten, bis Coll sie übernehmen würde. Wenn Klein Amberly einen Flieger benötigte, dann meldete sich Corm von der gegenüberliegenden Seite der Insel, oder Shalli, die Maris bei ihren ersten Flugversuchen begleitet hatte. Soviel ihr Vater wusste, hatte die Insel keinen dritten Flieger – und würde auch keinen haben, bis Coll von seinem Geburtsrecht Gebrauch machte.
Russ’ Einstellung zu Maris hatte sich verändert. Manchmal brüllte er sie an, wenn sie dasaß und träumte, manchmal legte er seinen gesunden Arm um sie und war den Tränen nah. Stets schwankte er zwischen den Extremen Wut und Mitleid. Schließlich zog er es vor, ihr aus dem Weg zu gehen. Nun verbrachte er seine Zeit mit Coll und versuchte, seine Freude und Begeisterung für das Fliegen zu erwecken. Als gehorsamer Sohn ging Coll darauf ein und bemühte sich, die Stimmung des Vaters nachzuempfinden. Aber Maris wusste, dass er auch ausgedehnte Spaziergänge unternahm und stundenlang Gitarre spielte.
Einen Tag bevor Coll flugjährig wurde, saß Maris auf der Sprungklippe. Ihre Beine baumelten über den Sims. Sie beobachtete Shalli, die Silberkreise am mittäglichen Himmel zog. Seekatzenwache für die Fischer, hatte sie gesagt, aber Maris wusste es besser. Sie war lange genug selbst geflogen, um einen Vergnügungsflug erkennen zu können. Selbst jetzt, als Landgefangene, konnte sie das entfernte Echo des Vergnügens spüren. Es gab ihr jedes Mal einen Stich ins Herz, wenn sie Shalli erblickte und bemerkte, wie sich das Sonnenlicht auf ihren Flügeln brach.
Soll es so enden?, fragte sich Maris. Nein, so hat doch alles begonnen. Ich erinnere mich genau.
Und sie erinnerte sich lebhaft. Manchmal glaubte sie, den Fliegern schon zugeschaut zu haben, bevor sie laufen konnte, aber ihre Mutter hatte das immer bestritten. Trotzdem, Maris erinnerte sich genau an jene Zeit auf der Klippe. Im Alter von vier oder fünf Jahren war sie jede Woche von zu Hause fortgelaufen. Hierher. Sie hatte dagesessen und die Flieger kommen und gehen sehen. Jedes Mal hatte ihre Mutter sie gefunden und mit ihr geschimpft.
»Du bist eine Landgebundene, Maris«, hatte sie ihr jedes Mal gesagt, nachdem sie ihr eine Tracht Prügel verabreicht hatte. »Verschwende deine Zeit nicht mit törichten Träumen. Meine Tochter wird niemals ein Holzflügler sein.«
Es gab eine alte Legende. Ihre Mutter hatte sie ihr immer erzählt, wenn sie sie auf der Klippe gefunden hatte. Holzflügler war der Sohn eines Tischlers, seine ganze Sehnsucht galt dem Fliegen. Aber er gehörte eben keiner Fliegerfamilie an. Das war ihm jedoch egal, berichtete die Geschichte. Er hörte weder auf seine Freunde noch auf seine Familie, er wollte nur den Himmel. Schließlich baute er sich in der Werkstatt seines Vaters ein Paar wunderschöne Holzflügel. Große Schmetterlingsflügel aus geschnitztem und poliertem Holz. Alle sagten, sie wären wunderschön, nur die Flieger nicht. Die Flieger schüttelten nur die Köpfe und verloren kein Wort. Schließlich kletterte Holzflügler auf die Sprungklippe. Die Flieger warteten dort oben schweigend auf ihn, in Schräglage kreisten sie im hellen Licht der Morgendämmerung. Holzflügler wollte mit ihnen fliegen und stürzte taumelnd in den Tod.
»Und die Moral von der Geschichte ist«, hatte Maris’ Mutter immer gesagt, »versuche nicht zu sein, was du nicht bist.«