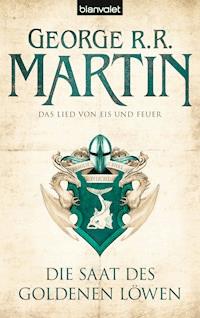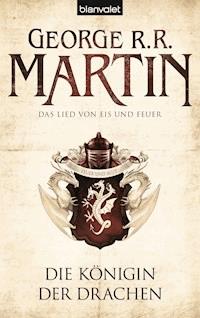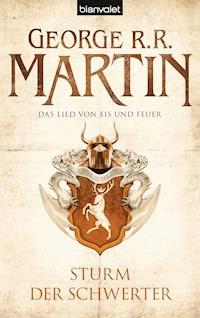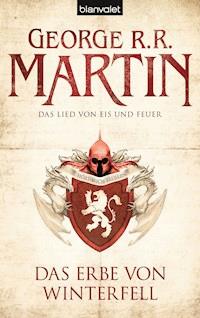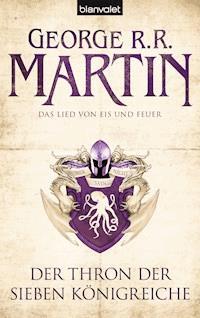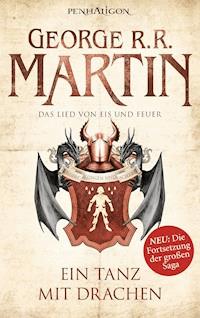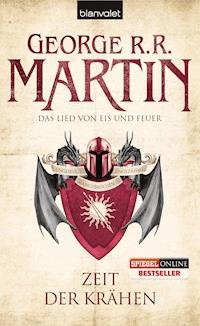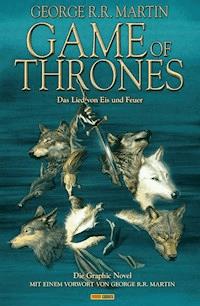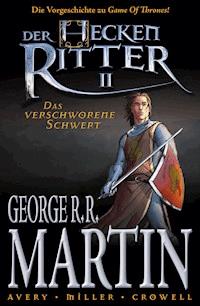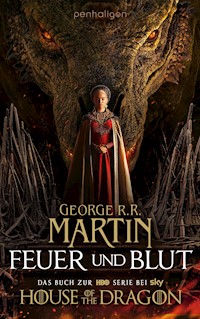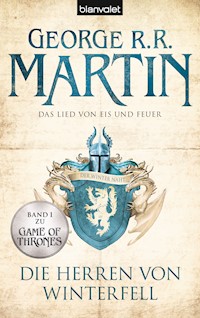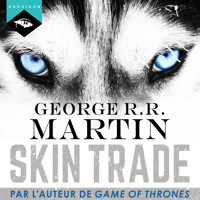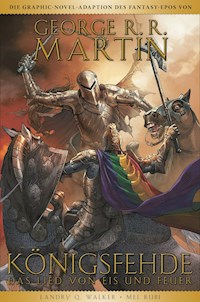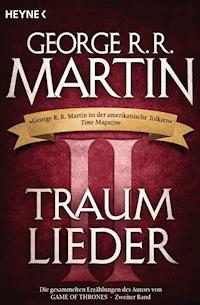
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Traumlieder
- Sprache: Deutsch
Darauf haben Millionen "Game Of Thrones"-Fans gewartet
Dass George R. R. Martin einer der erfolgreichsten Fantasy- Autoren aller Zeiten ist, steht außer Frage. Dass er noch viel mehr kann, beweist er in seinen beiden Erzählbänden Traumlieder, deren Vielseitigkeit Fantasy- und Science-Fiction-Fans jeder Generation begeistern wird: Das Porträt eines Mannes, der allmählich dem Wahnsinn verfällt, oder das unheimliche Schicksal eines Autors, dessen Selbstbezogenheit ihm zum Verhängnis wird, sind nur zwei der Geschichten dieser einzigartigen Storysammlungen. Ob Werwölfe, Magier, das ganz normale Grauen nebenan oder das Weltall: George R. R. Martin versteht es, seine Leser zu fesseln wie kein anderer. Die beiden Erzählbände vereinen erstmals die wichtigsten seiner vielfach ausgezeichneten Kurzgeschichten, darunter »Nachtgleiter«, die gerade unter dem Originaltitel »Nightflyer« als TV-Serie auf Netflix verfilmt wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 799
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
GEORGE R. R.MARTIN
TRAUMLIEDER
ERZÄHLUNGEN
ZWEITER BAND
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe
DREAMSONGS VOLUME 1/2
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Maike Hallmann (»Die Erben der Schildkrötenburg«, »Hybride und Horror«, »Nachtgleiter«), Lore Straßl und Susanne Grixa (»Die einsamen Lieder Laren Dorrs«), Rainer Gladys (»Der Eisdrache«), Eva Bauche-Eppers (»Das verlassene Land«), Michael Windgassen (»Der Fleischhausmann«), Jürgen Langowski (»Erinnerungen an Melody«), Hannelore Hofmann (»Sandkönige«), Joachim Körber (»Die Affenkur«, »Der birnenförmige Mann«), Michael Fehrenschild (»Eine Kostprobe von Tuf«), Berit Neumann (»Eine Bestie für Norn«, »Wächter«)
Deutsche Erstausgabe 3/2015
Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2003 by George R. R. Martin
Copyright © 2015 der deutschen Ausgabe
und der Übersetzungen by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Published by agreement with the author and the author’s agents,
The Lotts Agency, Ltd. and Utoprop Literary Agency
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Satz: Schaber Datentechnik, Wels
ISBN 978-3-641-14652-8
www.heyne.de
INHALT
❦
DIE ERBEN DER SCHILDKRÖTENBURG
Die einsamen Lieder Laren Dorrs
Der Eisdrache
Das verlassene Land
HYBRIDE UND HORROR
Der Fleischhausmann
Erinnerungen an Melody
Sandkönige
Nachtgleiter
Die Affenkur
Der birnenförmige Mann
EINE KOSTPROBE VON TUF
Eine Bestie für Norn
Wächter
Natürlich für Phipps
there is a road, no simple highway
between the dawn and the dark of night
Ich bin froh, dass du hier bist,
um sie mit mir zu beschreiten.
DIE ERBEN DER SCHILDKRÖTENBURG
❦
Die Fantasy und ich sind alte Bekannte.
Fangen wir am besten am Anfang an, denn es gibt einige eigenartige und weitverbreitete Irrtümer. Einerseits habe ich Leser, die vor Das Lied von Eis und Feuer noch nie von mir gehört haben und offenbar felsenfest davon überzeugt sind, dass ich nie etwas anderes geschrieben habe als Fantasy-Epen. Andererseits gibt es da die Leute, die all mein altes Zeug gelesen haben und darauf bestehen, ich sei ein Science-Fiction-Autor, der schändlicherweise zur Fantasy übergelaufen ist.
Tatsächlich aber habe ich seit meiner Kindheit in Bayonne Fantasy gelesen und geschrieben (Horror übrigens auch). Meine erste Veröffentlichung mag Science Fiction gewesen sein, aber die zweite war eine Geistergeschichte, ungeachtet dieser verflixten vorbeizischenden Hovertrucks.
»Die Ausfahrt nach San Breta« war beileibe nicht meine erste Fantasy-Geschichte. Noch vor Jarn vom Mars und seiner Bande außerirdischer Weltraumpiraten pflegte ich mir meine Mußestunden mit Geschichten über eine große Burg und ihre tapferen Ritter und Könige zu vertreiben. Indes – sie alle waren Schildkröten.
In den Siedlungen war die Haltung von Hunden und Katzen verboten, kleinere Tiere waren allerdings erlaubt. Ich besaß Guppys, ich besaß Wellensittiche, und ich besaß Schildkröten. Unmengen an Schildkröten. Die Sorte, wie man sie in billigen Kaufhäusern bekommt, im Set mit kleinen, in der Mitte geteilten Plastikschüsseln, bei denen auf der einen Seite Wasser hineinkommt, auf der anderen Seite Kies. In der Mitte befindet sich eine Plastikpalme.
Außerdem besaß ich noch eine Spielzeugburg, die zu den Plastikrittern gehörte (eine Zinnblechburg von Marx, ich weiß aber nicht mehr, welches Modell). Sie stand oben auf dem Tisch, der mir als Schreibtisch diente, und darin war gerade genug Platz für zwei jener Schildkrötenschüsseln. Dort also lebten meine Schildkröten … und weil sie in einer Burg wohnten, musste es sich folgerichtig um Könige und Ritter und Prinzessinnen handeln. (Ich besaß auch das Fort Apache von Marx, aber Cowboyschildkröten wären einfach absurd gewesen.)
Der erste Schildkrötenkönig hieß Big Fellow. Er muss einer anderen Art angehört haben als die anderen, denn er war braun, nicht grün, und gut doppelt so groß wie die kleinen rotohrigen Kerle. Eines Tages fand ich ihn tot auf – zweifellos war er einem finsteren Komplott der Krötenechsen und Chamäleons des benachbarten Königreichs zum Opfer gefallen. Sein Thronnachfolger meinte es zwar gut, war aber ein Pechvogel und starb ebenfalls bald darauf. Doch just als es für das Königreich am finstersten aussah, schworen Frisky und Peppy einander ewige Freundschaft und gründeten die Schildkrötentafelrunde. Peppy der Erste erwies sich als größter Schildkrötenkönig aller Zeiten, doch als er alt wurde …
Die Geschichte der Schildkrötenburg hat weder einen Anfang noch ein Ende, aber jede Menge Mitten. Sie wurde nur auszugsweise niedergeschrieben, aber ich arbeitete die großartigsten Szenen in meinem Kopf aus, Schwertkämpfe und Schlachten und Verrat. Ich erlebte die Herrschaft von mindestens einem Dutzend Schildkrötenkönige. Meine mächtigen Monarchen hatten die befremdliche Angewohnheit, aus der Marx-Burg zu fliehen und tot unter dem Kühlschrank zu enden, dem schildkrötischen Mordor.
Habe ich es nicht gesagt? Ich war schon immer Fantasy-Autor.
Ich kann allerdings nicht behaupten, auch immer Fantasy-Leser gewesen zu sein, aus dem schlichten Grund, dass es damals in den Fünfzigern und Sechzigern kaum Fantasy zu lesen gab. Die Drehständer meiner Kindheit wurden von Science Fiction, Krimis, Western, Schauerromanen und historischen Romanen beherrscht; weit und breit keine Fantasy. Ich war Mitglied im Science Fiction Book Club (drei Romane für einen Dime – unschlagbar), aber damals war es der Science Fiction Book Club, mit Fantasy hatte er nichts zu tun.
Fünf Jahre nach Have Space Suit, Will Travel (Raumjäger) stolperte ich über jenes Buch, das mich in Sachen Fantasy auf den Geschmack brachte: eine schmale Anthologie von Pyramid namens Schwerter und Magie, herausgegeben von L. Sprague de Camp und erschienen im Dezember 1963. Und was für ein köstlicher Geschmack das war. Es gab Geschichten von Poul Anderson, Henry Kuttner, Clark Ashton Smith, Lord Dunsany und H. P. Lovecraft. Eine Geschichte über Jirel, die Amazone von C. L. Moore und eine Erzählung über Fafhrd und den grauen Mausling von Fritz Leiber … und dann war da noch die Geschichte »Schatten im Mondlicht« von Robert E. Howard.
Wisset, o Fürst,
so begann sie,
zwischen den Jahren, als die Ozeane Atlantis und die strahlenden Städte verschlangen, und den Jahren des Aufstiegs der Söhne Aryas hat es ein Zeitalter gegeben, nicht einmal in Träumen vorstellbar. Damals, als glänzende Königreiche über die Welt verstreut lagen, gleich blauen Schleiern unter den Sternen – Nemedien, Ophir, Brythunia, Hyperborea, Zamora mit seinen dunkelhaarigen Frauen und Türmen voller spinnenbewachter Rätsel, Zingara mit seinen Rittern, Koth, das an die Weideländer Shems grenzte, Stygien mit seinen schattenbewehrten Grüften, Hyrkanien, dessen Reiter Stahl und Seide und Gold trugen. Doch der Welt stolzestes Königreich war Aquilonien, das im träumenden Westen die Vorherrschaft innehatte. Von dort kam Conan, der Cimmerier, mit schwarzem Haar, traurigen Augen, das Schwert in der Hand, ein Dieb, Räuber, Mörder, voll tiefer Melancholie, aber auch überschäumender Fröhlichkeit, um die edelsteingezierten Throne dieser Erde mit Füßen zu treten.
Mit Zamora hatte Howard mich am Wickel. Die Türme voller spinnenbewachter Rätsel hätten vollauf gereicht, denn 1963 war ich fünfzehn Jahre alt, aber auch die dunkelhaarigen Frauen erregten einiges Interesse. Fünfzehn ist ein ausgezeichnetes Alter, um die Bekanntschaft von Conan von Cimmerien zu machen. Dass Schwerter und Magie mich nicht dazu brachte, heroische Fantasy zu kaufen, wo ich ging und stand, so wie Have Space Suit, Will Travel (Raumjäger) mich dazu brachte, Science Fiction zu kaufen, lag nur daran, dass es kaum Fantasy zu kaufen gab, ob heroisch oder nicht.
In den Sechzigern und Siebzigern galten Fantasy und Science Fiction oftmals als ein und dasselbe Genre, nur trug dieses Genre eben meist den Namen Science Fiction. Es war ganz alltäglich, dass Autoren in beiden Genres arbeiteten. Robert A. Heinlein, Andre Norton und Eric Frank Russell, drei Lieblingsautoren meiner Kindheit und Jugend, wurden stark mit der Science Fiction assoziiert, aber sie alle schrieben auch Fantasy. Neben den Erzählungen über Nicholas van Rjin und Dominic Flandry schrieb Poul Anderson Das zerbrochene Schwert und Dreiherz. Jack Vance erschuf Großplanetund Die sterbende Erde. Fritz Leibers Spinnen und Schlangen trugen ihre Zeitkriege aus, derweil Fafhrd und der graue Mausling gegen die Herren von Quarmall kämpften.
Doch auch wenn all die großen Autoren Fantasy verfassten, so verfassten sie doch nicht viel Fantasy, jedenfalls nicht, wenn sie auch ihre Miete bezahlen und etwas zu essen kaufen wollten. Science Fiction war viel populärer und wurde erheblich besser bezahlt. Die Science-Fiction-Magazine wollten ausschließlich Science Fiction haben und veröffentlichten keine Fantasy-Texte, ganz gleich, wie gut sie geschrieben sein mochten. Gelegentlich wurden Fantasy-Magazine gegründet, aber sie hielten sich meist nicht lange. Astounding überdauerte Jahre und Jahrzehnte und wurde schließlich zu Analog, Unknown hingegen überlebte die Papierknappheit im Zweiten Weltkrieg nicht. Die Verleger von Galaxy und If brachten Worlds of Fantasy heraus und stampften das Projekt fast ebenso rasch wieder ein. Fantastic schleppte sich jahrzehntelang durch, aber Amazing war das Zugpferd. Und Boucher und McComas benannten bereits die zweite Ausgabe von The Magazine of Fantasy um in The Magazine of Fantasy and Science Fiction.
Natürlich verlaufen solche Entwicklungen oft zyklisch, und kurz darauf veränderte sich alles. 1965 veröffentlichte Ace Books unter Ausnutzung einer Lücke in den Copyright-Regelungen eine nicht autorisierte Taschenbuchausgabe von J. R. R. Tolkiens Herr der Ringe. Die Verkäufe gingen bereits in die Hunderttausende, bis Tolkien und Ballantine Books eilig mit einer autorisierten Ausgabe nachzogen. 1966 legte Lancer Books, möglicherweise angeregt durch den Tolkien-Erfolg von Ace und Ballantine, sämtliche Conan-Erzählungen als Taschenbuchreihe neu auf, mit Coverillustrationen von Frank Frazetta. 1969 dann brachte Lin Carter (als Autor grässlich, aber ein ausgezeichneter Lektor) den ersten Band der Reihe Ballantine Adult Fantasy heraus, in der Dutzende klassischer Fantasy-Geschichten in Neuauflage erschienen. Aber 1963, als ich die Lektüre von de Camps Schwerter und Magie beendete und mich nach weiterem Fantasy-Lesestoff umsah, war all das noch weit weg.
Fündig würde ich dann, wo ich es am wenigsten erwartet hatte: in einem Comic-Fanzine.
Die frühe Comic-Fangemeinde entwickelte sich als Ableger der Science-Fiction-Fangemeinde, aber nach einigen Jahren hatte sie sich zu einem ganz eigenen Mikrokosmos gemausert, und die meisten Fans waren sich der eigentlichen Wurzeln nicht einmal bewusst. Zur gleichen Zeit wuchsen all die Highschool-Jungs heran und erweiterten ihre Interessengebiete über das Lesen von Superheldencomics hinaus auf Gebiete wie Musik, Mädchen, Autos … und Bücher ohne Bilder. Unvermeidlich nahm diese Entwicklung auch Einfluss auf die Themen ihrer Fanzines. Artig wurde das Rad neu erfunden, und bald schossen spezialisierte Fanzines wie Pilze aus dem Boden, die sich nicht Superhelden widmeten, sondern Geheimagenten, Privatdetektiven oder den alten Pulp-Magazinen, dem Barsoom-Zyklus von Edgar Rice Burroughs … oder der heroischen Fantasy.
Das Schwerter-und-Magie-Fanzine hieß Cortana, es wurde »in dreimonatigem Abstand« (ha!) von Clint Bigglestone herausgegeben, später einer der Mitbegründer der Society of Creative Anachronism, die um 1964 herum im Bay Area bei San Francisco aus der Taufe gehoben wurde. Die Cortana fiel mit dem üblichen blassen Spiritus-Umdruck-Violett optisch nicht sonderlich auf, war aber herrlich zu lesen und voller Artikel und Pressemeldungen zu Conan und Konsorten, dazu Erstveröffentlichungen heroischer Fantasy-Geschichten aus der Feder einiger Top-Autoren der 60er-Comic-Fangemeinde: Paul Moslander und Viktor Baron (die ein und derselbe waren), mein Brieffreund Howard Waldrop (der es nicht war), Steve Perrin und Bigglestone selbst. In Waldrops Geschichten ging es um einen Abenteurer, den man nur unter dem Namen der Wanderer kannte und dessen Heldentaten in den Lobgesängen von Chimwazle gehuldigt wurde. Howard zeichnete auch die Cover von Cortana und einige der Illustrationen im Innenteil.
In Star Shudded Comics und den meisten anderen Comic-Fanzines fristete die Prosa ein Dasein als Mauerblümchen, der ganze Stolz galt den Comics. Hier war es anders. In Cortana regierten die Textgeschichten. Ich schrieb sofort einen glühenden Leserbrief, aber ich wollte mehr in diesem großartigen neuen Fanzine veröffentlichen als nur das. Also mottete ich Manta Ray und Dr. Weird erst einmal ein und setzte mich an meine erste Fantasy-Geschichte seit der Schildkrötenburg.
Ich nannte sie »Dark Gods of Kor-Yuban«, und ja, meine Mordor-Version klingt wie eine Kaffeemarke. Meine Helden waren eins der üblichen Paare ungünstig zusammengewürfelter Abenteurer, der melancholische Exilprinz R’hllor von Raugg und sein überschwänglicher und zur Prahlerei neigender Gefährte Argilac der Arrogante. »Dark Gods of Kor-Yuban« war die längste Geschichte, an der ich mich bis dahin versucht hatte (um die fünftausend Wörter), und endete tragisch mit dem Tod von Argilac, der von den titelgebenden dunklen Gottheiten verspeist wurde. Auf Marist hatte ich Shakespeare gelesen und einiges über Tragödien gelernt, also stattete ich Argilac mit dem traurigen Makel der Arroganz aus, der seinen Niedergang herbeiführte. R’hllor entkam, um die Geschichte erzählen zu können … und um tapfer weiterzukämpfen, wie ich hoffte. Sobald ich die Geschichte vollendet hatte, schickte ich sie nach San Francisco, und Clint Bigglestone nahm sie prompt an, um sie in Cortana zu veröffentlichen.
Es gab nie wieder eine Cortana-Ausgabe.
In meinem letzten Jahr auf der Highschool wusste ich durchaus mit Kohlepapier umzugehen. Ich war nur zu faul, mich damit herumzuschlagen. »Dark Gods of Kor-Yuban« ging in die Sammlung meiner verlorenen Geschichten ein. (Es war die letzte. Auf dem College fertigte ich Durchschläge sämtlicher Geschichten an, die ich schrieb.) Bevor sie ihre violetten Spiritus-Umdruck-Zelte abbrachen, erwies Cortana mir einen weiteren Gefallen. In der dritten Ausgabe brachte Bigglestone einen Artikel mit dem Titel Mach keinen Hobbit draus, durch den ich zum ersten Mal etwas über J. R. R. Tolkien und seine Fantasy-Trilogie Herr der Ringe erfuhr. Die Geschichte klang so vielversprechend, dass ich sofort zuschlug, als ich einige Monate später zufällig an einem Zeitungskiosk eine raubkopierte Ace-Taschenbuchausgabe von Die Gefährten sah.
Auf der Heimfahrt im Bus vertiefte ich mich in das dicke rote Taschenbuch und fragte mich bald, ob der Kauf nicht ein Fehler gewesen war. Die Gefährten schien mir alles zu sein, aber keine anständige heroische Fantasy. Was zum Geier sollte der ganze Quatsch mit dem Pfeifenkraut? Robert E. Howards Geschichten begannen normalerweise damit, dass eine riesige Schlange vorbeiglitt oder jemandes Kopf mit einer Axt gespalten wurde. Tolkien eröffnete mit einer Geburtstagsfeier. Und diese Hobbits mit ihren haarigen Füßen und der Vorliebe für Kartoffeln schienen einem Buch über Peter Hase entstiegen zu sein. Ich erinnere mich, wie ich gedacht habe: Conan würde sich einen blutigen Pfad mitten durchs Auenland hauen, von einem Ende zum anderen. Was ist mit der tiefen Melancholie, was ist mit der überschäumenden Heiterkeit?
Trotzdem las ich weiter. Bei Tom Bombadil hätte ich fast aufgegeben, als alle mit ihrem »Bimmel bammel billo! Tom Bombadillo« loslegten. Auf den Hügelgräberhöhen wurde es schon interessanter, und noch mehr in Bree mit dem Auftauchen von Streicher. Auf der Wetterspitze hatte Tolkien mich dann endgültig am Haken. »Gil-Galad war ein Elbenfürst«, rezitierte Sam Gamdschie, »die Harfe klagt im Liede noch.« Ein Schauer durchrann mich, wie Conan und Kull ihn nie hervorgerufen hatten.
Fast vierzig Jahre später stecke ich mitten in meiner eigenen High-Fantasy-Saga Das Lied von Eis und Feuer. Es sind gewaltige und gewaltig komplexe Bücher, die zu schreiben Jahre verschlingt. Wenige Tage nach der Veröffentlichung des neuesten Bands trudeln die ersten E-Mails mit der Frage ein, wann das nächste erschiene. »Du hast ja keine Ahnung, wie schrecklich die Warterei ist«, wehklagt manch einer meiner Leser. Ich weiß es sehr genau, möchte ich diesen Lesern sagen. Ich weiß, wie schrecklich es ist. Auch ich habe gewartet. Zu der Zeit, als ich Die Gefährten ausgelesen hatte, war noch keiner der anderen Bände als Taschenbuch erschienen. Ich musste darauf warten, dass Ace Die zwei Türme herausbrachte, und danach wartete ich auf Die Rückkehr des Königs. Zugegeben, lange musste ich mich nicht gedulden, aber es kam mir vor, als wären es Jahrzehnte. Sobald ich den nächsten Band in die Finger bekam, musste alles andere warten, während ich las … aber mitten im dritten Band hielt ich inne. Es verblieben nur noch wenige Hundert Seiten, und wenn ich damit fertig war, würde ich niemals wieder Herr der Ringe zum ersten Mal lesen können. So dringend ich auch erfahren wollte, wie es ausging, ich konnte es nicht ertragen, dass dieses Erlebnis vorüber sein sollte.
So tief liebte ich als Leser diese Bücher.
Als Autor jedoch war ich entsetzlich eingeschüchtert von Tolkien. Bei der Lektüre von Robert E. Howard dachte ich mir: Eines Tages wirst du in der Lage sein, genauso zu schreiben. Wenn ich Lin Carter oder John Jakes las, dachte ich: Ich kann heute schon was Besseres schreiben als das. Aber über Tolkien verzweifelte ich. Ich werde nie vollbringen können, was er vollbracht hat, dachte ich. Ich werde niemals auch nur nah herankommen. Auch wenn ich in den folgenden Jahren Fantasy schrieb, hielt ich mich stilistisch eher an Howard als an Tolkien. Man sollte sich nicht erdreisten, seinen Meister zu kopieren.
Während meines ersten Jahrs auf der Northwestern – als ich mich noch damit tröstete, dass sich die Cortana nur verspätete und nicht etwa das Zeitliche gesegnet hatte und dass »Dark Gods of Kor-Yuban« jetzt sicher ganz bald erscheinen würde – fing ich an, eine zweite R’hllor-Geschichte zu schreiben. In der Fortsetzung verschlägt es meinen Exilprinzen in das Dothrakische Reich, wo er sich Barron von der Blutigen Klinge anschließt, um gegen die geflügelten Dämonen zu kämpfen, die dessen werten Großvater Barristan den Kühnen getötet haben. Ich hatte schon dreiundzwanzig Seiten geschrieben, da entdeckten Freunde das Manuskript auf meinem Schreibtisch und fanden es so erheiternd, die Purpur-Prosa laut vorzulesen, dass ich zum Weiterschreiben zu verärgert war. (Ich habe die Seiten immer noch, und ja, sie sind ein bisschen violett an der Grenze zu Indigo.)
In meiner College-Zeit schrieb ich keine Fantasy mehr. Und abgesehen von »Die Ausfahrt nach San Breta«, die weder heroische noch High Fantasy ist, habe ich mich als Grünschnabel-Autor ebenfalls kaum damit befasst. Nicht, weil ich der Fantasy weniger zugeneigt war als der Science Fiction. Ich hatte praktischere Gründe dafür. Ich musste meine Miete zahlen.
Die frühen Siebziger waren eine wunderbare Zeit für junge aufstrebende Science-Fiction-Autoren. Jedes Jahr gingen neue Science-Fiction-Magazine an den Start: Vertex, Cosmos, Odyssey, Galileo,Asimov’s. (Neue Fantasy-Magazine gab es keine.) Von den bestehenden Magazinen kauften nur Fantastic und F & SF Fantasy-Geschichten an, und Letztere bevorzugten verschrobene moderne Fantasy, eher an Thorne Smith und Gerald Kersh angelehnt als an Tolkien oder Howard. Frischling oder Veteran, die Science-Fiction-Magazine hatten allesamt ernsthafte Konkurrenten in den Anthologie-Reihen: Orbit, New Dimensions, Universe, Infinity, Quark, Alternities, Andromeda, Nova, Stellar, Chrysalis. (Fantasy-Anthologien gab es nicht.) Auch Männermagazine boomten und hatten gerade entdeckt, dass Frauen Schambehaarung haben; viele dieser Magazine füllten die Seiten zwischen den Fotos mit Science-Fiction-Geschichten. (Sie kauften auch Horror, aber niemals High Fantasy oder heroische Fantasy.)
Damals gab es mehr Verlage als heute (Bantam Doubleday Dell Random House Ballantine Fawcett waren sechs Verlage, nicht einer, und die meisten hatten Science-Fiction-Reihen im Programm. (Den Fantasy-Meilenstein dieser Zeit setzten die Ballantine Adult Fantasy Series, die sich vorwiegend Neuauflagen widmeten. Lancer brachte seine Robert-E.-Howard-Titel heraus … aber Lancer war das Ende der Nahrungskette, ein wenig prestigeträchtiger, schlecht zahlender Verlag, dem die meisten Autoren entflohen, sobald sie irgendwo anders verkaufen konnten.) Die World Fantasy Convention gab es noch nicht, und auf der World Science Fiction Convention wurden ebenso selten Fantasy-Texte für den Hugo Award nominiert wie für die Nebula Awards der Science Fiction Writers of America (die dem Namen der Vereinigung damals noch kein »and Fantasy« hinzugefügt hatten).
Kurz gesagt: Als Fantasy-Autor ließ sich keine Karriere machen. Damals nicht. Noch nicht. So tat ich, was all die anderen Autoren vor mir gemacht hatten, Jack Williamson und Poul Anderson und Andre Norton und Jack Vance und Heinlein und Kuttner und Russell und de Camp und C. L. Moore und die anderen. Ich schrieb Science Fiction … und dann und wann, um der Liebe willen, schmuggelte ich ein oder zwei Fantasy-Geschichten dazwischen.
»Die einsamen Lieder Laren Dorrs« war die erste reine Fantasy-Geschichte, die ich als hauptberuflicher Schriftsteller schrieb. Sie erschien 1976 in der Fantastic. Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgehen, dass gewisse Namen und Themen schon in »Nur Kinder fürchten sich im Dunkeln« auftauchen und ich andere Namen und Themen in späteren Texten aufgegriffen habe. Wie im echten Leben werfe ich auch bei meiner Arbeit nichts weg, man weiß ja nie, wozu man es später noch brauchen kann. Sharra und ihre dunkle Krone waren ursprünglich für den Dr.-Weird-Mythos gedacht, den ich für Howard Keltner entwickeln sollte. 1976 allerdings lagen meine Fanzine-Zeiten fast ein Jahrzehnt zurück, und Dr. Weird hatte sich aus dem Geschäft zurückgezogen, also fühlte ich mich befugt, die Ideen für andere Geschichten zu verwenden.
Vor langer, langer Zeit glaubte ich, dass auf »Laren Dorr« noch mehr Geschichten über Sharra folgen würden, »das Mädchen, das zwischen den Welten wandelt«. Es kam anders … aber jener Satz ging nicht verloren, wie im Abschnitt über meine Jahre bei Film und Fernsehen zu lesen sein wird.
»Der Eisdrache« war die zweite von drei Erzählungen, die ich während der bereits erwähnten Weihnachtsferien im Winter 1978–79 schrieb. Die Winter in Dubuque inspirieren nachdrücklich zu Geschichten über Eis, Schnee und Hundekälte. Man hört mich nicht oft sagen, dass eine Geschichte sich wie von allein schrieb, aber in diesem Fall war es genau so. Die Worte entströmten mir förmlich, und am Ende war ich überzeugt, es sei eine der besten Geschichten, die ich je geschrieben hatte, vielleicht sogar die beste.
Kaum war ich mit dem Schreiben fertig, stieß ich auf einen Branchenbericht, in dem verkündet wurde, dass Orson Scott Card nach Beiträgen für die Anthologie Dragons of Light and Darkness suchte. Ich schickte Adara und ihren Eisdrachen an Card, die Geschichte wurde in Dragons of Light veröffentlicht und verschwand prompt in der Versenkung, wie es Geschichten in Anthologien so gern tun. Vielleicht war es nicht die beste Idee meines Lebens, sie von anderen Drachengeschichten umzingeln zu lassen.
Eisdrachen sind in den zwanzig und ein paar Jahren seither ganz alltägliche Erscheinungen in Fantasy-Büchern und Spielen geworden, aber ich glaube, mein Eisdrache war der erste seiner Art. Und die meisten jener anderen »Eisdrachen« scheinen wenig mehr zu sein als weiße Drachen, die in kalten Gegenden hausen. Adaras Freund, ein Drache aus Eis, der Kälte ausatmet anstelle von Flammen, ist meines Wissens bislang einzigartig, mein einziger wahrhaft neuartiger Beitrag zum Bestiarium der Fantasy.
»Das verlassene Land«, die dritte Geschichte, die gleich folgt, erschien zuerst in der DAW-Anthologie Amazons, herausgegeben von Jessica Amanda Salmonson. (»Wie hat sie dir eine Geschichte aus den Rippen geleiert?«, fragte mich ein anderer in der Anthologie vertretener Autor verdrießlich, als das Buch erschien. »Tja«, sagte ich, »sie hat mich gefragt.«) Wie »Die einsamen Lieder Laren Dorrs« sollte auch »Das verlassene Land« der Auftakt zu einer Serie sein. Später schrieb ich noch einige Seiten der Fortsetzung »Withered Hands«, aber wie gewöhnlich schaffte ich es nie, sie zu vollenden. Solange ich mich nicht wieder damit befasse (wenn ich es denn je tun werde), bleibt »Das verlassene Land« ein weiteres Beispiel meiner Serien mit nur einer Geschichte, auf die ich das Patent halte.
Ich sollte womöglich erwähnen, dass die Anregung zu »Das verlassene Land« zum Teil aus einem Lied stammte. Welches Lied? Das wäre zu einfach. Mir erscheint es ganz offensichtlich. Der entscheidende Hinweis für die, die solche Rätsel mögen, findet sich in der ersten Zeile.
Sharra und Laren Dorr, Adara und ihr Eisdrache, Alys die Graue, Boyce, Blue Jerais … sie alle sind die Erben der Schildkrötenburg, die Vorfahren von Eis und Feuer. Dieses Buch wäre ohne sie nicht vollständig.
Warum liebe ich Fantasy? Diese Frage möchte ich mit etwas beantworten, das ich 1996 als Begleittext zu meinem Porträt in Pati Perrets Bildband The Faces of Fantasy schrieb:
Die besten Fantasy-Geschichten sprechen die Sprache der Träume. Sie sind so lebendig wie Träume, wirklicher als die Wirklichkeit … wenigstens für einen Augenblick … jenen langen, magischen Augenblick, ehe wir erwachen.
Fantasy ist silbern und scharlachrot, indigo- und azurblau, mit Gold und Lapislazuli geäderter Obsidian. Die Realität besteht aus Sperrholz und Plastik, verkleidet in Schlammbraun und Braunoliv. Fantasy schmeckt nach Habaneros und Honig, Zimt und Gewürznelken, blutigem roten Fleisch und nach Weinen, süß wie der Sommer. Die Wirklichkeit besteht aus Bohnen und Tofu und wird am Ende zu Asche. Die Wirklichkeit, das sind die Einkaufszentren in Burbank, die Schornsteine von Cleveland, eine Parkgarage in Newark. Fantasy besteht aus den Türmen von Minas Tirith, den uralten Mauern von Gormenghast, den Sälen von Camelot. Die Fantasy fliegt auf Ikarus’ Schwingen, die Wirklichkeit mit Lufthansa. Warum schrumpfen unsere Träume so sehr zusammen, wenn sie Wirklichkeit werden?
Ich glaube, wir lesen Fantasy, um die Farben wiederzufinden. Um intensive Gewürze zu schmecken und dem Gesang der Sirenen zu lauschen. In der Fantasy liegt etwas Ursprüngliches, Wahrhaftiges, das uns tief in unserem Innern anspricht und das Kind in uns erreicht, das davon träumte, dereinst im Nachtwald auf die Jagd zu gehen, zu Füßen der Hollow Hills ein Festgelage abzuhalten und irgendwo zwischen dem südlichen Oz und dem nördlichen Shangri-La die Liebe zu finden, die ein Leben überdauert.
Ihren Himmel können sie behalten. Wenn ich sterbe, gehe ich lieber nach Mittelerde.
Die einsamen Lieder Laren Dorrs
❦
Es gibt ein Mädchen, das zwischen den Welten wandelt.
Es hat graue Augen, bleiche Haut, so jedenfalls heißt es in der Geschichte, und sein Haar ist ein pechschwarzer Wasserfall mit kaum merklichem rötlichen Schimmer. Um die Stirn trägt es einen Reif aus brüniertem Metall, eine dunkle Krone, die sein Haar zusammenhält und manchmal Schatten in seine Augen wirft. Es heißt Sharra, und es weiß, wo die Tore sind.
Der Anfang der Geschichte ist uns verloren gegangen, genauso wie das Wissen über die Welt, von der sie stammt. Das Ende ist noch nicht, und wann es kommen wird, können wir nicht sagen.
Wir kennen nur die Mitte, oder vielmehr auch davon nur ein kleines Stück, den winzigen Teil einer Legende, nicht mehr als ein Bruchstück des Ganzen. Eine kleine Geschichte aus der großen über die Welt, wo Sharra einmal Rast machte, und von dem einsamen Sänger Laren Dorr, und wie sie einander flüchtig trafen.
Eben noch hatte es bloß das Tal im Zwielicht gegeben. Die untergehende Sonne stand voll und violett hinter dem Kamm, und ihre Strahlen fielen schräg in den dichten Wald, dessen Bäume schwarze Stämme und farblose, geisterhafte Blätter hatten. Nur das Klagen der Trauervögel, die aus ihrem Tagesschlaf erwachten, und das Plätschern des Wassers in dem steinigen Bachbett brachen die Stille des Waldes.
Da plötzlich kam Sharra erschöpft und blutend durch ein unsichtbares Tor in die Welt Laren Dorrs. Sie trug ein schlichtes weißes, doch jetzt schmutzbeflecktes und verschwitztes Kleid und einen schweren Pelzumhang, den man ihr halb vom Rücken gerissen hatte. Ihr linker Arm, entblößt und schlank, blutete noch aus drei klaffenden Wunden. Am Ufer des Bachs tauchte sie auf. Sie zitterte und warf einen schnellen, wachsamen Blick um sich, ehe sie sich niederkniete, um ihre Wunden zu säubern und zu versorgen. Trotz seines flinken Laufs war das Wasser von einem moorigen Grün. Unmöglich zu sagen, ob es giftig war, aber Sharra war zu schwach und zu durstig. Sie trank und wusch ihren Arm in diesem zweifelhaften Wasser, so gut es ging, und verband ihre Wunden mit Streifen, die sie von ihrem Kleid riss. Als die purpurne Sonne allmählich hinter dem Kamm tiefer sank, kroch sie fort vom Bach und zu einem geschützten Fleckchen zwischen den Bäumen, wo sie sofort in einen Schlaf der Erschöpfung fiel.
Sie erwachte, als sie Arme um sich spürte, starke Arme, die sie ohne Mühe hochhoben, um sie irgendwohin zu tragen. Sie wehrte sich dagegen. Aber die Arme hielten sie nur fester, sodass sie sich nicht mehr rühren konnte. »Ruhig, ruhig«, sagte eine sanfte Stimme. Durch den aufsteigenden Nebel sah sie ein Männergesicht, länglich und irgendwie gütig. »Du bist geschwächt«, sagte der Mann, »und die Nacht ist nahe. Wir müssen hinter den Mauern sein, ehe es dunkel wird.«
Sharra wehrte sich nicht mehr, obgleich sie wusste, dass sie es tun sollte. Sie hatte sich so lange gewehrt und war so müde. Sie schaute ihn verwirrt an. »Warum?«, fragte sie, und ohne auf seine Antwort zu warten: »Wer bist du? Wohin bringst du mich?«
»In Sicherheit«, erwiderte er.
»Heim zu dir?«, fragte sie, sich mühsam wach haltend.
»Nein«, antwortete er so leise, dass seine Stimme kaum zu hören war. »Kein Heim, nie ein Heim. Aber es erfüllt seinen Zweck.«
Sie hörte Platschen, als trüge er sie durch den Bach, und weit vor ihnen, auf dem Kamm, sah sie verwirrende Umrisse – eine Burg mit drei Türmen, die sich schwarz gegen die versinkende Sonne abhob. Merkwürdig, dachte sie, die war doch zuvor nicht da. Sie schlief wieder ein.
Als sie erwachte, war er da. Er beobachtete sie. Sie lag unter weichen, warmen Decken in einem Himmelbett, dessen Vorhänge zurückgezogen waren. Ihr Gastgeber saß in einem großen Sessel im Schatten der Zimmerwand. Kerzenlicht spiegelte sich in seinen Augen. Er hatte das Kinn auf die gefalteten Hände gestützt. »Fühlst du dich besser?«, fragte er, ohne sich zu bewegen.
Sie setzte sich auf und bemerkte, dass sie nackt war. Schnell wie Misstrauen, flinker als Gedanken, fuhr ihre Hand zum Kopf. Aber die dunkle Krone war noch unberührt auf ihrem Haar, und das Metall drückte kühl gegen ihre Stirn. Sie entspannte sich, lehnte sich in die Kissen und zog die Decken über ihre Blöße. »Viel besser«, antwortete sie. Und als sie es sagte, fiel ihr erst auf, dass ihre Wunden nicht mehr waren.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!