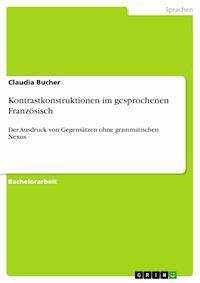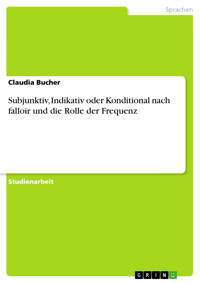
Subjunktiv, Indikativ oder Konditional nach falloir und die Rolle der Frequenz E-Book
Claudia Bucher
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Französische Philologie - Linguistik, Note: 1,0, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Romanisches Seminar), Veranstaltung: Frequenz in der Syntax, Sprache: Deutsch, Abstract: [...] Die somit in der Theorie recht durchschaubare Bildung und Anwendung des Subjunktivs wird erschüttert durch den tatsächlichen Gebrauch dessen im gesprochenen Französisch: Einerseits wird der Subjunktiv nach Konjunktionen verwendet, die ursprünglich keinen verlangen (après que), andererseits ist bei immer mehr Verben, die ursprünglich den Subjunktiv verlangen, ein Rückgang des Subjunktivs zu verzeichnen (z.B. bei verneinten Verben des Fühlens und Denkens). Bei einigen wenigen der Subjunktiv fordernden Verben, wie z.B. falloir, scheint er sich jedoch zu halten. Es kann angenommen werden, dass die Konservierung des Subjunktivs bei diesen Verben mit der Frequenz der Verben selbst zusammenhängt. Was aber nun, wenn nach falloir nicht der Subjunktiv, sondern Indikativ oder Konditional folgt? Diese Frage soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden. Gegenüber stehen sie hierbei der Konservierungseffekt (Subjunktiverhalt) und die Tendenz zu analogem Ausgleich (Indikativ-/ Konditionalgebrauch), wie er bei vielen Matrixverben bereits geschehen ist. Im Folgenden wird untersucht, welche semantischen, pragmatischen und syntaktischen Bedingungen erfüllt werden, dass nach falloir nicht der Subjunktiv folgt. Dabei soll diskutiert werden, ob die Semantik des Matrixverbs, wie Poplack (1992) annimmt, keine Rolle beim Gebrauch oder Nichtgebrauch des Subjunktivs spielt und der Ausdruck des Modus von morphosyntaktischen Faktoren abhängt. Dies soll in Hinblick auf die Rolle der Frequenz bei Sprachwandelprozessen geschehen. Wenn man davon ausgeht, dass der Gebrauch von sprachlichen Formen die Grammatik formt („language use shapes grammar“, Bybee und Thompson 2007: 269), so ist die Häufigkeit des Gebrauchs einer sprachlichen Form und die folgende Verankerung derer (entrenchment) in der mentalen Repräsentation des Sprechers von zentraler Bedeutung. Die Rolle der Frequenz bei Sprachwandelprozessen wird in Kapitel 1 erläutert. Dabei wird die Studie von Poplack zum Gebrauch des Subjunktivs im Kanadafranzösischen vorgestellt und ihre Ergebnisse werden kritisch betrachtet. In Kapitel 2 folgt die Analyse des Indikativoder Konditionalgebrauchs nach falloir im Französischen Europas. In Kapitel 3 wird diese Untersuchung mit Poplacks Studie verglichen und die Rolle der Frequenz wird hinsichtlich der Ergebnisse diskutiert. Kapitel 4 wird einen Ausblick gegeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Page 1
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. Romanisches Seminar Wintersemester 2008/2009 Masterseminar: Frequenz in der Syntax
Subjunktiv, Indikativ oder Konditional nachfalloir
und die Rolle der Frequenz
Claudia Bucher
Master of European Linguistics, 2. FS
Page 1
Einleitung
Das Französische unterscheidet vier Modi: Indikativ, Imperativ, Subjunktiv und Konditional. Diese Verbalmodi dienen dem Ausdruck der Modalität. „Die Modalität eines Satzes ist eine semantische Eigenschaft, die die Einstellung des Sprechers zum Inhalt des Satzes betrifft“ (Lehmann: Internet). Während der Indikativ sich auf einen Sachverhalt bezieht, der als faktisch, reell betrachtet wird, bezieht sich der Subjunktiv auf einen Sachverhalt, der als gedanklich, nicht faktisch betrachtet wird. Das Konditional bezieht sich auf einen Sachverhalt, der als hypothetisch betrachtet wird, für den eine Bedingung erfüllt werden muss. Es beinhaltet eine größere Ungewissheit bezüglich des Sachverhalts, wohingegen der Subjunktiv eine spezifischere Alternative zu einem Sachverhalt darstellt (vgl. Dreer 2007: 258). Die Grenzen sind hier im tatsächlichen Sprachgebraucht jedoch schwer zu ziehen. In traditionellen Grammatiken werden Verben deshalb in semantische Klassen unterteilt, die dem Sprecher anzeigen, welcher Modus zu wählen ist. Somit gibt es Auflistungen von Matrixverben, nach welchen der Subjunktiv stehenmuss,beispielsweise bei deontischen Modalitäten oder verneinten Verben des Fühlens und Denkens, oder stehenkann,je nach Absicht des Sprechers. Die somit in der Theorie recht durchschaubare Bildung und Anwendung des Subjunktivs wird erschüttert durch den tatsächlichen Gebrauch dessen im gesprochenen Französisch: Einerseits wird der Subjunktiv nach Konjunktionen verwendet, die ursprünglich keinen verlangen (aprèsque),andererseits ist bei immer mehr Verben, die ursprünglich den Subjunktiv verlangen, ein Rückgang des Subjunktivs zu verzeichnen (z.B. bei verneinten Verben des Fühlens und Denkens). Bei einigen wenigen der Subjunktiv fordernden Verben, wie z.B.falloir,scheint er sich jedoch zu halten. Es kann angenommen werden, dass die Konservierung des Subjunktivs bei diesen Verben mit der Frequenz der Verben selbst zusammenhängt. Was aber nun, wenn nachfalloirnicht der Subjunktiv, sondern Indikativ oder Konditional folgt?
Diese Frage soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden. Gegenüber stehen sie hierbei der Konservierungseffekt (Subjunktiverhalt) und die Tendenz zu analogem Ausgleich (Indikativ-/Konditionalgebrauch), wie er bei vielen Matrixverben bereits geschehen ist. Im Folgenden wird untersucht, welche semantischen, pragmatischen und syntaktischen Bedingungen erfüllt werden, dass nachfalloirnicht der Subjunktiv folgt. Dabei soll diskutiert werden, ob die Semantik des Matrixverbs, wie Poplack (1992) annimmt, keine Rolle beim Gebrauch oder Nichtgebrauch des Subjunktivs spielt und der Ausdruck des Modus von morphosyntaktischen Faktoren abhängt.
Page 2
Dies soll in Hinblick auf die Rolle der Frequenz bei Sprachwandelprozessen geschehen. Wenn man davon ausgeht, dass der Gebrauch von sprachlichen Formen die Grammatik formt („language use shapes grammar“, Bybee und Thompson 2007: 269), so ist die Häufigkeit des Gebrauchs einer sprachlichen Form und die folgende Verankerung derer (entrenchment) in der mentalen Repräsentation des Sprechers von zentraler Bedeutung. Die Rolle der Frequenz bei Sprachwandelprozessen wird in Kapitel 1 erläutert. Dabei wird die Studie von Poplack zum Gebrauch des Subjunktivs im Kanadafranzösischen vorgestellt und ihre Ergebnisse werden kritisch betrachtet. In Kapitel 2 folgt die Analyse des Indikativ-oder Konditionalgebrauchs nachfalloirim Französischen Europas. In Kapitel 3 wird diese Untersuchung mit Poplacks Studie verglichen und die Rolle der Frequenz wird hinsichtlich der Ergebnisse diskutiert. Kapitel 4 wird einen Ausblick gegeben.
1. Theoretischer Hintergrund
1.1 Frequenzeffekte
Von der Grundannahme ausgehend, dass „die mentalen Repräsentationen sprachlicher Strukturen sich zumindest in Teilen unserer Erfahrung mit Sprache verdanken“, so beeinflusst „die Häufigkeit, mit der ähnliche oder gleiche sprachliche Ereignisse produziert und perzipiert werden […] die kognitive Repräsentation von Sprache“ (Pfänder 2009: 1). Durch diese wiederholten Erfahrungen entstehen sprachliche Routinen bzw. „kognitive Trampelpfade“ (entrenchment) (vgl. Pfänder 2009: 1). Dabei werden sprachliche Handlungen automatisiert (vgl. Bybee und Thompson 2007: 271). Somit lassen sich quantitative Veränderungen im Sprachgebrauch als Erklärungen für sprachlichen Wandel heranziehen (vgl. Pfänder 2009: 12). Diese quantitativen Veränderungen konstituieren sich in zwei verschiedenen Arten von Häufigkeiten:Token-undTypefrequenz. Tokenfrequenzist die Anzahl der Wortformen in einem Korpus, wobei jede Wiederholung einer Form einmal zählt.Typefrequenzist die Anzahl der verschiedenen Wortformen in einem Korpus, wobei jede Form nur einmal zählt. Eine hohe Tokenfrequenz ist einerseits verantwortlich für den sogenanntenReduktionsprozess,d.h. sie fördert sprachlichen Wandel. DerReduktionseffektagiert auf drei Ebenen: der phonetischen (phonetische Reduktion), der syntaktischen (Verlust der internen Konstituentenstruktur), und auf der semantischen Ebene (semanticbleaching)(vgl. Bybee und Thompson 2007: 270f.). Andererseits ist eine hohe Tokenfrequenz für den sogenanntenKonservierungseffektverantwortlich, wobei Konstruktionen resistent gegenüber sprachlichem Wandel werden. Während derReduktionseffektbei Grammatikalisierungsprozessen eine wichtige Rolle spielt, agiert derKonservierungseffektsvor allem aufgrund von produktiven Mustern mit hoher Typefrequenz und führt zu Irregularitäten (vgl. Bybee und Thompson 2007: 269f.).
Page 3
DerKonservierungsprozessgeschieht aufgrund einer erhöhten lexikalischen Stärke undentrenchmenteines bestimmten Wortes oder einer Phrase. Dieses „konservative Verhalten“ hängt damit zusammen, dass hochfrequente Formen kognitiv leichter zugänglich sind: Je mehr eine sprachliche Form gebraucht wird, desto mehr wird ihre mentale Repräsentation gestärkt, was sie beim nächsten Gebrauch leichter und schneller zugänglich macht. Wörter, die fest verankert (entrenched) und einfach zugänglich sind, sind weniger von regulären Nivellierungen und analogischen Ausgleichen im sprachlichen System betroffen (vgl. Bybee und Thompson 2007: 271). Morphologische Irregularität findet man somit immer bei hochfrequenten sprachlichen Formen.