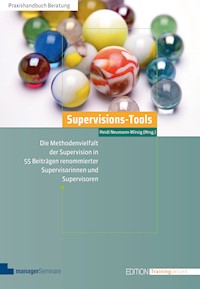
Supervisions-Tools E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: managerSeminare Verlags GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Edition Training aktuell
- Sprache: Deutsch
Rund 50 renommierte Supervisorinnen und Supervisoren aus unterschiedlichen Denkschulen präsentieren ihre bevorzugten Interventionstechniken. Der Leser nimmt so an einem sehr breiten Spektrum an Methodenkompetenz teil. Die Tools sind folgenden Phasen einer Supervision zugeordnet: Einstieg, Themenfindung, Bearbeitung und Abschluss. Ob für Einzel-, Gruppen oder Teamsupervision - schnellen Zugriff auf das passende Tool gewährt eine nach Settings sortierte Übersicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heidi Neumann-Wirsig (Hrsg.)
Supervisions-Tools
Die Methodenvielfalt der Supervisionin 55 Beiträgen renommierterSupervisorinnen und Supervisoren
managerSeminare Verlags GmbH, Edition Training aktuell
Heidi Neumann-Wirsig (Hrsg.)
Supervisions-Tools
Die Methodenvielfalt der Supervision in 55 Beiträgen renommierter Supervisorinnen und Supervisoren
© 2009 managerSeminare Verlags GmbH
8. Auflage 2023
Endenicher Str. 41, D-53115 Bonn
Tel: 0228-9 77 91-0
www.managerseminare.de
Der Verlag hat sich bemüht, die Copyright-Inhaber aller verwendeten Zitate, Texte, Abbildungen und Illustrationen zu ermitteln. Sollten wir jemanden übersehen haben, so bitten wir den Copyright-Inhaber, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten.
Herausgeber der Edition Training aktuell:
Ralf Muskatewitz, Jürgen Graf, Nicole Bußmann
ISBN: 978-3-98856-053-7
Lektorat: Michael Busch, Ralf Muskatewitz
Cover: istockphoto, Les Cunliffe
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
Einleitung
Übersichtstabelle Welches Tool passt zu welchem Setting?
Teil 1: Einstieg gestalten, Anwärmen ermöglichen, Kontakt aufnehmen
Ankommen und kennenlernen
FarbenVon Gabriele Biggel-Hammer
Mein Terminkalender stellt mich vorVon Hanna Herty
SchlüsselVon Heidi Neumann-Wirsig
Vielfalt in Teams und Gruppen explorierenVon Erika Luzia Lüthi
Von 0 bis 10Von Marlene Schildmayer
Übergänge gestalten (Kontext wechseln)
Im ÜbergangVon Edeltrud Freitag-Becker
PaparazziVon Monika Reichert
TriptychonVon Rosa Fischer-Stöckli
WollknäuelVon Wolfgang Morbach
Teil 2: Themenfindung, Problembeschreibung, Zielklärung
Schwerpunkte erkennen und Fokussierungen verdeutlichen
Arbeit am BegriffVon Edelgard Struß
Kontext-ZappingVon Karl-Peter Kirsch
Persönliches Team-Profil (PTP)Von Bernhard Lutz
Rad zur SystemsteuerungVon Heinrich Fallner
RollenspektrumVon Kurt F. Richter
SchlagzeilenVon Siegmund Zimmermann
Wortbild-AssoziationenVon Christine Lampert
Zürcher Ressourcen-Modell (ZRM)Von Sylvia Weise
Teamdynamiken erfahrbar machen
Team-PositionierungVon Tom Levold
Unser Team als SchiffsbesatzungVon Mechthild Herzer
Institutionsdynamiken kreativ darstellen
Wir machen (malen) uns ein Bild von Ihrer InstitutionVon Dr. Harald Pühl
Organisatorische Prozesse visualisieren
OrganisationspanoramaVon Dr. Astrid Schreyögg
Teil 3: Bearbeiten, Intervenieren
Konflikte bearbeiten, Entscheidungen vorbereiten
SchachbrettübungVon Hans-Karl Krey
Traumspiele in der GruppensupervisionVon Delia Anton
Virtuelle FragenVon Hans Gerd Schulte
Wenn Du Probleme hast, frag Dein KnieVon Mohammed El Hachimi
Perspektiven wechseln, Muster unterbrechen
Ferien vom IchVon Jutta Borck
KnopfsoziogrammVon Dr. Manfred Gellert
Das Problem als Lösung oder: Das Gute am SchlechtenVon Wolfgang Schmitz
Problem- und Lösungsbilder – Metaphern in der SupervisionVon Bernd Kuhlmann
Schub nach vorn: Zukunftsorientiertes FeedforwardVon Fridbert Hanke
Arbeitsbeziehungen klären, Prozesse steuern
Der Blick aus dem AdlerhorstVon Prof. Dr. Arist von Schlippe
Imaginatives Rolleninterview durch einen VertrautenVon Prof. Dr. Ferdinand Buer
Das Märchen als MetapherVon Ueli-Bartley Brönnimann
Zwang – als Chance!Von Ursula Eisenbarth
Projekte planen
Mein Haus – Dein HausVon Annette Lentze und Gabriele Röttgen-Wallrath
Walt-Disney-StrategieVon Annegret Sirringhaus-Bünder
Zurück aus der ZukunftVon Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp
Fälle bearbeiten
Analoge RückmeldungVon Gabriele M. Ruck
Das Auftragskarussell als Instrument der FallsupervisionVon Prof. Dr. Arist von Schlippe
Ich seh etwas …Von Heidi Rieger
Kunst am SeilVon Gabriele Gutmann
Supervision in Bewegung – Reise zu unterschiedlichen LösungsortenVon PD Dr. Joseph Rieforth
Die SystemskulpturVon Monika Reichert
ThemenformulierungVon Helmut Reichert
… und noch eine Runde!Von Christine Lampert
VogelperspektiveVon Heidi Neumann-Wirsig
Teil 4: Auswerten, abschließen, evaluieren
Nachhaltigkeit sichern (Transfer)
Der Blick zurück nach vorn!Von Prof. Dr. Lothar Krapohl
Fotokarten schwarz-weißVon Magdalena Fuchs Genzoli
GalerierundgangVon Christine Spreyermann
Pegelstände – Auswertung flüssigVon Karl-Peter Kirsch
Success-FotoshootingVon Tom Küchler
Unsere Beute für heute …Von Sylvia Hüttig-Rieck
ZukunftsprobeVon Kersti Weiß
Wirksamkeit überprüfen (Evaluation)
Bewertungsbogen für Team- und GruppensupervisionsprozesseVon Erwin Merz
Partizipatives Evaluieren lernen – Evaluation eines SupervisionsprozessesVon Dr. Brigitte Hausinger
Autorinnen und Autoren
Vorwort
Wozu dieses Buch?
Diese Frage habe ich mir immer mal wieder gestellt, nachdem mein Mann mich seinerseits mit der Frage „Wieso schreibst Du eigentlich kein Toolbuch für die Supervision?“ überhaupt auf die Idee gebracht hat. Sicher, ich könnte, wie viele Supervisorinnen und Supervisoren, leicht 50 Tools zusammenstellen. Hat sich doch so manches im Laufe der Jahre angesammelt.
Wozu also? Weil ich überzeugt bin, dass ein Buch mit Supervisions-Tools einen berechtigten und wichtigen Platz neben bereits vorhandenen Toolbüchern einnehmen wird. Weil sich Supervision derzeit in einer Phase befindet, die es sinnvoll macht, Supervision wieder stärker in die Aufmerksamkeit des Beratungsmarktes zu bringen. Weil sich Supervision neben den anderen Beratungsformaten deutlich profilieren und positionieren muss. Weil Supervisoren selbstbewusst ihr Können zur Verfügung stellen, ihre Unterschiedlichkeit wertschätzen und wirkungsvoll am Markt präsentieren sollen.
Die Frage, wo und wie sich Supervisions-Tools von anderen unterscheiden, ist schon schwieriger zu beantworten. Ich sehe den Unterschied vor allem in der Kunst der Beobachtung zweiter Ordnung (das bedeutet, der Supervisor arbeitet an den Kriterien, die der Supervisand seinem Problemerleben und seiner Problemschilderung zugrunde legt, es ist die Beobachtung der Beobachtung, eine Meta-Perspektive), wie sie vor allem in der Fallbearbeitung deutlich wird. Supervisions-Tools sind Anleitungen zur Selbstreflexion. Dabei macht es überhaupt keinen Unterschied, welcher methodischen Ausrichtung sich die einzelnen Supervisoren zuordnen. Ob sie dabei über Gefühle, Beziehungen, Wirkungen, Beobachtungen und anderes sprechen, ist nebensächlich. Unter dem Blickwinkel des Konstruktivismus betreiben und steuern sie die Beobachtung der Beobachtung.
Das Buch folgt in seinem Aufbau den klassischen Supervisions-Settings Einzel-, Gruppen- und Teamsupervision und den Phasen einer einzelnen Supervisionssitzung bzw. eines ganzen Supervisionsprozesses: Einstieg, Themenfindung, Bearbeitung, Auswertung. Viele Tools können in mehreren Phasen und Settings eingesetzt werden. In einer Matrix (ab Seite 27) erhält der Leser einen Überblick über alle im Buch vorgestellten Tools und gleichzeitig die Möglichkeit, phasen- und settingspezifisch nach einem geeigneten Tool zu suchen.
51 Supervisorinnen und Supervisoren verschiedener methodischer Ausrichtungen haben 55 Tools für das Buch zur Verfügung gestellt. Das ist nur ein kleiner Einblick in den unglaublichen Methodenreichtum von uns allen und gleichzeitig ein wunderbarer Schatz. Ich bin sicher, dass ein sehr anregendes Buch entstanden ist und freue mich über unser Gesamtwerk.
Zur besseren Lesbarkeit habe ich mich dazu entschieden, durchgängig die männliche Schreibweise zu benutzen, wohlwissend, dass ich damit nicht im Sinne aller Kolleginnen und Kollegen handle. Die holprig zu lesende Schreibweise, die männliche und weibliche Formen berücksichtigen will, verdirbt mir persönlich manchmal die Freude am Lesen, da sie den Lesefluss beeinträchtigt.
Ich danke meinen 50 Kolleginnen und Kollegen, die bereitwillig und mit Freude ihre Tools zur Verfügung gestellt haben.
Danken möchte ich auch meiner Freundin und Kollegin Christine Lampert, die mir immer wieder wichtige Impulse für die Weiterarbeit gab. Vor allem und in ganz besonderem Maße danke ich meinem Mann, Gerhard Neumann, für die Idee zu diesem Buch und seine unerschütterliche, vielfältige und liebevolle Unterstützung zu jeder Zeit.
Einleitung
Supervision – der verborgene Schatz
Erstaunt war ich über die erste Reaktion meiner Netzwerkkollegen, als ich ihnen von der Idee zu diesem Toolbuch erzählte. Zunächst herrschte einen Moment Schweigen, dann beglückwünschten sie mich und fanden die Idee sehr gut. Nach einer Weile sprach ein Kollege aus, was die anderen wohl auch gedacht hatten, nämlich dass es vor 20 Jahren schwer vorstellbar gewesen wäre, ein solches Buch zu schreiben. Als Autorin hätte ich zumindest Naserümpfen und Spott erfahren.
In den Siebziger- und Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts war es nach außen hin verpönt, Tools in der Supervision einzusetzen, obwohl es viele Supervisoren taten. Nach gängiger Auffassung war die hohe Kunst der Supervision, aus dem Prozess und der aktuellen Situation heraus, sich selbst entwickelnd sozusagen, die Themen aus dem Verborgenen hervortreten zu lassen, von der Hinterbühne auf die Vorderbühne zu holen, um sie bearbeiten zu können. Es handelte sich um rein sprachliche Vorgehensweisen, eher minimal strukturierte Interaktionsmodelle, mit denen der Supervisor flexibel auf den Lern- und Entwicklungsstand des Einzelnen und der Gruppe reagierte. Tools brauchten und benutzten eher Anfänger; sie gaben höchstens dem Supervisor Sicherheit und passten anscheinend nie wirklich, weil sie im Verdacht standen, schematisch und starr zu sein. Kollegen, die Tools in der Supervision benutzten, wurde unterstellt, lediglich an der Oberfläche zu arbeiten, um den schnellen Erfolg und die schnelle Lösung zu forcieren. So tat man es im Verborgenen, ohne die Arbeit mit Tools je offen und vorurteilsfrei zu diskutieren.
Supervisoren waren eher wie Zauberer, Allwissende, selbsterfahren und selbstreflektiert, eben etwas Besonderes. Ein Tool, das eine Schrittfolge vorgibt, konnte dagegen jeder anwenden. Die hohen Ziele der Emanzipation, Gleichberechtigung, Solidarität, Selbstverwirklichung, die Infragestellung von Machtverhältnissen und Hierarchien ließen sich mit der Anwendung von Tools nur schwer in Verbindung bringen. Für die Erreichung dieser Ziele schien nur der Weg der Selbsterfahrung und freien Exploration nach analytischen und gruppendynamischen Prinzipien vorstellbar. Tools dagegen sind vorgegebene Strukturen mit erwartbaren Ergebnissen. Sie schränken die freie Entfaltung ein.
Aber was hatten meine Netzwerkkollegen also mit ihren Bemerkungen gemeint? War die Supervision denn bisher methodenlos? Keineswegs! Casework, psychoanalytische, gruppendynamische, gruppenpädagogische Vorgehensweisen, Methoden der sozialen Gruppenarbeit, der humanistischen Psychotherapie, Gestalttherapie, Psychodrama, Kommunikations- und Systemtheorie u.a. wurden und werden in der Supervision eingesetzt. Meine Kollegen dachten eher an kreative, erlebnisorientierte und aktivierende Mittel wie Fotokarten, Wollfäden, Schlüssel etc., die Ende der Achtzigerjahre in die Supervision Einzug hielten. Ich erinnere mich noch gut an den Spott, den sich Kollegen in Fachkreisen zuzogen, die den Einsatz solcher Mittel in der Supervision propagierten.
Viel hat sich in der Supervisionsszene verändert in den 30 Jahren, die meine Netzwerkkollegen und ich überblicken können, in denen wir als Supervisoren und Ausbilder unseren Teil zur Entwicklung beigetragen haben. Die Polarisierung von Prozess versus Tool ist längst zugunsten einer Integration, einem Zusammenspiel von beiden aus der Supervisionspraxis gewichen. Nur wenige Supervisionskonzepte zeigen sich auch heute noch enthaltsam beim Einsatz von Tools: streng analytische und genau so streng lösungsfokussierte Verfahren.
Geschichtliches zur Supervision
Die Anfänge der Supervision liegen in den USA. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahmen die USA ca. 15 Mio. Einwanderer auf. Trotz boomender Industrien waren die Arbeitsbedingungen der Arbeiter katastrophal. Zyklisch verlaufende Wirtschaftskrisen bewirkten einen enormen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Vor allem in den Arbeiterfamilien herrschte tiefste Armut. Charity Organization Societies setzten so genannte friendly visitors, ehrenamtliche Helfer, und zwar vor allem Frauen aus wohlhabenden Bevölkerungsschichten, in der Armenfürsorge ein. Den friendly visitors wurden hauptamtliche Mitarbeiter zur Seite gestellt, die sie bei der Vergabe von Hilfsgütern an Bedürftige kontrollieren sollten. Das waren die ersten Supervisoren.
Bald schon wurde das Spektrum der Unterstützung für die friendly visitors auf die psychosozialen Aspekte der Hilfe erweitert, um einerseits die Helfer zu stärken und zu begleiten und andererseits deren Arbeit zu verbessern. Die Beziehungsdynamik zwischen Klienten und Helfern kam verstärkt in den Blick. Hilfe und Kontrolle bildeten die Hauptmerkmale von Supervision. Damit war Supervision sehr früh ein Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungsinstrument in der sozialen Arbeit.
Während in den USA auch heute der Kontrollaspekt neben der Unterstützung in der Supervision von großer Bedeutung ist, haben die Supervisoren in der BRD sehr früh den Beratungsaspekt ins Zentrum ihres Handelns gestellt. Dass das so ist, hat viel mit der deutschen Geschichte während der Nazizeit, den Entwicklungen in der BRD nach 1945, den USA als Siegermacht und den so genannten „Achtundsechzigern“ zu tun.
1950 wird erstmals in der deutschen Fachliteratur zur sozialen Arbeit der Begriff „Supervision“ erwähnt (Herta Kraus, Hrsg. 1950 Casework in USA, Frankfurt a.M.). Der erste Artikel zur Supervision erscheint in der „Zeitschrift der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie“, 8- 9/1952 von Erna Marun unter dem Titel „Casework und Supervision in der amerikanischen Jugendfürsorge“.
Methoden in der Supervision und das Bestreben nach Wirksamkeit
Supervision ist über viele Jahre hinweg eng mit der Entwicklung sozialer Arbeit verbunden und so übernimmt sie in den Fünfzigerjahren mit dem Casework (Einzelfallhilfe) auch deren Methoden. Analog dazu findet Supervision im Face-to-face-Setting, der Einzelsupervision, statt. Auch die Gruppenpädagogik, die sich in dieser Zeit als neue demokratische Lebensform in Beruf und Alltag versteht, hat Auswirkungen auf Sozialarbeit und Supervision.
In den Siebzigerjahren und darüber hinaus dominiert in der Supervision der psychoanalytische Rahmen (Belardi 1992, S. 96), wodurch hauptsächlich tiefenpsychologische Konzepte und eine der Psychotherapie entspringende Gesprächsführung eingesetzt werden. Es entsteht sogar der Eindruck, dass Supervision aus der Psychoanalyse kommt. Erst Weigand rückt 1989 mit seinem Aufsatz „Sozialarbeit – das Ursprungsland der Supervision“ die historischen Bezüge wieder zurecht.
Zur gleichen Zeit hält die Gruppendynamik Einzug in Deutschland und erfreut sich schnell in vielen Bereichen einer hohen Akzeptanz. Sie wird neben der Psychoanalyse zu einem wichtigen Verfahren in der Supervision. Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf das Vorgehen und das Setting der Supervision. Zur Einzelsupervision kommt nun die Gruppensupervision hinzu und gewinnt rasch an Bedeutung. 1973 nehme ich selbst das erste Mal an einer Gruppensupervision teil.
In den Achtzigerjahren ergänzen organisationssoziologische die gruppendynamischen Tendenzen in der Supervision. Als drittes Setting etabliert sich Teamsupervision und wird stark nachgefragt. Zunehmend werden auch systemische Konzepte attraktiv für die Supervision. Darüber hinaus gewinnt der Konstruktivismus als Erkenntnistheorie Bedeutung und prägt weite Bereiche der Supervision entscheidend mit. 1992 bringen Kersting/Neumann-Wirsig das erste Buch zur systemischen Supervision in der BRD heraus, das konstruktivistische Ideen auf Supervision bezieht (vgl. Neumann-Wirsig 1992).
Heute ist das Label „systemisch“ für Supervision unverzichtbar. In der Zeitschrift „managerSeminare“ erscheint in 2003 (Heft 65) eine Umfrage zu den Anforderungen an Supervisoren. 98% der Befragten halten es für unabdingbar, dass Supervisoren systemisch arbeiten können. Viele Kollegen und Kolleginnen haben seither Fragetechniken und Tools aus dem systemischen Kontext in ihre Supervisionen übernommen.
Supervision hat die Fähigkeit bewiesen, Konzepte und Methoden zu adaptieren und zu integrieren, ohne in benachbarte Beratungsformate „abzurutschen“. Das Bestreben nach Wirksamkeit und Nachhaltigkeit ist dabei der entscheidende Motor der Supervisoren, sich und die Supervision weiterzuentwickeln. Supervision hat ihre Eigenständigkeit bewahrt und zeichnet sich heute durch eine breite Methodenvielfalt und einen reichen Methodenschatz aus. Seile, Zeitungsausschnitte, Fischernetze usw. haben als stimulierende Mittel längst ihre Akzeptanz gefunden. Das belegen die Autoren dieses Buch mit ihren Tools sehr anschaulich.
Was ist Supervision?
Supervision ist Beratung von Menschen in ihrer Arbeit. Sie setzt an der Schnittstelle von Profession, Organisation und Person an.
Abb.: Der Fokus der Supervision
Supervision zielt explizit auf höhere Professionalität. Sie unterstützt die Entfaltung, Entwicklung und Verbesserung beruflichen Handels. Supervision kann auch als Beratung von Arbeitszusammenhängen beschrieben werden. Ihr wichtigstes Instrument ist die Reflexion von Arbeitssituationen im Kontext der Person und der Organisation.
Im Mittelpunkt der Supervision steht der Berufsrollenträger in seiner Berufspersönlichkeit. Seine konkreten Interventionen, seine Gefühle, Werte und seine Haltung gegenüber seinen Klienten, Kunden, Kollegen, Vorgesetzten, die in seinen Handlungen zum Ausdruck kommen, sind Gegenstand der Supervision.
Der Supervisand selbst steht im Zentrum der Supervision und nicht sein „Fall“.
… aus der Sicht des Konstruktivismus und der Differenztheorie
Der Konstruktivismus ist eine Theorie, die Ergebnisse der Naturwissenschaften (Physik, Mathematik) aufgreift und erklärt, wie Menschen Wirklichkeit erkennen bzw. schaffen (z.B. erleben und beschreiben zwei Kinder der gleichen Familie die Familienwirklichkeit völlig unterschiedlich). Es kommt also auf den Beobachtungsfokus an, was als Wirklichkeit „gesehen“ wird.
Wenn Supervision die Anleitung zur Reflexion bedeutet, ist das im Sinne des Konstruktivismus immer Beobachtung zweiter Ordnung, die Beobachtung der Beobachtung. Supervision ist eine Meta-Perspektive. In der Supervision schildert der Supervisand als Falleinbringer sein Problem, seine Sicht der Dinge. Der Supervisor richtet sein Augenmerk darauf, wie und was der Supervisand berichtet und was er nicht erzählt, welche Beobachtungskriterien der Schilderung zugrunde liegen und was in seiner Erzählung nicht vorkommt, wie die Geschichte noch erzählt werden könnte. In der Anleitung zur Reflexion – unter Zuhilfenahme unterschiedlichster Strukturierungsmuster – schauen Supervisand und Supervisor sozusagen „von oben“ auf die erlebte Geschichte herab. Aus dieser Perspektive erscheint die Geschichte anders, ihre Struktur wird erkennbar, andere Zusammenhänge werden deutlich, neue Zugänge ermöglicht.
Heinz Kersting (2001) erzählte gerne die Geschichte von Tünnes und Schäl, in der Tünnes zu Schäl sagt: „Ich wäre so gern ein Vogel.“ Schäl fragt nach dem Warum. Tünnes erklärt: „Dann könnte ich fliegen und von oben beobachten, was wir hier unten tun.“ Worauf Schäl meint „Dann wäre ich gerne zwei Vögel.“ Nun fragt Tünnes: „Warum?“ – „Dann könnte ich mich beobachten, wie ich fliege“ antwortet Schäl. Tünnes steigert das Ganze und sagt: „Dann wäre ich gern drei Vögel.“ – „Warum drei Vögel?“, will Schäl nun wissen. Tünnes antwortet: „Dann könnte ich hinter mir herfliegen und beobachten, wie ich beobachte, wie ich fliege!“ Diese Geschichte verdeutlicht das Prinzip der Beobachtung zweiter Ordnung.
Folgt man diesen Gedanken, ist das Beratungssystem, bestehend aus der Kommunikation von Klient und Supervisand das Beobachtungssystem erster Ordnung, und das Supervisionssystem, die Kommunikation zwischen Supervisand und Supervisor, ein Beobachtungssystem zweiter Ordnung.
H. Willke beschreibt das so: „Vielmehr soll Supervision verstanden werden als ein Reflexionsprozess, in welchem die notwendigen Paradoxien und blinden Flecken des Grundprozesses, etwa der Therapie, deutlich gemacht und probeweise als kontingent behandelt werden. Voraussetzung für Supervision ist damit die gezielte Verwendung von Beobachtung zweiter Stufe – also die Arbeit mit der Beobachtung von Beobachtung“ (Willke 1991, S. 38 ff. nach Belardi 1992, S. 75).
Abb.: Beobachtungen erster und zweiter Ordnung
Supervision lässt sich im Kern – in Anlehnung an die Differenztheorie G. Spencer Browns – auch als Einblendung des Ausgeblendeten, den Blick auf die andere Seite der Unterscheidung beschreiben. Die Problemschilderung des Falleinbringers umfasst (nur) ganz bestimmte Aspekte, Gefühle, Wahrnehmungen, so wie er sie erlebt, inklusive seiner Deutungsmuster und Bewertungen. Alles andere wird „ausgeblendet“, d.h. scheinbar nicht wahrgenommen. Es ist ein unausweichlicher Prozess menschlicher Wahrnehmung, dem wir alle unterliegen. In der Supervision wird mit und ohne Tools das Ausgeblendete in Sprache gebracht und so zugänglich gemacht. So gesehen ist Supervision die hohe Kunst der Unterscheidung (Kersting/Neumann-Wirsig 1996).
Die in diesem Buch vorgestellten Tools zeigen in beeindruckender Weise, wie die Beobachtung zweiter Ordnung, oder die Einblendung des Ausgeblendeten, von den Supervisoren in praktische Vorgehensweisen umgesetzt wird. Besonders deutlich wird das in den Tools zur Fallbearbeitung (siehe Teil 3 dieses Buches: Fälle bearbeiten, ab Seite 221).
Unterscheidung in Heimat- und Beratungssystem
In der Supervision haben wir es mit einem Phänomen zu tun, das auch in anderen Beratungsformaten von Bedeutung ist. Im Beratungssystem Supervision wird etwas erarbeitet, was in einem anderen System, dem Heimatsystem des Supervisanden, wirksam werden soll. Das bedeutet zweierlei für die Supervision. In der Zielklärung tun wir Supervisoren gut daran, zu unterscheiden zwischen den Zielen für die konkrete Supervisionssitzung und den Zielen, die der Supervisand mit seinen Klienten erreichen will. In der Supervision sind beide Zielsetzungen wichtig, hängen untrennbar zusammen, sind aber nicht identisch.
Die Leitfrage in der Supervision heißt deshalb: Inwieweit ist das, was wir hier besprechen und tun, hilfreich für den Supervisanden in seinem Heimatsystem? Diese Frage ist eine Art Prüfstein für die Supervisanden und den Supervisor und verstärkt die Fokussierung auf den Supervisanden und sein berufliches Handeln. Erst die Praxis des Supervisanden wird zeigen, wie wirkungsvoll die Interventionen, Vorgehensweisen, die Perspektivwechsel oder Handlungsoptionen, die in der Supervision erarbeitet werden, tatsächlich sind.
Das macht noch einmal deutlich, was Supervision von anderen Beratungen unterscheidet: Im Zentrum der supervisorischen Arbeit steht der Supervisand und nicht der Klient, mit dem er gerade arbeitet. Im Coaching arbeitet der Coach mit dem Heimatsystem. Der Klient ist ein Teil dieses Systems, so wie in der Sozialarbeit die Eltern ein Teil des Systems Familie sind.
Die zweite Auswirkung der Unterscheidung in Beratungs- und Heimatsystem bedeutet, dass die eigentliche Veränderung – im Sinne einer äußerlich und/oder innerlich wahrnehmbaren, sich in Handlung ausdrückenden Veränderung – zwischen den Supervisionen stattfindet. Supervision ist nicht primär der Ort der Veränderung, sondern sie schafft die Möglichkeit, dass Veränderung im Arbeitsalltag des Supervisanden geschehen kann. Dass der Supervisand die Supervision anders verlässt (gestärkt, hoffnungsvoll, erleichtert, sensibilisiert, kraftvoll etc.), als er sie begonnen hat, ist dabei von hoher Bedeutung.
Supervision oder Coaching
Nach wie vor diskutieren Kollegen, ob Supervision und Coaching dasselbe sind oder nicht. Gelegentlich unterstellen sie dabei, dass Supervision „besser“, weil tiefer gehend als Coaching sei, das zu sehr nach schneller Lösung strebe.
Sicherlich gibt es vor allem in der Ausbildung von Supervisoren und Coachs weitreichende und gravierende Unterschiede, aber erlaubt dieser Sachverhalt, bereits beides „gleich-zu-machen“ oder ein „Besser-schlechter“? Mir scheinen diese Diskussionen eher Fragen der Marktplatzierung aufzuzeigen.
Ich trete dafür ein – trotz vielfältiger Überschneidungen – Coaching und Supervision als zwei unterschiedliche Beratungsformate zu sehen und zu betreiben. Mir ist es wichtig, die Eigenständigkeit von beidem zu bewahren und zu entwickeln, ohne die Gemeinsamkeiten aus dem Blick zu verlieren.
In einer Matrix haben wir bei BTS Mannheim Supervision und Coaching unter bestimmten Fokussierungen gegenübergestellt.
Coaching
Supervision
Für Personen
mit Führungs- und Managementaufgaben
mit Sachfunktion/basalen Aufgaben
Ausrichtung
auf Unternehmensziele
auf die Person
Orientierung
ergebnisorientiert
prozessorientiert
Fokus
Personalentwicklung
Personenentwicklung
Themen
Führung/Management Karriere, Sinn, Leben
Professionelle Rolle
Kontrakt
Dreieckskontrakt mit Zielvereinbarung
zunehmend Dreieckskontrakt
Zeit
drei bis zehn Sitzungen, oft eilig
fünf bis? Sitzungen, weniger eilig
Wirkungsrichtung
top-down
bottom-up
Wirkungsort
innerhalb der Organisation
außerhalb der Organisation
Adressatenbezeichnung
Klient/Kunde
Supervisand
Vgl. Schreyögg 2003 Vgl. Neumann-Wirsig 2003
Die Unterschiede zwischen den beiden Formaten verschwimmen an einigen Punkten, vor allem wenn es sich um Teamsupervision, Teamentwicklung oder Teamcoaching handelt.
Supervision hat sich entschieden, die Berufsperson in den Blick zu nehmen und sich dadurch z.B. von Therapie abzugrenzen. Damit schränkt sie sich zwar auf die Professionalität ein, bleibt aber bei der Idee, dass der Weg zu mehr Professionalität über die Entwicklung der Person geht. Organisation und sozialer Kontext kommen nur in soweit vor, als sie für das Ziel Reflexion beruflicher Zusammenhänge relevant sind.
Diese Festlegung hat Coaching nicht getroffen (obwohl es sich ebenfalls von Therapie unterscheidet und auf die Arbeitszusammenhänge von Managern und Führungskräften fokussiert) und bleibt damit freier, sich den von den Beteiligten definierten Problemen zuzuwenden. Das kann z.B. im Rahmen von Work-Life-Balance bedeuten, die sozialen, familiären und gesundheitlichen Zusammenhänge im Coaching zu bearbeiten.
Die Diskussion um Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Supervision und Coaching kann schließlich auch mit beobachtbaren Ambivalenzen in der Supervisionsszene in Verbindung gebracht werden. Einerseits möchten Supervisoren gerne ihr Geld in der Wirtschaft verdienen und an die gut bezahlten Aufträge herankommen. Das ist verständlich und wünschenswert. Andererseits scheinen einige Kollegen noch einer gewissen sozialarbeiterischen Tradition verbunden zu sein, die ihnen den Umgang mit Menschen aus Wirtschaftsunternehmen – und hier besonders mit solchen, die mit Macht ausgestattet sind – erschwert.
In der Außen- und Innenwahrnehmung ist es sicher von Bedeutung, dass die größten Auftraggeber für Supervision nach wie vor die großen Wohlfahrtsverbände und die staatlichen Institutionen sind. Dadurch wird Supervision von außen vor allem im Kontext sozialstaatlicher Aufgaben wahrgenommen. Das verleiht ihr einen gewissen „Stallgeruch“, den Supervisoren in ihrem Verhalten auch immer wieder zu bestätigen scheinen.
Ein anderes Problem stellt für mich die fehlende gesellschaftliche Anerkennung von Supervision dar. Während es für viele Menschen gut zu verstehen und für jeden fußballkickenden Jungen auf der Straße ganz selbstverständlich ist, dass, wer immer gute Leistungen erbringen will oder soll, einen Coach braucht, stellt sich immer wieder die Frage „Was ist Supervision, wozu braucht man Supervision?“. Die Jubiläumsausgabe der Zeitschrift „Supervision“ beschäftigt sich nach 25 Jahren ihres Erscheinens ausschließlich mit der Frage „Was ist das eigentlich Supervisorische?“ (vgl. „Supervision“ 2/2007). Im Ergebnis erscheinen viele Facetten dessen, was Supervision ausmacht, aber kein Alleinstellungsmerkmal, das ihr in der Auseinandersetzung mit anderen Beratungsformaten und auf dem Markt helfen könnte, sich besser, eindeutiger zu positionieren. Deshalb muss sie sich während ihrer ganzen geschichtlichen Entwicklung immer wieder von anderen Beratungsformaten abgrenzen.
Lange repräsentierten die Settings Einzel-, Gruppen- und Teamsupervision das Spezifische der Supervision. Coaching macht ihr auch hier das Feld streitig.
Was können Coachs anders als Supervisoren? Prozesse zu begleiten erfordert ein anderes Auftreten als Prozesse zu steuern. Coachs waren häufig selbst Führungskräfte, bevor sie Coachs wurden. Sie haben die entsprechende Fachkompetenz und keine Berührungsängste mit der Macht und den damit verbundenen Spielen in Organisationen. Sie kennen und beherrschen die Spiele, wie z.B. den eigenen Claim rechtzeitig abzustecken, Konkurrenten in die Schranken zu weisen, sie können die Attacken in geeigneter Weise parieren. Sie kennen den Druck und die Wirkungen des ständigen Wandels. Sie wissen wie Prozesse in Organisationen gesteuert werden und lernen als Coachs, ihre Klienten dabei zu begleiten.
Supervisoren sind Experten in der Prozessbegleitung, häufig aber haben sie keine Erfahrung in der Prozesssteuerung als verantwortlicher Manager. Sie sind Meister der Reflexion, der Selbstreflexion und der Ermöglichung von Reflexion. Supervisoren beobachten das Geschehen zwischen dem Supervisanden und seinem Klienten, so wie es sich in dessen Geschichte präsentiert. Sie beobachten, welche Beobachtungskriterien der Supervisand seiner Geschichte zugrunde legt. Sie beobachten den Prozess, der sich aktuell zwischen dem Supervisand und dem Supervisor abbildet und in dem sich einerseits Teile der Geschichte des Supervisanden widerspiegeln und sich andererseits die Interaktionen zwischen Supervisand und Supervisor entwickelt.
Darüber hinaus beobachtet der Supervisor per Introspektion sich selbst, wie die Geschichte auf ihn wirkt, welche Gefühle, Affekte, Reaktionen, Impulse sie bei ihm auslösen und welche davon sich aus der geschilderten Szene speisen und welche der eigenen Geschichte des Supervisors zuzurechnen sind. Auf allen diesen Ebenen beobachtet der Supervisor nicht nur, sondern er ist in der Lage, auf jeder der Ebenen spezifisch zu intervenieren. Diese gleichzeitige Mehrperspektivität und Handlungsfähigkeit zeichnet Supervision in ganz besonderer Weise aus und macht sie so anspruchsvoll.
Der Supervisor sollte unterscheiden und präzisieren, was er anbietet: Supervision, Coaching, Organisationsberatung, Mediation oder anderes. Dass er dies bedarfsgerecht offerieren, den Auftrag mit dem Klienten klären und sein Angebot entsprechend formulieren kann, gehört zu den Selbstverständlichkeiten unserer Profession Supervision.
Tools oder Interventionen
Tools sind Strukturierungsangebote, Strukturhilfen. Ihre Strukturelemente ermöglichen Reflexion, leiten Denkprozesse an, fokussieren, verdichten, reduzieren und erhöhen die Komplexität, steuern, geben Sicherheit, machen Verhalten in sozialen Kontexten erwartbar, sind Ermöglichungen. Auf der anderen Seite engen sie ein, verhindern die Beobachtung außerhalb des Rahmens, der Struktur, bringen bestimmte Ergebnisse hervor, andere nicht, verhindern die Kreativität des Chaos und der Unbegrenztheit. Sie determinieren Kommunikationsabläufe und strukturieren Entscheidungsprozesse.
Tools sind auch ein Arrangement von Interventionen, in eine bestimmte Abfolge und Zusammenhänge gebrachte Einzelinterventionen. Sie beinhalten zeitliche, räumliche, inhaltliche und soziale Dimensionen. Sie sind Interventionsdesigns für kleine Beratungsprojekte. Tools basieren auf Hypothesen oder Diagnosen, je nach Selbstverständnis des Supervisors, und lassen bestimmt Wirkungen erwarten (vgl. Königswieser).
Intervention bezeichnet eine zielgerichtete Kommunikation, die eine bestimmte Wirkung beim Kommunikationspartner beabsichtigt. Intervenieren im Supervisionskontext heißt, so mit dem Kommunikationspartner zu kommunizieren, dass die Wahrscheinlichkeit der Problembeseitigung steigt (vgl. Simon/Rech-Simon).
Es lassen sich verschiedene Interventionsrichtungen unterscheiden. Zum einen für das Beratungssystem. Sie dienen der Einrichtung und Aufrechterhaltung des Beratungssystems. Im Ergebnis bilden sie das Setting und die Arbeitsbeziehung. Grundsätzlich gilt für jede Beratungsarbeit als ein wesentliches Kennzeichen von Professionalität, die Bedingungen für die eigene Arbeit zu kennen und herstellen zu können. Supervisoren verantworten das Setting und die Prozessgestaltung, die Supervisanden den Inhalt.
Interventionen in das Beratungssystem zielen innerhalb der Struktur des Prozesses auf die Problembearbeitung des Klientensystems (Supervisanden).
Innerhalb dieser letztgenannten Interventionsrichtung können nun wiederum zwei Arten von Interventionen unterschieden werden. Eine Interventionsart zielt darauf ab, die problemerhaltenden Muster zu beseitigen; die andere verfolgt das Ziel, die Ausbildung von Mustern, die eine Lösung herbeiführen können, zu initiieren.
Tools sind als Interventionsdesign ein Arrangement von Interventionen in das Beratungssystem.
Tools müssen in der Lage sein, eingefahrene Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsabläufe so zu unterbrechen, dass die Komplexität menschlicher Erfahrungsmöglichkeiten wieder zugänglich wird. Sie ermöglichen in der Supervision einerseits die Konzentration auf Wesentliches und andererseits die Erweiterung des Wahrnehmungs- und Handlungshorizontes. So gesehen ist Supervision das „Spiel“ mit der Komplexität, eine Abfolge von erweitern und reduzieren. Dabei sind Tools ein wichtiges Instrument bzw. Werkzeug.
Jeder Supervisor packt nach und nach seinen persönlichen Werkzeug- und Materialkoffer, in dem er praktisches, nützliches und erprobtes Handwerkszeug und die dazugehörigen Materialen zusammenfügt. Manchmal liegen bestimmte Werkzeuge obenauf und werden häufig benutzt. Sie haben eine Gebrauchspatina, liegen gut in der Hand, haben sich bewährt und funktionieren immer wieder gut. Manchmal lohnt es sich, den Koffer zu inspizieren, auszupacken und neu zu packen. Denn gelegentlich liefern gerade die wenig benutzten, fast in Vergessenheit geratenen Materialien und Tools neue Ideen und Anregungen für die nächste Supervisionssitzung.
Auch in der Supervision gilt der Spruch: Wer nur einen Hammer hat, sieht nur Nägel. Schon deshalb hat der erfahrene Supervisor sehr viele unterschiedliche Werkzeuge und Materialen in seinem Koffer. Diese Toolsammlung bieten Ihnen als Leserin und Leser die Möglichkeit, Ihren Handwerkskoffer zu ergänzen, zu erneuern, vielleicht Altbekanntes neu zu entdecken, von den Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen zu profitieren, von den Besten zu lernen.
Literatur:
Belardi, N. (1992). Von der Praxisberatung zur Organisationsentwicklung. Paderborn: Junfermann.
Kersting, H. (1996). Supervision, die hohe Kunst der Unterscheidung. In: Kersting, H./Neumann-Wirsig, H. (Hrsg.). Systemische Perspektiven in der Supervision und Organisationsentwicklung. Aachen: IBS Verlag, S. 19-40.
Königswieser, R./Exner, A. (6.Auflage 2001). Systemische Interventionen. Stuttgart: Klett-Cotta, S 149-151.
Neumann-Wirsig, H. (1992). Supervision – systemisch betrachtet. In: Kersting, H./Neumann-Wirsig, H. (Hrsg.). Supervision – Konstruktion von Wirklichkeiten. Aachen: IBS Verlag, S. 10-21.
Neumann-Wirsig, H. Alles Coaching – oder was? In: BSO – Journal 3/2003, S. 3-5.
Simon, F. B./Rech-Simon, Ch. (2000). Zirkuläres Fragen. Heidelberg: Carl-Auer-Verlag, S. 213-217.
Schreyögg, A. (2003). Die Differenz zwischen Supervision und Coaching. In: Organisationsberatung – Supervision – Coaching, Heft 3/2003, S. 217-226.
Weigand, W. (1989). Sozialarbeit – das Ursprungsland der Supervision. In: Integrative Therapie 3-4, 1989.
Weigand, W. (2007). Zurück zu den Anfängen – Zur Geschichte der Supervision in Deutschland. In: Zeitschrift Supervision 2/2007. Was ist das eigentlich Supervisorische. Jubiläumsausgabe 25 Jahre: 1982-2007. Weinheim: Beltz.
Willke, H. (1991). Supervision als Revisionsinstanz des Therapeutischen Prozesses. In: Gestalt und Integration 1/1991, S. 38 ff.
Zu meinem Netzwerk gehören:
Wolfgang Acht, Köln; Kurt F. Richter, Remscheid; Hans Gerd Schulte, Berlin; Hans-Karl Krey, Köln; Delia Anton, Aachen und Heinz Kersting, Aachen, verst. 2005.
Übersichtstabelle
Welches Tool passt zu welchem Setting?
Phase/Setting
Tool
Einzelsupervision
Gruppensupervision
Teamsupervision
Einstieg, Warming-up, JoiningAnkommen, in Kontakt kommen, Arbeitsbündnis herstellen, Vorgeschichte und Zielsetzung klären, in das Thema einführen, Erwartungen/Befürchtungen klären, Rollen klären, Neugier wecken, Atmosphäre schaffen
Farben
•
•
•
Fotokarten schwarz-weiß
•
•
•
Im Übergang
•
•
•
Mein Terminkalender stellt mich vor
•
•
Paparazzi
•
•
•
Persönliches Team-Profil
•
Schlüssel
•
•
•
Triptychon
•
Vielfalt in Teams … explorieren
•
•
Von 0 bis 10
•
•
•
Wollknäuel
•
•
Wortbild-Assoziationen
•
•
•
Zukunftsprobe
•
•
•
ThemenfindungProblembeschreibung/ZielklärungThemen aufbereiten, Ideen und Meinungen sammeln, Themen strukturieren, verdichten, vernetzen, priorisieren, Probleme analysieren, weitere Vorgehensweise klären
Arbeit am Begriff
•
•
•
Knopfsoziogramm
•
•
Kontext-Zapping
•
•
•
Mein Terminkalender stellt mich vor
•
•
Organisationspanorama
•
•
•
Persönliches Team-Profil
•
Problem als Lösung
•
•
Rad zur Systemsteuerung
•
•
•
Reise zu unterschiedl. Lösungsorten
•
Rollenspektrum
•
•
•
Schlagzeilen
•
•
•
Success-Fotoshooting
•
•
Teampositionierung
•
Tryptichon
•
Unser Team als Schiffsbesatzung
•
Von 0 bis 10
•
•
•
Wir machen (malen) uns ein Bild …
•
•
Wollknäuel
•
•
Zürcher Ressourcen-Modell
•
•
Bearbeiten/InterventionenThemen bearbeiten, Lösungsoptionen entwickeln, Konflikte bearbeiten, Interventionen setzen, Konsequenzen adaptieren, Entscheidungen treffen, Maßnahmen planen
Adlerhorst
•
Analoge Rückmeldung
•
•
Auftragskarussell
•
•
•
Ferien vom Ich
•
•
Galerierundgang
•
•
Ich seh etwas …
•
•
Imaginatives Rolleninterview
•
•
Knopfsoziogramm
•
•
Kunst am Seil
•
•
•
Märchen als Metapher
•
•
Mein Haus – Dein Haus
•
•
Problem- und Lösungsbilder
•
•
Problem als Lösung
•
•
Rad zur Systemsteuerung
•
•
•
Reise zu unterschiedl. Lösungsorten
•
Schachbrettübung
•
•
Success-Fotoshooting
•
•
Systemskulptur
•
•
•
Themenformulierung
•
•
•
Traumspiele in der Supervision
•
… und noch eine Runde
•
•
Vielfalt in Teams explorieren
•
Virtuelle Fragen
•
Vogelperspektive
•
•
Von 0 bis 10
•
•
•
Walt-Disney-Strategie
•
•
•
Wenn Du Probleme hast, …
•
Zukunftsorientiertes Feedforward
•
Zukunftsprobe
•
•
•
Zurück aus der Zukunft
•
•
•
Zwang als Chance
•
•
Auswerten/AbschließenAuswerten, Feedback geben (Zusammenarbeit, Verlauf, Ergebnisse), persönlichen und gemeinsamen Nutzen reflektieren, Praxistransfer sichern, evaluieren, bedanken, belohnen, würdigen, „verankern“, Hausaufgaben, Abschied gestalten
Bewertungsbogen … Teamsupervision
•
•
Blick zurück nach vorn
•
•
•
Fotokarten schwarz-weiß
•
•
•
Galerierundgang
•
•
Im Übergang
•
•
•
Kunst am Seil
•
•
•
Partizipatives Evaluieren lernen
•
•
•
Pegelstände
•
•
Rad zur Systemsteuerung
•
•
•
Reise zu unterschiedl. Lösungsorten
•
Schlüssel
•
•
•
Success-Fotoshooting
•
•
Unsere Beute für heute
•
•
•
Zukunftsorientiertes Feedforward
•
Zukunftsprobe
•
•
•
Teil 1
Einstieg gestalten, Anwärmen ermöglichen, Kontakt aufnehmen
Ankommen und kennenlernen
Gabriele Biggel-Hammer beschreibt einen „farbenprächtigen“ und einfühlsamen Einstieg in die Supervision. Das Tool Farben verbindet die aktuelle Befindlichkeit der Teilnehmer mit möglichen Themen für die Supervision.
Hanna Herty ermöglicht den Teilnehmern mit Mein Terminkalender stellt mich vor aus der Beobachterperspektive des eigenen Terminkalenders heraus sich selbst, die derzeitige Arbeitssituation und die dabei aktuell auftauchenden Themen und Fragen für die Supervision zu formulieren.
Heidi Neumann-Wirsig verdeutlicht, wie Schlüssel in allen Phasen des Supervisionsprozesses eingesetzt werden können, insbesondere für das gegenseitige Kennenlernen, die Anknüpfungen an die vorangegangene Supervisionssitzung und die aktuellen Erwartungen und Ziele.
Erika Luzia Lüthi stellt das Tool Vielfalt in Teams und Gruppen explorieren vor, das geeignet ist, die Unterschiede der Teilnehmer sichtbar, ansprechbar und wirklich nutzbar zu machen. Sie zeigt, wie das mit diesem Tool in hervorragender Weise gelingen kann.
Marlene Schildmayer beschreibt mit dem klassische Zahlenstrahl Von 0 bis 10, eine typisch systemische Intervention, die als Orientierungshilfe dient und mit der Supervisanden und Supervisor relativ schnell und anschaulich eine Bestandsaufnahme – bezogen auf eine gezielte Fragestellung – vornehmen können.
Übergänge gestalten (Kontext wechseln)
Edeltrud Freitag-Becker benutzt die Metapher der Türen, um Menschen Im Übergang zwischen Bekanntem und Neuem, zwischen Kommen und Gehen, zwischen Ankunft und Abschied ein differenziertes Erleben und den Kontextwechsel zu ermöglichen.
Monika Reichert nennt ihre Form eines imaginierten Blitzlichtes Paparazzi und beschreibt eine überraschende und ungewöhnliche Möglichkeit, sich selbst und anderen einen ausgewählten und auf den Moment fokussierten Einblick in Erlebnissausschnitte der jüngsten Vergangenheit zu gewähren.
Rosa Fischer-Stöckli stellt das Tool Triptychon vor, mit dem sich zu Beginn die Ziele „zur Ruhe kommen, sich das Vergangene, das Gegenwärtige sowie das Zukünftige vorstellen, empfinden, spüren und dies ohne Worte mit Farben aufs Papier bringen“ erreichen lassen.
Wolfgang Morbach visualisiert mit einem Wollknäuel Verbindungen zwischen den Erfolgsgeschichten der Supervisanden und ihren weiteren Anliegen. Das Tool ist selbst eine Verbindung zwischen lösungsorientiertem Vorgehen und einer dialogisch orientierten Gesprächsrunde.
Farben
Von Gabriele Biggel-Hammer
Kurzbeschreibung
Das Tool „Farben“ vermittelt den jeweils anderen Team- und Gruppenmitgliedern einen Eindruck, mit welchen Themenfeldern sich der Kollege beschäftigt und wie er sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Außerdem regt die Übung die Supervisanden zur Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion an.
Anwendungsbereiche
Einstiegsmethode für Einzel-, Gruppen- oder Teamsupervision.
Besonders geeignet für einen Personenkreis, der noch wenig Erfahrung mit Supervision und Selbstreflexion hat.
Zielsetzung/Effekte
Das Tool „Farben“ ermöglicht eine Standortbestimmung der eigenen Befindlichkeit in Bezug auf die unterschiedlichen Themenbereiche. Es erleichtert den einzelnen Teilnehmern, zu Beginn einer Supervision eine gute Arbeitshaltung einzunehmen und den Blick nach innen zu richten. Gleichzeitig erfahren die anderen Teilnehmer etwas über die gemeinsame „Landkarte“ bzw. das „Farbenspektrum“ der Gruppe und nehmen diese differenzierter wahr.
Ausführliche Beschreibung
Das Einstiegs-Tool ist besonders für Einzel- oder Gruppen-/Teamsupervision mit maximal sieben Personen geeignet. Es wird vor der Themenfindung eingesetzt und dient als „Stimmungsblitzlicht“. Die Themenfindung kann sich daraus ableiten, was aber nicht zwangsläufig geschehen muss. Je nach zeitlichen Ressourcen kann das Interview, das der Supervisor mit dem Supervisanden führt, kürzer oder länger gestaltet werden.
1. Schritt
In der Mitte des Stuhlkreises liegen Wachskreiden und weiße Moderationskärtchen. Der Supervisor bittet die Supervisanden, sich zu den Bereichen „Arbeit im Team“, „Arbeit mit den Klienten“ und „Privatleben“ Wachsmalkreiden in drei Farben auszusuchen und mit jeweils einer der gewählten Farben je eine Moderationskarte zu bemalen.
Die Themen werden je nach Fokus und Art der Gruppe unterschiedlich ausgewählt und vorgegeben. Bei einer Ausbildungsgruppe könnten es z.B. die Bereiche „Beruflicher Alltag“, „Weiterbildung“, „Privates“ sein, während bei einer Projektgruppe eher die Bereiche „Konzeptioneller Stand des Projektes“, „Finanzierung“, „Integration in Bestehendes“ fokussiert werden.
2. Schritt
Jeder Teilnehmer legt seine drei Kärtchen vor sich auf den Boden, so dass sie von allen gesehen werden können. Anschließend interviewt der Supervisor jeden Supervisanden zur Wahl seiner Farben. Folgende Fragen haben sich als nützlich erwiesen:
Sie haben für den Bereich „Arbeit im Team“ die Farbe Rot gewählt. Was verbinden Sie mit der Farbe Rot?
Ist das ein Zustand, der so bleiben soll?
Welche Farbe wäre Ihnen lieber?
Beschreiben Sie die Situation, wie die Arbeit im Team aussehen würde, wenn Sie für diesen Bereich Ihre Lieblingsfarbe nehmen würden.
usw.
Nacheinander stellen alle Supervisanden ihre drei gewählten Farben zu den verschiedenen Themenbereichen der Gruppe vor. Die Länge des Interviews hängt davon ab, wie viel Zeit die Gruppe/das Team insgesamt hat und worauf der Fokus der Arbeitseinheit gerichtet ist.
3. Schritt
Der Supervisor dankt jedem Supervisanden dafür, dass er seine Farben für die Bereiche vorgestellt und ihre Bedeutung erklärt hat. Bevor er den nächsten Supervisanden interviewt, kann er noch nach Zusammenhängen fragen, die der Supervisand zwischen den drei Farben herstellt. Weitere Fragen sind die nach dem Einfluss der Farben auf das Hiersein des Supervisanden oder welche der drei Farben in der Supervisionssitzung den größten Einfluss gewinnen wird oder ob die Farbenwahl nach der Supervision anders oder gleich ausfallen wird.
Voraussetzungen/ Kenntnisse
Kenntnisse in zirkulärem Fragen sind hilfreich und erweitern das Fragenspektrum.
Kommentare
Das Tool „Farben“ ist einfach und leicht durchführbar. Bei sehr zielorientierten Teams ruft dieser kreative Einstieg manchmal Widerstand hervor. Außerdem sollte der Supervisor vorher gut überlegen, ob und wie er in einem Arbeitsteam den Bereich „Privates“ sinnvoll thematisiert. Eine Möglichkeit besteht darin, für diesen Bereich zwar eine Karte malen zu lassen, aber die Supervisanden dazu nicht weiter zu interviewen.
Als weitere Variante bietet sich an, statt der Farben eine Skalierung mit Zahlen von 1-10 einzusetzen. Hierbei steht „10“ für „supergut“ und „1“ für „ganz schlecht“. Auch bei dieser Variante kann zirkulär gefragt werden.
Quellen/Literatur
Quelle unbekannt.
Technische Hinweise
Mehrere ansprechende Farbensets (Wachskreiden, dicke Buntstifte). Weiße Moderationskärtchen.
Mein Terminkalender stellt mich vor
Von Hanna Herty
Kurzbeschreibung
Aus der Perspektive des Terminkalenders stellt der Supervisand seine derzeitige Arbeitssituation und die dabei aktuell auftauchenden Themen und Fragen dar. Der Supervisand berichtet dabei schon aus der Beobachterperspektive und hat die Möglichkeit, bereits bei der Darstellung eine andere, neue Perspektive einzubringen und zu erleben. Der Terminkalender kann dabei vom Supervisor befragt werden.
Anwendungsbereiche
Das Tool eignet sich für die Einstiegsphase einer Gruppen- oder Teamsupervision mit mindestens vier Personen sowohl in der ersten Sitzung als auch zu Beginn einer Sitzung im laufenden Prozess (Themenfindung). Die Methode dient zu Beginn eines Supervisionsprozesses der Vorstellung der Teilnehmer als Warming-up, aber auch im Prozessverlauf als Einstiegsübung zur Fokussierung von zu bearbeitenden Fragestellungen.
Zielsetzung/Effekte
Diese Methode erlaubt dem Supervisanden, seinen Arbeitsalltag und sich selbst aus der Beobachterperspektive seines Terminkalenders zu betrachten.
Die Vorstellung, der eigene Terminkalender könne sprechen, ermöglicht dem Supervisanden, eine distanzierte Haltung und Position zu sich selbst und seinem Arbeitsalltag einzunehmen. Das führt zu einer Perspektivenerweiterung, die bereits beim Einstieg zu einer erweiterten Wahrnehmung beiträgt. Der Terminkalender als ständiger Begleiter im Arbeitsalltag steht einerseits für die Ressourcen und Möglichkeiten, andererseits auch für die Themen und Fragen, die es zu optimieren gilt. Da auch die anderen Teilnehmer den „Terminkalender“ befragen können, werden hier erste Vernetzungen innerhalb einer Gruppe vorgenommen. Ziel kann hierbei auch eine Erweiterung des gegenseitigen Kennenlernens sein.
Ausführliche Beschreibung
Einführung der Methode durch den Supervisor
„Stellen Sie sich vor, Ihr Terminkalender könnte sprechen. Zunächst stellt sich Ihr Terminkalender vor. Er beschreibt, wie er aussieht, wo er sich befindet, berichtet aus seinem Leben …“
Danach berichtet der Terminkalender von seinem Besitzer (Beschreibung der Person, der Funktion, der Rolle, des derzeitigen Befindens). Dann erzählt er, was zur Zeit in der Arbeit besonders gut läuft und was der Besitzer dazu beiträgt.
Als Nächstes denkt der Terminkalender laut darüber nach, was den Besitzer derzeit am stärksten beschäftigt und welche Frage er mit sich herumträgt.
Der Terminkalender spricht in der „Ich-Form“.
„Ich, der Terminkalender von XY, bin klein, quadratisch und liege auf dem Schreibtisch von XY …“
1. Schritt
Die Supervisanden haben Gelegenheit, sich 2-3 Minuten auf diese Einstiegsübung vorzubereiten, bevor sie möglichst spontan berichten. Während des Berichtes ist es Aufgabe des Supervisors darauf zu achten, dass der Supervisand in der Rolle des Terminkalenders bleibt, also in der Beobachterposition und in der Ich-Form spricht und erzählt.
2. Schritt
Um weitere detailliertere Informationen zu erhalten, kann der Supervisor den Terminkalender selbst interessiert und neugierig befragen. Je nach Zielrichtung und Intention werden auch die anderen Teilnehmer an der Befragung beteiligt. (Das kann man machen, muss es jedoch nicht.) Auf diese Weise stellt sich jeder Supervisionsteilnehmer aus der Perspektive seines Terminkalenders vor.
Voraussetzungen/ Kenntnisse
Voraussetzung ist eine Spielfreude seitens des Supervisors und der Supervisionsteilnehmer.
Der Supervisor sollte in der Lage sein, mit einer gewissen Neugierde und in einer wertschätzenden Haltung nachzufragen und über die Fragen aktivierend den Prozess zu fördern.
Beim Einsatz von Methoden ist es wichtig, dass der Supervisor erklären kann, inwieweit die Methode eine Bereicherung darstellt und die Erweiterung der eigenen Wahrnehmung über einen Perspektivenwechsel ermöglicht.
Kommentare
Das Tool kann auf unerfahrene Supervisionsgruppen befremdlich wirken, besonders wenn die Teilnehmer es nicht gewohnt sind, sich und ihr Erleben über einen Perspektivenwechsel darzustellen. In diesen Situationen ist es in unerfahrenen Gruppen hilfreich, über einen Rollentausch eine kurze Selbstdarstellung zu demonstrieren, z.B. „Mein Terminkalender könnte u.a. über mich sagen …“ Meistens genügen einige wenige Sätze, um das Vorgehen deutlich zu machen.
Die Einstiegsmethode ist einfach umzusetzen und aktiviert in der Regel den Prozess. Sie nimmt jedoch Zeit in Anspruch und eignet sich deshalb eher für kleinere Gruppen mit bis zu acht Personen.
Quellen/Literatur
Warming-up-Übung aus dem Psychodrama; genaue Quelle unbekannt.
Technische Hinweise
Keine.
Schlüssel
Von Heidi Neumann-Wirsig
Kurzbeschreibung
Schlüssel jeder Form und Art lösen, wenn wir sie in die Hand nehmen und betrachten, Assoziationen aus, die mit Erfahrungen, Erwartungen, Hoffnungen und Gefühlen verbunden sind. Bezogen auf die jeweilige Fragestellung werden sie aktualisiert und für den weiteren Supervisionsprozess nutzbar gemacht. Wir benutzen Schüssel tagtäglich, um aufzuschließen, einzuschließen, abzuschließen, um Räume betreten und verlassen zu können, die Tür im übertragenen Sinne hinter uns zuzumachen oder einzutreten in einen anderen metaphysischen Raum. Gerade weil Schlüssel etwas so Alltägliches sind, bieten sie als Analogie vielfältigen Zugang zum persönlichen und beruflichen Erleben.
Anwendungsbereiche
Das Tool „Schlüssel“ ist ein wahrer Allrounder. Es eignet sich für alle Phasen eines Supervisionsprozesses: das Kennenlernen, das Anknüpfen an die vorangegangene Supervision, die aktuellen Erwartungen und Ziele, die Bearbeitung des Falles und den Abschluss der Supervisionssitzung. Auch wenn der Prozess stagniert, kann über den Einsatz der Schlüssel ein neuer Zugang für die Weiterarbeit gefunden werden.
Zu Beginn der Supervision dient das Tool dem Aufschließen, in der Mitte dem Erschließen z.B. von Lösungen und Ressourcen und am Ende der Supervision dem Abschließen der Sitzung oder des ganzen Prozesses.
Das Tool ist außerdem für alle Settings der Supervision geeignet, ob in der Einzel-, Gruppen- oder Teamsupervision. Vor allem in der Einzelsupervision ist es in der Phase des Beziehungsaufbaues und der Vertrauensbildung ein wertvolles Instrument.
Zielsetzung/Effekte
Das Tool ermöglicht durch die Symbolkraft der Schlüssel einen einzigartigen und durch die jeweilige Fragestellung zugleich fokussierten Zugang zur inneren Welt, zur Person des Supervisanden und lädt ihn ein, auf spielerische Weise einen Zusammenhang zwischen sich selbst, der Situation, dem Problem oder der Fragestellung und dem Schlüssel herzustellen.
Die Bedeutungsgebung der Supervisanden, die Geschichte, die sie mit dem Schlüssel verbinden, zeigt die spezifische Ankoppelung des einzelnen Supervisanden an die aktuelle Situation. Gleichzeitig können damit Erfahrungen der Vergangenheit, Beziehungsangebote in der Gegenwart und Erwartungen an die Zukunft verknüpft werden. Das Spiel mit den Begriffen, die der Supervisand mit Blick auf den ausgewählten Schlüssel benutzt, kann dazu beitragen, Gefühle bewusst und ansprechbar zu machen.
Das Tool und die verwendeten Schüssel helfen als Analogie, die in Sprache zu übersetzen ist, dem Supervisanden, Person und Situation in Verbindung zu bringen. Der Supervisand wird dabei zu persönlichen Aussagen und Bedeutungsgebungen angeregt.
Häufig gelingt es mit diesem Tool, sowohl in der Einzel- als auch in der Gruppensupervision, eine situationsadäquate Vertrautheit aufzubauen und ein gewisses Maß an persönlicher Nähe herzustellen.
Ausführliche Beschreibung
Ich wähle hier die Phase des Beginns einer Gruppensupervisionssitzung für die illustrierende Darstellung der Arbeit mit dem Tool.
Der Supervisor legt am Beginn einer Supervisionssitzung viele verschiedene Schlüssel vor den Supervisanden auf dem Boden oder dem Tisch aus und bittet die Supervisanden, sich die Schlüssel einen Moment lang anzuschauen und die Unterschiedlichkeit der Schlüssel bewusst wahrzunehmen. Es gibt kleine und große, zierliche und grobe, schlichte und verzierte und noch viele andere.
Nach dem Moment der Konzentration auf die Schlüssel bittet der Supervisor die Supervisanden, jeweils denjenigen Schlüssel auszuwählen und an sich zu nehmen, der ihrer derzeitigen Stimmung, ihrem Befinden und ihrer Situation am besten entspricht. Die Frage könnte heißen: „Was hat dieser Schlüssel im Moment mit Ihnen zu tun?“
Wenn alle einen Schlüssel gewählt haben, bittet der Supervisor jeden Supervisanden, „seinen“ Schlüssel zunächst einmal zu beschreiben und dann zu erzählen, was dieser Schlüssel im Augenblick mit ihm oder ihr zu tun hat.
Die anderen hören aufmerksam zu und vermeiden, eigene Interpretationen in die Schlüsselauswahl oder -form hineinzulegen. Der Supervisor kann die Supervisanden durch gezieltes Nachfragen ermuntern, weitere Zusammenhänge zwischen sich und „ihrem“ Schlüssel herzustellen oder es kann auf andere Bedeutungen hinweisen. Kommentare in Form von positiven Konnotationen unterstützen den Aufbau einer guten Arbeitsatmosphäre und ermöglichen andere Perspektiven.
Weitere Fragenbeispiele:
Was möchten Sie sich heute hier erschließen?
Was möchten Sie abschließen, um mit der Supervision beginnen zu können?
Wie sieht die Tür aus, zu der dieser Schlüssel passt, und was befindet sich davor und was dahinter?
Mal angenommen, der Schlüssel könnte sprechen, was würde er uns im Moment über Sie erzählen?
Was hat der Schlüssel mit der heutigen Supervision zu tun?
Je nach Fokussierung der Frage werden natürlich auch andere Antworten der Supervisanden evoziert. Jeder Supervisand sollte höchsten fünf Minuten über „seinen Schlüssel“ und sich erzählen. Danach beendet der Supervisor die Einstiegsrunde mit einem abschließenden Kommentar, einem Dank an alle für die Aussagen, die gemacht wurden, oder für den Einblick, den jeder den anderen in seine derzeitige Situation gewährt hat.





























