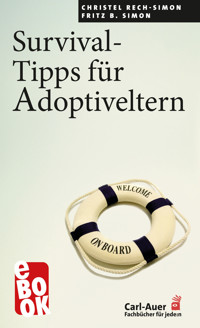
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Fachbücher für jede:n
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
In Deutschland werden jährlich ungefähr 5000 Kinder adoptiert. Die Mehrheit der Adoptivfamilien entwickelt sich wie andere Familien auch - mit kleineren oder größeren Problemen, wie sie zum Leben gehören. Ein Teil der Adoptiveltern aber findet sich zusammen mit ihren Kindern in einem Drama wieder, auf das sie nicht vorbereitet waren. Diesen Familien "am Rand des Nervenzusammenbruchs" bieten Christel Rech-Simon und Fritz B. Simon lebensnahe Hilfestellung an. Die Autoren blicken aus zwei Richtungen auf das Thema: als Adoptiveltern und als erfahrene Psychotherapeuten. Ihre "Survival-Tipps" sind keine einfachen Patentrezepte. Sie benennen zuallererst die "Tänze", zu denen sich Eltern von ihren Kindern nicht "einladen" lassen sollten. Das erfordert in erster Linie eher, das Falsche zu unterlassen als das Richtige zu tun. Diesem "Don't" fällt überraschenderweise das eine oder andere aus pädagogischer und psychologischer Sicht vermeintlich "richtige" Erziehungsverhalten zum Opfer. Viele authentische Fallbeispiele ergänzen die wissenschaftlichen Erkenntnisse und konkreten Tipps. Das Buch macht deutlich, dass Mütter und Väter auch scheinbar ausweglosen Krisensituationen nicht hilflos ausgeliefert sind. Sie können etwas tun - auch wenn dies oft etwas anderes ist, als gemeinhin angenommen und erwartet wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unseren großartigen Töchtern M. und P.
Christel Rech-Simon, Fritz B. Simon
Survival-Tipps für Adoptiveltern
Vierte Auflage, 2023
Reihe: »Fachbücher für jede:n«
Lektorat: Barbara Imgrund, Heidelberg
Gestaltung: Uwe Göbel
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Vierte Auflage, 2023
ISBN 978-3-8497-0510-7 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8453-9 (ePub)
© 2008, 2023 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte dvorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
Danksagung
1 Einleitung
1.1 Wozu dieses Buch?
1.2 Gebrauchsanweisung
1.3 Wozu Kinder?
2 Prinzipielles: Abhängigkeit und Autonomie
2.1 Drei »gewöhnliche« Situationen
2.2 Warum Adoptivkinder »ganz anders« sind … und warum sie es nicht sind
2.3 Vor und nach der Geburt
2.4 »Frühe Traumatisierung« versus »frühes Lernen«
2.5 Das Abspalten von Gefühlen
2.6 Orientierung an aktuellen Bedingungen oder künftigen Zwecken
2.7 Fehlendes »Urvertrauen« oder »Urmisstrauen«
2.8 Das Autonomie-Paradox
3 Was tun? – Ein (Selbst-)Beobachtungsschema zur Eröffnung von Handlungsalternativen
4 Fallbeispiel: »Die Sommers«
5 Entwicklungsphasen
5.1 Rolle und Funktion von Eltern
5.2 »Pathologisierendes« und »normalisierendes« Beobachten
5.3 Die Vorschulzeit
5.4 Die Schule
5.5 Das fatale Dreieck: Schule, Kind, Eltern
5.6 Pubertät und Adoleszenz
6 Zehn Gebote für Adoptiveltern
Nachbemerkung
Kommentiertes Literaturverzeichnis
Über die Autoren
Danksagung
Unser Dank gilt unseren beiden Töchtern, die uns nicht erlaubt haben, in Ruhe alt zu werden. Sie haben uns mit genug Herausforderungen versorgt (und tun das noch), um nicht in bewusstlosem Dämmerzustand das Leben zu verpassen. Ohne sie hätten wir uns sicher weniger Gedanken darüber gemacht, was für uns wirklich wichtig ist …
1 Einleitung
1.1 Wozu dieses Buch?
Brauchen Adoptiveltern Ratschläge, die sich von denen für Eltern nichtadoptierter Kinder unterscheiden? Und geht es dabei wirklich um ihr »Überleben«, wie der leicht dramatisierende Titel dieses Buches unterstellt? Wir meinen, dass beide Fragen mit »Ja« zu beantworten sind. Denn es gibt Adoptivfamilien, in denen Eltern wie Kinder an existenzielle Grenzen kommen und in denen zumindest das psychische Überleben der Beteiligten gefährdet erscheint.
Dass dies nur in einer Minderheit der Fälle zutrifft, muss zu Beginn betont werden. Denn die meisten Adoptionsgeschichten unterscheiden sich nicht oder nur wenig von den Geschichten biologischer Familien. Dieses Buch ist aber, um Missverständnisse von vornherein zu vermeiden, für diejenigen Adoptiveltern gedacht, die sich mit unerwarteten Problemen konfrontiert sehen – wenn sie sich im Umgang mit ihrem Kind als Akteure in einem Drama finden, das sie sich nicht hätten träumen lassen und auf das sie keiner vorbereitet hat.
Adoptiveltern, die den Eindruck haben, die Konflikte und Probleme, die sie mit ihren Kindern gelegentlich haben, seien nicht anders als in anderen Familien – denn Konflikte sind ja in keiner Familie vermeidbar (Trotzphase, Pubertät etc.) –, die brauchen hier gar nicht weiter zu lesen. Sie werden wahrscheinlich nicht ansatzweise nachvollziehen können, um welche Schwierigkeiten es in diesem Buch gehen soll.
Ganz allgemein geht ja die Frage, ob man seine Kinder »richtig« oder »falsch« erzieht, immer an den Kern der elterlichen Identität. Deswegen sind Erziehungsfragen sehr intim und emotional hoch brisant. Wenn mit den Kindern alles gut geht, dann schreiben sich die Eltern die Verantwortung zu. Sie meinen (wie die Leute in ihrem Umfeld auch), sie hätten ihren Job hinreichend gut erledigt. Und das stimmt wahrscheinlich auch. Damit Kinder gedeihen, müssen die Eltern nicht Kinderpsychologie studiert haben, es reichen in der Regel »hinreichend gute Eltern« – so zeigt die Forschung.
Wenn es aber Probleme mit den Kindern gibt – wenn es zu großen Konflikten oder zu auffälligen Verhaltensweisen des Kindes kommt –, dann sehen sich die Eltern infrage gestellt – nicht nur von anderen (das auch), sondern vor allem von sich selbst. Denn der Schluss liegt ja nahe, dass die Eltern vieles (oder gar alles) falsch gemacht haben, wenn die Kinder »aus der Spur« geraten. Da Eltern schon seit Urzeiten ihre Kinder großziehen, sollte es doch eigentlich – so die öffentliche Meinung – kein so großes Problem sein, sie in Anstand und Würde großzuziehen. Wenn also »die Karre in den Dreck gefahren wird«, dann richtet sich der Blick bei der Suche nach den Schuldigen auf die Eltern, schließlich sollten sie ja am Steuer zu sitzen. Sie scheinen intellektuell oder emotional ihrer Aufgabe nicht gewachsen zu sein (zu »dumm«, zu »nachlässig« oder zu »uneinfühlsam« usw., um zu wissen oder zu spüren, was Kinder brauchen).
Wenn so geurteilt wird, dann liegt dahinter eine Vorstellung der Eltern-Kind-Beziehung, in der richtig und falsch die Endpunkte eines Spektrums von Verhaltensmöglichkeiten sind. Am einen Ende ist das total falsche Verhalten von Eltern einzuordnen, am anderen Ende das vollkommen richtige. Die meisten Durchschnittseltern sind in diesem Modell mit ihrem Verhalten irgendwo in der Mitte zu positionieren, d. h., sie machen weder alles richtig noch alles falsch. Und das Gedeihen oder Missraten der Kinder ist der Test dafür (»Es fällt ja immer auf die Eltern zurück!«).
Solch eine Sichtweise geht – nicht ganz zu Unrecht, aber auch nicht ganz zu Recht – davon aus, dass alle Kinder irgendwie gleich bzw. ähnlich sind und in gewisser Weise dieselben Bedürfnisse haben. Daher müsste eigentlich auch die Eltern-Kind-Beziehung immer in irgendeiner Form ähnlich oder gleich sein, und Eltern müssten immer irgendwie Ähnliches tun. Der Unterschied zwischen »guten« und »schlechten« Eltern bzw. funktionalen und dysfunktionalen Eltern-Kind-Beziehungen ist in dieser Sichtweise eher quantitativ bestimmt: Die Eltern haben entweder zu wenig oder zu viel Liebe, Einfühlung, Fürsorge (oder was auch immer) gegeben oder zu wenig oder zu viel Grenzen gesetzt, Machtworte gesprochen, Disziplin eingefordert usw.
Doch diese Sichtweise wird den Adoptivfamilien, in denen es zu größeren Schwierigkeiten kommt, nicht gerecht. Denn wenn dort die Eltern das tun, was üblicherweise von »guten Eltern« erwartet wird (und woran sie sich selbst auch meistens orientieren), dann scheitern sie grandios.
Es gibt Adoptivkinder, bei denen die nach »gesundem Menschenverstand« und pädagogischer wie psychologischer Lehrmeinung richtigen erzieherischen Verhaltensweisen der Eltern desaströse Folgen haben. Sie sind – so kann aus der Außenperspektive gesagt werden – falsch, denn sie führen leider nur zu oft in die Katastrophe.
Um es auf eine – in ihrer Radikalität hoffentlich unmissverständliche – Formel zu bringen: Viele elterliche oder erzieherische Verhaltensweisen, die im Umgang mit durchschnittlichen Kindern (ob adoptiert oder nicht) richtig sind, erweisen sich im Umgang mit bestimmten Adoptivkindern schlicht und einfach als falsch. Und je mehr Eltern und Erzieher das tun, was allgemein als »richtig« gilt, umso verfahrener und auswegloser wird die Situation.
Doch das weiß kaum jemand, sogar nur die wenigsten der vermeintlichen Experten. So geraten die Eltern dieser Kinder fast zwangsläufig in eine extrem schwierige Sandwichposition. Sie sind auf der einen Seite dem für sie oft nicht verstehbaren und uneinfühlbaren Verhalten ihres Kindes ausgeliefert, und auf der anderen Seite stehen sie Verwandten, Freunden, Nachbarn und mehr oder minder wohlmeinenden Sozialarbeitern und Lehrern gegenüber, von denen sie sich genauso wenig verstanden fühlen, wie sie ihr Kind verstehen. All deren gute Ratschläge sind zu nichts nütze, weil sie von bestimmten Vorannahmen über die Eltern-Kind-Beziehung ausgehen, die in »durchschnittlichen« Familien mit »durchschnittlichen« Kindern passend sind, in ihrem Fall aber nicht.
Um unser Thema noch einmal perspektivisch einzuordnen: Glaubt man den Statistiken, so entwickeln sich die meisten Adoptionen zur Zufriedenheit der Beteiligten, und nur eine Minderheit hat die Art von Schwierigkeiten, von denen wir im Folgenden sprechen wollen. Doch um genau diese Fälle geht es uns. Wir wollen, ganz parteiisch, den Familien, in denen die Adoption zum Drama gerät, Hilfestellung leisten. Um dies tun zu können, haben wir die Fachliteratur studiert, Interviews mit betroffenen Familien geführt, Theorien diskutiert und die Erfahrungen von Experten ausgewertet.
Neben dem fachlichen Interesse haben wir aber auch einen persönlichen Grund, dieses Buch zu verfassen. Wir sind selbst Eltern von Adoptivkindern. Was uns auf den ersten Blick von den meisten anderen Adoptiveltern unterscheidet, ist, dass wir lange Jahre hauptberuflich mit Kindern und Familien gearbeitet haben (als analytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin bzw. als systemischer Familientherapeut), und wir haben beide eine psychoanalytische Ausbildung genossen. Daher haben wir auch ganz gute Vorstellungen davon, was sich in der Psyche eines Kindes abspielt und wie Familien funktionieren. Wir sind außerdem darin trainiert, unsere eigenen Gefühle und Gedanken im Umgang mit anderen Menschen kritisch zu beobachten und zu reflektieren. Doch all unser Training hat uns nur begrenzt geholfen, mit den Herausforderungen umzugehen, die mit der Adoption unserer Kinder verbunden waren. Es gab immer wieder Momente, in denen wir mit unserem Latein am Ende waren und die uns an unserer Kompetenz, ja, an uns selbst zweifeln ließen. Es waren Situationen, auf die uns unsere Ausbildung nicht vorbereitet hatte und in denen wir alle »guten« Ratschläge von Kollegen und anderen Experten als irgendwie »daneben« erlebten. Und wir fanden uns oft in einer Lage, in der wir uns vom Rest der Welt nur sehr begrenzt verstanden und manchmal sogar unverhüllt abgelehnt und ausgegrenzt fühlten.
In diesen Phasen hätten wir gern ein Buch gehabt, in dem wir uns nicht nur in unserer besonderen Lage als Adoptiveltern wiedererkannt hätten, sondern in dem wir auch konkrete Ratschläge gefunden hätten, was wann wie zu tun ist – im Umgang mit unseren Kindern, den Nachbarn, den Lehrern usw.
Nun sind unsere Kinder erwachsen, und wir haben in den Jahren seit ihrer Adoption Vieles erfahren und – schmerzlich wie freudig – gelernt, dessen Kenntnis für Adoptiveltern hilfreich und ermutigend sein könnte.
Dennoch ist dies kein Buch über unsere Kinder, sondern unser Ziel war, das Buch zu schreiben, das wir gern zur Hand gehabt hätten, als wir – manchmal am Rande der Verzweiflung – in Schwierigkeiten mit unseren Kindern geraten sind.
Unser Vorteil als therapeutische Profis war und ist, dass wir nicht so leicht einzuschüchtern sind wie »normale«, d. h. fachlich unvorbelastete, Eltern. Wir konnten immer zwischen der Innenperspektive der emotional betroffenen und beteiligten Eltern und der etwas distanzierteren Außenperspektive von Therapeuten, die (auch) mit Adoptivfamilien arbeiten, wechseln und den Blick aus beiden Winkeln zueinander in Beziehung setzen.
Unsere Hoffnung ist, dass wir anderen Adoptiveltern mit diesem Buch ganz konkrete Hilfestellungen geben können, um die manchmal existenziellen Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert werden (können), relativ (!) gelassen, vor allem aber zuversichtlich (!) durchzustehen. Dabei geht es uns nicht darum, das Thema Adoption in all seiner psychologischen und soziologischen Vielschichtigkeit abzuhandeln, sondern wir wollen den betroffenen Eltern »Survival-Tipps« geben, um so nicht nur ihr eigenes, sondern auch das (emotionale, soziale etc.) Überleben ihrer Kinder ein wenig leichter zu machen.
Und, um auch in dem Punkt keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Dieses Buch soll keineswegs vor der Adoption warnen. Wir halten Adoption für eine großartige Sache – und die Mehrheit der problemlosen Adoptionen belegt dies. Auch für uns – wie für viele unserer Interviewpartner – gehört die Adoption unserer Kinder zu den sinnvollsten Dingen, die wir im Leben getan haben.
Um die Botschaft, die wir geben wollen, gleich zu Beginn deutlich zu formulieren: Auch in den schwierigsten und scheinbar ausweglosesten Situationen gibt es guten Grund, die Zuversicht zu bewahren: Man ist als Mutter oder Vater nicht hilflos, man kann etwas tun – auch wenn dies oft etwas anders ist, als gemeinhin erwartet wird …
1.2 Gebrauchsanweisung
Ein paar Worte zur Struktur und Benutzung des Buches: Auch wenn wir im Titel Tipps versprechen, so ist das, was im Alltag einer Familie so alles geschehen kann, nicht vorhersehbar. Das heißt, niemand kann heute wissen, ob, wann und in welcher Lage Eltern solche Tipps morgen brauchen werden. Außerdem sind keine zwei Situationen im Leben unterschiedlicher Familien gleich. Jede Familie ist unverwechselbar, jedes Kind – ob adoptiert oder nicht –, jede Mutter und jeder Vater ist einzigartig.
Aber trotzdem gibt es gewisse Anforderungen und Herausforderungen im Leben von Kindern und Eltern, die sie alle bewältigen müssen und denen keiner entgeht. Das betrifft zunächst einmal bestimmte körperliche Entwicklungen, die biologisch vorgegeben sind. Man kann sich – außer vielleicht im Roman – nicht entscheiden, nicht zu wachsen oder nicht älter zu werden. Und so, wie man bestimmte körperliche Veränderungen psychisch und im Umgang miteinander bewältigen muss, müssen die Mitglieder jeder Familie mit der Tatsache umgehen, dass es im sozialen Umfeld bestimmte Vorstellungen und Anforderungen an das Verhalten jedes Einzelnen gibt, denen er oder sie gerecht werden muss, wenn sie oder er vorhersehbare negative Konsequenzen vermeiden will.
Trotz der unverwechselbaren Einzigartigkeit jedes Individuums sind aber auch – das ist einer der oft schwer zu fassenden Widersprüche – alle Menschen ähnlich »gestrickt«. Eigenarten, die alle Menschen charakterisieren, charakterisieren auch jeden einzelnen Menschen.
Dasselbe gilt für Familien: Auch hier kann gesagt werden, dass es wahrscheinlich keine zwei Familien auf der Welt gibt, die nach exakt denselben Spielregeln funktionieren. Daraus gewinnt das eigene Familienleben für viele Menschen seine spezifische Attraktivität. Und dennoch sind sich alle Familien irgendwie gleich. Sonst würden wir keine Schwiegermutterwitze verstehen, wir könnten nicht nachvollziehen, warum jemand den Wunsch hat, sich von seiner überfürsorglichen Mutter abzugrenzen oder gegen einen autoritären Vater zu rebellieren usw.
Wenn es diese Gemeinsamkeiten nicht gäbe, dann gäbe es auch weder Psychologie noch Pädagogik als Wissenschaften, keine Familienforschung, weder Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie noch Familientherapie. Sie alle haben mit dem grundsätzlichen Widerspruch von Unterschieden und Gemeinsamkeiten umzugehen: dass alle Menschen und alle Familien einzigartig sind und sich doch irgendwie gleichen.
Als Wissenschaften können sie daher nicht exakt sein – wie Physik, Mathematik oder Astronomie. Sonnenaufgang und -untergang lassen sich auf die Sekunde genau vorhersagen, das Verhalten eines Menschen allerdings (glücklicherweise) nicht. Aber trotz dieses Mangels an genauer Berechenbarkeit können psychologische und familiendynamische Einsichten und Theorien im Alltag nützlich sein, um die grobe Richtung des eigenen Handelns daran zu orientieren.
In diesem Sinne sind unsere Tipps zu verstehen. Wir versuchen, gewisse theoretische Grundlagen darzustellen, die es Eltern von Adoptivkindern erleichtern können, ihre Kinder zu verstehen und deren Verhaltensweisen zu erklären. Denn wie wir uns als Eltern verhalten, hängt ja nicht allein von den beobachtbaren Fakten ab, sondern davon, wie wir sie deuten. Sehen wir in unserem Kind, das gerade wütend die Tür zuknallt, jemanden, der sich »schlecht benimmt« (obwohl er oder sie genau weiß, dass »man das nicht tut«), oder sehen wir im Knallen der Tür die Mitteilung, dass es unserem Kind gerade »schlecht« geht und es »Hilfe braucht«?
Das Verhalten eines Menschen – sei es Kind oder Erwachsener – muss immer (!) in seiner Bedeutung interpretiert werden. Und diese Bedeutung ist nicht objektiv klar und eindeutig festgelegt, sondern sie entsteht im Auge des Betrachters. Wir zerbrechen uns den Kopf über die Ursachen des Verhaltens unserer Kinder und bewerten es nicht nur sachlich, sondern auch emotional. Und unsere Kinder tun im Blick auf unser Verhalten dasselbe. Je nachdem, wie diese Erklärungen und Bewertungen ausfallen, fallen die Reaktionen der Beteiligten aus.
Adoptierte Kinder sind mit Herausforderungen in ihrer psychischen Entwicklung konfrontiert, die Kindern, die mit ihren biologischen Eltern aufwachsen, in der Regel (allerdings nicht in jedem Fall und nicht immer) erspart bleiben. Das ist auch für die Eltern mit Herausforderungen verbunden. Denn viele erzieherische Strategien, die im Umgang mit nichtadoptierten Kindern nützlich sein mögen, funktionieren hier nicht – ja, sie führen oft zur Verstärkung von Problemen. Um sich in dieser Situation anders verhalten zu können, als es die alltagspsychologische Weisheit nahelegt, ist es nötig, eine Ahnung davon zu entwickeln, wo und wie (manche) adoptierte Kinder anders »ticken« als andere Kinder.
Unsere Tipps beruhen auf einem Erklärungsmodell1, das wir über das ganze Buch hinweg durchsichtig zu machen versuchen (dabei haben wir uns bemüht, jedes Fachchinesisch zu vermeiden). Dieser – wenn man so will – theoretische Teil bildet das Skelett des Buches.
Das Fleisch liefern dann zum einen konkrete Szenen aus Adoptivfamilien, die typische Situationen illustrieren (auch wenn sie in dieser Form natürlich nur in der jeweils beschriebenen Familie vorgekommen sind). Sie werden – so unsere Hoffnung – durch die von uns dargestellten Erklärungsmodelle in ihrer emotionalen Logik nachvollziehbar.
Dieser Verknüpfung von Theorie und Praxis soll auch ein ausführliches Interview mit einer Adoptivmutter (Frau Sommer) dienen. Es zeigt exemplarisch, wie Adoptiveltern ihre Situation erleben und durch welche Höhen und Tiefen sie zu gehen haben.
Den dritten Bestandteil des Buches bildet ein Beobachtungsschema, aus dem Tipps im engeren Sinne abgeleitet werden können. Wie bereits erwähnt, ist Familienleben nicht vorhersehbar. Daher können nur einige charakteristische, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit immer wieder auftretende, Situationen behandelt werden.
Unser Beobachtungsschema für Adoptiveltern folgt dabei einer dreiteiligen Ordnung:
Wir beginnen mit der Skizzierung charakteristischer Situationen und dem Erleben der Eltern (Selbstbeobachtung). Die Aufmerksamkeit wird dabei auf die eigene Beteiligung an der Kommunikation gerichtet – genauer gesagt: die »Einladung zum Tanz«, die bei uns als Vater oder Mutter ankommt, wenn unser Kind sich auf die eine oder andere Weise verhält. Wir reagieren erfahrungsgemäß alle auf bestimmte Verhaltensweisen unserer Kinder mit bestimmten, nahezu automatisierten Reflexen, und unsere Kinder tun dies bei unserem Verhalten. Auf diese Weise entsteht – von außen betrachtet – so etwas wie ein Tanz, eine Schrittfolge, bei der die Beteiligten gemeinsam ein Muster der Kommunikation erzeugen, das keiner allein unter Kontrolle hat (man braucht eben zwei, um Tango zu tanzen). Solche Tänze können nützlich, sie können aber auch schädlich sein.
Um ein Beispiel zu geben: Wenn ein Kind weint und offensichtlich traurig ist, dann spüren wir als Eltern (meistens) zwei Dinge: Zum einen fühlen wir mit unserem traurigen Kind, d. h., wir erleben in einer Art der Resonanz die Gefühle, die auch unser Kind zu haben scheint (ob es solche Gefühle wirklich hat, können wir natürlich nicht wissen, da wir nicht in das Kind hineinblicken können, sondern nur seinem Verhalten diese Bedeutung zuschreiben; aber Empathie – Einfühlungsvermögen – ist die Fähigkeit, die gegenseitiges Verstehen überhaupt erst ermöglicht). Zum anderen spüren wir den Handlungsimpuls, auf unser Kind zuzugehen und es tröstend in den Arm zu nehmen. Es schickt durch sein Weinen eine »Einladung« an uns, es zu trösten, und wenn wir das tun, dann beginnt der Tröstungs-Tanz (was in den meisten Fällen hilfreich, nützlich und befriedigend für beide, Eltern wie Kinder, ist). Aber nicht alle derartigen Tänze sind nützlich und hilfreich. Manche sind sogar ausgesprochen destruktiv (wenn zum Beispiel die Demütigung des einen zur Retourkutsche einlädt, sodass die Demütigung des anderen der »logische« nächste Schritt zu sein scheint usw.).
Ob ein Kind, wenn es weint, tatsächlich möchte, dass Mutter oder Vater es tröstet, weiß niemand wirklich, und meist weiß es das Kind selbst auch nicht. Da niemand in eine fremde Seele hineinschauen kann, kann das auch niemand wirklich wissen, sondern immer nur vermuten und erspüren (»Bauchgefühl«). Was wir als Eltern aber genau wissen und beobachten können, ist unser eigener Handlungsimpuls – unsere individuelle Reaktion auf eine Einladung. Wenn wir uns ihrer bewusst werden, so gewinnen wir die Option, solche Einladungen anzunehmen oder abzulehnen. Wenn unsere »liebe Kleine« oder unser »lieber Großer« zum Beispiel »Streit sucht« (wie es so schön heißt), so sind wir frei zu sagen: »Diesen Tanz lasse ich mal aus!« Und wenn solch eine Einladung ausgeschlagen und nicht zur Kenntnis genommen wird, dann kommt es auch zu keinem Streit, denn allein kann man sich nicht wirklich gut streiten …
Unser Beobachtungsschema beginnt daher stets mit der Frage nach dem eigenen Erleben und den eigenen Handlungsimpulsen, die wir als Eltern verspüren:
(a) »Wie geht es mir jetzt gerade, d. h., welche Gefühle erlebe ich in dieser Situation?« (Hier stellt sich dann immer die Frage, ob es sich um die Resonanz des Erlebens des Kindes handelt – ein Verstehen der Gefühle, die das Kind selbst im Moment gerade fühlt oder fühlen könnte.) Und
(b) »Wenn ich jetzt spontan (aus dem Bauch heraus) handeln würde, was würde ich tun?«
Zugegeben: Das ist etwas paradox, weil das Beantworten der Frage nach dem spontanen Handeln ja das spontane Handeln verhindert. Aber diese Verzögerung ist gewollt, denn der Weg vom Fühlen zum Handeln ist normalerweise sehr kurz, sodass wir stets Gefahr laufen, zu schnell (!) zu reagieren. Solch ein schnelles Reagieren ist erfahrungsgemäß in Notfallsituationen nützlich (wenn z. B. das Haus brennt). Doch in der Beziehung zu unseren Kindern ist meist keine Eile geboten und ruhiges Reagieren besser als überhasteter Aktionismus.
Diese beiden Fragen sind deswegen wichtig, weil ihre Beantwortung uns eine Idee davon vermitteln kann, zu welchem Tanz wir eingeladen werden. Denn wenn wir uns in die Position des Kindes einfühlen (Empathie, Resonanz), so können wir in etwa nachvollziehen, wozu es uns gerade (ge)braucht. Und wenn wir uns unsere Handlungsimpulse bewusst machen, dann sehen wir den Gegenpart dazu. Ein Tanz (auf dem Parkett wie im Familienleben) ist immer eine Gemeinschaftsleistung. Diese Fragen helfen, einen Blick von außen auf den möglichen oder wahrscheinlichen, in seiner Wirkung konstruktiveren oder destruktiveren Tanz zu werfen. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, Nein zur jeweiligen Einladung zu sagen.
Nach der Beantwortung dieser Fragen versuchen wir, zwei unterschiedliche Arten konkreter Tipps zu geben. Zum einen geben wir exemplarisch Ratschläge, was man als Vater oder Mutter (oder gemeinsam) in solch einer Lage aktiv tun kann. Zum anderen geben wir Ratschläge, was man lieber unterlassen oder vermeiden sollte.
Das Schema unserer Tipps wird also mehrgliedrig sein:
Zunächst schildern wir eine Situation, damit unsere Tipps nicht im luftleeren Raum hängen. Im Rahmen der Selbstbeobachtung fragen wir (a) nach dem eigenen Erleben der Eltern, (b) nach den Handlungsimpulsen, um daraus abgeleitet (c) einen Blick auf die Einladungen zum Tanz zu werfen, die in der jeweiligen Situation verschickt (und eventuell angenommen) werden. Wir kommentieren sie und versuchen zu erklären, was in der geschilderten Situation gerade geschieht. Danach geben wir dann konkrete »Was-tun?«-Ratschläge. Wir werden hier zwei Rubriken unterscheiden: Unter der Überschrift »Ja« werden wir Vorschläge machen, was man als Mutter oder Vater in der dargestellten Situation tun kann, und unter der Überschrift »Nein« werden wir Hinweise geben, was man besser unterlassen oder vermeiden sollte. Beides sind Vorschläge, die nicht unbedingt wörtlich zu verstehen sind, da sie eher Prinzipien illustrieren sollen, die dann entsprechend der aktuellen Situation zu modifizieren sind.
Natürlich sind wir uns dessen bewusst, dass man als Vater oder Mutter nicht immer das tun kann, was theoretisch sinnvoll oder gar das Beste wäre (unsere Familie kann da ein Lied singen). Deshalb scheinen uns die Ratschläge, die benennen, was besser unterlassen werden sollte (»Nein«), weit wichtiger als die Darstellung eines vermeintlichen elterlichen Idealverhaltens (»Ja«). Es gibt keine idealen Eltern, und Eltern machen – gemessen am Ideal – immer vieles »falsch«. Wir alle sind Menschen, und das wissen auch unsere Kinder (zumindest merken sie es im Laufe der Zeit). Und alle Forschungen zeigen: Es gibt nicht die eine, richtige Methode, seine Kinder großzuziehen.
Wie in vielen anderen Bereichen unseres Lebens ist Erfolgsrezepten generell zu misstrauen, denn es gibt immer viele Wege zum Ziel. Was man aber ganz gut und relativ zuverlässig analysieren kann sind Misserfolgsrezepte. So wie man ziemlich genau sagen kann, was man als Mensch tun muss, um krank zu werden oder früh zu sterben (z. B. sich ungeimpft und unter Vernachlässigung aller Hygienemaßnahmen in einer Infektionsstation aufhalten/vom Hochhaus springen …), nicht aber, was man tun muss, um zuverlässig gesund zu bleiben, kann man auch viel leichter Prinzipien des Scheiterns in der Familie formulieren. Sie sind deswegen so hilfreich, weil es viel einfacher ist, etwas altbewährt Schädliches zu vermeiden (z. B. vom Hochhaus zu fallen), als etwas neues Nützliches zu tun.
Deswegen ist es uns viel wichtiger, wenn Sie als Leser, statt irgendein ideales Verhalten anzustreben, Verhaltensweisen vermeiden, die erfahrungsgemäß zu Schwierigkeiten oder gar in die Katastrophe führen. Das Problem bei derartigen Verhaltensweisen ist, dass wir sie ja nicht aus bösen Absichten, sondern – ganz im Gegenteil – oft aus den nobelsten Motiven heraus vollziehen. Aber bekanntermaßen ist ja »das Gegenteil von gut die gute Absicht«. Und oft resultieren unsere Handlungsimpulse als Eltern aus solchen guten Absichten: »Ich kann doch nicht ruhig zusehen, wie mein Kind …« Doch manchmal ist Nichtstun das Beste, was Sie tun können. Denn zu destruktiven Tänzen kommt es in der Familie leider oft gerade dann, wenn wir als Eltern unseren spontanen Handlungsimpulsen unreflektiert folgen.
Deswegen erscheint es uns auch so sinnvoll, durch die Einschaltung der genannten Fragen (»Was fühle ich gerade?«; »Welche Handlungsimpulse spüre ich gerade?«; »Zu welchem Verhalten fühle ich mich eingeladen?«) Zeit zu gewinnen. Auf diese Weise wird die Interaktion verlangsamt, und damit lässt sich oft schon eine Eskalation verhindern, bei der viel emotionales Porzellan zerschlagen würde, das später nur schwer wieder zu kitten wäre.
Also: Nichts spricht dagegen, dass Sie sich an unseren guten »Ja«-Ratschlägen orientieren. Aber, wenn das zu schwierig erscheint, ist es nicht tragisch. Viel wichtiger für Ihr Überleben und das Ihres Kindes ist, dass Sie im Zweifel unsere »Nein«-Tipps beherzigen.
Am Ende des Buches versuchen wir, so etwas wie 10 Gebote für Adoptiveltern zu formulieren, d. h. allgemeine Prinzipien, die es Ihnen erleichtern sollen, sich in den unvorhersehbaren Geschehnissen des familiären Alltags zu orientieren und zu handeln.
Doch bevor wir uns all dem widmen, richten wir unseren Blick auf die Frage, warum es sich überhaupt lohnt, sich Kinder anzuschaffen – denn das kann auch erklären, was uns mit anderen Adoptiveltern verbindet und warum wir dieses Buch schreiben.
1.3 Wozu Kinder?
Früher »bekam« man Kinder. Ob man Kinder »haben« wollte oder nicht, war keine Frage, die man wirklich entscheiden konnte. Das ist heute anders. Die verschiedenen Möglichkeiten der Empfängnisverhütung eröffnen die Option, sich zumindest gegen Kinder entscheiden zu können. Erst seither stellt sich die Frage, warum sich Menschen für Kinder entscheiden.
Es ist eine Entscheidung, von der jeder weiß oder zumindest ahnt, dass sie sein Leben radikal verändern wird. Und dennoch – oder gerade deshalb – wollen viele Menschen Kinder haben. Da es für sie um die Gestaltung der eigenen Zukunft geht, steht nicht so sehr die Frage nach dem Warum im Mittelpunkt des Interesses (Warum-Fragen sind immer irgendwie vergangenheitsorientiert), sondern die Frage nach dem Wozu: Wozu wollen Menschen eine lange Phase ihres Lebens mit einem oder mehreren Kindern verbringen?
Diese Frage stellt sich heute jedem in unserer westlichen Hemisphäre, der sich mit dem Gedanken beschäftigt, Kinder großzuziehen. Das ist besonders dann der Fall, wenn Kinder adoptiert werden sollen. Biologische Eltern können dieser Frage ausweichen, sie verleugnen oder es als selbstverständlich und gottgegeben annehmen, dass sie Kinder bekommen. Wer hingegen ein Kind adoptieren will, entgeht dieser Frage nicht, schon weil in die Entscheidung darüber – anders als bei biologischen Eltern – eine Vielzahl anderer Akteure einbezogen ist (z. B. Behörden). Der Kinderwunsch muss begründet und rechtfertigt werden, er wird kritisch betrachtet und hinterfragt, er ist keine Privatsache (mehr).
Wie immer die Motive im Einzelnen sein mögen: Sich Kinder »anzuschaffen« widerspricht heute (das war nicht immer so) der ansonsten in der westlichen Welt vorherrschenden ökonomischen Rationalität. Man zeugt keine Kinder mehr, um billig zu Arbeitskräften zu kommen, die bei der Ernte helfen, oder damit man im Alter versorgt ist. Und schon gar nicht adoptiert man Kinder aus derartigen Gründen. Es muss also um etwas anderes gehen. Wenn wir unsere eigenen Motive wie die anderer Adoptiveltern, die wir kennen und mit denen wir gearbeitet haben, betrachten, so ist die plausibelste Antwort die, dass Kinder über die eigene, begrenzte Existenz hinaus dem eigenen Leben Sinn zu stiften vermögen – und das in einer nahezu konkurrenzlosen Weise.
Wer sich jemals auf das Gedankenexperiment einlässt, sich auf sein Sterbebett zu fantasieren und auf sein Leben zurückzuschauen, der wird merken, dass ihm von all den Gütern, die er im Laufe seines Lebens erworben hat, nur wenige wirklich etwas bedeuten und dass die Ehrungen, Erfolge und der Reichtum, die er errungen haben mag, ziemlich schnell ihre Bedeutung verlieren. Was ihm – wenn er denn ein erfülltes Leben gehabt haben sollte – geblieben ist, sind befriedigende Beziehungen zu einzelnen, unverwechselbaren Menschen, die ihm nahe stehen, Höhen und Tiefen einer gemeinsamen Geschichte, Erfahrungen mit Personen, die für ihn emotional wichtig waren und für die er wichtig war.
Diese sinnstiftende Wirkung von Kindern ist nicht schwer zu erklären. Wir leben in einer Zeit, in der von jedem Einzelnen einerseits erwartet wird, sich in seiner Individualität zu verwirklichen bzw. zu beweisen. Auf der anderen Seite ist unser gesellschaftliches Leben so organisiert, dass jeder Einzelne vollkommen austauschbar ist. Wir mögen in unserem Beruf noch so gut sein, von den Kollegen geschätzt und geachtet – an der Tatsache, dass wir ersetzbar sind, ändert dies nichts. In unserer professionellen Rolle werden wir dafür bezahlt, dass wir bestimmte Aufgaben und Funktionen übernehmen, und wenn wir sie nicht übernehmen, so übernimmt sie ein anderer. Keine Behörde und kaum ein Unternehmen geht daran zugrunde, dass einem ihrer Mitarbeiter ein Ziegelstein auf den Kopf fällt. Ganz im Gegenteil, die prinzipielle Austauschbarkeit der Mitglieder sichert das Überleben all der Organisationen, die heute unser Arbeitsleben bestimmen.
Für den einzelnen Rollenträger heißt dies, dass seine persönliche Wichtigkeit immer nur begrenzt ist. Darüber hinaus muss er sich bewusst sein, dass er nicht als »ganzer Mensch« gefragt ist, sondern nur ein sehr beschränkter Teil von ihm: die Fertigkeiten und Kompetenzen, die zur Erfüllung seiner Aufgabe nötig sind. Und auch als Kunde, Antragsteller oder jemand, der etwas von einer Organisation »will« oder ihr ausgeliefert ist, sind wir auf wenige Aspekte reduziert: unser Anliegen, unseren Bedarf usw. Als Individuen bestehen wir aber aus viel mehr, d. h., unsere Möglichkeiten, Fähigkeiten, Wünsche und Ziele gehen weit über das hinaus, was wir im beruflichen Rahmen realisieren können oder was an uns als Kunden interessant ist.
In der Familie ist das anders (wobei der Begriff Familie hier für eine langfristige Beziehung zwischen Eltern und Kindern stehen soll – ob mit oder ohne Trauschein –, aber nicht für Paare ohne Kinder). In der Beziehung zu seinen Kindern kann sich jeder als nicht austauschbar erfahren, als unverwechselbar. Denn Kinder haben eben im Allgemeinen nur ein Elternpaar, mit und bei dem sie aufwachsen. Mit der Geburt beginnt eine gemeinsame Geschichte, deren Resultat eine spezifische Form der Bindung ist. Ob nun diese Bindung dafür sorgt, dass man eine gemeinsame Geschichte durchläuft, oder ob die gemeinsame Bindung entsteht, weil man eine gemeinsame Geschichte durchläuft, ist eher von akademischem Interesse. Auf jeden Fall entsteht in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern – seien es biologische oder adoptierte – eine spezifische Verbindung, ein soziales System mit einzigartigen Qualitäten, eine Gegenwelt zum Rest der Gesellschaft. Nur hier wird der Einzelne als ganzer Mensch gesehen, nur hier ist alles, was für den einen wichtig ist, auch für die anderen wichtig. Wer sich Kinder anschafft, eröffnet sich ein Universum, in dem weder er noch seine Kinder auf die Erfüllung von Funktionen reduziert werden können. Als unverwechselbares Individuum kommt jeder Einzelne heute nur noch in der Familie vor.
Deshalb bedarf es keiner prophetischen Fähigkeiten, um zu prognostizieren, dass die Idee der Familie (wenn auch vielleicht nicht in ihrer kleinbürgerlichen Form) eine Renaissance erleben wird. Aber nicht, um die Rentenkasse aufzufüllen oder aufgrund der Sonntagsreden von Politikern, sondern aufgrund der Tatsache, dass in Zeiten, in denen das rein wirtschaftliche Überleben der meisten Menschen gesichert ist, Raum für die Frage entsteht: »Was wollen wir denn eigentlich mit unserem Leben anfangen?«, oder anders: »Wozu leben wir?«.
Hier liefern Kinder eine Antwort, und hier gewinnt die Adoption von Kindern ihren Sinn. Neugeborene und kleine Kinder sind nicht allein lebensfähig. Sie können schon rein physisch – über das Psychische ist noch zu sprechen – nur überleben, wenn Erwachsene für sie sorgen. Die Überlebenseinheit ist also in dieser Phase des menschlichen Lebens nie der kindliche Organismus allein, sondern immer eine soziale Einheit, die aus dem Kind und einer oder mehreren versorgenden Personen besteht. Wer sich »eigene« Kinder anschafft (biologische/adoptierte), kann diese überlebenssichernde Funktion nur übernehmen, wenn er sein Handeln an den (vermuteten/erspürten/verstandenen …) Bedürfnissen des Kindes orientiert, sich in sein Kind einzufühlen versteht und sich – mit anderen Worten – mit seinem Kind identifiziert. Sie oder er (das betrifft Mutter wie Vater) muss zumindest für einige Zeit seines Lebens ein Selbstbild entwickeln, das seine/ihre eigenen körperlichen Grenzen überschreitet und das eigene Fühlen, Denken und Handeln in den Dienst einer größeren Überlebenseinheit stellt – bestehend aus ihm/ihr selbst und dem Kind. Diese Aufhebung der Ich-Du-Unterscheidung in der frühen Phase der Eltern-Kind-Beziehung ermöglicht es jedem Elternteil, in seinem Handeln einen Sinn zu finden, der über die Anforderungen, Ziele und Beschränktheiten des Alltags und der eigenen Person hinausgeht.
Sich Kinder anzuschaffen erfordert und erlaubt – das ist durchaus ambivalent zu verstehen –, sich vom Realitätsprinzip des sozialen Umfelds zu distanzieren und eigene (d. h. andere) Prioritäten zu setzen, als es z. B. die Berufswelt erfordert. Das ist für Eltern (meistens die Mütter) oft ein Handicap im Blick auf die Karrierechancen. Es kann aber auch ein riesiger Vorteil im Blick auf die Frage sein, was im Leben wirklich wichtig ist. Wer Kinder großzieht, investiert sich und seine Ressourcen zwangsläufig anders als Menschen, die sich etwa den Zielen von Organisationen verpflichtet fühlen. Sich um Kinder zu kümmern bedarf keiner abstrakten Begründungen, die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns ist alltäglich konkret erlebbar.
Doch die Identifikation mit den Kindern ist riskant. Wer seinen Lebenssinn aus der Elternrolle zieht, macht sich abhängig von seinen Kindern. Wer z. B. auf berufliche Selbstbestätigung verzichtet, um sich ganz den Kindern zu widmen, gibt seinen Kindern eine Wichtigkeit, die sie möglicherweise überfordert. Wer eine »gute Mutter« oder ein »guter Vater« sein will und den eigenen Selbstwert daran misst, wie »gelungen« oder »missraten« seine Kinder sind, bringt sie in eine unangemessene Machtposition. Denn nun können die Kinder durch ihr »gutes« oder »schlechtes« Verhalten über die Identität ihrer Eltern, über ihr Scheitern oder ihren Erfolg – also über ihr Selbstwertgefühl – entscheiden.
Das gilt in besonderem Maße für Adoptiveltern, die sich nicht darauf berufen können, sie hätten die Kinder schicksalhaft bekommen. Sie haben sich für ihre Kinder, diese Kinder, entschieden. Sie sind sehenden Auges eine Bindung eingegangen, deren Konsequenzen nicht vorhersehbar waren. Das gilt zwar auch für biologische Kinder, aber bei denen ist die Situation etwas anders, weil hier diffuse Vererbungshoffnungen zur beruhigenden Erwartung der Ähnlichkeit mit den Eltern führen.
In jedem Fall kann gesagt werden, dass eine (im Allgemeinen wenig thematisierte, aber doch nicht zu unterschätzende) Wirkung von Kindern die ist, dass sie für Überraschungen im Leben ihrer Eltern sorgen. Auf diese Weise verhindern sie, dass ihre Eltern einrosten, erstarren, engstirnig und kleinkariert werden. Kinder sind nicht wirklich steuerbar, sie verhalten sich unkalkulierbar, zeigen Vorlieben und Talente, mit denen niemand gerechnet hat usw. Das hat auf Erwachsene meist die Wirkung, dass sie darüber klagen, früher sei alles besser gewesen. Doch Eltern haben nicht die Chance, sich auf diese Weise zu distanzieren und sich vor der Entwicklung der Welt um sie herum zu verschließen. Ihre Kinder haben eine irritierende Wirkung, auf die sie reagieren müssen. Und wenn alles gut geht, so ist diese Irritation der Auslöser für die eigene Weiterentwicklung, die Veränderung ihrer Interessen, ihrer Weltanschauung, die Erhaltung ihrer Flexibilität, ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung usw. Auch dies ist ein Effekt der Bindung zwischen Eltern und Kindern.
Eltern und Kinder begeben sich auf eine Art gemeinsamer Wanderung, vergleichbar mit einer Bergtour. Auch dort ist man in der Regel nicht als isolierter Einzelgänger unterwegs, sondern sichert sich in unwegsamem Gelände und auf gefährlichem Grund dadurch, dass man sich aneinander bindet (Sicherungsseile). In manchen Fällen werden diese Bindungen nur wenig beansprucht, weil die Wanderung nur durch ein liebliches Hügelland führt. Die Befriedigung, ja, das Vergnügen ist dann größer als die Mühe. In anderen Fällen ist das aber ganz anders. Die gemeinsame Geschichte entwickelt sich zur riskanten Hochgebirgstour, die durch ungeahnte Höhen und Tiefen führt und in der das Überleben der Beteiligten davon abhängt, dass die gegenseitige Sicherung aufrechterhalten wird. Im Falle der Adoption von Kindern finden sich die Eltern manchmal (und wie die Statistiken zeigen: öfter als in anderen Familien) mit ihren Kindern in einer Steilwand wieder. Hier besteht die Gefahr, dass alle gemeinsam abstürzen.
Wenn diese schwierigen und steilen Phasen gemeinsam durchgestanden werden, so eröffnet sich danach aber oft auch eine ganz besondere und wunderbare Aussicht – sowohl im Blick zurück als auch voraus – auf des





























