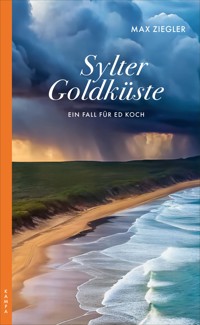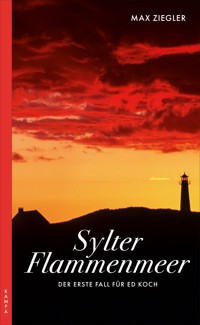
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Ed Koch
- Sprache: Deutsch
Kurz nach Neujahr, wenn auch die letzten Touristen abgereist sind, ist es auf Sylt am friedlichsten. Kommissar Eduard »Ed« Koch liebt diese Tage, an denen nur der Wind und das Rauschen der Wellen die Ruhe stören. Erst zum traditionellen Biikebrennen im Februar werden sich die Hotels wieder füllen. In diesem Jahr aber riecht die kühle Winterluft schon Wochen vorher nach Feuer: Im Nobelort Kampen brennt ein Reetdachhaus lichterloh. Verletzt wird zum Glück niemand, das Haus befindet sich noch im Bau. Wenig später brennt ein zweites Haus. Benzinkanister zeugen von Brandstiftung. Ed und seine Kollegen stehen vor einem Rätsel: Will hier ein Immobilienhai seinem Konkurrenten das Handwerk legen? Handelt es sich um Protest gegen die Sylter Baupolitik? Ed erfährt die Wohnungsnot auf der Insel am eigenen Leib, lebt immer noch mit seiner Ex-Frau und den beiden Kindern in einem Haus. Und inzwischen auch mit ihrem neuen Freund. Aber ist Ed überhaupt bereit für ein neues Leben? Mit seiner Vorgesetzten Elsa vielleicht, in die er heimlich verliebt ist? Als bei einem dritten Brand ein Mann stirbt, ändert das alles - auch für Ed persönlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Ziegler
Sylter Flammenmeer
Der erste Fall für Ed Koch
Kampa
Lernen heißt begreifen. Begreifen bedeutet Konsequenzen ziehen.
Wir haben gelernt. Wir ziehen die Konsequenzen.
Wer den Löwen nicht erlegt, den wird der Löwe fressen.
Nur wer lernt, lebt.
Lernen bedeutet mehr, als den Dingen einen Namen zu geben.
Lernen heißt, seinen Platz in der Welt anzunehmen und die Welt damit zu verändern.
Lernen heißt, eine bessere Welt zu schaffen, indem wir die Konsequenzen aus dem ziehen, was wir gelernt haben.
Wer lernt, verhilft der Wahrheit zum Licht.
Der Wahrheit, die für alle sichtbar ist und die doch keiner sieht.
Lernen heißt, die verkaufte Wahrheit, die entrechtete Wahrheit, die heimatlose Wahrheit wieder in ihr Recht zu setzen.
Das Leben der Vornehmen am Strand und in den Bars gleicht einem langen Sonntag. Sie wohnen in schönen Häusern unter reetgedecktem Dach, die sich niemand leisten kann, der auf der Insel aufgewachsen ist.
Die Vornehmen tragen teure Kleider.
Sie haben feiste Gesichter.
Sie sprechen ihre eigene Sprache.
Sie sprechen die Sprache der Macht in der Grammatik der Herrschaft.
Sie fressen Fischbrötchen und betrinken sich, um am Nachmittag ein Grundstück nach dem anderen auf der Insel zu kaufen. Darauf bauen sie ein Friesenhaus und noch eines und noch eines. Sie bauen so viele, dass sie selbst nie darin wohnen können, zu Preisen, die kein Handwerker bezahlen kann, der die Häuser baut.
Wir haben gelernt: Wenn niemand mehr auf der Insel leben kann, weil sie Stück um Stück verkauft wurde, dann müssen wir uns unsere Insel zurückholen, weil wir keine neue Insel schaffen können.
Es ist an der Zeit, der Freiheit ein neues Haus zu bauen.
Es ist an der Zeit, die alte Ordnung abzufackeln.
Es ist an der Zeit, auf den Ruinen der Ferienhäuser Wohnungen für Friesen zu bauen.
Lasst sie brennen zu Biike.
Lasst es Freudenfeuer sein.
Lasst es Freiheitsfeuer sein.
Lewer duad üs Slaav.
Friede den Hütten!
Krieg den Palästen!
1
Es ist die stillste Zeit im Jahr. Sie beginnt nach Neujahr mit einem Megastau an der Westerländer Autoverladung, der fast bis nach Rantum reicht. Aber spätestens an Heilige Drei Könige sind die letzten Touristenschlangen vor den Bäckereien verschwunden. Dann umweht die Insel eine überraschende Friedlichkeit. Die Einheimischen, die sich Leben und Wohnung auf der Insel noch leisten können, brechen auf, um selbst ein paar Tage Urlaub zu machen. Die Läden in der Strand- und in der Friedrichstraße in Westerland verkürzen ihre Öffnungszeiten oder bleiben gleich ganz geschlossen. Erst kurz vor dem 21. Februar, wenn die aus vertrockneten Weihnachtsbäumen aufgeschichteten Biikefeuer auflodern, glüht der Umsatz wieder hoch.
Das Einzige, was die nachweihnachtliche Stille in dieser Zeit noch stören kann, sind die Winterstürme. Meterhoch türmt sich die Gischt auf und wird vom Wind über den Sand gepeitscht. Sturm drückt das Wasser hoch und höher und knabbert hungrig am Strand. Jahr für Jahr wird deshalb an wechselnden Stellen auf der Insel neuer Sand aufgespült. Eine Sisyphusarbeit. Durch riesige rostige Röhren, die wie eine Land-Art-Installation in der Landschaft liegen, wird der neue Strand aus den Tiefen des Meeres geholt. Doch dieser kieselige Vorspülsand ist lediglich eine flüchtige Gabe an Wettergott und Klimawandel, denn er wird in den kommenden Jahren von der See gierig Stück für Stück wieder verschlungen.
In diesem Jahr ließen die Winterstürme auf sich warten.
Stattdessen schob der Golfstrom treulich sein wärmeres Wasser aus den tropischen Regionen des Atlantiks in Richtung Nordsee. So blieben die Temperaturen auch Anfang Januar noch recht mild und lagen deutlich über dem Gefrierpunkt. Mittags stand die Sonne zwar noch immer tief über dem Horizont. Aber an einem geschützten Platz täuschte sie bereits etwas Frühling an, während der kühle Wind den Himmel blitzeblau polierte.
Ed liebte diese Tage.
Sie kamen ihm vor wie ein Geschenk, nach den dunklen Novemberwochen, in denen der Herbst seine stürmische Kraft gezeigt hatte und ein gutes Stück von Hörnum fortgespült worden war. Ed liebte diese Tage aber auch, weil die meisten Feriengäste abgereist waren. Manche von ihnen kannten nach ein, zwei Flaschen Schampus weder Hemmung noch Anstand. Trunken setzten sie sich in ihre übermotorisierten Luxuskarossen. Manchmal dachte Ed, dass sie geradezu nach Bestrafung lechzten. Zwei Parkplätze hinter dem trendigen Strandlokal im Süden der Insel sammelten seine Kollegen die Schlangenlinien fahrenden Wintergäste auf ihrem Heimweg nach Kampen und Keitum regelmäßig in einer Mausefalle ein. Die Taxis standen dann schon bereit, um die zumindest für diese Nacht vom Führerschein befreiten Touristen in ihre Ferienhäuser und Hotels zu chauffieren. Doch anstatt den Kollegen dankbar dafür zu sein, dass sie aus dem Verkehr gezogen wurden und daher niemandem schweren Schaden zufügen konnten, verfluchten sie die Polizisten und beschimpften sie unflätig. Unterstützt wurden sie von ihren aufgetakelten Begleiterinnen, von denen sich manche nach den ersten empörten Schritten in der kalten Winterluft über den kahlen Heckenrosen erleichterten.
Weihnachten und Silvester auf Sylt waren kein Vergnügen.
In gemütlichem Laufschritt stapften Ed und Rob schweigend durch den Sand an der Nordspitze der Insel. An diesem Januarsamstag begegneten ihnen nur wenige andere Spaziergänger. Sie hatten den Strand fast für sich allein, frischen Salzwind und Sonnenschein inklusive.
Auch diese langen Runden liebte Ed.
Gleich hinter dem Flutsaum lagen vereinzelt kleine Holzstücke. Glatt gespült vom Meer schimmerten sie silbrig grau. Die Freunde sammelten einige der bizarr geformten Hölzer mit ihrer feinen geschliffenen Maserung auf und wischten mit den Fingern behutsam den Sand ab.
»Und Nathalie?«, fragte Ed.
Rob wartete einen Moment mit seiner Antwort, als müsste er sich besinnen, wer diese Nathalie, von der Ed sprach, überhaupt war. Mit dem rechten Fuß kickte er eine große Herzmuschel über den Sand und zuckte mit den Schultern.
»Was soll sein? Nichts. Kein Wort, kein Brief, keine Mail. Schweigen.«
»Weißt du überhaupt, wo sie jetzt ist?«
»Ich vermute, sie ist noch immer in Vancouver. Aber eigentlich weiß ich es nicht genau.«
Und damit war das Thema Robs Ex-Frau für dieses Mal beendet. Wobei die Bezeichnung Ex-Frau es nicht wirklich traf. Schließlich waren Rob und Nathalie noch immer verheiratet, auch wenn sie sich seit drei Jahren nicht gesehen und kaum gesprochen hatten. Ohne ein Wort, ohne Brief und in Robs Augen auch ohne jeden Grund hatte Nathalie damals zwei Tage nach Weihnachten einen Koffer gepackt und sich auf den Weg gemacht, während Rob einen Spaziergang machte. Als Rob wieder nach Hause kam, war sie einfach fort. Erst vermutete er, sie würde sich mit einer Freundin auf einen Tee treffen, auch wenn sie ihm davon nichts erzählt hatte. Nach ein paar Stunden hatte er dann begonnen, überall anzurufen und rumzufragen, wo sie sein könnte. Nichts. Niemand wusste etwas. Auf dem Polizeirevier vertröstete man ihn. Wenn ein Erwachsener verschwinden wolle, verschwinde er eben, und noch seien keine vierundzwanzig Stunden seit ihrem Verschwinden vergangen. Ein Verbrechen scheine ja nicht vorzuliegen. Es half alles nichts. Rob musste warten, ob und wann sich Nathalie bei ihm meldete. Doch Nathalie schwieg beharrlich weiter, ebenso ihr Handy, bis aus heiterem Himmel einige Wochen später eine Postkarte mit der Ansicht des Florentiner Doms bei ihm eintraf, auf der sie ihn bat, ihr Zeit zu geben.
Bis heute rätselte Rob, was vorgefallen war, was Nathalie zur Flucht veranlasst hatte, denn es war nichts anderes als eine Flucht aus dem gemeinsamen Haus gewesen, das sie zusammen geplant und gebaut hatten. An ihrem letzten gemeinsamen Weihnachten hatte er ihr einen seidenen Umhang geschenkt, mit einem wunderbaren zarten Muster in lichten Farben, den er auf ihrer gemeinsamen Reise nach Marokko im Herbst entdeckt hatte. Irgendwie stimmte es ihn zuversichtlich, dass sie diesen Umhang mitgenommen hatte.
Gelegentlich schickte Nathalie ihm eine Nachricht. Bin hier. Bin dort. Es geht mir gut. Ich brauche bitte Geld (das er ihr dann treulich aufs Konto überwies). Das war’s. Von Italien aus machte sie sich auf den Weg nach Amerika, New York, San Francisco, Seattle und von dort weiter nach Kanada, wo sie vermutlich noch immer irgendwo zwischen Elchen, Grizzlys und Seeadlern lebte. Die Erinnerung an Nathalie wurde zu einem Schatten, der in Robs Alltag zwar immer mehr verblasste, aber doch nicht ganz verschwinden wollte und eine Wunde hinterließ.
Schweigend liefen Ed und Rob weiter.
Männergespräche brauchen nur wenig Worte. Darin waren sie sich beide einig, so wie sie in den meisten Dingen übereinstimmten. Dieses schweigende Einverständnis bildete die Grundlage ihrer Freundschaft, obwohl sie sich nur unregelmäßig trafen, zu einem Spaziergang am Meer oder einem Bier am Abend.
Daher dauerte es bis zum zweiten Leuchtturm am Königshafen, ehe jeder aus dem Zirkel der eigenen Gedanken wiederauftauchte und Rob den losen Gesprächsfaden aufnahm.
»Und Mara?«
»Schwierig, irgendwie, immer noch«, antwortete Ed und senkte den Kopf.
Der Seenotretter, der im Lister Hafen stationiert war, machte eine Tour durch die Meerenge, die Sylt vom dänischen Rømø trennte. Für einen Augenblick blieben die Männer stehen und sahen dem Schiff zu, das sich durch die gefährlich kabbelige Strömung zwischen den Inseln kämpfte.
»Schließlich macht sie inzwischen mit Fiete rum, diesem Flachbohrer.«
Rob grinste.
»Na, ist doch wahr.«
Ed seufzte.
Es gab kaum noch einen Tag, an dem er einen vernünftigen Satz mit seiner Ex wechseln konnte und sie nicht anfing, sich über ihn oder seine Arbeit zu mokieren. Er wusste, dass das aufhören musste. Aber vor den Konsequenzen schreckte er zurück. Noch.
»Sie ist mit ihrem Fiete derzeit völlig ausgelastet«, stöhnte er. »Aber wegen Lasse und Lotte mache ich mir Gedanken. Die Kinder müssen sich ja wie zwischen zwei Mühlsteinen vorkommen.«
»Oder sogar zwischen drei, wenn du Fiete mitzählst«, fügte Ed nach einer kurzen Pause hinzu, während er dem Auf und Ab des Seenotretters in der Dünung weiter folgte.
Rob beugte sich über eine tote Möwe, die am Strand lag.
Keine Zeichen von Öl. Immerhin. Wodurch auch immer das Tier verendet war, wenigstens nicht durch illegal in der Nordsee verklapptes Öl.
»Es ist für die Kids wirklich nicht leicht. Zudem ist Sylt ohnehin nicht der spannendste Ort für Pubertisten. Und dann ziehen in schöner Regelmäßigkeit ihre besten Freunde weg auf das Festland, weil sich die Eltern das Leben hier nicht mehr leisten können oder ihnen die Wohnung unterm Hintern wegverkauft wird. Und niemand unternimmt etwas dagegen.«
»Was willst du auch machen?«
Ed zuckte mit den Schultern.
Er selbst hatte keine Idee, und auch die Sylter Gemeinden offenbar nicht. Es war ein vergebliches Ringen. Die Insel verdiente blendend an den Feriengästen, und die Immobilienpreise kannten seit Jahrzehnten nur eine Richtung: steil aufwärts. Wirkungsvolle Instrumente, um dauerhaft genügend bezahlbare Wohnungen für die Einheimischen zu erhalten, hatte bisher niemand gefunden. Wer auf der Insel nicht seit Generationen oder durch einen Zufall über ein Stück des sündhaft teuren Grunds und Bodens verfügte, der hatte schlechte Karten. Aber selbst das musste ja noch nicht ausreichen. Ed kannte genügend Fälle, in denen die Eltern, die Oma oder ein Onkel verstorben waren und eine Erbengemeinschaft entstand. Und anstatt sich über die wertvolle Erbschaft zu freuen, begann man sich zu zerstreiten. Der eine wollte das Grundstück behalten, der andere ausgezahlt werden, doch dafür reichte das Barvermögen der Übrigen nicht aus. Schon hatte man den Kladderadatsch. Und so wurde das Haus nach Jahren des Streits und des Leerstands am Ende doch verkauft und schließlich abgerissen. Dafür entstanden neue Ferienapartments im Pseudofriesenstil unter Reet, als wären die Gäste im Innersten ihres Herzens alles kleine Keitumer Kapitäne.
Obwohl es erst kurz nach Mittag war, begannen sich die blauen Schatten immer länger auszudehnen. Die Sonne stand bereits tief am Himmel und tauchte alles in ein unwirkliches Licht. Von ihren grellen Strahlen geblendet, blieben Ed und Rob erneut stehen und sogen den Moment ein. Ed spürte eine kostbare Ruhe durch den Körper strömen.
Was für ein Glück trotz allem, hier auf der Insel leben zu dürfen, dachte er.
Das Meer, der Strand, die Dünen. Einfach perfekt.
An der Wattseite entlang kehrten sie langsam zum Auto zurück, den Blick über die weite Bucht des zu drei Seiten durch Dünen eingefassten und so ganz natürlich geschützten Königshafens. Im nassen, schweren Wattsand quietschte jeder Schritt. Ed hätte die Zeit gern weiter ausgedehnt, wäre am liebsten weiter und immer weiter gelaufen. An diesen Januartagen besaß die Welt eine Schönheit und Friedlichkeit, dass man sie am liebsten in ein Marmeladenglas füllen wollte, um sie später in kleinen Portionen frühstücken zu können. Ed wollte sich an diese Momente klammern, sie nicht mehr freigeben und wusste doch, wie vergeblich dieser Wunsch war, wie widersinnig, ja wie kindisch. Alles war in Bewegung. Immer. Veränderung war der Normalzustand. Das vergaß man nur allzu leicht. Und er selbst bildete da keine Ausnahme, gestand sich Ed ein.
Die Gesichter von Wind und Anstrengung leicht gerötet, trabten die Freunde die letzten Meter durch den sanft wogenden Strandhafer auf den Dünen bis zum ersten der beiden Lister Leuchttürme. Dort hatte Rob sein Auto geparkt. Eine Herde Schafe umlagerte den Wagen. Die Tiere trollten sich nur langsam, als sie näher kamen. Doch zwei Schafe blieben einfach stehen. Ed strich ihnen durch das Fell, das sich fest und fettig anfühlte.
»Magst du nachher noch mit zu uns kommen?«, fragte er. »Hab von Rose einen Fisch mitgebracht, den wollte ich braten.«
Doch Rob schüttelte den Kopf.
»Lass mal gut sein. Ich muss bis morgen noch einen Auftrag fertigbekommen.«
Ed nickte. Er schob das Tier zur Seite. Rob hatte recht. Es war an der Zeit.
2
Das Haus war voll, alle waren daheim. In Lasses und Lottes Zimmern brannte Licht, Fiete quatschte mit Mara unten in der Küche. Leise schloss Ed die Haustür hinter sich und schlich die Treppe ins Dachgeschoss hoch, um mit niemandem reden zu müssen. In seiner Küche oben holte er den Wolfsbarsch aus dem Kühlschrank und legte ihn auf den Rost im Ofen. Salz und Pfeffer, dazu ein paar frische Kräuter und einen Spritzer Zitrone, frisches Brot und Aioli. Er entkorkte den Grauburgunder, der ebenfalls im Kühlschrank auf ihn gewartet hatte, und füllte Leitungswasser in eine Glaskaraffe, in die er einige Minzblätter gefüllt hatte. Alles nicht sehr friesisch. Aber alles möglichst frisch. Das war Ed wichtig.
Kaum hatte er sich an den alten Esstisch aus Holz in der Küche gesetzt und angefangen, am Laptop seine Mails durchzugehen, als die Küchentür aufging.
»Hi, Paps.«
»Hi, was gibt’s?«
»Wollte ich auch gerade fragen«, sagte Lasse und nickte zum Ofen.
»Wolfsbarsch.«
»Fein. Salat?«
»Wenn du einen machst, gerne.«
»Yo. Soll ich Lotte unten Bescheid sagen?«
»Gibt’s bei deiner Mutter nichts zu essen?«
Lasse verdrehte die Augen.
»Schmusegurken an Turtelragout.«
»Hey, du sprichst von deiner Mutter«, wies ihn Ed zurecht und bemühte sich, sein Schmunzeln glaubhaft zu unterdrücken.
»Sag Lotte, dass wir in einer Viertelstunde essen können.«
»Yep. Ich hole sie, dann machen wir den Salat.«
Polternd stürzte Lasse die Treppe hinunter und kam kurz darauf mit seiner ein Jahr jüngeren Schwester zurück.
»Wolfsbarsch?«, fragte sie rhetorisch.
Ed lächelte.
Die Kinder hatten zwar mit einem Leben als Vegetarier geliebäugelt, aber ihre Leidenschaft für Fisch hatte die Oberhand behalten. Glücklicherweise endete ihre pubertäre Weltverbesserung vor dem Genussverzicht.
»Na los, macht mal den Salat.«
Gemeinsam schnippelten sie Gurke und Tomaten in kleine Stücke, zupften den grünen Salat und ergänzten das Gemüse mit Mangostückchen und Avocado. Für das Dressing nahm Lasse das fruchtige Olivenöl, das Ed neulich aus Ottensen mitgebracht hatte, und mischte etwas Zitrone, Bockshornklee und Kresse darunter, während Lotte auf dem Herd ein paar Körner anröstete.
Als sie zu dritt am Tisch saßen, ging die Küchentür erneut auf, und Mara schaute herein.
»Schon wieder Fisch?«
»Aber ja. Wolfsbarsch. Magst du auch?«, lud Lasse seine Mutter ein, wohl wissend, dass sie nichts annehmen würde.
»Nein danke«, antwortete sie prompt. »Aber denkt bitte daran, ordentlich zu lüften, sonst stinkt das Haus wieder den ganzen Abend nach eurem Fisch.«
Ed fühlte sich wie ertappt und spürte zugleich den Zorn in sich aufsteigen.
»Aber ja«, antwortete er und zwang sich zu einem Lächeln.
»Man kann ja auch mal nur Brot essen, oder?«, fragte Mara und zog die Tür wieder zu.
»Kann man. Schmeckt aber nicht«, rief Lotte ihrer Mutter hinterher.
Für einen Moment saßen die drei schweigend um den Tisch und kauten still, bis Lotte mit einem »Schmeckt gut« das Eis wieder brach.
»Gibt es eigentlich einen moralischen Mord?«, schob sie hinterher, als wäre es selbstverständlich, beim Abendbrot eine solche Frage zu stellen.
Ed verschluckte sich und bekam einen heftigen Hustenanfall.
Was war denn das jetzt? Wollte Lotte ihre Mutter meucheln? Was war in das Kind gefahren? Ein derartiges Potenzial von muttermordender orestischer Dramatik hatte er nie bei ihr vermutet. Natürlich waren ihre aktuellen Wohnverhältnisse gewöhnungsbedürftig, und sie hockten einander viel zu dicht auf der Pelle, zumal im Winter, wenn alle weniger draußen an der frischen Luft waren als im Sommer. Aber ansonsten kamen zumindest er und die Kinder einigermaßen gut miteinander aus in dem alten Satteldachhaus. Fand er zumindest. Lotte unten im Erdgeschoss bei Fiete und Mara. Er mit Lasse in der Einliegerwohnung im Obergeschoss, die sie früher an Sommergäste vermietet hatten, als Mara und Ed noch Tisch und Bett geteilt hatten.
»Wie meinst du das?«
Sein Husten hatte wieder nachgelassen. Lasse hatte ihm kräftig auf den Rücken geschlagen, während Ed die Arme wie ein kleines Kind zur Decke emporstreckte und Lotte ihm ein Glas Wasser reichte. Er nahm einen kräftigen Schluck.
»Na, ich meine, wenn der Untertan den Fürsten umbringt. Oder beim Tyrannenmord in der Antike beispielsweise.«
»Ach so.« Ed war beruhigt.
»Brutus und Cäsar. Cicero und Marc Anton.«
»Mord ist niemals moralisch«, verkündete Ed kategorisch.
»Graf Stauffenberg, Georg Elser – es war also unmoralisch von ihnen, zu versuchen, Hitler zu töten?«, fragte Lasse provokant.
»Ein Mord ist niemals moralisch zu rechtfertigen, aber manchmal ist er dennoch notwendig«, schob Ed nach, den eigenen moralischen Rigorismus aufweichend.
Lasse grinste.
»Aber das sind politische Ausnahmesituationen«, versuchte Ed zu erläutern.
»Es gibt genügend Diktatoren in der Welt«, erwiderte Lotte.
»Ja, die gibt es. Aber das Ziel politischen Handelns muss es sein, sich mit friedlichen Mittel wieder von ihnen zu befreien.«
»Aber was ist mit einem as-Sisi in Ägypten oder sogar mit Assad in Syrien, der verbotene chemische Kampstoffe gegen die eigene Bevölkerung anwendete?«, beharrte Lotte.
»Hast du für die Mathearbeit gelernt?«, fragte Ed.
»Du weichst deiner Tochter aus«, sprang Lasse seiner Schwester in belehrendem Tonfall bei.
»Ja, tue ich«, ergab sich Ed. »Weil ich versuche, meiner Hilflosigkeit auszuweichen. Natürlich ist es unverzeihlich, Kampfgas zu verwenden, im Irak, in Syrien, wo auch immer. Natürlich wäre es gut, wenn alle Diktatoren dieser Welt verschwinden würden. Und natürlich wäre es gut gewesen, wenn Graf Stauffenberg 1944 Erfolg gehabt hätte und Hitler in der Wolfsschanze beim Attentat gestorben wäre. Und noch besser wäre es gewesen, wenn Georg Elser bereits mit seinem Attentat im Münchner Bürgerbräukeller Erfolg gehabt hätte. Millionen Menschen wären dann nicht sinnlos gestorben und ermordet worden.« Ed gönnte sich eine kleine dramaturgische Pause und tunkte sein Brot in das Dressing des Salats. »Andererseits bleibt Mord immer Mord. Selbst der Tyrannenmord, so legitim er auf den ersten Blick erscheinen mag, bleibt letztlich immer ein Mord. Es ist ein Dilemma, sich zwischen dem Tod des einen und dem drohenden Tod der vielen zu entscheiden …«
»Klingt zynisch«, warf Lotte ein, deren Gerechtigkeitsempfinden durch die Argumente ihres Vaters empfindlich gestört wurde. »Es gibt Situationen, in denen ist man einfach zum Handeln gezwungen.«
»Sei froh, dass wir von solchen Entscheidungen hier und heute meilenweit entfernt sind. Glücklicherweise«, versuchte Ed die Debatte in die Gegenwart zurückzuholen. Zugleich begeisterte ihn das Engagement seiner Kinder.
»Ja, glücklicherweise«, stimmte Lasse zu. »Aber wodurch haben wir dieses Glück verdient?«
Die drei sahen sich für einen Moment an und spürten, dass sie mit ihrem Gespräch nicht weiterkommen würden. Es gab Momente, in denen der unmoralische Mord moralisch geboten war. Aber wann war das der Fall? Wann war eine Grenze überschritten? Und wer wollte und durfte das entscheiden?
Ed musste daran denken, dass er erst vor wenigen Stunden selbst darüber nachgedacht hatte, wie unverdient das Glück war, auf dieser Insel leben zu dürfen. Keine Frage. Das Leben war ungerecht. Und sie standen auf der Sonnenseite. Völlig unverdient. Und allzu oft undankbar.
»Ich muss noch mal los«, nuschelte Lasse.
»Zu Clara?«, neckte ihn seine Schwester.
»Hm«, bestätigte er.
»Na, dann viel Spaß.« Lotte grinste unverschämt.
»Werden wir haben.« Lasse grinste zurück.
»Na los, dann haut beide ab. Ich mache heute den Abwasch allein und lüfte die Bude, damit Mum sich nicht wieder beschwert.«
»Guter Dad«, bescheinigte ihm Lotte.
Auch wenn er gut mit den Kindern auskam, war Ed klar, dass seine Situation auf Dauer nicht haltbar war. Fiete und Mara lebten unten im Haus, dazu die beiden Kinder auf die beiden Geschosse verteilt und er als Ex-Mann in der Einliegerwohnung. Die Konstellation besaß etwas Absurdes. Er würde sich früher oder später dazu aufraffen müssen, nach einer eigenen Wohnung auf der Insel zu suchen. Den Kontakt zur Bauamtsleiterin hatte er zwar schon geknüpft, aber dann hatte er nicht mehr bei ihr nachgefragt. Ohne Drängeln klappte dort nichts. Andererseits hing er an dem Haus aus den fünfziger Jahren, so klein und zugig und voll es auch sein mochte. Auszuziehen würde bedeuten, sich etwas einzugestehen, was zwar eigentlich längst Wirklichkeit war, aber sich doch wie ein Scheitern anfühlte. Endgültig. Es würde ihn furchtbar schmerzen. Der Verlust einer Sicherheit, einer Vertrautheit. Der Verlust seiner Liebe. War er am Ende nur zu feige, etwas Neues zu beginnen? Oder war er einfach bloß faul?
Aufs Festland zu ziehen kam für ihn nicht infrage. Er musste vor Ort sein, schnell verfügbar. Und Fiete und Mara würden nicht ausziehen. Das Haus gehörte Ed und Mara zu gleichen Teilen, seit Eds Tante gestorben war. Vielleicht hätte er damals im jugendlichen Liebesrausch nicht so großzügig seine Frau mit ins Grundbuch eintragen lassen sollen.
Egal, dachte er, das ist so und nicht mehr zu ändern.
Er goss sich ein zweites Glas Grauburgunder ein.
Mara hatte ihren Fiete. Und er? Er hatte ein Auge auf Elsa geworfen. Aber die Dinge waren, nun ja, sie waren kompliziert. Man würde sehen, was sich ergab. Er war sich unsicher, was das Verhältnis zu seiner Chefin betraf. Wie sich die Dinge entwickeln würden, ob daraus mehr entstehen konnte, eine Beziehung vielleicht sogar. Er merkte, wie schwer es ihm fiel, das Wort zu denken, geschweige denn es auszusprechen. Andererseits spürte er die Wärme, die der Gedanke an Elsa bei ihm verursachte, und lächelte in sich hinein.
Seiner Ex-Frau und Fiete gab er jedenfalls keine Chance auf eine dauerhafte Beziehung, auch wenn sie in den letzten Wochen demonstrativ turtelten, so wie Lasse und Clara. Nur dass die beiden Jugendlichen gerade einmal siebzehn waren und seine Ex-Frau Ende vierzig. Und Fiete? Was immer sie an diesem fischigen Typ fand, mit seinem halblangen rötlich blonden Haar, das er mit Mittelscheitel trug, und der unangenehmen Stimme. Dazu diese bevormundende Art. Lotte hatte erzählt, wie grässlich sie Fiete im Unterricht fand. Zum Glück hatte sie ihn nur als Vertretung gehabt. Fiete unterrichtete Mathe und EDV, dazu leitete er die Wirtschafts-AG.
Es schüttelte Ed innerlich bei dem Gedanken, wie Fiete Mara berührte.
Eifersüchtig?, dachte er bei sich und horchte nach.
Ja, etwas Eifersucht war wohl dabei, gestand er sich ein. Aber auch sonst war ihm der Typ, mit dem er seit letztem Sommer in einer Art Zwangshausgemeinschaft leben musste, herzlich unsympathisch. Musste er wirklich?
Ed seufzte und schäumte den Schwamm mit viel Spülmittel ein, um endlich die fettigen Teller und das Besteck abzuwaschen. Das nasse Geschirr platzierte er auf dem Beckenrand der alten Spüle, damit es ordentlich abtropfen konnte. Abtrocknen und wegräumen würde Lasse die Sachen nachher. Er öffnete das Fenster und spürte, wie der Wind gegen Abend aufgefrischt hatte. Im Sommer konnte er von hier aus sogar das Meer sehen, was Mara veranlasste, ihm vorzuwerfen, dass er sich mal wieder den besten Platz gesichert habe. Die Etagen tauschen wollte sie aber auch nicht. Ed lächelte und schrubbte. Schon absurd. Schließlich hatte er das Haus damals von seiner Tante geerbt.
Von fern mischten sich in das Brausen des Windes der Klang von Sirenen und ein rauchiger Geruch wie von den Kartoffelfeuern im Herbst. Noch bevor sein Diensthandy klingelte, ahnte Ed, dass es ein langer Abend werden würde.
3
Lange nach Mitternacht schlich Ed auf Socken die Treppe zu seinem Zimmer hinauf. Die Schuhe hatte er noch vor der Haustüre ausgezogen, um niemanden mit seinen Schritten aufzuwecken. In der Küche drehte sich die Trommel der Waschmaschine mit gleichmäßigem Klacken. Für einen Moment setzte sich Ed in die Dunkelheit. Seine nach Qualm stinkenden Klamotten konnte er auch nachher ausziehen und waschen. Auf dem Küchentisch stand noch das Glas Weißwein vom Abend. Ed nahm einen kleinen Schluck und ließ ihn sich langsam über die Zunge gleiten, während er der Waschmaschine lauschte, die die Stille im Haus durchdrang.
Alles schläft, einsam wacht, dachte er und grinste schief.
Er war grässlich müde. Aber zugleich spürte er eine innere Anspannung. Sie würde sich erst langsam lösen. Es würde heute lange dauern, bis er einschlafen konnte. Er kannte das. Es half nichts. Was er jetzt brauchte, war eine halbe Stunde Zeit, manchmal auch etwas länger, um zur Ruhe zu kommen.
Er genehmigte sich einen weiteren Schluck, diesmal etwas größer, und konzentrierte sich auf den Geschmack, auf das leichte Brennen am Gaumen, auf die holzigen Noten, die leichte Frucht.
Zufrieden stellte er das Glas wieder auf den Tisch. Strich mit der Hand über die Tischdecke, deren rot-weißes Karomuster im Dämmerlicht schwarz-weiß erschien.
Die Dinge verwandelten sich je nach Beleuchtung. Die eigentliche Aufgabe war es, den Scheinwerfer jeweils so auszurichten, dass die richtigen Details beleuchtet wurden. Das war die Kunst. Jedes Mal. Erst dann konnte man etwas erkennen. Erst dann wurden die Dinge klarer. Erst dann konnte man Himmel und Hölle unterscheiden.
Die Brandwache war am Haus in Kampen zurückgeblieben, das fast bis auf die Grundmauern niedergebrannt war. Verletzte gab es keine. Gottlob. Weder im Haus selbst noch unter den Feuerwehrleuten. Die Kriminaltechniker mussten die Brandursache weiter untersuchen. Ein Kabelbrand erschien denkbar. Aber letztlich war es ebenso unwahrscheinlich, wie dass sich beim Decken des Reetdaches etwas entzündet hatte. Für die freiwilligen Sylter Feuerwehren war es ein Großeinsatz, gut sechzig Leute kämpften gegen das Feuer an, das sich in Windeseile durch die Lagen des Reetdaches fraß, die Holzbalken anknabberte und vor allem die Dämmung in den Wänden entflammte. Blaue und orangefarbene Blinklichter, Scheinwerfer, dazu das Flackern des Brandes und der beißende Qualm, der in Wogen aus dem Dach stieg, Wasser rann über die Straße, die verzerrte Stimme des Einsatzleiters aus den Funkgeräten.
Noch während er mit seinem Kollegen Muri in sicherer Entfernung vor dem brennenden Haus stand, traf Stein ein. Mit seinen nachgemachten Reetdachhäusern im Friesenstil hatte er in den letzten Jahren jedes zweite Grundstück auf der Insel zugebaut und sich damit nach Eds Einschätzung dumm und dämlich verdient. Stein war eigentlich Architekt und entwarf die Dinger auch noch selbst, mit denen er die Insel vollstellte. Damit verdiente er doppelt an seinem Geschäft. Seine Architektenseele würde dafür ewig in der Hölle schmoren, war sich Ed sicher. Aber wer wusste schon, ob es überhaupt eine Hölle gab? Und wenn – welchen Geschmack Gott und der Teufel hatten, wäre ja auch noch zu klären. Klar war nur, dass jede Menge Rechtsanwälte, Professoren und Unternehmer aus der ganzen Republik in den letzten Jahren bei Stein ein Ferienhaus oder eine Wohnung gekauft hatten, als gäbe es kein Morgen mehr. Aber bitte mit Reetdach! Das viele Geld aus dem Anlagenotstand nach der letzten Finanzkrise suchte sich einen Weg zurück auf den Markt und landete bei Stein, der selbst eines der Keitumer Kapitänshäuser bewohnte, das er in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege vorbildlich saniert hatte. Sogar mit einem Preis war er dafür ausgezeichnet worden. Wo immer ein Alteigentümer verstarb, stand Stein auf der Schwelle und kaufte die alten Fünfziger-Jahre-Häuser auf, um sie durch dicht an dicht gesetzte Luxusneubauten zu ersetzen.
»Und? Was wissen Sie?«, fragte er Ed, ohne ihn zu grüßen.
»Bisher noch nichts, Herr Stein«, antwortete er.
»Was soll ich der Versicherung sagen?«, hakte Stein nach.
»Dass es brennt.«
Stein schaute Ed und Muri entgeistert an.
»Nicht Ihr Ernst, oder?«
»Herr Stein«, setzte Ed an. »Wir wissen doch noch gar nichts Genaues. Wirklich. Die Kollegen löschen gerade das Feuer im Haus, wie Sie sehen, und versuchen ihr Bestes, um zu retten, was zu retten ist. Aber Holz und Reet brennen nun einmal prächtig, sobald sie Feuer gefangen haben. Wenn alles gelöscht ist, sehen wir weiter. Allerdings ist es erfahrungsgemäß bei solchen Bränden extrem schwierig, anschließend herauszufinden, was den Brand verursacht hat. Insofern können Sie Ihrer Versicherung tatsächlich im Moment nichts anderes sagen, als dass es brennt. Aber das sollten Sie möglichst bald tun. Dort wird sich dann umgehend ein Experte melden, der sich mit uns in Verbindung setzen will. Ganz ehrlich, seien Sie froh, dass offenbar niemand bei dem Unglück verletzt wurde.«
»Ja wie auch, das Haus war ja noch gar nicht fertig.«
»Personenschaden wäre trotzdem denkbar. Es hätte ja auch einen der Bauarbeiter treffen können.«
Stein nickte und wirkte tatsächlich für einen Moment nachdenklich.
»Sie haben recht«, entschuldigte er sich. »Ist nur … Ich frage mich, wie kann so etwas bloß passieren?«
»Tja, keine Ahnung. Wie gesagt, das werden wir herausfinden müssen.«
Muri hatte die ganze Zeit neben seinem Chef gestanden und versonnen in die Flammen gestarrt, die aus den Fensteröffnungen züngelten. Der leicht untersetzte Mittvierziger hatte vor Jahren den Weg aus Bayern nach Sylt gefunden, was man ihm, dem Muritzer Harald, wie er in seiner alten Heimat immer genannt wurde, im Tonfall immer noch anhörte.
Auf Sylt wurde daraus ein knappes Muri.
»Verdammt heiß, was?«, rief er.
Selbst aus der sicheren Entfernung, mit der sie dem Feuer zuschauten, war die Hitze mittlerweile kaum zu ertragen.
Wie beim Biikebrennen, dachte Ed.
Sie wichen noch ein Stück weiter zurück.
»Frag mal bei Bendix nach. Vielleicht kann der schon was zur Ursache sagen.«
Muri trabte in Richtung Einsatzwagen, der neben einem von Heckenrosen überwucherten Friesenwall stand.
»Weiß nicht«, brubbelte der untersetzte Einsatzleiter.
Mit seiner Glatze, auf der die Schweißperlen standen, und seinem roten Gesicht sah er immer so aus, als stünde er kurz vor einem Herzinfarkt. Stand er ja möglicherweise auch.
»Aber das Ding ist dermaßen abgegangen, dass ich mal auf Brandbeschleuniger tippen würde.«
Brandstiftung bedeutete eine völlig andere Qualität als technisches Versagen oder ein Unfall. Nicht nur für die Versicherung. Auch für Ed. Auch für die Ermittlungen. Also telefonierte er vorsichtshalber mit Elsa.
»Sag mir Bescheid, wenn du Näheres weißt, ja? Und seid bitte vorsichtig«, fügte sie hinzu.
Der Rest der Nacht war Routine.
Muri klapperte die Häuser der Umgebung ab auf der Suche nach möglichen Zeugen. Aber jetzt Mitte Januar stand hier alles leer. Kein Feriengast, nirgends. Kampener wohnten in dieser Gegend so und so kaum. Gab es überhaupt noch echte Kampener?
Stein hatte sich in seinen Wagen gesetzt, den er am Ende der Straße geparkt hatte, und telefonierte. Wahrscheinlich sprach er mit seiner Versicherung. Es würde ausreichen, wenn er morgen von Bendix’ Verdacht erfuhr, sofern der sich erhärten sollte.
Nach und nach fanden die Flammen immer weniger Nahrung. Eine Ausbreitung auf die Nachbarhäuser hatte die Feuerwehr erfolgreich verhindert.
Warum sollte jemand ein noch nicht bezogenes, aber fast fertiggestelltes Friesenhaus anzünden?
Das war die Frage.
Falls es Brandstiftung war.
Hinnerk vom Tageblatt machte ein paar Fotos von der Brandstelle und fragte bei Bendix und Ed nach, was sie schon wussten. Dem Reporter gegenüber äußerten sie nichts von ihrem Verdacht. Andernfalls hätten sie ihre Vermutungen am nächsten Morgen im Tageblatt gefunden. Ed kannte Hinnerk schon lange und schätzte ihn. Der Journalist bemühte sich um Sachlichkeit in seinen Texten und vermied, wo möglich, allzu reißerische Schlagzeilen. Doch es war eine Gratwanderung. Seine Zurückhaltung brachte ihm regelmäßig Rüffel aus dem Verlag in Flensburg ein. Dort war man auf Schlagzeilen aus. Schlagzeilen brachten Umsatz, und die gab es nur bei Zuspitzung und hemmungslosen Übertreibungen.
Eine Brandstiftung auf der Insel wäre da ein gefundenes Fressen, zumal in Kampen.
Ed hatte keinerlei Interesse daran, Informationen vor den Medien zurückzuhalten. Aber ebenso wenig wollte er Spekulationen säen. Also vermied er es, Hinnerk in einen Gewissenskonflikt zu stürzen. Hinnerk würde seine Informationen erhalten, sobald sie gesichert waren. Das abgebrannte Friesenhaus würde ihm ohnehin für mehrere Tage als Schlagzeile dienen. Sollte es sich wirklich um Brandstiftung handeln, würde man sogar wochenlang das Blatt damit füllen können. Sie mussten also besonders vorsichtig sein, welche Informationen sie preisgaben.
Aber das mussten sie schließlich immer.
4
Ed wollte schon los, als Muri auf ihn zukam.
»Um die Ecke wohnt offenbar doch noch jemand. Steht ein braunmetallicfarbener Opel Manta vor der Tür.«
»Ein Manta, wirklich?«
»Trippel H.«
Ed schaute ihn fragend an. Er brauchte einen Moment, bis er die Anspielung verstand. Das Auto war ein Youngtimer aus Hamburg, der durch ein zusätzliches H im Nummernschild gekennzeichnet war. Trippel H also.
»Hast du geklingelt?«
»Wollte auf dich warten, Chef.«
Ed lächelte. Na gut, dann auch das noch. Der Abend war ohnehin schon lang gewesen. Auch egal.
Im Haus brannte tatsächlich noch Licht. Die Bewohner schliefen also nicht. Auf das Klingeln hin öffnete ein junger Mann, vielleicht Mitte zwanzig, der Ed an Lasse erinnerte.
»Coutino, guten Abend«, begrüßte er die Polizisten mit Handschlag. »Sie kommen wegen des Feuers. Aber wir haben nichts Auffälliges bemerkt, wir wären sonst schon zur Feuerwehr rübergekommen. Aber wir wollten auch nicht als Gaffer da rumstehen, verstehen Sie?«
Trotz seines südländisch klingenden Namens hatte der Mann blondes Haar, Seitenscheitel. Die beiden obersten Knöpfe des Hemdes waren offen, dazu trug er eine beigefarbene Chino und eine Uhr mit Metallarmband am Handgelenk, die sich auf den zweiten Blick als Rolex entpuppte.
Sehr Hamburg, dachte Ed.
»Bitte kommen Sie doch erst einmal herein. Möchten Sie einen Tee? Ist ja aasig kalt draußen.«
»Vielen Dank, wir wollen Sie gar nicht lange stören. Tatsächlich wollten wir nur hören, ob Sie etwas bemerkt haben.«
Coutino schüttelte den Kopf.
»Auch meine Freundin hat nichts bemerkt. Beatrice, komm doch bitte mal.«
Coutinos Freundin war etwa im gleichen Alter, genauso blond, genauso sportlich, genauso Hamburg.
Auch sie hatte nichts bemerkt. Die beiden wirkten ziemlich verliebt, schien es Ed, der ihren Blicken folgte und innerlich lächelte. Auch das war wie bei Lasse und seiner Clara.
Der Name kam Ed bekannt vor.
»Sind Sie Immobilienhändler?«
Coutino nickte.
»Unter anderem. Hausverwaltung, Ferienwohnungen. Mein Vater leitet unser Büro in Hamburg, und ich kümmere mich um die Häuser hier«, ließ er mit einer sonnigen Unbekümmertheit wissen, die die Nacht erstrahlen ließ.
Ed reichte ihm seine Karte und bat ihn, sich zu melden, falls ihnen noch etwas ein- oder auffallen sollte. Dann machte er sich mit Muri auf den Rückweg.
Die Müdigkeit kroch jetzt zusammen mit der Kälte endgültig in ihm empor.