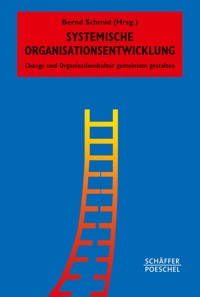
Systemische Organisationsentwicklung E-Book
52,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Systemisches Management
- Sprache: Deutsch
- Wie schafft man es, Veränderungen langfristig in Unternehmen zu verankern? - Wie werden alle Mitarbeiter zu aktiven Gestaltern? Indem man Veränderungen nicht einfach von außen implementiert, sondern alle mit ins Boot holt, um der Organisation eine neue Richtung zu geben, die sowohl dem Unternehmen als auch den in ihr arbeitenden Menschen entspricht. Das leistet die systemische Organisationsentwicklung: ein durch Erleben entstandenes und im Handeln verankertes Verständnis dessen, worauf es in der Organisation ankommt. Der Autor beleuchtet die relevanten Grundlagen, Methoden und Arbeitsweisen und veranschaulicht sie mit Fallbeispielen renommierter Unternehmen. Das Buch liefert Beratern, Coaches, Trainern, aber auch internen Personalentwicklern, Organisationsentwicklern und Führungskräften eine kraftvolle methodische Basis und beispielhafte Vorgehensweisen für komplexe Organisationsentwicklungsprojekte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
InhaltCopyrightEin persönliches Vorwort1 Einleitung (Bernd Schmid)Teil 1: OE als Entwicklung menschlicher Systeme2 Der isb-Ansatz zur Organisationsentwicklung (Bernd Schmid)2.1 Die Eckpunkte der isb-Position im Überblick2.1.1 Position I: OE-spezifische Anleitung von Verantwortlichen in der Organisation2.1.2 Position II: Organisationsentwicklung (OE) im Verbund mit Kulturentwicklung (KE)2.1.3 Position III: Perspektiven, Haltungen und Prinzipien2.1.4 Position IV: ISB-Ansätze für OE und KE2.1.5 Position V: Lern- und Arbeitsformen für OE und KE2.2 Zu Position I: OE und KE durch Verantwortliche in den Organisationen2.2.1 Welche Bilder von OE gibt es?2.2.2 Welcher Kompetenzerwerb wird fokussiert?2.2.3 Externe und interne Dienstleister2.3 Zu Position II: Organisationsentwicklung (OE) im Verbund mit Kulturentwicklung (KE)2.3.1 Dienst ist Dienst2.3.2 Themenbezogene Kulturbeispiele2.3.3 Wesensentwicklung von Organisationen?2.4 Zu Position III: Perspektiven, Prinzipien und Haltungen2.5 Zu Position IV: Bewährte isb-Konzepte und Prinzipien2.5.1 Rahmenklärungen und Kontrakte2.5.2 Freilandtauglichkeit statt Treibhauseffekte2.5.3 Realistisch getimtes und umsichtiges Vorgehen2.5.4 Kristallisierendes Vorgehen und Probeinszenierungen2.5.5 Multiplikationsfähige Anlage2.5.6 Komplexitätskontrollierendes Vorgehen2.5.7 Transferprobleme minimierendes Vorgehen2.5.8 Reifegrade der Akteure berücksichtigen2.5.9 Ressourcenschonendes Vorgehen2.5.10 Kultur-Prinzipien in allen Teilprozessen sichern2.6 Zu Position V: Lern- und Arbeitsformen von OE/KE2.6.1 Dialogisches und exemplarisches Vorgehen2.6.2 Vertikale Teamentwicklung2.6.3 Werkstätten als Medium des OE-Lernens3 Reifegrade von Professionellen und Organisationen (Bernd Schmid)3.1 Springreiten-Geschichte3.2 Warum Reifegrade thematisieren?3.3 Reifegradbestimmungen3.4 Zwei Beispiele unterschiedlicher Reifegrade3.5 Didaktische Herausforderung im Umgang mit Reifegraden3.6 Orchester-Metapher4 Wie und wozu soll Kultur gestaltet werden? (Bernd Schmid)4.1 Gestaltet die Anfänge!4.1.1 Ein Praxis-Beispiel zur Kulturveränderung4.1.2 Eile mit Weile – ein Schaubild4.2 Das isb-Kulturverständnis4.2.1 Arbeits-Definition zur Kultur4.2.2 Gegen die Macht der Gewohnheit4.2.3 Organisationskulturen4.2.4 Kultur und Komplexitätssteuerung4.2.5 Überzeugungsstrategien4.3 Kultur wird hipp4.3.1 Professionskulturen4.3.2 Verbandskultur und Unternehmertum4.3.3 Lernkulturen4.3.4 Die isb-Lernkultur4.4 Systemintelligenz und Kultur4.5 Internationale Kulturbegegnung4.6 Persönlichkeit und Kultur5 OE-/KE-bezogenes Coaching (Marc Minor und Bernd Schmid)5.1 Das Konzept5.2 Einbettung von Coaching in Organisationsvorhaben5.3 Das Spektrum coachingbasierter OE5.4 ... und wenn einzelne Akteure nicht mitwirken wollen?.5.5 Rolle Coach bzw. Coachteam5.6 Worst case? Tatsächlich worst case?Teil 2: OE-Praxis heute und morgen6 Organisationsentwicklung heute (Markus Schwemmle)6.1 Einleitung6.1.1 Werkzeugmanie oder nützliche Innovation?6.1.2 Umgang mit Komplexität in der Organisationsentwicklung6.2 Das Dreieck der Organisationsentwicklung6.3 Kampagnen/Campaigns6.3.1 Veränderung durch mitreißende Inszenierung6.3.2 Kulturentwicklung durch Missionierung der Organisation6.3.3 Klare Trennung zwischen richtig und falsch6.4 Multiplikatorbasierte Ansätze6.4.1 Überzeugte Schlüsselpersonen helfen anderen6.4.2 Spannung zwischen Linienorganisation und Change Organisation6.4.3 Multiplikatoren als standardisierte Veränderer6.4.4 Veränderung im Schneeballsystem6.4.5 Ein Schuss, kein Treffer?6.5 Change by Consulting – ich sage Dir wie es besser geht6.5.1 Erstes Missverständnis: Es geht ohne Personenqualifizierung6.5.2 Zweites Missverständnis: Wer nicht mitmacht, wird ersetzt6.5.3 Drittes Missverständnis: Fertig ohne Umsetzung6.5.4 Retterdynamik im Krisenfall6.6 Change by Toolbox6.6.1 Toolfabriken überschwemmen die Organisation6.6.2 Trugschluss der Geschwindigkeit durch zentrales Handeln6.7 Vorgaben von Finanzkennzahlen6.7.1 Kotter´s 8-Step Change Model6.7.2 Ein Beispiel für Versuch und Irrtum6.8 Vorgaben von neuen Fähigkeiten/Fertigkeiten/Skills6.8.1 Kompetenzmanagement steuert die Skills der Mitarbeiter6.8.2 Beispiel Einführung Kompetenzmanagement im Großkonzern6.9 Vorgaben neuer Strukturen6.10 Sonderfall Restrukturierung6.11 Zusammenschluss von Einheiten oder Organisationen7 Heuristiken erfahrener Organisationsentwickler (Markus Schwemmle)7.1 Einführung zu den verwendeten Heuristiken7.2 Rudi Wimmer – Leadership Task Fields7.3 Alexander Exner – Unternehmens(Selbst)Steuerung7.4 Marianne Grobner – Angewandte Organisationsentwicklung8 OE- und KE-Lernen (Bernd Schmid)8.1 Chor-Metapher8.2 OE-Werkstätten als Lernmedium8.3 Werkstattarbeit als didaktische Herausforderung8.4 Design OE-Werkstatt8.5 Übungen Reifegrade8.6 Kompetenzklärung und Passungdialoge8.7 Verantwortungsdialoge8.8 Wirklichkeitsverständnisse abgleichen8.9 Spiegelung und innere Bilder8.10 Rollenvereinbarung und Rollensicherheit8.11 Integrationsorientierte Professionalisierung9 Interner Workshop OE-/KE-Lernen –Verantwortungsdialoge (Irmina Zunker)9.1 Einführung9.2 Voraussetzungen für internen Lern-Workshop9.3 Der interne OE-Lern-Workshop – ein Praxisbeispiel9.3.1 Ablauf und Design des vorbereitenden Workshops9.3.2 OE-Lerneinheit auf der internen Tagung9.4 Wirkungen über die Lern-Werkstatt hinaus10 Coachingbasierte Organisationskulturentwicklung (Marc Minor)10.1 Die Anfrage des Unternehmens10.2 Der Start-Workshop10.2.1 Vier-Augen-Interviews mit den Geschäftsführern im Plenum10.2.2 Ausrichten der Bereichsleiter auf das Interview mit dem Geschäftsführer10.2.3 Bezug der Bereichsleiter auf das Interview10.2.4 Fazit aus dem Workshop10.3 Einzel-Coaching für das Management-Team10.4 Zweitägige Klausur nach den Einzelcoachings10.5 Was folgte nach dem zweitägigen Workshop?10.6 Weitwinkelperspektive/Fazit11 Kulturentwicklung komplex und konkret – aus der Praxis eines globalen Mittelstandsunternehmens (Volker Köhninger)11.1 Zur Darstellung: Mehr im Internet11.2 Der Kunde11.3 Unser Einstieg im Kunden-Unternehmen11.4 Eine Vision soll »verkündet« werden11.5 Eine dialogische Großgruppen-Veranstaltung11.6 Auftrag zur Kulturveränderung11.7 Unsere Kernkompetenz: Architektur-und Design-Arbeit11.8 Phase 1: Kulturerhebung mit Bildern11.8.1 Topmanagement-Workshops11.8.2 Flächen-Workshops11.8.3 Reduzierung der Bilder-Komplexität11.9 Phase 2: Definition einer Soll-Kultur11.9.1 Arbeit mit dem Vorstand11.9.2 Ein unerwarteter Konflikt11.9.3 Vorstand, Aufsichtsrat und Gründerfamilie11.9.4 Konflikte um Auftrag, Macht- und Rollenverteilung11.9.5 Machtpolitische und individuelle Dynamiken11.10. Phase 3: Implementierung der Soll-Kultur11.10.1 Ein differenziertes Kommunikationskonzept11.10.2 Führungskultur-Initiative11.10.3 Role Modeling mit Schlüsselplayern11.10.4 Multiplikative Verbreitung11.10.5 Weiterentwicklung der Feedback-Kompetenz11.10.6 Synchronisation der HR-Landschaft11.10.7 Umsetzung in Pilot-Projekten11.10.8 Implementierungsmaßnahmen zusammengefasst11.11 KE und/Ohne OE?– eine entscheidende Krise11.12 Der Start in integrierte KE/OE11.13 FazitTeil 3: Weitergehende Betrachtungen12 Zum Thema System (Bernd Schmid)12.1 Systemisch und Definitionen von Systemen12.2 System und Umwelt12.3 Drei Arten von Systembeschreibungen12.3.1 Struktursystem12.3.2 Funktionssysteme12.3.3 Menschliche Systeme12.4 Systemverständnisse und OE-Ansätze13 Wie viel Mensch? Wie viel Organisation? – die beiden Perspektiven bei der OE (Bernd Schmid)13.1 Menschenversteher und Problemlöser – das Dilemma der Berater13.2 Spaltungen in internen Abteilungen13.3 Spaltungen bei externen Dienstleistern13.4 Unternehmensformen und Geschäftsmodelle13.5 Beziehungspräferenzen psychologisch betrachtet13.6 Können Konzepte integrieren?13.7 Das Rollenkonzept der Persönlichkeit13.8 Menschenbilder und kulturelle Auswirkungen – Beitrag zu einem wissenschaftlichen Diskurs14 OE oder Changemanagement? (Bernd Schmid)14.1 Worum es geht14.2 Metabetrachtungen14.3 Organisationsentwicklung14.3.1 Organisation14.3.2 Entwicklung14.3.3 Organisationsentwicklung14.4 Changemanagement14.4.1 Change14.4.2 Management14.4.3 Changemanagement14.5 Changemanagement oder OE?14.6 Gedankenspiele anhand eines metaphorischen Beispiels15 »Die elastische Organisation« (Dagmar Wötzel)15.1 Ausgangslage und Notwendigkeit15.2 Faktoren für verbreitetes Scheitern15.3 Erfolgskriterien für strategische Projekte15.4 Elastizität als strategisches Ziel?15.5 Was ist eigentlich Elastizität?15.6 Faktoren für eine elastische Organisation15.7 Dimensionen für Elastizitätsentwicklung15.7.1 Das Belohnungssystem15.7.2 Die Implementierung15.7.3 Pflege einer »elastischen« Kultur15.7.4 Kooperation und Vertrauen15.7.5 Elastizitätskurator/in15.8 Zusammenfassung – Elastitzität verankert in der Unternehmenskultur16 »Die gesunde Organisation« (Thorsten Veith)16.1 Organisation und Gesundheit16.2 Gesundheit als Systemqualität – und die Rolle von Führungskräften als Kulturprotagonisten16.3 Arbeiten mit Reifegraden zum Thema Gesundheit – ein Diagnose- und Ressourcenmodell16.4 Reifegrad-Dimensionen zu Gesundheit16.4.1 Die Organisation (institutionelle Entwicklung)16.4.2 Die Person (persönlich-professionelle Entwicklung)16.5 Drehbuch für einen Gesundheitsdialog – eine didaktische Hilfe17 »Die vernetzte Organisation« (Martin Lindner und Lutz Berger)17.1 Digitaler Klimawandel17.1.1 »We are already seeing changes!«17.1.2 Vom Archiv zum Fluss17.2 Von der Linienorganisation zur vernetzten Organisation17.3 Auf dem Weg zur Netzwerk-Organisation17.4 Change 2013: Das Internet als Kulturtechnik18 Anhang: Abschlussberichte isb-Curricula18.1 Curriculum systemische OE und Changemanagement18.1.1 Modelle und Methoden18.1.2 Praktische Anwendungen innerhalb der Ausbildung18.1.3 Anwendung der Inhalte im professionellen Kontext18.1.4 Persönliche Weiterentwicklung18.1.5 Fazit18.2 Abschlussbericht Curriculum Systemische Beratung und Steuerung in Organisationen18.2.1 Einstieg in Curriculum18.2.2 Neuorientierung18.2.3 Neue Zugangsweisen18.2.4 Nachhaltige Lernkultur18.2.5 Die zwölf Curriculum-Bausteine18.2.6 FazitLiteraturverzeichnisStichwortverzeichnisHerausgeber und AutorenReihe Systemisches Management
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der DeutschenNationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über<http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
E-Book ISBN 978-3-7992-6719-9
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2014 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht [email protected]
Einbandgestaltung: Dietrich Ebert, Reutlingen/Jessica Joos Satz: Marianne Wagner
März 2014
Schäffer-Poeschel Verlag StuttgartEin Tochterunternehmen der Haufe Gruppe
Ein persönliches Vorwort
... und nähme doch Schaden an seiner Seele.
Im Zentrum steht für uns immer der Mensch. So begann Marianne Grobner ihren Vortrag über ein Organisationsentwicklungsprojekt in großem Maßstab (Schmid 2013a). »Ja!« sagte es in mir. Dabei bin ich nicht der beziehungsorientierte Typ, der immer auf gute Gefühle der Menschen achtet, jeden zufriedenstellen oder einbeziehen möchte. Ich habe ehrgeizige Ziele, entwickle gerne Projekte, achte auch auf meinen Vorteil und lege großen Wert auf Professionalität, auf Inhalt und Sachlichkeit. Es soll möglichst Großes dabei herauskommen. Doch für wen am Ende? Mir ist im Laufe meiner Entwicklung deutlich geworden, wie schal dies alles wird, wenn es nicht auch mit der Perspektive geschieht, damit Menschen zu erreichen, zu einem humanen Wirtschaften und zur gesellschaftlichen Entwicklung beizutragen. Da aber niemand weiß, wie seine Bemühungen letztlich herauskommen, möchte ich auch schon unterwegs befriedigende menschliche Erfahrungen machen. Entwicklungen möchte ich so betreiben, dass auch dann, wenn sie der Vergänglichkeit anheimfallen, sie durch das Wie unterwegs wertvoll gewesen sind. Nun ist das nicht einfach, wenn man komplexe, sachlich anspruchvolle Vorhaben angeht, sich dabei am mühsam betriebenen Forschritt orientiert und selbst Trockenzeiten in Kauf nimmt. Und ich gebe zu, dass ich gefährdet bin, diese Orientierung auch immer wieder zu verlieren, dass Sachlogiken und die Begeisterung für Systematiken zeitweise überhand nehmen, ich das Humanum schleifen lasse. Doch dann merke ich, dass ich mit Verflachung bezahle und meist geschieht etwas, das mich wieder zur Besinnung bringt und zu Bemühungen, alles in den Dienst einer humanen Entwicklung und guter Beziehungen zu stellen.
I have a dream
Wenn heute ein neues IT-System zur Organisation von Geschäftsprozessen angegangen wird, dann wissen alle, dass es viele Ressourcen und lange Zeit in Anspruch nehmen wird. Es bedeutet ein Durchforsten fast aller Geschäftsprozesse und Zuständigkeiten. Und: Man muss in die Menschen, die damit betraut oder davon betroffen sind, investieren. Sonst wird es teuer oder das Vorhaben fliegt einem um die Ohren. Das hat mit der mangelnden Elastizität nicht menschlicher Systeme zu tun. Fehler und Schlampigkeiten rächen sich in technischen Systemen erbarmungslos, wenn die Menschen nicht lernen, sie nach ihren Logiken zu bedienen. Erfreulicherweise ist das bei menschlichen Systemen anders. Sie können den Sinn von Vorhaben verstehen und eigengesteuert positiv dazu beitragen, können weiterdenken, können Unklarheiten und Fehler ausbügeln. Die Kehrseite: Ausbeutung und Überlastung von Menschen werden in Kauf genommen, oft unbemerkt, weil es so etwas wie Engagement und Treue scheinbar umsonst gibt. Man ist weniger gezwungen, sich Rechenschaft abzulegen, ob man seiner Ressourcenverantwortung gerecht geworden ist. Es funktioniert ja irgendwie. Viele Versäumnisse meint man nicht der eigenen Steuerung solcher Vorhaben zurechnen zu müsssen. Diese Entlastung bieten technische Systeme nicht. Man kann ihnen keine Motivationen wie Widerstand oder Missgunst unterstellen. Dies führt zum Glauben, dass die Entwicklung menschlicher Systeme weniger Sorgfalt und Pflege braucht. Dabei werden Kreativität und Einsatzbereitschaft von Menschen nicht immer erkannt und gewürdigt. Wir sollten von diesem Glauben abfallen und menschlichen Systemen und der menschlichen Seite von Organisationsentwicklung die gleiche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen wie z.B. der Einführung eines neuen IT-Systems.
Ich danke den Menschen, die mir auf meinen Lebenswegen nah und verbunden waren und sind. Dies ist zu vorderst und seit nun über 40 Jahren meine Frau Irene. Ihr Motto, jeden Ort und jeden Menschen möglichst ein bisschen besser verlassen als man ihn antrifft ist mir Orientierung.
Viele Kolleginnen und Kollegen sind mir zu Freunden geworden, hier in Wiesloch und in den sich noch immer weiter aufspannenden Netzwerken. In ihrem Kreise finde ich Resonanz und immer wieder neue Gestaltungskraft.
Ich danke den Vertretern des Verlags, die mit dem Wunsch nach einem Werk aus Wiesloch Anlass für dieses Buch waren und dessen Entwicklung unkompliziert und wohlwollend begleitet haben. Und last but not least danke ich unserer Lektorin Ingeborg Weidner, die in der ihr eigenen Sorgfalt das Manuskript in Endfassung gebracht hat.
Wiesloch im Oktober 2013 Bernd Schmid
1 Einleitung
(Bernd Schmid)
Dieses Buch schlägt einen Bogen von der systemintelligenten Personenqualifizierung über die personensensible Systemqualifizierung (Schmid/Fauser 1994a) zur konkreten Organisationsentwicklung (OE) und Kulturentwicklung (KE) in Organisationen.
Natürlich haben wir als Sytemiker gelernt, jenseits der Belange einzelner Menschen in Systemen zu denken und verstehen sogar Luhmans Ansatz der Funktionssysteme, in denen der Mensch Umwelt darstellt. Doch können fast alle Praktiker nur unter geistiger Verrenkung so denken. Für sie bleiben es die Menschen, die Systeme darstellen, sie schaffen oder als deren Agenten bewusst oder unbewusst tätig sind. Es sind Ideen und Verantwortlichkeiten von Menschen, die Systeme als das fortschreiben, was sie sind oder sie eben verändern, neu denken, neu inszenieren. Schon um dieser Verantwortung willen, sollten Organisationen kompetent als menschliche Systeme begriffen und gestaltet werden. Der Mensch ist des Menschen Schicksal. Wer sonst, wenn nicht Menschen in ihren Organisations- und Professionsrollen sollten sich die Gegenüber sein? Wann hat man mit Systemen ohne Menschen als Akteure im Guten wie im Schlechten zu tun? Nur, wenn man Menschen aus der eigenen Perspektive ausblendet. Selbst automatisch kriegführende Drohnen sollten als Werkzeuge menschlicher Systeme begriffen werden. Dann bleibt Verantwortung Menschensache und nur Menschen in ihren Systemen sind Adressaten, wenn es darum geht, die Logiken von Systemwirklichkeiten zu verändern.
Systemisch denken heißt auch Wirklichkeit als die des Beobachters zu begreifen. Hoffentlich begreifen sich Menschen gegenüber ihrer Wirklichkeit nicht nur als Sezierer, Opfer, Gewohnheitstiere oder Profiteure, sondern verstehen ihr Betroffensein, nehmen Verantwortung auf sich, wenn auch oft nur mit kleinen Hebeln. Den Verzicht darauf nannte Hannah Arendt im Hinblick auf »Bruder« Eichmann die Banalität des Bösen: Bei der Bereitschaft, sich dem zu stellen und auch im Kleinen zu wirken, sprach Paul Watzlawick von Kettenreaktionen des Guten. Von hieraus ist es nicht weit, Organisationen als menschliche Kulturen zu begreifen. Leider sind sie wie Eisberge nur zu einem kleinen Teil offen zu sehen. Sie zu begreifen und zu gestalten, ist eine komplexe Angelegenheit, die nicht mit Teilperspektiven-Optimierung und Patentrezepten zu bewältigen ist. Vieles bleibt untergründig und nur indirekt dem Begreifen und Gestalten zugänglich. Kulturentwicklung scheint die Chance zu sein, lebendige Systeme zu steuern und zu entwickeln. Hierzu soll das vorliegende Werk beitragen.
Es ist in drei Abschnitte eingeteilt. In Teil 1 OE als Entwicklung menschlicher Systeme wird der isb-Ansatz von Organisationsentwicklung entworfen. Hierzu gehören das Zusammenspiel mit Kulturentwicklung, wesentliche Perspektiven und Arbeitsprinzipien wie sie sich im Umkreis des isb bewährt haben, die Bestimmung von Reifegraden der Akteure und Organisationen. Und schließlich wird der isb-Ansatz für OE- und OK-spezifisches Coaching skizziert. Diese Beiträge sind knapp angelegt. Vieles wird um der Lesbarkeit willen als weiterführende Betrachtungen in Abschnitt 3 verschoben.
Die Praktiker unter den Lesern wollen sich meist bald eine Vorstellung machen können, was das alles im richtigen Leben bedeuten kann. In Teil 2 OE-Praxis heute und morgen wird daher zunächst ein Überblick über heute gängige Ansätze von OE und Change gegeben. Dann wird die künftig (hoffentlich) an Bedeutung gewinnende systemisch-Menschen-orientierte Praxis ins Visier genommen. Zunächst kommen drei dem isb verbundene namhafte Berater zu Wort. Rudi Wimmer, Axel Exner und Marianne Grobner. Sie umreißen ihre Heuristiken für das Arbeiten mit Organisationen. Auch dabei ist unübersehbar, wie sehr ihre komplexen Professionsperspektiven neben einer theoretischen Orientierung mit ihnen als Menschen und mit ihrem Zugang zu Menschen verbunden sind. OE und KE sind immer mit Lernen verbunden. Daher wird OE-Lernen als nächstes zum Thema gemacht und es werden Perspektiven und Arbeitsformen des isb konkret dargestellt. Aus der Unternehmenspraxis wird dann ein Beispiel für anfangs von außen angeregtes und dann intern gesteuertes OE-Lernen geschildert. Anhand eines weiteren Beispiels aus der Praxis wird dann dargestellt, wie Coaching und OE/KE zusammengehen. Schließlich rundet eine komplexe Darstellung eines Kultur- und Organisationsentwicklungprozesses »in freier Wildbahn« die Praxisberichte ab.
Insgesamt und speziell für die Praxisberichte werden ergänzende Materialien auf der Website des isb zur Verfügung gestellt. Sie werden nach den Kapiteln des Buches geordnet, so dass jeweils Illustrationen und Vertiefungen gezielt gefunden werden.
Schließlich sind in Teil 3 Weitergehende Betrachtungen zum Thema System, zur Frage, wie viel Mensch und wie viel Organisation jeweils berücksichtigt werden kann, zur Unterscheidung von OE und Change angestellt. Drei Beiträge zu besonderen Perspektiven wie Elastizität, Gesundheit und Vernetzung von Organisationen runden diesen Abschnitt ab.
Im isb Wiesloch werden seit 30 Jahren Konzepte und Praktiken für Leistungsträger entwickelt. Die meisten legen gleichzeitig Wert auf Professions- und Organisationskultur und verstehen sich in diesem Sinne auch als Gestalter menschlicher Systeme. In einem lebendigen Professionellen-Netzwerk und in regionalen oder fachspezifischen Gruppen tauschen sich derzeit ca. 4000 Alumni unserer Curricula regelmäßig aus. Im Anhang sind 2 Abschlussberichte solcher Curricula als Beispiele zu finden. Sie sollen ein Gefühl für die isb-Weiterbildungskultur vermitteln.
Die Autoren sind langjährig Vertraute des Instituts für systemische Beratung (isb-GmbH Wiesloch), das im Erscheinungsjahr Jahr 30-jähriges Jubiläum feiert. In diesen Jahrzehnten entwickelte und gestaltete das isb Weiterbildungen für Professionelle im Organisationsbereich und betreibt Weiterentwicklungen zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, die ihrerseits Unternehmer, Lehrer, Praktiker und Autoren sind.
Über die Ansätze und Erfahrungen des isb sind zahlreiche Schriften, Ton- und Videodokumente verfügbar, vieles auch in englischer Sprache. Darüber hinaus arbeitet das isb daran, die eigenen Konzepte und Arbeitsmaterialien didaktisch aufzubereiten und jedermann zur Verfügung zu stellen. Außer den Verlagsprodukten wird alles unter www.isb-w.eu zum kostenlosen Download bereitgestellt. Unter www.forum-humanum.eu wird pro bono Unterstützung für Non-Profit-Organisationen und für Corporate-Social-Responsibility-Projekte angeboten. Im Rahmen der Schmid-Stiftung www.schmid-stiftung.org werden allgemein gesellschaftliches Engagement und ein neues Zusammenwirken von Profit- und Non-Profit-Unternehmertum unterstützt.
Teil 1: OE als Entwicklung menschlicher Systeme
In diesem ersten Teil wird erläutert, was am isb unter Organisationsentwicklung (OE) und Kulturentwicklung (KE) verstanden wird. Wie später noch deutlicher wird, kann Kultur von Professionen und Organisationen in seiner Komplexität nicht auf wenige Dimensionen oder auf schematische Vorgehensempfehlungen reduziert werden (siehe auch z.B. Kap. 12). Doch kann hier aufgezeigt werden, in welchem Licht Organisationen und Entwicklungsvorhaben am isb gesehen und welche konzeptionellen Scheinwerfer darauf gerichtet werden. Bezüglich Vorgehensweisen gibt es kaum allgemeine Rezepte, jedoch eine Reihe von Gestaltungsprinzipien, deren Berücksichtigung die Chance auf nachhaltige Entwicklung erheblich vergrößert. Kulturdarstellungen bleiben immer fragmentarisch. Ein Fragment ist ein Teil, das das Ganze erahnen lässt. Das ganze Bild lässt sich nicht vollständig beschreiben. Doch werden viele Wirkfaktoren zwischen den Zeilen erkennbar, auch ohne dass sie ausdrücklich konzeptionell hervorgehoben werden. Im Lichte der folgenden Betrachtungen und Empfehlungen lösen sich verbreitete Illusionen über schnell Machbares auf. Vielleicht zunächst ernüchternd, doch kommt dies realistischer Entwicklung, tatsächlicher Leistung und der Lebensqualität der Menschen in Organisationen zu gute.
2 Der isb-Ansatz zur Organisationsentwicklung
(Bernd Schmid)
2.1 Die Eckpunkte der isb-Position im Überblick
2.1.1 Position I: OE-spezifische Anleitung von Verantwortlichen in der Organisation
Im isb-Ansatz wird OE nicht von außen konstruiert und dann implementiert, sondern durch die realen Player innen, life entwickelt (Schmid 2009a). Daraus folgt: OE/KE mit den dafür vorgesehenen Funktionsträgern der Organisation on the job und in Abstimmung untereinander einzuüben! Unter der Verantwortung der internen Funktionsträger können natürlich Ressourcen von außen einbezogen werden. Hierzu zählen auch Training und Beratung zur Qualifizierung der Player, aber auch Maßnahmen zu ihrer Orientierung auf die Belange der Organisation. Gerade aber Orientierung muss i.d.R. aus der Organisation selbst kommen und kann durch Qualifikation nicht ersetzt werden. Man kann ja auch eine fehlende Konzeption für ein Theaterstück nicht durch mehr Schauspielschule ersetzen. Letztlich können nur die Maßgebenden der Organisation Orientierung bieten, eventuell vorbereitet und vermittelt durch Fachleute ohne Managementverantwortung. Orientierung wie auch Qualifizierung können auch durch kollegiale Multiplikation in der Organisation geleistet werden, wenn dies entsprechend vorbereitet ist. Interne und externe PE/OE-Fachleute sollten dabei eher kollegiales Lernen inszenieren (Drehbücher schreiben, Regie führen, in Rollen und Abläufe einführen) als selbst trainieren, instruieren und beraten.
2.1.2 Position II: Organisationsentwicklung (OE) im Verbund mit Kulturentwicklung (KE)
Organisationen sind komplex und daher nicht rational durchzusteuern. Viele Beteiligte müssen den Geist der Organisation und der beabsichtigeten Entwicklungsvorhaben verstehen, um sie auch bei zentraler Steuerung in gegenseitiger Abstimmung dezentral realisieren zu können. Dazu braucht es KE. Das bedeutet neben einer bewusst-methodischen OE ein intuitiv durch Erleben entstandenes, im Handeln verankertes Verständnis dafür, worauf es ankommt, d.h. was und wie die Entwicklung vorangebracht werden soll. Kultur bringt das Relevante bezogen auf die OE in den Funktionsträgern in den Vordergrund und verknüpft es untereinander (Schmid 1996a, Schmid 2002a). Durch Kultur wird gelernt, sich intuitiv gegenseitig die vielschichtigen Signale zu geben, um die Entwicklungen zu erhalten und fortzuschreiben und damit OE auf Kurs zu halten.
2.1.3 Position III: Perspektiven, Haltungen und Prinzipien
Der isb-OE-Ansatz ist mehr definiert durch Perspektiven, Prinzipien und Haltungen als durch Schemata für Ereignisse oder Vorgehensweisen. Dieser Zugang wird in Kapitel 2.4 erklärt.
2.1.4 Position IV: ISB-Ansätze für OE und KE
Beispielhaft lassen sich zunächst 10 bewährte isb-Ansätze benennen, die in Kapitel 2.5. näher erläutert werden.
Rahmenklärungen und Kontrakte mit den Entscheidern
Möglichst wenig Treibhauseffekte
Realistisch getimtes und umsichtiges Vorgehen
Kristallisierendes Vorgehen und Probeinszenierungen
Multiplikationsfähigkeit sichern
Komplexitätskontrollierendes Vorgehen
Transferprobleme minimierendes Vorgehen
Reifegrade der betreibenden Individuen, aber auch der tragenden Organisation berücksichtigen
Ressourcenschonendes Vorgehen
Kultur-Prinzipien in allen Teilprozessen sichern
2.1.5 Position V: Lern- und Arbeitsformen für OE und KE
Am isb haben sich bezogen auf OE und KE spezielle Arbeitsformen für das Entwickeln, Kooperieren und Lernen bewährt. Sie haben wiederum ihre eigene Logik, in der sich das isb-Kulturverständnis spiegelt. Hier seien zunächst einige Beispiele genannt. Diese werden später näher erläutert. Als beispielhafte Arbeitsformen werden sie z.B. in Kapitel 8 und 16 didaktisch verfügbar gemacht, bzw. deren Einsatz an Praxisprojekten z.B. in Kapitel 9 und 10 verdeutlicht:
Kontraktklärungen zwischen Intern und Extern – Anfänge sind Keimsituationen für alles Folgende. Faule Kompromisse sind später kaum korrigierbar. Die Art der Beauftragung und der Kontraktklärung ist bereits der Anfang von OE und KE.
Verantwortungsdialoge in OE-Prozessen – Wer, wann, wie auf welche Fragen Antworten geben muss, kann nicht umfassend und einmalig geklärt werden, sondern bedarf einer ständig gepflegten Kultur der Verantwortungsdialoge.
Vertikale Teamentwicklung – Teams sind Gemeinschaften mit gemeinsamer Verantwortung. Wer hierarchieübergreifend in welcher Rolle dazu gehört, muss je nach Fragestellung situativ geklärt werden.
Coaching bezogen auf OE und KE – Arbeitsformen aus dem Coaching können in OE und KE-Prozessen eingesetzt werden. OE-spezifisches Coaching mit Schlüsselplayern hilft Passung und Stimmigkeit zu pflegen.
OE-Werkstätten – Gemeinsames Lernen und Entwickeln für OE und KE bedarf eigener Formate. Sie müssen eingeführt und deren selbständige Weiternutzung vor Ort muss geübt werden.
Interner Peer-to Peer-Transfer – Vermutlich findet Lernen tatsächlich zu 90% in der Organisation statt. Auch dann, wenn zunächst vieles extern zugeliefert wird, muss alles intern etabliert werden. Kosten- und Kulturgründe sprechen dafür, eine auf internes Lernen angepasste kollegiale Lernkultur zu etablieren.
2.2 Zu Position I: OE und KE durch Verantwortliche in den Organisationen
2.2.1 Welche Bilder von OE gibt es?
Als Bilder und Events, an denen ein OE-Ansatz erkannt werden soll, kommen schnell solche aus klassischen OE-Ansätzen in den Sinn: Organigramme, Ablaufdiagramme, Marktanalysen und Kennzahlenentwicklungen, Innovationsprogramme und Kampagnen, Strategieklausuren mit Experten, Kickoffmeetings usw. Diese Bilder gehören oft in ein eher mechanistisches Grundverständnis von Organisation: Eine Maschine wird konstruiert und soll dann von Menschen übernommen und betrieben werden. Anders zu denken ist die Entwicklung lebendiger Systeme (Schmid/Meyer 2010). Es wäre nicht unbedingt eine Hilfe, wenn nur das Gegenteil betont werden würde. Pauschale Ansätze, die möglichst viele Betroffene zu Beteiligten machen oder Hoffnung auf Selbstorganisation nach Vorgabe von Zahlenzielen machen, wecken da falsche Erwartungen. Bottom-up-Ansätze aller Art können gleichermaßen einseitig sein. Viele Ansätze betonen die Entwicklung der Organisation als Objekt und vernachlässigen die Subjekte. Doch: Wie sollen die Vorhaben in die Selbststeuerung der Menschen gebracht werden? Wie sollen sich diese dafür qualifizieren?
Hier soll deutlich gemacht werden, wie durch spezielle Konzepte zur Unterstützung Verantwortlicher die Entwicklung der Organisation vorangebracht werden kann, wie die Organisationsentwicklungs (OE)- und Organisationskultur (OK)-Gestalter in ihrem persönlichen Wirken und im Zusammenspiel unterstützt werden können.
2.2.2 Welcher Kompetenzerwerb wird fokussiert?
Im Rahmen von OE- und KE-Vorhaben kann allgemeines persönliches Lernen von Playern oder der allgemeine Umgang der Organisation mit Steuerungsproblemen und Beziehungen nicht im Fokus stehen. Wenn hier erheblicher Nachholbedarf besteht, muss dieser zwar gedeckt werden, doch sollte kritisch geprüft werden, ob dies anlässlich einer OE erfolgen kann. Ein OE-Projekt zur strategischen Führung ist dann kaum zu realisieren, wenn basale Management- und Führungskompetenzen wenig vorhanden sind. Davon wird in Kapitel 3 noch ausführlicher die Rede sein. Im Rahmen einer OE sollte personales Lernen speziell auf die Entwicklung von Rollen, Strukturen, Prozessen, Beziehungen und Kulturen des OE-Prozesses ausgerichtet sein. Man sollte sich nicht mit Grundkompetenzen aufhalten müssen. Zwar eignen sich viele der hier vorgestellten Arbeits- und Lernformen auch für eine vorbereitende allgemeine Personenqualifizierung, doch liegt in diesem Buch der Fokus mehr auf der OE und auf Systemqualifizierung (Schmid/Hipp 1998a) für eine OE und KE. Qualifizierung gilt von vornherein den Verantwortlichen in der Organisation und unter sukzessivem Einbinden und Starkmachen den Menschen, die die neue Organisation dann tragen werden. Der Unterschied liegt also nicht in erster Linie in den Settings oder Arbeitsformen, sondern in der Zielgruppe und im Fokus, auf den hin die Gestaltungs- und Lernprozesse angelegt sind.
2.2.3 Externe und interne Dienstleister
Beim isb-Ansatz kommt externen oder internen Dienstleistern eher die Funktion eines Ferments, Hilfsdrehbuchschreibers, Hilfsregisseurs oder fachlichen Unterstützers für die im wirklichen Leben Verantwortlichen zu. Letztere werden, soweit möglich, in die Verantwortung genommen oder in ihr gehalten. OE wird also nicht an Experten delegiert, sondern wird dadurch unterstützt, dass man den originär OE-Verantwortlichen mit Coaching- und Expertisefunktion zur Seite tritt, diese also in ihrer Funktion stärkt. Die dabei angestoßenen Prozesse sind bereits Teil des organisationalen Lernens der Zuständigen und Transfer ist schon im Prozess gegeben.
2.3 Zu Position II: Organisationsentwicklung (OE) im Verbund mit Kulturentwicklung (KE)
Wer schnell zur Sache will, sollte mit Kultur anfangen.
In diesem Abschnitt soll die Bedeutung von Kulturentwicklung für OE angerissen und dargelegt werden, warum und wie Kulturentwicklung von Anfang an dazugehören sollte.
Abbildung 1: Verhältnis von Ergebnis- und Kulturorientierung in Organisationen (Schmid 1996)
Dieser Slogan und Abbildung 1 illustrieren einen verbreiteten Irrtum und die Alternative dazu. OE oder Change sind oft dann gefragt, wenn Ergebnisse nicht stimmen. Dann drängen viele inhaltliche Themen, die unverzüglich angegangen werden sollten, will man überhaupt noch den Kopf über Wasser halten. Egal wie wenig man vorbereitet ist, man glaubt, keine Zeit verlieren zu dürfen und mit einer auch schlecht eingespielten Mannschaft loslegen zu müssen: also sofort zu den Themen! Das ist etwa so, als würde man mit einer unvorbereiteten Seilschaft eine Erstbesteigung versuchen. Klar kommt man zunächst gut voran, doch dann türmen sich allmählich die Folgen unzureichender Abstimmung aufeinander. Wird also sofort an den Themen und ergebnisorientiert gearbeitet, so häufen sich meist zunehmend nicht erkannte Kulturprobleme im Zusammenspiel. Sie verzehren zunehmend Kraft, bis am Ende wenig Ergebnis bleibt. Als Alternative kann man jedoch mit beispielhaften Themen und Schritten Richtung erster Ergebnisse starten, jedoch nicht mit der Priorität auf Themen und Lösungen, sondern mit dem Ziel, dabei eine Kultur der Zusammenarbeit zu etablieren, die dem Vorhaben und der Orientierung hin zu möglichen Lösungswegen angemessen ist. Dann kommt man erst allmählich in Fahrt, ist aber besser gerüstet und für später auftretende Unstimmigkeiten vorbereitet. (siehe auch Reifegrade Kap. 3). Also: Vor einer Erstbesteigung macht man eine Probebesteigung ohne Gipfelzwang, um die Fitness der Manschaft zu klären und Fehlendes nachzurüsten.
Je weiter die Kulturentwicklung vorangeschritten ist und von den Mitwirkenden getragen wird, desto mehr kann nun die Ergebnisorientierung ohne Schaden in den Vordergrund treten. Am Ende bleibt gerade wegen der anfänglich vorrangigen Pflege von Kultur mehr Ergebnis.
2.3.1 Dienst ist Dienst
Oft wird die Bedeutung von sozialer Abstimmung für gemeinsame Vorhaben erkannt, doch mit zweifelhaften Maßnahmen beantwortet. Viele versuchen zum Beispiel irgendein Gemeinschaftserleben zu organisieren, z.B. gemeinsames Fußballschauen mit reichlich Alkohol oder ein Outdoorevent. Möglicherweise kommt man sich dabei näher, ist mal ungezwungen beieinander. Ob dies einer nachfolgenden Kultur der Zusammenarbeit dient, ist eine andere Frage. Sich mal ganz privat zu begegnen, kann angenehme oder unangenehme Erfahrungen bescheren. Manchmal liefern gruppendynamische Effekte beides hintereinander: zunächst undifferenzierte Nähe und dann Distanzierung wegen eines »Katers«, z.B. weil man sich zu sehr »entblößt« sieht oder enttäuscht ist, dass im beruflichen Zusammenhang dann doch andere Spielregeln gelten.
Der sinnvolle Weg: Die Leute, die dann auch im Vorhaben zusammenarbeiten sollen, werden eingeladen und zwar nicht privat, sondern in ihren Organisationsrollen und bezogen auf das Vorhaben. Das Zusammensein darf gerne persönlich werden, was von privat zu unterscheiden wäre. Der Mensch in und hinter der Organisationsrolle soll einbezogen werden, nicht der Privatmensch neben der Berufssphäre (siehe auch Diskussion Kapitel 19). Immer bezogen auf die zu erwartenden beruflichen Realitäten, aber mit viel Spielraum und Aufmerksamkeit dafür, dass sich die Menschen dabei mit vielerlei Eigenarten und Hintergründen begegnen und austauschen, übt man sich ohne Druck im Zusammenspiel und in Bezogenheit dabei. Im Bild der Seilschaft erfährt man von den bisherigen Erfahrungen mit Kameraden, von besonders wichtigen Gesichtspunkten, von wichtigen Motivationen und Empfindlichkeiten, besonderen Stärken und Schwächen und unter welchen Umständen diese aktiviert werden können, usw. So enstehen viele intuitive Bilder von den anderen in möglichen Situationen am Berg, die später entscheidend sein können. Gleichzeitig wird der bewusste und sorgsame Austausch auf diesen Ebenen eingeübt und meist nachhaltiger als wertvoll empfunden als ein »thrilling Event«.
2.3.2 Themenbezogene Kulturbeispiele
Eine schöne Story beschreibt 3 Vorstände und 20 strategische Themen:
Es fanden sich drei Vorstände einer internationalen Großorganisation ein, um zum Umgang mit ihren strategischen Themen Beratung einzuholen. Während drei Chauffeure auf dem Parkplatz warteten, nahmen sie sich immerhin einen Tag Zeit dafür. In der Eingangsrunde wurden ca. 20 strategische Themen als die wichtigsten identifiziert, zu denen man endlich Ergebnisse erwartete. Der Druck war groß. Statt nun die gewünschten Themen wie gewohnt zu diskutieren, wurden sie dafür gewonnen, dass jeder ein ihm besonders wichtiges auswählte, für das er federführend sein wollte, zu dem er aber die Mitwirkung der anderen in irgendeiner Weise brauchte oder wichtig fand. Jeder sollte zunächst vom Berater interviewt werden, um dann erst die beiden anderen einzubeziehen. Der Bereitwilligste begann.
Nun wurde er in einem differenzierten Interview nach den Vorstellungen zu seinem strategischen Thema gefragt:
nach bisherigen Erfahrungen, damit voranzukommen,wie man sich das Verhalten anderer erklärt,wen man brauchte und wer wie mitzog oder auch nicht,warum welcher Beitrag von welchen anderen wie wichtig war,was man bisher versucht hatte, um diese zu gewinnen,wie sehr er gelungen oder gescheitert war, angemessene Resonanz zu finden,wie man das verarbeitet hatte und was es brauchte, um zu vermutlich für alle befriedigende Lösungen zu finden etc.Erst dann wurden die anderen beiden interviewt:
was sie verstanden hatten,wie sie das Erfahrene verarbeiten,welche neuen Perspektiven nun erkennbar waren,welche Möglichkeiten des Zusammenwirkens oder eben auch der Auseinandersetzung sie nun sahen undwie sie es erlebt haben, auf diese Weise viel mehr von der Erlebniswelt und der Steuerungsvorstellungen des Kollegen zu erfahren.Erst dann gab es eine erste Runde des Verabredens und Aushandelns zum konkreten strategischen Anliegen, gesteuert vom Berater und ausgerichtet auf die Anliegen und Verantwortlichkeit des Federführenden, solange bis dieser mit seinem Anliegen für den Moment »rund« und mit den anderen »klar« war. Jeder Druck und jedes »Belauern« waren verschwunden. Schon in der ersten Runde war eine so dichte Atmosphäre enstanden, dass sich am Ende auch der Skeptischste der Drei auf diesen Prozess zu seinem Thema einließ. Die Zeit reichte aus und am Ende des Tages waren alle zufrieden, obwohl viele auch drängende Themen nicht zur Sprache gekommen waren. Vielleicht nicht nur im Scherz bedauerte einer, dass sie nun wieder in getrennten Limousinen zurückfahren mussten. Bei einem Telefonat einige Tage darauf fragte eine der Sekretärinnen verwundert, was geschehen sei, denn es würde sich Vieles nun wie von selbst fügen und Hand in Hand gehen.
Natürlich geht es nicht immer so glatt. Doch statt von Kultur zu sprechen war es gelungen, Kultur und deren Wirkung spürbar zu machen. An dieser Stelle soll nicht didaktisch durchbuchstabiert werden, was hier geschehen ist. Doch kennen viele ähnliche Gegebenheiten. Fehlende Wirksamkeit und sich nicht lösender Zeitdruck sind oft die Folge ineffizienter Debatten, in denen nicht klar ist, um wen oder was es wirklich geht, wer was wie versteht und braucht und wie Beziehung spezifisch und konkret dafür gestaltet werden könnte etc. Erlebte und unter Anleitung aktiv gestaltete Kontrasterfahrungen dazu überzeugen sofort, auch wenn die Betroffenen nicht benennen können, was dabei genau geschieht, anders ist und wodurch dies bewirkt wurde. Offenbar kann das dennoch auf andere Situationen übertragen werden und hat Ausstrahlung auch auf solche, die nicht direkt eingebezogen waren. Klar ist, dass eine Schwalbe da keinen Sommer macht, doch kann dies ein Einstieg sein in die Bereitschaft solche Kultur zu pflegen, damit sie sich einschleifen kann.
2.3.3 Wesensentwicklung von Organisationen?
Eine Story zum Schmunzeln als Einstieg zum Thema Wesensart einer Organisation:
Gehirngerechte Bildung bauen
Vor einem Verband der Bauindustrie begeisterte ein Gehirnforscher mit einem Vortrag zu seinen Vorstellungen von einer neuen gehirngerechten Pädagogik. Ergriffen von Menschen der Tat für ein Projekt dazu gesammelt und es kamen beachtliche Zusagen i.H.v. 2 Millionen Euro zusammen. Gerührt erwartete der Gehirnforscher nun, damit interessante Experimente machen zu können. Doch dem Wesen des Verbands entsprechend wurde beschlossen, mit dem Geld etwas zu bauen, die Frage war nur, was. Dies ließ den Gehirnforscher etwas ratlos werden.
Mit dem Begriff Entwicklung (ent - wickeln) ist klassisch die Idee einer »natürlichen Wesensart« eines Organismus verbunden. Diese Wesensart entfaltet sich unter Anpassung an die Umweltbedingungen, doch ist sie im Wesentlichen vorprogrammiert, denn aus einem Birkensetzling kann keine Eiche werden. Wesensart ist durch einen schöpferischen Akt schon begründet und entfaltet sich im Lebensvollzug nur noch. Bei einem Unternehmen kann dies ganz anders verlaufen. Ein Stromversorger kann zum Finanzinvestor mutieren. Die Wesensart einer Organisation ist keine Natur-, sondern eine Kulturerscheinung. Das ist auch der Grund, weshalb OE kaum ohne Kulturentwicklung zu denken ist. In welchen Medien die »Kultur-DNA« kodiert ist, ist eine spannende Frage. Der herrschende Geist kann sich z.B. in Statuten manifestieren, in Strukturen, Geschäftsmodellen, aber auch in Haltungen und Gewohnheiten der Organisationsmitglieder. Jeder Betrachter muss diese Dimensionen für sich bestimmen, wobei meist solche Dimensionen in den Vordergrund gehoben werden, über die man glaubt Entwicklung beeinflussen zu können. Nicht immer sind diese die entscheidenden, so dass es auf jeden Fall ratsam ist, mit anderen Wirkkräften als den bekannten, bevorzugten oder beeinflussbaren zu rechnen. Von dem als beeinflussbar vordefinierten System unterscheidet man meist eine als nicht beeinflussbar angesehene, aber zu berücksichtigende Umwelt. Auch die Umwelt ist nicht natürlich, sondern meist gleichermaßen kulturell geprägt. Zudem sind die Grenzen zwischen innen und außen nicht unbedingt fest. Selbst Unternehmensgrenzen lösen sich heute durch Netzwerke und Verflechtungen aller Art immer mehr auf. Dies verlangt nach einer bewussten Bestimmung von System und Umwelt, je nach Betrachtung.
Geht man davon aus, dass zur Weiterentwicklung einer Organisation Ergänzungen oder Änderungen notwendig sind, die sich nicht aus bloßer Weiterentwicklung ergeben würden, spricht man eher von Changemanagement (Schmid 2012a).
2.4 Zu Position III: Perspektiven, Prinzipien und Haltungen
Der OE-/KE-Ansatz des isb ist mehr durch Perspektiven, Prinzipien und Haltungen definiert als durch Schemata für Ereignisse oder Vorgehensweisen.
Nachdem die OE als Entwicklung menschlicher Systeme nun oben durch das Arbeiten in der Organisation und mit den dort Verantwortlichen mit Fokus OE charakterisiert wurde, sollen hier statt der Empfehlung bestimmter Vorgehensweisen Steuerungsgesichtspunkte dargestellt werden. Diese und nicht typische Ereignisse sind es, an denen man diesen Ansatz erkennt. Die Ereignisse, die nach solchen Gestaltungsprinzipien inszeniert werden, können situativ sehr verschieden sein. Je nach Besonderheiten der Organisation können vorhandene Ereignisse für OE genutzt und spezielle dafür geschaffen werden (Schmid 2004a u. 2004b). Dafür können kaum Schemata oder Methoden vorgegeben werden. Obwohl das Repertoire ohnehin zu groß ist, um hier dargestellt zu werden, muss vielleicht trotzdem etwas neu kombiniert oder konzipiert werden. Konkrete Vorgehensweisen werden in den jeweiligen Projekten und Kontexten definiert und bestimmen sich auch aus dem Repertoire der Akteure. Am besten passen die von uns formulierten Prinzipien zu den am isb gelehrten Vorgehensweisen. Doch gibt es auch andere Vorgehensweisen, die mit den isb-Prinzipien gut verträglich sind. Aber es gibt auch Vorgehensweisen, die sich nicht mit ihnen vertragen, was die Metapher Wer Fischbestand schonend fischen will, kann nicht mit engmaschigen Netzen bis zum Grund fischen wollen, verdeutlichen soll. Wenn man kampagnenmäßig zum großen Kick-off einlädt und dort hauptsächlich zu begeistern sucht, dann lässt sich das kaum mit den isb-Prinzipien vereinbaren. Wer isb-Prinzipien nicht wenigstens integrieren will, für den ist der isb-OE-Ansatz auch nicht geeignet.
2.5 Zu Position IV: Bewährte isb-Konzepte und Prinzipien
Bei OE-bezogenen Lernprozessen werden bewährte Prinzipien des isb konkret realisiert und für die multiplikative Verbreitung gelernt. Entsprechend unserem Ansatz (siehe Kap. 14) sind diese Perspektiven zueinander nicht eindeutig abgegrenzt, noch sind sie vollständig. Hier werden zunächst 10 Betrachtungsweisen nebeneinandergestellt, die abgewandelt, ausdifferenziert oder zusammengefasst, reduziert oder erweitert werden können, je nachdem, welcher Betrachtung sie dienen sollen.
2.5.1 Rahmenklärungen und Kontrakte
Hier geht es um anfängliche Rahmenklärungen mit den Entscheidern bzw. das Sichern, dass und wie die Rahmenklärung und Autorisierung nach und nach hergestellt werden soll. Wenn möglich, sollte mit zentral Verantwortlichen gestartet und geklärt werden, wer Drehbuch- und Regieverantwortung, wer Absicherung in der Hierarchie und bei wesentlichen Partnern (Schirmherrenfunktion) übernimmt. Dadurch gibt es für Externe definierte Verantwortliche in der Organisation, mit denen Macht-, Verantwortungs- und Ressourcenfragen gelöst werden können. Falls OE irgendwo von der Mitte der Organisation ausgehen soll, ist zu klären, über welche Prozesse Autorisierung nachgeholt und die OE-Maßnahme in die gesamte OE-Strategie eingebunden werden soll. Falls OE stockt, wie funktioniert das Rückspielen an die Verantwortlichen in der Organisation? Solche Fragen gehören zur Rahmenklärung.
2.5.2 Freilandtauglichkeit statt Treibhauseffekte
Statt »edle Sonderfertigungen« Prototypen für »freilandtaugliche Entwicklungen«. Es macht wenig Sinn, unter Expertenanleitung und exquisiten Bedingungen zustande gekommene Pilote als Vorlage für die alltägliche Realisierung durch mittelmäßig kompetente und engagierte Gestalter zu nehmen. Pilote sollten von Vornherein auf das spätere Betreiberniveau abgestellt sein. Dadurch muss man entscheiden, wie anspruchsvoll die Inszenierungen sein dürfen, damit sie nach Abzug der Neuinszenierungsregisseure und der Stars, von der Tagesregie mit dem Durchschnittsensemble auf Niveau gehalten und weitervermittelt werden können. Oder umgekehrt gefragt: Welches Niveau müssen die Alltagsbetreiber erlangen und wie soll dieses Niveau gehalten werden?
2.5.3 Realistisch getimtes und umsichtiges Vorgehen
Lernprozesse erlauben kein Draufgängertum, keine Kraftakte, erst recht nicht, wenn sie aus der Not oder Selbstüberschätzung statt aus Kraft und Übersicht geboren werden. Gas geben ist nur empfehlenswert, wenn die Spur stimmt und die Manövriersicherheit nicht verlorengeht. Lieber in begrenzten Bereichen ergebnisoffen experimentieren. Es sollte immer die Freiheit für einen Plan B bezüglich Wirklichkeitsentwurf und Vorgehen erhalten bleiben. Kein Verstören alter Strukturen ohne Vorstellungen vom Danach und Vorbereiten eines geordneten Übergangs.
2.5.4 Kristallisierendes Vorgehen und Probeinszenierungen
Der Verantwortliche sollte nicht gleich flächendeckende Konzepte oder Breitenlösungen anstreben, sondern experimentierendes Vorgehen, bis deutlich wird, was wie wo geht und was nicht. Zunächst sind nur Themen, Personen, Ebenen einzubeziehen, die am Anfang oder später im gegenwärtigen Stadium gebraucht werden und die auch hinreichend betreut werden können. Erweiterungen folgen dann, wenn durch Inszenierungen Exemplarisches gelungen ist und Erweiterung nach diesen Prinzipien durch die bereits Einbezogenen gestaltet werden kann. Differenziertes Vorgehen soll leitend sein, das die Besonderheiten, unter denen es dann nachhaltig gelebt werden kann, berücksichtigt. Was muss abgewandelt werden, um Anschlussfähigkeit an andere Prozesse, Strukturen und Kulturen zu begünstigen? Wer soll, darf, kann das tun? Kein Kampagnenprinzip oder erst dann, wenn bewährte Programme für breite Nutzung verfügbar sind und deren Einführung vorbereitet ist.
2.5.5 Multiplikationsfähige Anlage
Wenn im Kleinen erfolgreich begonnen wird, entsteht schnell der Wunsch nach Ausweitung in andere Themenbereiche, andere Abteilungen, andere Standorte, auf andere Geschäftsfelder oder auf andere Organisationen im Verbund. Wer soll diese Ausweitungen leisten? Manches kann auf speziell dafür vorgesehene Kräfte verlagert werden. Doch können verantwortliche Rollenträger im schon fortgeschrittenen OE-Prozess besonders kompetent und glaubwürdig als Multiplikatoren gegenüber neu Hinzukommenden auftreten. Wünscht man kollegiales Lernen vom vergleichbaren Funktionsträger, dann ist zu berücksichtigen, dass bei diesen dafür Kompetenzen, Motivationen und Kapazitäten vorhanden sein müssen. Dies sollte vielleicht schon bei der Auswahl der ersten OE-Verantwortlichen berücksichtigt werden und muss sich dann über die weiteren Verbreitungswellen fortsetzen. Kompetenzen für diese Formen kollegialen Lernens decken sich mit vielen OE-Kompetenzen, haben aber auch einige spezielle Anforderungen (Schmid et al. 2009b). In manchen Unternehmen werden vorbereitend Funktionsträger im OE-orientierten Coaching weitergebildet und bekommen zu 10-20 % ihrer Arbeit Gelegenheit, im Unternehmen in solchen Rollen tätig zu werden. Manche spezialisieren sich im Rahmen eines OE-Prozesses vielleicht sogar darauf, während andere zwar die Kompetenzen schätzen und verstehen, was gespielt wird, jedoch lieber in anderen Rollen mitwirken.
2.5.6 Komplexitätskontrollierendes Vorgehen
Komplexitätsreduktion findet meist entweder durch starke Schematisierung in Breitenansätzen oder durch exemplarisches Entwickeln in Experimenten und Insellösungen statt. Natürlich kommen bei letzterem meist nicht gleich flächendeckende Lösungen raus, wie sie oft gewünscht werden. Dafür hat man nicht die ganzen Folgeprobleme durch Schematisierungen, die dann oft doch nicht passen und daher mit Bypass-Lösungen oder subversiven Abweichungen beantwortet werden. Wie bei allen Dienstleistungen erzeugen zu einfache Lösungen beim Anbieter komplexe Probleme beim Kunden, wenngleich auch oft so verschoben, dass man sie nicht als Folgen anfänglicher Vereinfachungen erkennt. Angemessen komplexe und auf Integrierbarkeit ausgelegte Ansätze seitens der Dienstleister macht OE für Kunden hingegen leistbar. Manche Kunden wollen zu einfache Lösungen für komplexe Probleme und finden auch solche Dienstleister, zahlen aber auch an anderer Stelle den Preis dafür.
2.5.7 Transferprobleme minimierendes Vorgehen
OE ist erst abgeschlossen, wenn die eingeführten neuen Entwicklungen im Regelvollzug des Alltags selbstverständlich (zur Kultur) geworden sind. Transferprobleme entstehen dadurch, dass man separat von nicht Alltagsverantwortlichen entwickelte Lösungen auf täglich Verantwortliche und in den Alltagsbetrieb übertragen muss. Zwar kann es zunächst aus Kapazitäts-, Motivations- oder Kompetenzgründen einfacher sein, OE zunächst abgetrennt vom Alltag und den Menschen, für die sie lebbar sein muss, zu gestalten, doch muss beides letztlich doch geleistet werden. Erst dann kann OE als erfolgreich betrachtet werden. (Manchen Chirurgen wird nachgesagt, sie betrachten sich schon als erfolgreich, wenn die Operation technisch gelungen ist und der Patient an die Nachsorge abgegeben werden kann, auch wenn die Patienten danach nicht überleben oder schlecht leben. Misst man den Erfolg jedoch an der Lebensqualität von Patienten, dann gelten sicher andere Kriterien.) Wenn das Einbeziehen der Menschen, die ein System leben müssen, zu lange verschoben wird, dann kann es dazu kommen, dass die Passung nicht mehr hergestellt werden kann. Entweder passen die OE-Maßnahmen für diese Menschen nicht wirklich oder sie können oder wollen sich nicht anpassen. Vielleicht müssen eben auch andere betraut werden, doch dann muss vorher geklärt werden, ob und wie dies möglich ist. Durch das sukzessives Einbeziehen derer, die OE-Prozesse letztlich selbstgesteuert tragen müssen, wählt man zunächst einen anspruchsvolleren Weg mit bescheideneren Anfangserfolgen. Dafür hat man weniger das Problem, Lösungen zu haben, die nicht wirklich selbsttragend gelebt werden können.
2.5.8 Reifegrade der Akteure berücksichtigen
Reifegrade der betreibenden Individuen, aber auch der tragenden Organisation sollte man von Anbeginn berücksichtigen. Dazu muss man sich einerseits ein Bild von den Reifegraden der verantwortlichen Initiatoren und Betreibern für OE wie auch andererseits vom Reifegrad der Organisation, die OE tragen soll, machen. Selbst wenn die OE-Initiatoren persönlich kompetent sind, kann ein OE-Prozess nur so gut versorgt werden und vorankommen, wie auch die Organisation, in der er stattfinden soll, kompetent ist oder im Zuge der OE gemacht werden kann. Sind sowohl Initiatoren und Betreiber wie auch OE-Berater unerfahren, dann verschätzen sie sich in vielen Dimensionen. Zu den natürlichen Problemen einer OE schaukeln sich noch Beurteilungs- und Steuerungsfehler hoch und sprengen die beherrschbare Komplexität.
Nähere Erläuterungen hierzu siehe unter Kapitel 2.6.3. Werkstätten als Medium des OE-Lernens.
2.5.9 Ressourcenschonendes Vorgehen
Es gilt, nur soviel Änderung anzugehen, wie mit den vorhandenen Kräften und im vorgesehenen Gestaltungsbogen auch geleistet werden kann. Wer in alle Richtungen loslaufen will, bleibt stehen. Man kann Inseln bilden, auf denen relativ störungsfrei experimentiert werden kann, und man sollte Spielraum für Lernschleifen lassen. Die Einbeziehung von weiteren Akteuren erfolgt nur dann und soweit als dafür schon Drehbücher entworfen und Regieverantwortlichkeiten definiert sowie Kapazität und Bereitschaft zur Integration der Neuen vorhanden sind. Damit soll der verbreiteten Idee, dass jeder Betroffene zum Entwickler werden muss, widersprochen werden (Der Slogan »Betroffene zu Handelnden machen« kann nicht bedeuten, jeden Maurer beim architektonischen Entwurf mitreden zu lassen). OE-Verantwortliche (und das sind alle mit auch strategischen Führungsaufgaben) müssen die Entwicklung mitverantworten, auch wenn sie Expertise und Konzepte von OE-Fachleuten dabei einbeziehen. Expertise kann delegiert (durch Berater abgedeckt) werden, Verantwortung nicht. Nicht-OE-Verantwortliche können die zu probierenden Varianten daraufhin durchspielen, ob sie nachher übernommen und mitgetragen werden können. Doch dies ist eine andere Beteiligung, als OE-Maßnahmen aktiv zu entwerfen oder zu gestalten. Alle Prozesse sollen so angelegt sein, dass Gestalter in Bezug auf die anstehende OE das Notwendige dazulernen können. Dies an Schulungen zu delegieren, kommt dem Versuch gleich, jemanden zur Schauspielschule zurückzuschicken, anstatt ihm zu ermöglichen, seine spezifische Rolle im Stück unter guter Regie auch zu finden. Dass daneben Qualifizierungen sinnvoll sein können, steht auf einem anderen Blatt.
2.5.10 Kultur-Prinzipien in allen Teilprozessen sichern
Kultur-Prinzipien sollten in allen Teilprozessen gesichert werden, damit gewünschte Endprozesse und Kultur schon auf allen Ebenen auf dem Weg geübt werden können. Mit jeder OE ist automatisch auch eine KE verbunden. Die realisierten Beispiele machen Schule auch auf Ebenen, die nicht unbedingt geplant sind. Da Kultur-Prozesse weitgehend unbewusst gelernt und weitergegeben werden, etabliert sich Kultur von Anfang an, was nachträglich nur schwer korrigiert werden kann. Daher sollte die durch OE gewünschte Kultur schon während des OE-Prozesses realisiert werden.
2.6 Zu Position V: Lern- und Arbeitsformen von OE/KE
Bisher sollte deutlich gemacht werden, dass es sich auch dann um OE handelt, wenn die Settings und Methoden personenbezogen sind, wenn die Selbststeuerung von Zuständigen auf Organisationssteuerung und -entwicklung zielt und OE-Perspektiven maßgebend sind. Nun sollen Beispiele für Arbeitsformen für OE/KE oder zum Erlernen von OE/KE im Rahmen von OE-Vorhaben genannt werden. Ausführlichere Darstellungen von Dimensionen und Arbeitsformen des OE-/KE-Lernens finden sich in Kapitel 8–11. Im Kapitel 8 wird auch auf Nutzungsmöglichkeiten von isb-Know-how dafür hingewiesen.
2.6.1 Dialogisches und exemplarisches Vorgehen
Dialog wird oft gleichgesetzt mit Zwiegespräch, meint aber genereller »durch das Wort« vermittelt. Hierbei ist das persönliche Wort gemeint, ein Sprechen, bei dem die Person dahinter mit ins Bild kommt und bei dem man sich weit über den reinen Inhalt hinaus gegenseitiges Verstehen ermöglicht. Im OE-Zusammenhang ist speziell das Sprechen zwischen Akteuren von OE/KE gemeint, also vorranging dialogische Klärung mit Verantwortlichen in OE-Prozessen. Dieses Sprechen ist an Begegnung und wechselseitige Abstimmung über Bedeutungen und Wirkungen gebunden. Nur so kann gegenseitiges Verstehen und die Entwicklung gemeinsamer Wirklichkeiten genügend verlässlich hergestellt werden. Alles Propagandistische und Breitenwirkungen werden hier zunächst zurückgestellt. Die Klärung eines OE-Vorhabens z.B. erfolgt vielleicht vorab mit Einzelnen und wird dann auf wachsende Zirkel der für das OE-Vorhaben Wichtigen ausgeweitet. Man übt sich im exemplarischen gemeinsamen Klären von OE-Vorhaben und in der Steuerung von Kooperations- und Führungsbeziehungen, von Strategieentwicklung und Umsetzung in der Organisation.
Viele isb‘ler arbeiten bevorzugt so: Z.B. wird ein Führungskreis zusammen mit wichtigen anderen Personen zu einem Thema versammelt. Dann werden zu diesem OE-Thema die zentral Verantwortlichen in ihren Organisationsrollen in einen Innenkreis eingeladen. Sie bilden dort eine Verantwortungsgemeinschaft bezogen auf das OE-Anliegen, aber auch eine darauf bezogene organisationale Lerngruppe. Zunächst reflektieren die Protagonisten (evtl. mit beraterischer Hilfe) vor anderen, wo sie mit ihrer Selbststeuerung stehen, was sie von wem brauchen, um mit ihrem OE-Anliegen voranzukommen, wie sie sich das Voranbringen des OE-Anliegens vorstellen und welche Fragen sie dabei zur Beziehungsgestaltung haben. Dabei können Sach-, Verantwortungs-, Rollen- und Interessenklärungen so vorgenommen werden, dass die dafür wichtigen anderen Mitarbeiter verstehen, was die Steuerungsfragen der Hauptverantwortlichen sind, und welche Vorstellungen von Verantwortungs- und Beziehungsgestaltung diese dazu haben. Als Betroffene können sie dann selbst zunächst für sich und dann in der Beziehung in den Klärungsprozess gehen, bei einiger Erfahrung können sie auch als kollegiale Supervisoren unabhängig von der eigenen Rolle im OE-Prozess hilfreich sein. Zwar werden Settings und Methoden verwendet, wie sie aus Lerngruppen aller Art bekannt sind, anders ist jedoch, dass ein echtes OE-Projekt im Fokus steht, für das man in seiner Organisationsrolle verantwortlich handelt. Für eine zweite Ebene der allgemeinen Personenqualifikation fällt bei diesem Prozess jedoch vieles ab. Und gemeinsam entwickelte Formen des gemeinsamen Lernens können auch ein wesentlicher Bestandteil einer gewünschten OE-Kultur sein.
2.6.2 Vertikale Teamentwicklung
Wenn von Team die Rede ist, denkt man meist an strukturelle Zugehörigkeiten, wie »das Leitungsteam« oder »die Außendienstler«. Wir verwenden einen anderen Teambegriff: Team als Verantwortungsgemeinschaft (Schmid 2005b). Zum Team gehören recht flexibel diejenigen, die für die Lösung einer aktuellen Herausforderung zusammenspielen müssen. Damit können viele gemeint sein, sowohl abteilungs- und bereichsübergreifend wie auch hierarchieübergreifend. Unter dem Begriff Value Network machen solche Gemeinschaften auch nicht mehr an Unternehmens- oder Branchengrenzen halt. Wenn es zu viele werden, die im Prinzip eingebunden werden könnten, wird es mit der Handhabung schwierig. Deshalb sollten situativ Überlegungen angestellt werden, wen man für einen bestimmten Fokus aktuell im Team braucht. Wenn es um erste Klärungen, Entwicklung und Lernen geht, braucht man zunächst nicht alle, sondern Stellvertreter, so dass bezüglich der aktuellen Herausforderung an Beispielen gelernt und entwickelt werden kann. Daraus folgt, dass der Fokus der Entwicklung bestimmt, wer aktuell zum Team gehörig betrachtet wird und wen man für die nächsten Schritte in weitere Teamentwicklungsmaßnahmen einbeziehen will.
Im Unterschied zum üblichen Verständnis hat sich am isb dafür der Begriff vertikale Teamentwicklung eingebürgert. Damit wird betont, dass neben Gleichgestellten (horizontal) auch Vorgesetzte und Untergebene (vertikal) zum Team gehören, wenn sie für den Fokus der Teamentwicklung in ihrer Rolle Verantwortung tragen. Vertikale Teamentwicklung (Schmid/Hehmann 1998b) sieht äußerlich





























