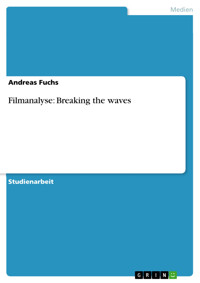Chronik des Klosters Mattenthal
Regel des heiligen Benedikt, Kapitel LVII / 7:
Ut in omnibus glorificetur Deus –
Damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde.
21. Juni, am Tag des heiligen Aloisius von Gonzaga
„Sie meinen also, Basil sei abgehauen?“
Abt Othmar saß mir entspannt gegenüber. Seine rechte weiße Hand zog mit einem der Spielzeugautos schnurgerade Linien auf der Schreibtischplatte. Diese Marotte verunsichert. Immer holt er sich aus der Schachtel mit Spielzeug einen Gegenstand und tut damit herum. Bei den Kindern, die, aus welchen Gründen auch immer, zum Abt gerufen werden, mag das zur Auflockerung nützlich sein, bei einem Gespräch mit einem Mitbruder, auch wenn es nur ein kleiner Novize ist, halte ich das für verfehlt. Jedes Mal fühle ich Unbehaglichkeit. Vielleicht irritiert der totale Gleichmut, mit dem er alles angeht und den er durch diese Spielereien unterstreicht.
Zurück zu unserem Pater Basil! Eigentlich Dr. phil. Martin Perhamer, im Kloster jedoch Basilius genannt. Nicht gerade ein üblicher Name. Aus Gründen, die mir unbekannt sind, hat es in Mattenthal jedoch immer einen Basilius gegeben. Ganz hinten in unserer Gruft ist eine Tafel eingelassen, die aus dem hohen Mittelalter stammen muss. Mit einiger Mühe kann man den Namen „Basilius“ entziffern, aber keine Jahreszahlen.
Den Mitbruder Perhamer jedenfalls nennt ein jeder Basil – zumindest wenn er anwesend ist. In seiner Abwesenheit ist er der Basilisk, und das nicht nur seiner dicken Brillengläser wegen, durch die seine hellen Augen vergrößert scheinen. Es ist seine Zurückgezogenheit, seine Abgeschiedenheit, selbst innerhalb der Gemeinschaft. Beim Chorgebet ist er stets der Erste und vernachlässigt keine seiner klösterlichen Pflichten, wenn ich auch „in aller Demut“ anmerken darf, dass seine Pflichten sich im Grunde im Schreiben unserer Chronik erschöpfen. Undurchsichtig, schweigsam, in sich gekrochen, gleicht er einem Olm, einem Reptil, das außerhalb der Chor- und Essenszeiten höchstens in seinem Garten zu finden ist. Nur manchmal erlebt man ein Rucken des fast kahlen Kopfes, eine überraschend rosige Zunge, die vorschnellt, und eine ironische Bemerkung, die genau an dem Punkt verletzt, wo man schwach und verwundbar ist.
In jedem Fall ist der Basilisk verschwunden – und so wird seit heute mir die Pflicht zuteil, die Chronik Mattenthals fortzuführen. Es ist eine große Ehre für mich, bin ich doch nur ein unbedeutender Novize, der inständig hofft, in den ältesten Orden der heiligen katholischen Kirche aufgenommen zu werden. Unser hochwürdigster Abt Othmar hat mich mit diesem Amt betraut. Alle meine Beobachtungen solle ich aufschreiben, auch meine eigenen Gedanken und Schlussfolgerungen. „In aller Demut und in aller Offenheit“, so trug er es mir auf, „wobei die Demut diesmal die zweite Stelle einnimmt, mein junger Anselm. Und vergessen Sie nicht: Sie schreiben einzig zu meinem persönlichen Gebrauch.“
Vorerst sollte ich den Computer benutzen, den Basilius sich entgegen der Klosterregel zugelegt hatte. Später würde Abt Othmar entscheiden, ob man zum Schreiben mit Papier zurückkehren und Seite um Seite einen Folianten füllen sollte, der sich zu den anderen kaum gelesenen Klosterberichten im Regal gesellen würde.
Es war eines der Marienmädchen, das an die Tür meiner Zelle klopfte. Schon seit einiger Zeit wird die Klausur auch für halbwüchsige Mädchen durchbrochen, doch noch immer verblüfft es ein wenig, wenn zu den Buben in ihren schwarzen Kitteln nun Mädchen in grauen, knöchellangen Kleidern durch die Gänge laufen. Sie sind leiser, bewegen sich hurtiger, klopfen mit einer gewissen Ehrfurcht an die Zellentüren, wenn sie mit ihren kleinen Botengängen unterwegs sind. Als wenn sie Angst hätten in dem Labyrinth der Flure. Angst auf verbotenem Gebiet, vor den Bildern alter Männer in ihren Kukullen wie vor den Bildern aus der Heiligengeschichte. Schräg und doch fasziniert sehe ich manchen Blick aus Kinderaugen zum Martyrium des heiligen Johannes wandern. Es ist nicht das gütige Gesicht des in den Wolken thronenden Herrn, es ist der stürzende Blutstrahl, der gleichsam geschleuderte Kopf, und es sind die Augen der mit der Schale wartenden Salome, welche die Fantasie beleben und die kleine Seele frühzeitig prägen.
Ich weiß nicht, wie lange die Kleine schon an meine Zellentür klopfte. Mit meinen Gedanken war ich bei der nachmittäglichen Novizenunterweisung „Keuschheit nach der Regel des heiligen Benedikt im Licht der Gnade“. Pater Notker, unser Novizenmeister, lässt uns nichts durchgehen, und es ist mein Bestreben, unter den Novizen der Erste zu sein. Das ist nicht einfach bei nun acht neu ins Kloster eingetretenen, in Liebe zu Gott erglühenden Männern. Aber es ist auch nicht einfach für Pater Notker, nach so langer Leere in Mattenthal plötzlich einen Haufen junger Burschen zu unterweisen.
Endlich vernahm ich das dünne Pochen. „Herein in Gottes Namen!“ Die Tür öffnete sich. Das Marienmädchen hatte ich schon irgendwo gesehen, wahrscheinlich beim Gottesdienst in der vordersten Bankreihe.
„Hochwürdiger Frater Anselm, schnell kommen, sagt der heilige Vater Abt. Ganz schnell!“ Mit hüpfenden Schritten lief das Mädchen vor mir her durch den langen Flur bis zu dem schmiedeeisernen Tor, das die obere Klausur vom profanen Klosterbereich trennt. Ohne auf mich zu warten, stemmte es das Tor einen Spaltbreit auf, schlüpfte hindurch und ließ es wieder zufallen. Wie eine Maus verschwand sie im Winkel des Treppenhauses. Ich hörte das Klappern der Holzsandalen. Dann Stille. Hatte die Kleine auf dem nächsten Treppenabsatz haltgemacht? Beobachtete sie mich durch die Brüstung, während ich an der kleinen Prälatur vorbei zur großen hastete? Manchmal sind mir trotz allem diese Kinder unheimlich. Sie wissen mehr, als man annehmen mag, beobachten andere Dinge und ziehen andere Schlüsse, von denen ich nicht weiß, ob sie falsch oder richtig sind.
Wie sehr hat sich doch die klösterliche Welt verändert, seit wir unsere Pforte für das Projekt Formosus’ II. geöffnet haben. „Bringet alle Kinder zum Herrn!“ lautet das Motto, und sie kommen in Scharen:
Vertreter staatlicher Stellen wie drogensüchtige Mütter und verzweifelte Väter. Zu Gesicht bekommen wir sie nie. Wie es Vorschrift ist, wenden wir uns ab, wenn die Glocke in der Kammer hinter den Wirtschaftsgebäuden schrillt und anschließend jemand davonschleicht, - rennt oder in ein Auto mit laufendem Motor springt. Die Kleinen, die in der Kammer warten, nehmen wir bei uns auf.
Trotz meines guten Willens, trotz meines Betens habe ich den Zugang zu den Seelen der geistig verwirrten Kinder, die wir Marienkinder nennen, noch nicht finden können. Noch immer verspüre ich ein leichtes Grauen, und doch weiß ich, dass der Herr sie so gewollt hat und sie ihm im Paradies besonders nahestehen werden. Ich wünschte, sie wären mir weniger fremd. Ich bemühe mich und nehme Buße für meine Haltung bereitwillig auf mich, bisher allerdings mit wenig Erfolg. Stets wurde mir Pater Basilius in dieser Hinsicht als Vorbild anempfohlen, doch damit ist es nun wohl vorbei.
Es sei denn, der verschwundene Basilisk taucht unverhofft wieder auf – und Abt Othmar verzeiht ihm seine Sünden, auf die ich später noch zu sprechen kommen werde. Dann brabbelt er wieder mit den Marienkindern, erzählt ihnen seltsame Geschichten, verschwindet in seinem Garten und ist uns allen ein Ärgernis.
Vorerst aber war er erst einmal verschwunden.
„Sie meinen also, Basil sei abgehauen?“
So ist er, unser Abt Othmar. Er kommt unerfreulich rasch und drastisch auf den Punkt.
Ich fand den Begriff „abhauen“ unpassend. Mönche hauen nicht aus einem Kloster ab. „So habe ich das nicht gemeint“, wandte ich vorsichtig ein. „Aber fest steht doch nun einmal, dass Pater Basil seit zwei Tagen spurlos verschwunden ist. Er war nicht beim Chorgebet, und niemand hat ihn gesehen. Ich dachte, er sei bei Verwandten oder bei einem Arzttermin in Luzern, aber Sie sagen mir, das ist nicht der Fall. Also hat er wohl die Gemeinschaft verlassen.“
Abt Othmar legte die Fingerspitzen beider Hände wie betend unter sein Kinn. „Und wo liegt der Unterschied zwischen Ihrem lyrischen ‚verlassen‘ und meinem schlichten ‚abhauen‘? Ich sehe keinen. Nur wundere ich mich, dass Ihnen diese Idee als Erstes kommt. Basil packt seine Sachen, zieht den Habit aus und verschwindet klammheimlich aus dem Kloster? Ich bitte Sie! Basil ist fast vierzig Jahre bei uns. Wenn er hätte gehen wollen, so hätte er es mir gesagt. Kann es sein, dass ich da eine gewisse Antipathie bemerken muss? Sie hätten es wohl gerne, wenn Basil – bleiben wir ruhig bei dem Ausdruck, der Ihnen missfällt – abgehauen wäre?“ „Wenn ich ehrlich sein darf ...“, wagte ich mich vor.
„Sie dürfen.“
„Ja dann – Antipathie möchte ich es keinesfalls nennen, aber einer gewissen Verwunderung würde ich schon gern Ausdruck geben.“
„Dann raus damit. Also – was nervt Sie?“
„Nun, im Grunde tut Pater Basil hier doch nichts. Während wir alle unsere Aufgaben erfüllen, verschwindet er in seinem Garten, züchtet Rosen und gibt von seiner Blütenpracht nichts für den Altarschmuck ab. Und was er im Winter macht, weiß kein Mensch. Er ist kein ... klösterliches Vorbild.“
Sanft wie ein schnurrendes Kätzchen erwiderte der Abt: „Meinen Sie nicht, dass die Einteilung der klösterlichen Aufgaben Sache des Abtes ist? Irgendwo steht so etwas in unserer Regel. Vergessen Sie nicht, dass Basil von mir beauftragt ist, die Chronik unseres Klosters zu führen. Ich bin überzeugt, dass er das mit größter Sorgfalt tut. In unserer jetzigen Situation des Umbruchs, der Neubelebung der Klöster, der Kirche selbst, ist gerade die Chronik enorm wichtig. Aber kommen wir zur Sache.“
Abt Othmar hatte wieder eines seiner Spielzeugautos in der Hand und ließ es hin und her rollen.
„Fakt bleibt, dass Basil seit vorgestern verschwunden ist. Am Montagabend hat Placidus ihn noch gesehen, und seither weiß ich nicht, wo er ist oder sein könnte. Das Gerücht mit dem Verwandtschaftsbesuch oder dem Arzttermin, dem Sie aufgesessen sind, habe ich übrigens selbst in die Welt gesetzt.“
Er bemerkte mein Erstaunen, tastete ein wenig unsicher an seinem goldenen Pektorale und fuhr fort: „Manchmal muss auch ein Benediktiner jesuitisch denken, mein Lieber. Der Zweck heiligt die Mittel.“
Auf seinem Schreibtisch verschob er ein grünes Auto von links nach rechts. „Basil ist verschlossen, vielleicht weil er zu viel gesehen hat. So genau will ich das gar nicht wissen, eines aber weiß ich mit absoluter Sicherheit. Er ist nicht abgehauen. Dafür würde ich mein Brustkreuz versetzen und bis zu meinem Lebensende in der Station Maria/Johannes den Babys die Windeln wechseln. Wobei ich bisweilen ohnehin denke, dass dieser Job mir lieber wäre als mein jetziger.“ Die Hand mit dem Spielzeugauto hielt auf der Tischplatte inne. „Ich mache mir Sorgen, Anselm.“
Es verursachte mir ein seltsames Hochgefühl, dass mein Abt mit mir über seine Sorgen sprach. Mit mir, nicht mit einem bedeutenden Mitglied des Konvents! Um mich dessen würdig zu zeigen, dachte ich so konzentriert wie nur möglich nach.
„Dass Sie sich Sorgen machen, kann ich gut verstehen, aber es sind erst zwei Tage, Vater Abt. Vielleicht hat er vergessen, sich an der Pforte abzumelden, und ist wirklich beim Arzt.“ „Glaube ich nicht. Basil ist die Korrektheit in Person. Wenn er Geld für ein Paar neue Socken brauchte, tauchte er bei mir nach Voranmeldung auf und bat darum. Basil vergisst nichts.“ Meine neue Rolle stieg mir zu Kopf. Gewichtig legte nun auch ich meine Finger ans Kinn. „Dann müssen wir wohl an ernstere Dinge denken. Ich nehme an, das haben Sie bisher nicht getan?“
Seine äbtliche Gnaden schüttelte unwirsch den Kopf: „Ach was! Meinen Sie, ich bin von gestern? Er könnte irgendwo auf dem Klostergelände zusammengebrochen sein. Kreislaufkollaps, Herzinfarkt ...“
Ich nahm meinen Mut zusammen und wagte es: „Oder er hat sich ...“
Mit heller, fast brüchiger Stimme beendete Abt Othmar meinen Satz: „Oder er hat sich umgebracht und hängt da an einem Sparren. Denken Sie, ich habe daran nicht auch gedacht? Ich habe mit Bruder Placidus jeden Winkel in den Klostergebäuden durchsucht, natürlich zuerst Basils Zelle, danach aber wirklich den gesamten Rest. Sogar die Schuhkammer und die alte Duschanlage, die keiner mehr benutzt. Das ganze Klostergelände und jedes Wirtschaftsgebäude haben wir durchkämmt. Nichts. Da lag keiner, und da hing auch keiner. Keller und Speicher waren ordnungsgemäß verschlossen, und Basil hatte, soweit ich weiß, keinen Schlüssel.“
„Aber wenn er einen gehabt hätte, hätte er von innen zuschließen können, nicht wahr?“ „Gut gedacht. Hilft aber nichts. An sämtlichen Türen hängen alte Vorhängeschlösser. Und die waren unberührt.“
„Möglich wäre natürlich auch, dass Basil irgendwo orientierungslos herumirrt. Er ist kein junger Mann mehr. Ein Apoplex kommt in seinem Alter nicht selten vor.“ „Eine Variante, die man in Erwägung ziehen muss. Aber ich mag nicht daran glauben. Er war fit wie ein Turnschuh.“
Ich konnte mir die kleine Bosheit nicht verkneifen: „Gartenarbeit ist eben gut für die Gesundheit.“
„Ihre Spitzen bringen uns nicht weiter. Wenn Sie es allerdings wirklich für möglich halten, dass Basil irgendwo herumirrt, dann macht mir das Angst.“
„Auch wenn es Ihnen nicht gefällt“, warf ich zögernd ein, „wir müssen wohl auch die Berge als Möglichkeit einbeziehen.“
„Was wollen Sie damit sagen? Dass er in eine Schlucht gestürzt sein könnte? Tögiberg, Drofelerspitze, Zockenbach ... Paradiesli. Gerade Letzterer wäre ein hübscher und beziehungsreicher Ort. Ich habe nie herausgefunden, weswegen man diesen gefährlichen Steilhang Paradiesli genannt hat. Aber was ist, wenn das alles nicht zutrifft? Wenn er weder abgehauen ist noch plötzlich gestorben ist, weder Selbstmord begangen hat noch hilflos herumirrt – welche Möglichkeit gibt es noch?“
Er ließ mir Zeit und beobachtete mich. Kein Autorädchen unterbrach die Stille. „Und?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Er könnte entführt worden sein.“
„Wie bitte?“, platzte ich heraus. „Wer sollte ein Interesse daran haben, einen völlig unwichtigen Benediktinermönch aus seinem Kloster zu entführen?“ „Eine Möglichkeit bleibt es trotzdem. Oder nicht?“
„Aber eine ganz und gar theoretische.“
„Pater Korbinian will am Montag nach der Komplet zwei fremde Männer in der Nähe von Basils Garten gesehen und das Geräusch eines aufheulenden Motors gehört haben.“
Ich zupfte erregt an meinem Skapulier. „Aber wir wissen doch alle, dass Pater Korbinian ein alter Herr mit enormer Sehschwäche ist und bisweilen trotzdem Dinge sieht, die, sagen wir – ungewöhnlich sind. Denken Sie nur an die Erscheinung der heiligen Scholastika letztes Jahr!“ Abt Othmar verzog verdrossen den Mund. „Ach, hören Sie auf mit dieser dummen Geschichte.“
„Im Übrigen war es nach der Komplet bereits stockdunkel“, fuhr ich fort. „Aber es wäre doch möglich“, beharrte Abt Othmar mit einer Spur von Unsicherheit in der Stimme.
Ich tat ihm den Gefallen: „Möglich wäre es. Ja.“
Der Abt erhob sich. „Was also schlagen Sie vor?“
Dass er mich um Rat fragte, erfüllte mich mit Stolz, auch wenn ich die Animositäten, die so etwas hervorrief, kannte. Als man ihn zum Abt wählte, bestand der Konvent aus elf alten Männern. Inzwischen sind wir vierundzwanzig, die vielen Jungen verdrängen die Alten und fordern damit Neid und Tücke heraus. Da mich mein Abt aber einmal darum bat, blieb mir nichts anderes übrig, als die Führung zu übernehmen: „Zuerst einmal muss der Konvent zusammengetrommelt werden. Es ist ja möglich, dass doch noch jemand etwas weiß. Dann brauchen wir Suchtrupps, selbstverständlich muss der örtliche Rundfunk verständigt werden und das Fernsehen, der Talsender. Und nicht zuletzt die Polizei. Wenn es Ihnen recht ist, werde ich das in die Wege leiten.“
Abt Othmar schaute still vor sich hin, dann sagte er sehr leise: „Es muss anders gehen, mein lieber Anselm.“
Noch nie hatte mich mein Abt „mein lieber Anselm“ genannt.
„Wäre es unserem Kloster etwas nütze, wenn man herausfinden würde, dass da ein Mönch sich selbst gerichtet hat? Und was könnte bei Presse und Polizei nicht alles herauskommen? Sie wissen doch selbst, dass diese Journalisten vor nichts haltmachen und die Kriminalleute ihre Nase in alles und jedes stecken. Ich möchte, dass die Sache diskret gehandhabt wird.“ Jetzt verstand ich. Er hatte Angst, die Selbstmordvariante könnte mehr als nur blanke Theorie sein, und ebendeshalb hatte er das Gerücht vom Arztbesuch in die Welt gesetzt. „Ich fürchte, an den Ruf unseres Klosters können wir im Augenblick nicht denken“, wandte ich ein. „Basil irrt irgendwo hilflos herum, liegt vielleicht verletzt in einer Schlucht oder tot im Wald. Bei allen Varianten muss schleunigst etwas geschehen. Sollte sich wirklich herausstellen, dass Basil sich selbst getötet hat, gibt es immer noch Möglichkeiten, das in den Augen der Presse herunterzuspielen. Geistige Verwirrtheit, Altersdemenz oder ein Unfall. Machen Sie sich darum keine Sorgen. Das kriegen wir schon hin.“
Mit einer fahrigen Geste schob mein geistliches Oberhaupt die Autos von der Schreibtischplatte. „Also schön. Mit Ihren Suchtrupps erkläre ich mich einverstanden. Aber mit nichts anderem. Ich wünsche absolute Diskretion. Ist das klar? Sie werden das schon machen, mein lieber Anselm. Sie sind der geeignete Mann.“
Es war mir klar, dass das kein Kompliment war, sondern eher das Gegenteil. „Nein, hochwürdigster Herr Abt, ich bin dafür nicht geeignet“, erwiderte ich gekränkt. „Ich finde Ihre Haltung verantwortungslos, vor allem dem armen Basil gegenüber. Es brennt in diesem Kloster, und wenn es brennt, kann man nicht erst diskret nach einem Gartenschlauch suchen.“
Abt Othmar zuckte zusammen, und ich erwartete einen donnernden Verweis. Stattdessen schob er nach einer Pause sein Pektorale in die Mitte der Brust und gewann seine Beherrschung zurück. „Frater Anselm“, begann er mit eiskalter Autorität. „Meine
Verantwortung als Abt, die Sie höchst ungehörig anzweifeln, zwingt mich, Ihnen etwas zu eröffnen, was außer mir in diesem Kloster niemand weiß. Wären die Umstände nicht, wie sie nun einmal sind, wären Sie der Letzte, dem ich es anvertrauen würde. So aber sage ich es Ihnen als Ihr Abt und sub sigillo. Ist das klar?“
Sub sigillo? Unter dem Siegel? Der Begriff stammte aus dem Mittelalter, als man kleine oder große Kleriker dazu verdonnerte, über Anrüchigkeiten und dunkle Geheimnisse zu schweigen. Wie passte das drohende „sub sigillo“ zu dem Verschwinden des Basilisken? Mit einer Demut, die nicht ganz echt war, senkte ich meinen Kopf und antwortete: „Ja, ich verspreche es, Vater Abt.“
Abt Othmar stand auf, brachte sein Skapulier in Ordnung und ging zu dem Tresor, der neben dem Betschemel stand. Umständlich holte er einen Schlüsselbund aus der Tasche seines Habits und wählte einen der Schlüssel. Dann öffnete er die mit goldenen Ranken verzierte Tür und griff mit beiden Händen in den Hohlraum. Wieder am Schreibtisch, legte er behutsam eine große, mit einem Purpurband umwickelte Pergamentrolle vor sich hin und daneben ein schmales, geöffnetes Kuvert. Hörbar holte er Atem, dann schob er mir das Kuvert zu. „Lesen Sie, Frater! Beachten Sie das Wappen auf dem Umschlag!“
Das Kuvert war aus weißem, dickem Papier. Vorne, unten links, tief und gelb eingeprägt, prangte das Wappen, das in der christlichen Welt jeder kennt: Zwei gekreuzte Schlüssel unter der Tiara – das Wappen des Heiligen Stuhls.
Meine Hände zitterten, als ich in den Umschlag griff. Ein Bogen handgeschöpftes Bütten, zur Hälfte beschrieben mit einer fahrigen, doch lesbaren Schrift. Natürlich kannte ich diese Handschrift, und die Unterschrift war nicht weniger bekannt als das Wappen. Das Schreiben war in Deutsch abgefasst. Kein Wunder, war doch der Verfasser einige Jahre Nuntius in unserem Land gewesen und ließ als Papst keine Gelegenheit aus, darauf hinzuweisen. Nur die Anrede war in Italienisch. Ich kann mich an jedes Wort erinnern:
Fratellino,
der Segen des Herrn sei mit Dir.
Ich weiß, dass Du zurückgefunden hast zu dem Weg, den der Herr zu gehen Dir aufgetragen hat. Gott hat Dir sicherlich vergeben, also tue auch ich es. Ich weiß nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Manchmal glaube ich, dass es nicht mehr lange dauern wird.
Der Delfin ernennt Sie, Pater Basilius Perhamer, Ordo Sancti Benedicti, hiermit zum Kardinaldiakon der heiligen katholischen und apostolischen Kirche. Alles Weitere können Sie der förmlichen Urkunde entnehmen.
Ich habe es in pectore getan. Pietro wird es Ihnen erklären. Sie können den Purpur tragen, dann wird man Sie eben vorher noch schnell zum Bischof machen. Wollen Sie dies tun, so
werden ich oder mein Nachfolger uns daran halten. Sie wissen ja, dass wir Päpste uns manchmal über den Tod hinaus kleine Kassiber zuschieben. Auch mündliche. Sie können den Purpur aber auch verleugnen. Dann wird kein Hahn danach krähen, auch der des heiligen Petrus oder dessen Nachfolger nicht. Eine Ablehnung jedoch ist nicht möglich. Denken Sie an den Gehorsam und die Verschwiegenheit, die Sie mir und der Kirche schulden ... Usque ad effusionem sanguinis, bis zum Vergießen Ihres Blutes. Aus diesem Grund tragen Kardinäle Purpur. Sie können meinen Nachfolger mitwählen, wenn Sie mögen. Er wird die Last nicht mehr tragen müssen. + Formosus II
PS: Vielleicht interessiert es Dich, dass Dr. Grassi nicht mehr in Rom ist. Ich nehme an, dass sie sich irgendwo in der Dritten Welt engagiert. Gott ist mit ihr.
Sah ich in den Augen Abt Othmars Ironie, ja fast Amüsement über meine Verblüffung? „Wollen Sie die Rolle auch überprüfen?“, fragte er. „Das ist die Ernennung mit allen Klauseln, Inkunabeln und Schnörkeleien. Und um Ihre Neugierde zu befriedigen, mein so überaus gescheiter junger Freund, erzähle ich Ihnen auch die dazugehörende Geschichte: Vor etwa zweieinhalb Jahren kam ein Weltpriester an die Klosterpforte, ein unscheinbarer Mann mit Baskenmütze, langem Priestermantel und einer abgeschabten Aktentasche. Ich war zufällig an der Pforte, um Bruder Emmeram zusammenzustauchen, weil er beim Suppenausteilen wieder einmal den Knauser herausgekehrt hatte. Der Priester begrüßte mich höchst ehrerbietig, wohl geblendet durch mein Brustkreuz, und fragte in gebrochenem Deutsch nach Basil. Das Ganze wirkte recht harmlos, ich sah nichts Violettes, keinen Purpurstreifen und schon gar keinen Ring! Also ließ ich Basil holen. Später sah ich, wie er mit dem Besucher im winterlichen Klostergarten auf und ab ging. In der Nacht kam Basil dann zu mir und legte mir diese Papiere auf den Schreibtisch. Sie können sich vorstellen, dass ich nicht weniger verblüfft war als Sie gerade eben. Bevor ich meinem zu so großen Ehren gelangten Mitbruder gratulieren konnte, bat mich Basil, ihn anzuhören und nicht zu unterbrechen. Er war absonderlich ruhig, die großen Augen starr auf mich gerichtet. Diese Sache sei eine Angelegenheit zwischen dem Papst und ihm. Der Mann, der ihn besucht habe, sei der Privatsekretär des Papstes, Pietro Bertonazzi, gewesen. Er sei lediglich in petto ernannt worden, noch wisse kein Mensch im Vatikan von ihm. In der Liste des Heiligen Kollegiums sei er ‚non nomen‘, ohne Namen, eingetragen, und Bertonazzi habe ihm gesagt, das könne so bleiben. Er wäre dann einfach ein im Geheimen ernannter Kardinal, lediglich dem Papst und Bertonazzi bekannt. Sogar die Ernennungsurkunde sei von Bertonazzi ausgefüllt und dann vom Papst unterzeichnet worden.
Ich kann mich noch genau an die Worte Basils erinnern: ‚Pietro wird schweigen. Pietro hat immer geschwiegen. Schweigen ist seine Seele.‘ Wenn ich nichts tue, dann werde ich eine vatikanische Karteileiche sein.
Ich weiß noch, dass dieses Wort mir aufstieß: ein Kardinal der heiligen römischen Kirche als Karteileiche. Aber Basil fuhr schon fort: ‚Ich bitte Sie, hochwürdigster Abt, nehmen Sie diese Dinge zu sich! Sie können sie aufheben oder verbrennen. Ich bitte Sie nur demütig, alles zu vergessen, nicht mit mir oder anderen über diese Sache zu reden und mich auch in Zukunft zu nehmen als den, der ich bin, ein kleiner, demütiger Mönch unseres Vaters Benedikt.‘ Niemals werde ich das Gesicht Basils vergessen. Trotz meiner Neugier habe ich mich an die Ordensregel gehalten: Der Abt soll die Herzen seiner Jünger durchdringen, und er lasse sich von seinem Gespür für den rechten Augenblick leiten. Ich habe die Papiere vor den Augen Basils in den Tresor gelegt und ihm gesagt, dass ich seinen Wunsch respektiere. Dann ging er mit diesen zierlichen, trippelnden Schritten aus dem Zimmer. Bevor er die Tür schloss, rief ich ihm nach, dass Gott ihn segnen möge. Er murmelte noch eine Antwort. Seit Montag grübele ich, ob ich sie richtig verstanden habe.
Er sagte: ‚Vielleicht. Am Tag des Zorns.‘“
Eine Weile lang herrschte Schweigen zwischen uns. Ich wagte nicht, eine Frage zu stellen, und irgendwann sprach Abt Othmar, nun wieder im Ton des gestrengen Herrn, weiter: „Aus Rom kam danach nichts. Ich habe mich die ganze Zeit über an mein Versprechen gehalten, habe nichts gesagt und keine Frage gestellt – auch nicht die nach dem Vergehen Basils, das eine päpstliche Verzeihung notwendig machte. Nicht einmal nach dieser Dr. Grassi habe ich gefragt und keine Nachforschungen angestellt. Und Sie werden sich ebenfalls an diese Grundsätze halten. Ich will keine Gossenpresse im Kloster – einen Skandal können wir uns unter keinen Umständen leisten. Schon gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt, und wer weiß, was für eine Hornisse sich im vatikanischen Bienenstock verstecken mag? Gerade erst haben wir Formosus den Großen zu Grabe getragen, und das Konklave steht bevor. Sie wissen, wie sehr wir im Fokus der Medien stehen. Ich will jetzt keinen verirrten oder an einem Ast hängenden Kardinal – und erst recht keinen unter obskuren Umständen verschwundenen oder, was am schlimmsten wäre, einen Kardinal, der entführt wurde. Verstehen Sie mich jetzt? Wollen Sie vielleicht nach Rom zitiert und dort vom neuen Heiligen Vater höchstpersönlich zur Schnecke gemacht werden? Haben Sie immer noch Anmerkungen zu machen über meine
Verantwortung und wie ich sie handhabe? Kommt Ihnen immer noch das Lachen hoch, wenn ich von Entführung rede? Irgendwas ist faul an der Sache. Ich weiß zwar, dass Basil nach der Wahl von Formosus längere Zeit in Rom war, aber ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat. Immerhin muss er es da soweit gebracht haben, dass ihn das Oberhaupt der Christenheit mit ‚fratellino‘ anredet und ihn zum Kardinal ernennt. Und dann ist da noch etwas, das die
Sache alles andere als besser macht. Letzte Woche war Basil zwei Tage in Rom. Er hat mir nicht gesagt, was er dort wollte, und ich habe ihn auch nicht gefragt. Kardinäle fragt man nicht. Er war in Rom an dem Tag, an dem Formosus gestorben ist.“
Ich weiß nicht mehr genau, was in meinem Kopf vorging. Das, was mir da gerade eröffnet wurde, überstieg meinen Horizont. Ich bin ins Kloster gegangen, damit man mich führt. Zumindest in diesem Augenblick ließ ich mich nur allzu gern führen. Ich senkte meinen Blick, dann meinen Kopf und sagte leise: „Ich verstehe vollkommen. Ich bitte um Verzeihung. Was soll ich tun?“
„Sie werden einen Suchtrupp zusammenstellen. Novizen, wie ich schon sagte. Erfinden Sie irgendetwas! Sie werden die Zelle von Pater Basil genauestens auf den Kopf stellen. Es ist mir gleichgültig, ob Sie dabei auch höchst persönliche Papiere überprüfen. Die weiteren Schritte überlasse ich Ihnen – aber keine Presse, kein Fernsehen und keine Polizei! Sub sigillo! Versprechen Sie mir das?“
Natürlich versprach ich es.
Abt Othmar stand auf, sah mich gelassen an und sagte kühl: „Gehen Sie mit Gott, Frater Anselm!“ Vor dem rankenverzierten Safe fügte er hinzu: „Sie berichten ausschließlich mir! Und noch etwas: Sie führen bis auf Weiteres die Chronik unseres Klosters fort.“
22. Juni, am Fest des heiligen Paulinus von Nola
Ich habe einen Mann namens Professor Senf erfunden, einen älteren Bücherwurm, etwas geistesabwesend und leicht gehbehindert. Im Kloster sei er zu Gast, um einige seltene Handschriften in der Bibliothek zu studieren, und nun sei er abgängig. Sei nicht zum Essen erschienen und habe sich womöglich bei einem seiner Spaziergänge verlaufen.
Seit gestern umkreisen sieben Novizen das Kloster. Meine Konfratres waren ein wenig bockig, als ausgerechnet ich mit Anordnungen daherkam. Zweifellos hegen sie immer noch Vorbehalte, weil ich aus einer reichen, calvinistischen Bankiersfamilie stamme und zum katholischen Glauben konvertiert bin. Als ich ihnen aber mitteilte, der Abt habe mich beauftragt, hielten sie sich an die Regel unseres Ordensgründers und übten sich in Gehorsam. Ich habe darum gebeten, die jungen Männer sollten sich Jeans oder Sporthosen anziehen und nicht im Habit aus dem Kloster gehen. Eine Gruppe durch den Wald hastender, rufender Mönche wäre allzu auffällig. Seit gestern also sind sie auf der Suche. Bislang vergeblich. Kein Basil und kein Professor Senf.
Mit Emmeram, unserem über achtzigjährigen Bruder Pförtner, habe ich ein wenig geplaudert. Wer im Kloster ein und aus geht, muss an ihm vorbei. Die früheren Schleichwege über die
Sakristei oder den Kreuzgang sind längst verschlossen. Emmeram war nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Es war ihm überhaupt nichts aufgefallen.
Während des gestrigen Mittagessens warf ich diskret meine Angel aus: Wo steckt eigentlich Pater Basil? Fehlt ihm was? Ist er krank? Reaktionen erhielt ich so gut wie keine. Basil lebt zu isoliert und pflegt keine der distanzierten „Klosterfreundschaften“. Er ist unbeliebt. Einige hatten etwas gehört von einem Besuch bei Verwandten. Oder war nicht die Rede von einem Arzttermin in Luzern? Abt Othmar hatte ganze Arbeit geleistet.
Der alte Pater Korbinian, neben den ich mich bei der Recreatio setzte, mümmelte an seinem Kuchenstück und berichtete etwas von zwei Männern und einem Auto. Ein großes Auto sei es gewesen, vielleicht sogar einer dieser kleinen Busse, aber das könne natürlich auch letzte Woche gewesen sein. Er habe nicht sonderlich darauf geachtet, sondern im Klostergarten nach der Komplet sein Brevier gelesen. Brevierlesen, wenn es schon stockfinster war? Entweder schwindelte Korbinian sich um seine Brevierpflicht herum oder es stand schlimmer um ihn, als man denkt. Mit seiner Aussage war jedenfalls nicht das Geringste anzufangen.
Nachdem der mönchische Suchtrupp abgezogen war, ging ich in Basils Zelle. Wie es der Regel entspricht, war sie unverschlossen.
Der heilige Benedikt hätte seine Freude an dieser Mönchszelle gehabt. Nichts Unnützes befand sich darin, und die Ordnung war geradezu klinisch. Die Männer im Kloster umgeben sich je nach ihrem Charakter mit persönlichen Gegenständen, hängen sich Bilder der Eltern an die Wand, horten Bücher, Zeitschriften oder lassen ihre Behausung verkommen. Ich habe schon Zellen altgedienter Mönche gesehen, da gab es zwischen Zeitungsstößen und ungewaschenen Kleidungsstücken nur Trampelpfade zu Waschbecken, Bett und Betschemel, während sich im Spind verschimmelte Semmeln und Kuchenreste türmten. Ich hatte erwartet, Basils Zelle in ähnlichem Zustand vorzufinden. Nun stand ich stattdessen in einem Raum, in dem außer dem Bett, einem Nachtkästchen, einem billigen Resopalschrank und dem Betschemel nur ein Schreibtisch und ein Stuhl die Einrichtung bildeten. An der Wand hingen keine Bilder, nur ein Kruzifix ohne Korpus und ein kleines Stringregal mit ein paar Büchern. Es lag nichts herum, keine Papiere auf dem Schreibtisch, nicht einmal ein Blumentopf am Fenster, was beim Hobby unseres Basils verwunderlich war. Mein erster Verdacht keimte erneut in mir auf: Basil musste „abgehauen“ sein. So sah eine Zelle aus, die ihr Bewohner für den Nachfolger aufgeräumt hatte, um ihr auf immer „Adieu“ zu sagen.
Ich machte den Schrank auf, und mein Verdacht verflog. Auch hier war alles penibel aufgeräumt, doch es schien nichts zu fehlen. Der zweite Habit baumelte neben der Kukulle, der graue Anzug, den Basil trug, wann immer das Mönchskleid nicht angebracht war, hing auf seinem Bügel, die Unterwäsche war sorgfältig gefaltet, Pullover und Hemden stapelten sich
ausgerichtet in den Fächern. Die Schuhe standen geputzt am Boden, und an der Schrankwand entdeckte ich einen Lederkoffer. Ohne Koffer haute niemand ab. Brauchte ich noch einen Beweis, so fand ich ihn in dem Stapel Papiere neben der Wäsche: die persönlichen Urkunden von Basil, Geburtszeugnis, Promotionsnachweis und Krankenversicherungskarte. Lediglich eine Brieftasche mit Ausweispapieren war nicht zu entdecken.
Etwas Eisiges kroch mir den Rücken hinunter. Zum ersten Mal erfasste nun auch mich die Sorge um Pater Basil.
Abt Othmar hatte gesagt, ich solle alle Papiere, auch die persönlichen, durchsehen. Ich leerte den Schrank und zog die Schubladen des Schreibtischs auf, durchwühlte die Wäschestapel und blätterte durch leere Schreibblöcke, fand aber nichts als zwei Brillen, ein Exemplar des liturgischen Kalenders, eine angebrochene Packung Aspirin, ein zerlesenes Brevier ohne Merkzeichen und einen Teller mit einem verschrumpelten Apfel. Keine Papiere, keine Korrespondenz mit Eltern oder Freunden, geschweige denn mit Papst Formosus. Keine Zeitungsausschnitte, weder Weihnachtspostkarten noch Sterbebildchen. Auf dem Wandregal stand neben Büchern über Rosen- und Staudenzucht eines über giftige Pflanzen, doch auch dieses erwies sich als harmloses Nachschlagewerk.
Ich untersuchte das Bett, schob die Matratze vom Rost und fand wiederum nichts. In der Lade des Nachtkästchens lagen lediglich zwei alte Pantoffeln aus Leder. Auf dem Bord über dem Waschbecken gab es die üblichen Toilettenutensilien. Kein angebrochenes Röhrchen Veronal. Nichts in diesem Raum war verdächtig – nichts als der schier antiseptische, vollkommen leblose Raum selbst. Dass hier ein Kardinal, ein Fürst der heiligen katholischen Kirche, wohnen sollte, erschien nicht vorstellbar. Unvermittelt fiel mir ein, dass Formosus, der große, wenn nicht der größte Papst der Kirchengeschichte, seinen „fratellino“ nur zum Kardinaldiakon gemacht hatte. Der Heilige Vater hatte es offenbar für richtig befunden, Basil zwar unter die höchsten Diener Gottes zu berufen, ihn dort aber auf der untersten Stufe zu belassen. Ich habe Basil nicht gemocht. Als Kardinal, so musste ich mir eingestehen, mochte ich ihn nicht mehr als zuvor.
Für meine Suche blieb mir jetzt nur noch der Computer auf dem Schreibtisch übrig. Ein altes Modell. Ich setzte mich auf den klapprigen Stuhl und fuhr den Rechner hoch. Dabei bemerkte ich an der Frontseite des Gehäuses Kratzspuren, wie wenn jemand mit einem groben Werkzeug ins Innenleben des PC hatte eindringen wollen.
Auf dem Bildschirm erschien eine grüne Wiese unter blauem Himmel. Die üblichen Programme. Nichts Aufregendes. In einer der gelben Boxen auf dem Himmel prangte der Schriftzug: „Chronik Mattenthal“. Ich klickte sie an.
Seit meinem Eintritt ins Kloster vor knapp zwei Jahren hatte sich Basil regelmäßig in seine Zelle zurückgezogen, um diese Chronik unseres Klosters abzufassen, der unser Abt zu Recht
so viel Wichtigkeit beimisst. Was aber fand ich, als ich die Datei öffnete? Nichts. Für Sekunden stockte mir buchstäblich der Atem. Die Chronik unseres Klosters war eine endlose Folge von Daten ohne einen einzigen Eintrag.
Ich gebe gern zu, dass in einer Ordensgemeinschaft wie der unseren nichts wirklich Sensationelles geschieht, doch auch die kleinen Dinge sind es wert, festgehalten zu werden, sie machen die Textur des Klosterlebens aus. Die Krankheit eines Mitbruders, seine Genesung, eine Profess, die sich so wunderbar häufenden Neueintritte in unsere Klostergemeinschaft, die Entwicklung der aufgenommenen Kinder, die Eröffnung der anonymen Entbindungsstation. Alles zusammen bildete ein Großes: die spirituelle Erneuerung und die wieder erstarkende Macht unserer heiligen Mutter Kirche. Nichts davon war für Basil erwähnenswert gewesen. Jeden Tag hatte er penibel aufgeführt, ihn mit dem Datum und der entsprechenden Bezeichnung nach dem liturgischen Kalender versehen, den Namen des Heiligen und den kirchlichen Festtag hinzugefügt. Danach folgte nur noch ein Doppelpunkt und dann in endloser Wiederholung dasselbe Wort: Nichts. Seitenlang, über Monate, Jahre schrie es mir entgegen: Nichts. So wie Ludwig XVI. am Tag der Erstürmung der Bastille „rien“ in sein Tagebuch gekritzelt hatte, ehe die Guillotine ihn eines Besseren belehrte.
Was musste in einem intelligenten Mann vorgehen, damit er eine solche Art von Klosterchronik aufsetzte? An jedem Tag, den unser Herr ihm schenkte, hatte der Basilisk den Computer hochgefahren, die Datei geöffnet, das Datum geprüft und dann dieses kleine Wort hingeschrieben. Jeden Tag! Die Gewissenhaftigkeit erschien mir erschreckend. Der letzte Nichts-Eintrag stammte vom Sonntag.
Offenbar hatte sich niemand, nicht einmal Abt Othmar, die Mühe gemacht, Basils Arbeit zu überprüfen. Vielleicht hätte man ihm helfen können in seiner Verwirrtheit oder seiner Bosheit. Ein öffentliches Sündenbekenntnis im Kapitel wäre erforderlich gewesen: Ja, ich habe meine Arbeit nicht, so gut ich es kann, verrichtet. Ich habe leider gar nichts getan. Warum, unser aller Bruder Basilius, warum? Gehe in dich und erzähle es uns!
Hätte sich Basil uns anvertraut, hätte er Gründe für diese Groteske aufdecken können?
Noch etwas anderes an diesem Computer war mehr als nur merkwürdig: Auf dem gesamten Desktop und in sämtlichen anderen Rubriken gab es außer der leeren Chronik von Mattenthal keine weitere Datei. Keine wissenschaftlichen Niederschriften, Exzerpte oder Gedanken, obwohl Basil als Historiker und Schriftgelehrter galt. Kein Wort über Gärten und Pflanzen, keine Briefe – nichts.
Ich bin kein Experte in Computerfragen und erst recht kein tüfteliger Hacker, aber natürlich kann ich mit den digitalen Möglichkeiten umgehen. Der Computer ist ein fester Teil unseres
klösterlichen Lebens, und ich habe mich seit meiner Gymnasialzeit mit diesem Gebiet beschäftigt. Auch als Christ muss man mit der Zeit gehen, das Potenzial moderner Errungenschaften erkennen und ausnutzen. Zur Ehre Gottes und um den Einfluss der göttlichen Gnade zu mehren. Die Kenntnisse, die ich vor diesem Hintergrund gesammelt hatte, genügten mir, um schließlich festzustellen, dass ein Teil von Basils Festplatte für den arglosen Benutzer nicht sichtbar war.
Ich konnte einfach nicht glauben, dass Basil sich in so langer Zeit mit nichts anderem beschäftigt haben sollte. Brennend vor Neugier, die der Herr mir verzeihen möge, startete ich das Betriebssystem erneut und entdeckte, dass die sichtbare Größe der Festplatte nie und nimmer mit der realen Dimension übereinstimmen konnte. In Basils Festplatte musste ein riesiger inaktiver Datenspeicher stecken. Diente die unschuldige Box „Chronik Mattenthal“ womöglich dazu, ein dunkles, ausgedehntes Höhlensystem zu verbergen? Oder war der Rechner vielleicht nur defekt, lag ein Fehler in der Handhabung vor?
Mit den üblichen Tricks war nichts herauszufinden. Also schaltete ich den Rechner wieder aus und ging hinüber zu den Wirtschaftsgebäuden, um mir im Büro des Cellerars das notwendige Handwerkszeug zu besorgen. Es dunkelte bereits. Die Mitglieder des Suchtrupps trudelten ein und berichteten, sie hätten nichts gefunden. Ich sagte ihnen, sie bräuchten sich keine Sorgen zu machen, bei schusseligen Professoren wüsste man schließlich nie, was ihnen einfiele. Wahrscheinlich sei er in irgendeiner Almhütte untergekrochen. Trotzdem sollten sie am nächsten Morgen noch einmal ausschwärmen, die weitere Umgebung überprüfen und bei den bewirtschafteten Almen nachfragen. Anschließend ging ich dann ins Wirtschaftsbüro und ließ mir von Bruder Gordian, dem Buchhalter, die CDs mit den Prüfprogrammen geben.
Zurück in Basils Zelle, ließ ich eins nach dem anderen durchlaufen und wurde fündig. Kein kaputter Computer. Der verdeckte Teil war formatiert und von Daten besetzt. Natürlich versuchte ich alles, um diesen Bereich der Festplatte zu aktivieren. Ich probierte aus, was immer mir einfiel, ließ das Abendessen ausfallen und tippte mich in Schweiß. Kurz bevor es zur Komplet läutete, war ich so weit, die Waffen zu strecken – und genau in diesem Augenblick öffnete sich auf dem blauen Himmel jäh eine rechteckige Kartusche: „Zugriff auf Laufwerk verweigert. Passwort eingeben!“
Obwohl ich so etwas Ähnliches erwartet hatte, war ich schockiert. Widerstrebend eilte ich in die Kirche zum Chorgebet. Zweifellos war es nicht gottgefällig, wenn ein Mönch beim Singen des „Salve Regina“ an eine Computerfestplatte dachte und den Segen des Abtes nicht erwarten konnte, weil ihm Worte und Gedankenfetzen im Kopf herumjagten: Passwort! Schlüssel! Ein riesiger geheimer Datenspeicher in einem Kloster des heiligen Benedikt – in einem Kloster, dessen Regel jegliches Geheimnis untereinander untersagte! Und der
unglaubliche Blaubart, der dafür verantwortlich zeichnete, war der fratellino eines Papstes, war ein höchst befremdlicher Kardinal und spurlos verschwunden!
Konnte ein heimliches Laster dahinterstecken – Basil als User von Pornos aus dem Internet? Das schien mir unwahrscheinlich, Basil war nicht der Typ. Ein Satz aus dem päpstlichen Schreiben, das Abt Othmar mir gezeigt hatte, kam mir in den Sinn: Nicht nur durch Gehorsam habe sich ein höchster Diener der Kirche auszuzeichnen, sondern ebenso durch Schweigen. Wie lautete das Passwort zu diesem Schweigen? Beim „Salve Regina“ bot ich meine Seele der heiligen Gottesmutter nur äußerst unzulänglich dar, doch ich hoffte, sie würde mir verzeihen.
Nach dem Chorgebet trat Abt Othmar wie zufällig an meine Seite. Wir blieben ein wenig zurück. Als Abt durfte er mir die Erlaubnis erteilen, das Schweigegebot zu durchbrechen, und so flüsterte ich ihm zu, dass weder die Suche noch meine Recherchen bisher etwas ergeben hätten. Die „Chronik des Nichts“ verschwieg ich ihm. Abt Othmar hatte Sorgen genug, und ich wollte nicht derjenige sein, der Basil verpetzte, auch wenn ich ihm jegliche Bestrafung von Herzen gönnte.
Über den Computer sagte ich lediglich, ich wäre auf eine Unregelmäßigkeit gestoßen und würde daran arbeiten. Abt Othmar nickte und flüsterte: „Tun Sie das und tun Sie es schnell.“ Er zog mich am Ärmel in eine dunkle Ecke des Kreuzgangs. Seine Stimme war ebenso leise wie drängend. Von der kühlen Gelassenheit des Mannes mit den Spielzeugautos schien nichts mehr übrig. „Tun Sie es schnell, Anselm, ich beschwöre Sie! Heute Nachmittag erhielt ich einen sonderbaren Anruf. Jemand wollte unbedingt mit Basil sprechen. Eine barsche Männerstimme mit fremdem Akzent verlangte ausdrücklich nach Pater Basilus Perhamer. Ich habe versucht, mich herauszureden. Der Mann wurde unverschämt und erklärte, ich müsse ein wahrhaft vorbildlicher Abt sein, wenn ich nicht wüsste, wo meine Schafe sich befänden. Dann hängte er abrupt ein.“
Abt Othmar ließ meinen Ärmel los, wandte sich ab und knurrte mit nie da gewesener Unbeherrschtheit: „Verdammte Sauerei!“
Dann lief er mit großen Schritten und wehender Kukulle hinter den anderen Mitgliedern des Konvents her, die schweigsam durch den Kreuzgang ins Klostergebäude zogen, und ließ mich mit meiner Suche nach dem Passwort in der Dunkelheit stehen.
Ich beschloss, nicht noch einmal in Basils Zelle zurückzukehren. Der Gedanke, stundenlang mit der erbärmlichen Kartusche vor Augen vor dem flimmernden Kasten zu sitzen, machte mich schwach. Also ging ich in meine Zelle, legte mich aufs Bett und versuchte nachzudenken.
Wahrscheinlich hat Abt Othmar recht mit seiner Forderung nach Diskretion. Ohne Zweifel hatten wir einen obskuren Kardinal im Kloster, der spurlos verschwunden war und obendrein
eine Riesendatei mit einem Passwort versehen hatte. Zwar bestand theoretisch noch die Möglichkeit, dass Basil morgen wieder auftauchte, doch mein Gefühl sagte mir, dass es nicht so sein würde. Wenn ihm wirklich etwas passiert war, würde sich die Presse darauf stürzen. Was hatte Abt Othmar gemeint mit der Hornisse im Vatikan? Gab es eine undichte Stelle, womöglich diesen Pietro, der so schweigsam, wie er tat, gar nicht war? Wenn der geringste Hinweis durchsickerte, würde es in den Medien von Schlagzeilen über den verschwundenen Kardinal nur so wimmeln. Umso schlimmer, wenn der Gesuchte sich auch noch tot im Wald anfand – ich sah die Fernsehscheinwerfer auf den Gängen des Klosters förmlich vor mir und stellte mir vor, wie Reporter mit ihren Mikrofonen über den Hof flitzten. Sie würden uns beim Chorgebet filmen, und wenn Abt Othmar Einspruch erhob, würden sie einfach Ausschnitte aus einem anderen Kloster dazwischenschneiden. Gerade jetzt, wo der Glaube wieder Einzug in die Seelen der Menschen hielt, war die Kirche Angriffen ausgesetzt wie selten zuvor, und ein Skandal wie dieser wäre ein gefundenes Fressen für die Journaille. Ganz besonders, da die Wahl des Papstes unmittelbar bevorstand und die Blicke der Welt sich auf Rom richteten. Und dann war da noch die Zeitbombe auf Basils PC. Wut auf einen Mitbruder, der sich nicht scheute, uns in solchen Schlamassel zu reiten, erfasste mich. Eine harmlose Erklärung hielt ich mittlerweile für ausgeschlossen. Jäh fielen mir die Kratzspuren am Gehäuse des Computers wieder ein, und auf einmal fragte ich mich, ob es im Dorf keinen pensionierten, katholischen Kriminalbeamten gab, den man mit diskreten Recherchen beauftragen könnte. Befanden sich nur Basils Fingerabdrücke auf dem Blech, oder gab es nicht einzuordnende fremde? Und wenn ja, konnten sie von den Insassen des Kleinbusses stammen, den Frater Korbinian gesehen haben wollte? Leider kannte ich keinen Kriminalisten, den ich um Hilfe hätte bitten können, aber ich nahm mir vor, noch einmal herumzufragen, ob jemand Fremde in der Klausur gesehen hatte. Höchstwahrscheinlich würde nichts dabei herauskommen, und dass einer von uns sich an dem Gerät zu schaffen gemacht hatte, konnte ich mir nicht vorstellen.
Ich lag auf meinem Bett, sah blicklos ins Dunkel und bemühte mich krampfhaft, meine Gedanken zu ordnen. Wie ich es auch drehte und wendete, als Anhaltspunkt blieb mir nichts als die monströse Datei auf Basils Rechner. Also würde ich mich darauf konzentrieren. Eigentlich hätte ich Abt Othmar von der Sache mit dem Passwort erzählen müssen, doch während ich an die Decke starrte, gestand ich mir ein, warum ich es nicht getan hatte: Ich fühlte mich herausgefordert. Keiner als ich sollte derjenige sein, der das Geheimnis des Basilisken löste.
Vor welche Probleme stellte mich meine Neugier? Zuerst einmal musste ich natürlich das Passwort finden, doch damit wusste ich noch nicht, in welches System Basil dieses
Passepartout eingebettet hatte. Führte die einmalige Verwendung eines falschen Wortes womöglich dazu, dass die ganze Datei sich automatisch löschte? Wie sollte ich Basils Gedankengänge verstehen? Hätte er sich umgebracht, wie ich anfangs vermutet hatte, dann hätte er sein geheimes Datengewölbe doch sicher zum Absturz gebracht? Oder hatte er im Gegenteil versucht, eine Spur zu legen?
Mörder zieht es zurück an ihren Tatort, heißt es. Kriminalpsychologen behaupten, Serientäter legten immer eine Spur mit der unbewussten Absicht, entdeckt zu werden. Ist also ein Geheimnis nur dann ein Geheimnis, wenn zumindest die geringste Möglichkeit der Entdeckung besteht? War das ganze mysteriöse Labyrinth nichts als die Neckerei eines törichten alten Mannes? Hatte der zum Schweigen verpflichtete „Kirchenfürst“ am Computer Seite um Seite nur für den ihm nahen oder fernen Gott gefüllt, um sich selbst zu entlasten, zur Reinigung seiner Seele? Genau Formuliertes lässt sich leichter ertragen als eine ungeformte, fluoreszierende Geschichte im Kopf. Vor seinem tödlichen Entschluss hatte er womöglich beschlossen, den Text zu löschen – nur ein paar Mausklicks, und alles wäre wie nie da gewesen. Wer aber brächte das schon fertig?
Bin ich nicht selbst in einer ähnlichen Lage? Ich schreibe einen Bericht, der nur für die Augen meines Abtes bestimmt ist, sub sigillo, geheim wie die Beichte. Trotzdem ertappe ich mich, wie ich immer mehr an den Sätzen feile, mir dies oder jenes an stilistischen Arabesken einfallen lasse und mit Wohlgefallen die bisherigen Seiten betrachte. Ich wäre erbittert, würde mein Abt von mir verlangen, mein Werk zu löschen. Ich könnte mich damit abfinden, wenn mein Bericht auf einer Diskette tief in einer Schreibtischschublade oder im Tresor der Abtei aufgehoben bliebe, aber nicht mit der unwiderruflichen Vernichtung. Und wenn es schon mir so ergeht, wie muss es dann Basil ergangen sein, der nach der formatierten Speichergröße zu schließen unendlich lange an dieser Datei gearbeitet hatte? Vielleicht schied es sich leichter aus der Welt mit dem Wissen, dass das eigene Werk darin bestehen blieb, wenn auch durch einen Passwortschutz unzugänglich gemacht. In jedem Fall konnte ich die Möglichkeit eines Selbstmords nicht von meiner Liste streichen.
Und wenn Basil uns mit seiner verborgenen Datei tatsächlich eine letzte Herausforderung hatte liefern wollen, durfte ich vermutlich keine Vielzahl von Passwortvariationen ausprobieren, sondern nur ein einziges. War es das falsche, würde sich der Speicher in das Chaos unzusammenhängender Daten auflösen, aus dem er entstanden war.
25. Juni
Die Suchtrupps haben Professor Senf nicht gefunden. Ich habe mich entschlossen, ihn wegen des Todes seiner bejahrten Cousine auf eine Reise nach Zürich zu schicken. Hals über Kopf. In der Aufregung musste er glatt vergessen haben, sich abzumelden.
Ich habe mir Pater Basils Professakten angesehen; vielleicht ein wenig außerhalb der Legalität, aber jeder weiß, wo die Schlüssel zum Archiv aufbewahrt werden. Was für ein überschaubares Leben! Geboren in Pertzen, die Eltern betrieben die Gastwirtschaft „Zur Post“, Grundschule in Pertzen, Gymnasium in der Kreisstadt, Ministrant, ein sehr guter Schüler. Nach dem Abitur Eintritt in unser Kloster. Theologiestudium, die letzten Semester auf der Benediktinerhochschule Sant’Anselmo in Rom. Bester seines Jahrgangs, gute Italienischkenntnisse. Nichts Auffallendes, keine Besonderheit, die mir weiterhelfen könnte. Die Urkunde über die ewigen Gelübde. Nicht die geringsten Vermögenswerte. Und am Ende die gestochene, kleine Unterschrift Basils. Dann zusätzliches Studium der älteren Geschichte auf Veranlassung des damaligen Abtes und gegen den Wunsch Basils, der lieber Biologie studiert hätte.
Promotion „summa cum laude“.
Mit einigen Schwierigkeiten habe ich in unserer Bibliothek seine Doktorarbeit gefunden. Ein schmaler, broschierter Band, billiges Papier und Computerdruck. Ich kann damit nichts anfangen. Geschichte hat mich nie interessiert. Was gehen mich vermoderte Urkunden an bei den Herausforderungen unserer Zeit? Ist das Wühlen in der Vergangenheit nicht auch gegen unsere Regel? „Ora et labora“. Akademische Beschäftigung, das Tändeln mit Theorien, Axiomen, Thesen und Hypothesen ist keine Arbeit; nicht einmal wenn es um theologische Aspekte geht. Wäre ich Abt gewesen, ich hätte Basil Studium und Promotion nicht gestattet. Aber das war ja noch zu einer Zeit, wo jeder Mönch seine wissenschaftlichen oder sonstigen Passionen ausleben durfte, weil man ja schon froh war, dass überhaupt jemand ins Kloster eintrat. Heute stehen wir – dem Herrn sei Dank – ganz anders da. Basils idyllisches, nutzloses Gärtchen war das letzte Relikt dieses unbenediktinischen Schlendrians.
Was für einen Nutzen, welche reale Wirkung konnte schließlich eine wissenschaftliche Arbeit haben, die mit einem Titel wie „Die Rolle 3 Q 15 von Qumran und einige Fragmente aus Höhle 1 in historischer und theologischer Sicht“ protzte? Hunderte von Anmerkungen, Fußnoten und Verweisen sammelten sich auf den Seiten, und am Ende prangte glorreich das Prädikat „summa cum laude“. Wen aber interessierten heute noch die Funde von Qumran? Die hektische Aufregung über die nach dem Zweiten Weltkrieg am Toten Meer gefundenen Schriftrollen hatte sich längst gelegt. Schon als Basil sein „wissenschaftliches Werk“ verfasste, musste dieses Thema mehr als exotisch gewesen sein. Zweifelsfrei hatte sich herausgestellt, dass diese Texte ausschließlich etwas mit der winzigen Sekte der Essener und nichts, aber auch gar nichts mit der Person von Jesus Christus zu tun hatten. Damit hatten sich
die Verschwörungstheorien, der Vatikan halte ein fünftes oder gar sechstes Evangelium zurück und Jesus sei nicht am Kreuz, sondern irgendwo in Indien gestorben, als das erwiesen, was sie waren: Sensationsmache der Presse, populärwissenschaftlicher Unsinn und antikirchliche Propaganda. Eine wissenschaftliche Eintagsfliege – war das ausgerechnet Pater Basil nicht klar gewesen?
Beim Überfliegen des schwer lesbaren Textes stellte ich fest, dass Basil offenbar irgendeinen verqueren Bezug zum 13. Jahrhundert und dem Stauferkaiser Friedrich II. angenommen hatte. Das erschien mir hanebüchen. Nur weil Autoren historischer Romane den ketzerischen alten Friedrich zum ersten modern denkenden Fürsten emporstilisierten, wurde schließlich kein wissenschaftliches Ei des Kolumbus daraus. Dass die Rolle 3 Q 15 und irgendwelche synoptischen Spinnereien dazu einen Bezug auf mein Passwort hatten, hielt ich für unwahrscheinlich. Dazu hätte auch die Widmung auf dem Deckblatt des schäbigen Büchleins nicht gepasst, in der Basil „demütig und dankbar meine bescheidene Arbeit dem Abt, dem Kloster und dem Orden des heiligen Benedikt“ dedizierte. In Demut sicherte man keine Datei mit einem Passwort und ließ die Welt vor dem Rätsel des Passworts stehen. Mein Gespür sagte mir, dass ich auf der falschen Fährte war.
Verließ ich mich wahrhaftig auf mein Gespür, noch dazu beim Basilisken? Mein Leben lang hatte ich auf Intuition nichts gegeben, sondern mich an klaren Gedanken und Fakten ausgerichtet. Die Sache wuchs sich zu einer fixen Idee aus. Fast glaubte ich, zu sehen, wie die spitze rosige Zunge vorschnellte, und zu hören, wie die Greisenstimme überdeutlich artikulierte: „Lösen Sie es, kleiner Anselm, lösen Sie es!“
Ich war in eine Falle geraten. Und mir schwante auch, warum. Die totale Verschiedenheit zwischen ihm und mir war schuld. Er hatte etwas, was mir fehlte. Aber es war etwas, das ich beileibe nicht haben wollte! Ich werde es lösen, mein lieber Basil, schwor ich ihm und mir stumm. Ich werde es lösen. Was hatte Papst Formosus II. dem Mönch aus Mattenthal zu verzeihen? Darüber würde ich – vielleicht – Auskunft bekommen, wenn ich mir erst Zugang zu der Datei verschafft hätte. Auf das Passwort aber fehlte mir noch immer der geringste Hinweis. Die im päpstlichen Schreiben erwähnte Dr. Grassi fiel mir ein. War mit der etwas anzufangen? Offenbar handelte es sich um eine Frau, die in Rom gewesen war, sich jetzt aber nicht mehr dort, sondern im Nirgendwo aufhielt, das war alles, was ich von ihr wusste. Sollte ich versuchen, Grassi oder Dr. Grassi oder Doktor Grassi in die Kartusche zu tippen? Ich war am Ende und nahe daran, herumzuprobieren, ließ es dann aber sein. Vielleicht, weil ich dachte, dass Basil genau das von mir erwartete. Stattdessen beschloss ich, zu Abt Othmar zu gehen und ihm Bericht zu erstatten. Er sollte entscheiden, was jetzt zu geschehen habe. Seit dem Verschwinden Basils waren inzwischen fünf Tage vergangen, und um die Polizei
würde man nicht länger herumkommen. Sollte die sich doch um Korbinians Beobachtungen und diesen vermaledeiten Datenkram kümmern. Vorher wollte ich zur Sicherheit aber noch Bruder Placidus genauer ausfragen, dem etwas aufgefallen sein mochte. Placidus war ein einfach strukturierter und schweigsamer Mensch, aber seinem tief verwurzelten Ordnungssinn entging nichts, weshalb er für den gesamten Klostergarten und die Bienen zuständig war. Auf meiner Suche machte ich einen Abstecher in das Gärtchen von Basil. Vorher war mir dieses Stück Grund nie besonders aufgefallen. Ich hatte wenig Interesse an der Natur, doch jetzt sah ich es mit anderen Augen. An der Südseite unserer großen Gartenanlage, direkt an der hohen Backsteinmauer, an drei Seiten umgeben von Gemüsepflanzen und Beerensträuchern in genau gezogenen Reihen, lag dieses nicht mehr als einhundertfünfzig Quadratmeter große Areal des verschwundenen Kardinals. Ich sagte ja bereits, dass mir die Natur nichts gab, dass mich der Anblick der Berge rund um uns in ihrem ewigen Eis kaltließ und dass ich bei sich wiegenden Bergblumen oder tosenden Wasserfällen nicht an Beseeltheit denken konnte. Nur der Mensch besaß eine unsterbliche Seele, um die Teufel und Gott rangen. Und nur die Kirche, meine Kirche in Rom, schärfte den Blick für das Wesentliche. Trotzdem überkam mich ein Anflug von Rührung, besser gesagt, Sentimentalität, als ich den schmalen Weg in dieses Paradiesgärtlein betrat. Es gab ein mittelalterliches Bild, das in jedem Gebetskalender abgebildet ist: die Muttergottes, Tiere, Engel, Heilige und jede Menge Blumen. Für meinen Geschmack war es zu süßlich, aber doch beeindruckend. In Basils Garten fehlten zwar die Figuren, aber die Blumenpracht hätte durchaus als Vorlage für den unbekannten Maler dienen können. Um ein kleines, wie mit der Nagelschere geschnittenes Rasenrondell prangte eine farbige, duftende Vielfalt von Blüten und Rispen. In der Größe steigerten sie sich bis hin zu den über zwei Meter hohen Sonnenblumen, die wie ein abwehrender Zaun an der Grenze zu Placidus’ Nutzgarten standen. Sogar die Farben schienen bewusst aufeinander abgestimmt. Basil hatte sich hier ein eigenes kleines Traumreich erschaffen, das mit unseren Ordensregeln nichts zu tun hatte. Wenn es überhaupt möglich war, so wurde mir Basil hier noch fremder, und das Passwort fand ich inmitten dieser von Bienen umsummten Idylle bestimmt nicht. Als ich sie verließ, um Placidus zu suchen, sprang mir jedoch etwas ins Auge: Eine Schneise aus zertretenen Blüten und geknickten Stängeln zerstörte die Vollkommenheit. Jemand musste von außen durch die sorgsam gehegten Blumen getrampelt sein und sich einen Weg zum Rondell gebahnt haben.
Placidus, im Arbeitshabit, mit blauer Schürze und Hut, werkelte bei den Kompostsilos. Wie es sich gehört, redete ich zuerst über das Wetter und fragte ihn dann nach seiner Gärtnerei.
„Es geht.“
„Salat?“
„Der schießt.“
Wie sollte ich bei diesem wortkargen Mitbruder etwas über ein Passwort erfahren?
Ich fragte, ob ihm die Verwüstung von Basils Garten aufgefallen sei.
„Ja, schon. Ist noch nicht lange. Gibt ja nur einen niederen Holzzaun ums Gelände. Ist halt einer drüber und hat Blumen gestohlen … Mir stehlen sie manchmal auch das Gemüse. Gesehen hab ich nichts.“
„Sagen Sie einmal, wie ist eigentlich Ihre Zusammenarbeit mit Pater Basil?“, tastete ich mich vor. Ohne sich in seiner Arbeit stören zu lassen, knurrte Placidus: „Er macht seines, ich mach meines.“ Dann, nach einer kleinen Pause, fügte er hinzu: „Ist er wieder da?“
„Er wird schon wiederkommen“, antwortete ich vorsichtig. „Aha.“ Placidus stellte seine Grabgabel akkurat an das Silo, wischte sich seine schmutzigen Hände an der Schürze ab und blickte mich abwartend an.
„Es würde mich wirklich interessieren, wie es hier im Garten so zugegangen ist, Bruder Placidus. Sie haben sich doch täglich gesehen. Über was haben Sie sich unterhalten?“ „Über gar nichts.“ Fast verächtlich ergänzte er: „Er kümmerte sich nur um Blumen, und für den Altar hat er nichts hergegeben. Nie was abgeschnitten, das nicht verblüht war. Alles wie in der Natur, hat er gesagt. Meinen Kompost wollte er auch nicht. Hat seinen eigenen gemacht.“
„Also haben Sie sich doch ab und zu unterhalten?“ „Höchstens einmal. Über Kompost. Er hat ja nie was gesagt, nur immer dieses Brummen, wenn er in seinem Garten war.“
„Was denn für ein Brummen?“