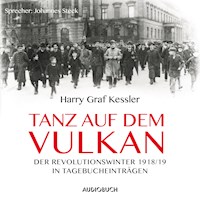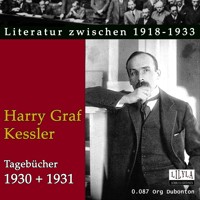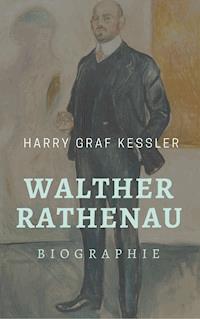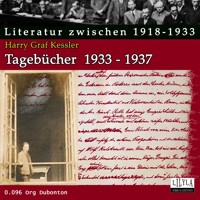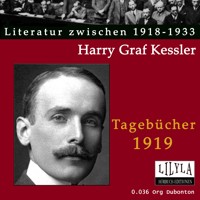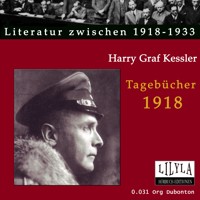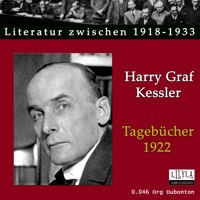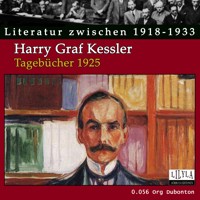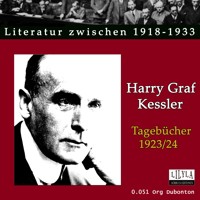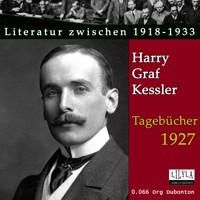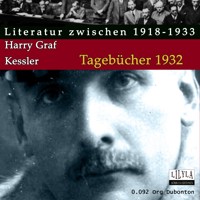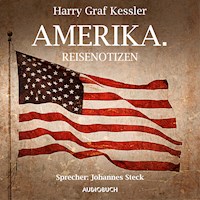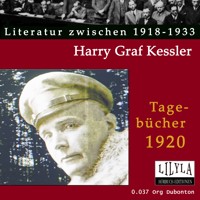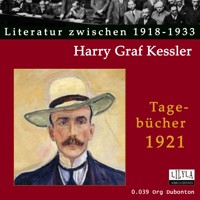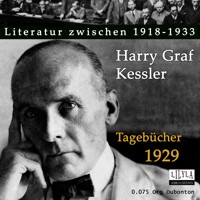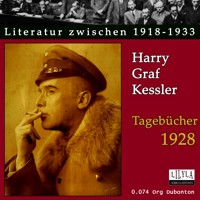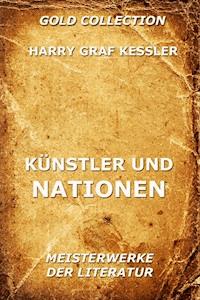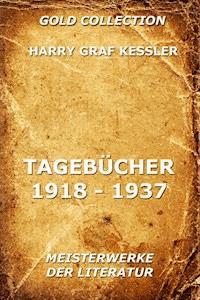
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Kessler führte 57 Jahre (1880-1937) Tagebuch, wobei er großen Wert auf Vollständigkeit legte. Dieses Tagebuch darf mit Recht als Kesslers literarischer Nachlass bezeichnet werden. Kritiker halten diese Texte für "ein Fest für Literaturnarren und Wissbegierige nach Geschichte und Geschichten". Kessler macht in seinen Aufzeichnungen "die sinnliche Erfassung von Phänomenen zum Credo. Seine Wahrnehmungs-Erfahrungen", so die Kritik, "tragen nicht selten Züge einer Experimentalsituation, einer Inszenierung und besitzen somit artifiziellen Charakter". Dieses Werk umfasst die Jahre 1918 - 1937.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1117
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tagebücher 1918-1937
Harry Graf Kessler
Inhalt:
Harry Graf Kessler – Lexikalische Biografie
Tagebücher 1918-1937
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Tagebücher 1918 – 1937, Harry Graf Kessler
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
www.jazzybee-verlag.de
ISBN: 9783849629250
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Harry Graf Kessler – Lexikalische Biografie
Deutscher Kunstsammler, Mäzen, Schriftsteller, Publizist und Diplomat, geboren am 23. Mai 1868 in Paris, verstorben am 30. November 1937 in Lyon. Sohn des Hamburger Bankiers Adolf Wilhelm Kessler und der Irin Alice Harriet Blosse-Lynch. Es gab vielfach Gerüchte über eine Beziehung zwischen dem Kaiser und Kesslers Mutter; bis heute wird vermutet, dass nicht Adolf Kessler, sondern Wilhelm I. der Vater Harrys war .Jedenfalls lernte Wilhelm Harrys Mutter in den späten 1860er Jahren kennen – womöglich auf der Pariser Weltausstellung von 1867 – und blieb mit ihr zeitlebens in Kontakt. 1879 wurde Harry zusammen mit seinem Vater Adolf Wilhelm durch Kaiser Wilhelm I. in den erblichen Adelsstand, 1881 dann durch den Fürsten Reuß j.L. in den erblichen Grafenstand erhoben. Kessler wuchs in Frankreich, England und in Deutschland auf. Er war in mehreren Kulturen erzogen worden, unternahm zahlreiche Reisen, war als Diplomat im Ausland tätig. Er selbst betrachtete sich auch zeit seines Lebens als Angehöriger einer europäischen Gesellschaft. Kessler besuchte in seiner Kindheit zunächst ein Halbinternat in Paris und wechselte 1880 auf ein Internat in Ascot (England). Auf Wunsch seines Vaters trat er 1882 in die Hamburger Gelehrtenschule des Johanneums ein, wo er auch das Abitur ablegte. Nach einer Weltreise (Dezember 1891 – Juli 1892) trat er anfangs Oktober 1892 ins 3. Garde-Ulanen-Regiment in Potsdam ein und wurde Offizier. Um die Möglichkeiten, die seine gesellschaftliche Stellung ihm bot, auszunutzen, entschied sich Kessler zunächst für ein Jurastudium, das er 1888 in Bonn begann und einige Jahre später in Leipzig mit einer Promotion abschloss, später noch für ein Studium der Kunstgeschichte. 1893, nach seiner Übersiedelung nach Berlin, arbeitete er in der Redaktion der Kunstzeitschrift PAN mit, in der unter anderem Veröffentlichungen von Richard Dehmel, Theodor Fontane, Friedrich Nietzsche, Detlev von Liliencron, Julius Hart, Novalis, Paul Verlaine und Alfred Lichtwark sowie Kunstbeilagen berühmter Maler erschienen. In Berlin wurde Kessler Mitglied der 1875 gegründeten Studentenverbindung Canitzgesellschaft und verkehrte in vielen Salons, vor allem bei Marie von Schleinitz, der er in seinen Memoiren ein Andenken setzte. Am 2. März 1903 übernahm Harry Graf Kessler die ehrenamtliche Leitung des Weimarer Museums für Kunst und Kunstgewerbe. Kessler hatte Weimar zum Experimentierfeld gewählt. Er wollte das Ausstellungskonzept modernisieren und eine ständige Ausstellung für Kunst und Kunstgewerbe einrichten, um in dieser relativ abgeschlossenen Sphäre einen kulturellen Reformversuch zu wagen, für den die Metropolen Berlin oder München keine Möglichkeiten boten. Neben seiner Tätigkeit im Museumsbereich konzipierte Kessler seit 1904 die "Großherzog-Wilhelm-Ernst-Ausgabe" in Zusammenarbeit mit dem Insel-Verlag und dem Goethe- und Schiller-Archiv. Zuerst erschien eine Goethe-Ausgabe, der verschiedene Klassikerneuausgaben folgten. Kessler wollte Bücher mehr und mehr als Gesamtkunstwerke gestalten, indem er Inhalt, Typographie, Illustration und Materialien künstlerisch aufeinander abstimmte. Dazu richtete er 1913 in Weimar eine Privatpresse ein, die Cranachpresse. In dieser Offizin entstanden in oft jahrelanger Arbeit und mit höchsten Qualitätsansprüchen einige buchkünstlerisch bedeutende Werke. Zum Beispiel eine Ausgabe der Eklogen des Vergil mit Illustrationen von Aristide Maillol und Shakespeares Hamlet in der Neuübersetzung von Gerhart Hauptmann und mit Illustrationen von Edward Gordon Craig. Unter dem Namen eines so genannten Mustertheaters wollte Kessler eine neue Institution etablieren. Den dazugehörigen Theaterneubau sollte der Architekt und Künstler Henry van de Velde entwerfen. Außerdem unternahm Kessler den Versuch, durch die Einbeziehung europäischer Dichter und Schriftsteller die literarische Moderne im „Neuen Weimar“ einzuführen und dem Ort einen neuen, europäisch geprägten, literarischen Glanz zu verleihen. Gerhart Hauptmann, Richard Dehmel und Rainer Maria Rilke waren auf Vermittlung Kesslers mit Vorträgen in Weimar zu Gast. Die Pläne seines Mustertheaters scheiterten jedoch nach einer ausführlichen öffentlichen Diskussion an den konservativ-nationalistisch-völkischen Widerständen. Die international orientierte europäische Moderne und die national-völkisch ausgerichtete Heimatkunstbewegung standen sich im Kaiserreich gegenüber. Diese Positionen prallten in Weimar zu Anfang des 20. Jahrhunderts aufeinander. Zusammen mit Friedrich Lienhard hatte gegen Ende der 19. Jahrhunderts der völkisch-antisemitische Weimarer Literaturhistoriker Adolf Bartels erste Überlegungen zur Gründung einer neuen Zeitschrift angestellt. Die erste Nummer erschien zu Beginn des Jahres 1900 unter dem Titel Heimat. Blätter für Litteratur und Volkstum im Heimatverlag Georg Heinrich Meyer (Berlin, Leipzig). Die Zeitschrift stieg zum Sprachrohr der so genannten Heimatkunstbewegung auf und wurde noch im selben Jahr in Deutsche Heimat umbenannt. Kesslers Reformpläne scheiterten und die konservativen Positionen gewannen die Oberhand. Dabei spielte der Personenkreis um die Weimarer Ortsgruppe des Bundes Heimatschutz, aus dem der Deutsche Schillerbund hervorging, eine wesentliche Rolle. Auch andere Künstlerpersönlichkeiten verließen ihre vorübergehende Wirkungsstätte Weimar. 1908 ging der Maler und Grafiker Ludwig von Hofmann, zwei Jahre später der Künstler Hans Olde, 1915 verließ schließlich auch Henry van de Velde Weimar, der mit seinen architektonischen und kunstgewerblichen Arbeiten die Voraussetzungen des Bauhauses schuf. Mit Hugo von Hofmannsthal verband ihn seit 1898 eine jahrzehntelange Freundschaft. 1908 unternahm er mit ihm und Aristide Maillol eine Reise nach Griechenland. Am Libretto zum Rosenkavalier war Kessler ein maßgeblicher Mitverfasser. Hofmannsthal setzte dann auch die Worte voran: „Ich widme diese Komödie dem Grafen Harry Kessler, dessen Mitarbeit sie so viel verdankt.“ 1911 machte er Sergei Djagilews St. Petersburger Compagnie Ballets Russes auf Hofmannsthal aufmerksam und verschaffte ihm den Auftrag für das Ballett mit der Musik von Richard Strauss' Josephslegende. In den 1920er Jahren versuchte Kessler als Publizist auf die politischen Diskussionen der Weimarer Republik Einfluss zu nehmen. So schrieb er Aufsätze zu unterschiedlichen sozial- und außenpolitischen Themen, wie etwa über den Gildensozialismus oder den Völkerbund. Er schrieb eine Biografie des 1922 von Rechtsextremen ermordeten Politikers Walther Rathenau, seit 1932 erschien die von ihm mitherausgegebene Zeitschrift Das Freie Wort. 1924 versuchte er für die von ihm mitgegründete Deutsche Demokratische Partei ein Reichstagsmandat zu erlangen. Da dieser Versuch scheiterte, zog er sich weitgehend aus der Politik zurück. In den zwanziger Jahren war Kessler des Öfteren Gast des Berliner SeSiSo-Clubs. Nach der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ im März 1933 resignierte Kessler und emigrierte zunächst nach Paris, dann nach Mallorca und schließlich in die südfranzösische Provinz. Er starb 1937 in Lyon.
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar, zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein, und ist im Gesamten zu finden unter http://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Graf_Kessler.
Tagebücher 1918-1937
1918
Berlin–Magdeburg. 6. November 1918. Mittwoch
Früh um acht telephonierte mich Hatzfeldt an, das Kabinett habe doch noch gestern abend in Sachen Pilsudski einen Beschluß gefaßt, allerdings in Abwesenheit des Kanzlers und nach aufgehobener Sitzung im Stehen, aber unter Zustimmung von Groener und Hoffmann. Er soll freigelassen werden, aber vorher eine schriftliche Erklärung abgeben, deren Wortlaut von General Hoffmann aufgesetzt ist. Ich wurde beauftragt, hinzufahren und ihn zu der Erklärung zu bestimmen.
Mit Hatzfeldt ins Kanzlerpalais, wo der Kanzler nicht zu sehen war; dagegen Groener, den ich nur einen Augenblick, ohne Pilsudski zu erwähnen, sprach; dann Haeften, der die Sache formal in die Hand nahm. Im gewaltigen Kongreßsaal berieten derweilen an einem Tischchen der Marinestaatssekretär Mann und der Sozialdemokrat Ebert; Haeften hatte Eile, weil er Hermann Müller in ein Flugzeug setzen mußte, damit er nach Hamburg fliege, wohin die Verbindungen unterbrochen sind; Scheidemann schritt majestätisch im Gespräch mit einem anderen Staatsmanne durch die Säle. Auf der Treppe traf ich Oberndorff, der mir zurief, daß er um fünf mit Erzberger zu Foch ins französische Hauptquartier fahre, um die Waffenstillstandsbedingungen zu erfahren. Das débâcle ist vollständig, Kapitulation und Revolution; in diesen durch den Berliner Kongreß bismarckisch geweihten Räumen ebenso packend wie vor fünfzig Jahren die Kaiserkrönung in Versailles. Büdingen im Kriegsministerium, wohin ich mit Hatzfeldt wegen Pilsudski ging, erzählte, außer Kiel seien Hamburg, Lübeck, Cuxhaven von der meuternden Marine genommen, in Hamburg die Truppen übergelaufen, eine rote Regierung. Rote strömten mit allen Zügen von Hamburg nach Berlin. Man erwarte für heute abend hier einen Putsch. Die Russische Botschaft ist heute früh aufgeflogen wie eine Kaschemme, Joffe mit Personal abgeschoben. Das bolschewistische Hauptquartier in Berlin damit zerstört. Vielleicht werden wir sie noch zurückrufen.
Um drei nach Magdeburg. Drei Viertel sieben an. Keine Weisungen angetroffen. Daher Verhandlungen heute abend unmöglich. Der Hauptmann d. R. Schloessmann, der Bewachungsoffizier von Pilsudski, sagt mir, es sei ausgeschlossen, daß dieser unsere Erklärung unterschreibe oder überhaupt etwas Schriftliches von sich gebe; er und Sosnkowski seien genau über die politische Lage unterrichtet und hätten ihm bereits gesagt, daß sie infolge des Waffenstillstandes in wenigen Tagen freikommen müßten. Weshalb sollten sie da sich jetzt noch binden?
Magdeburg. 7. November 1918. Donnerstag
Da früh noch immer keine Weisungen, an Hatzfeldt über Generalkommando telegraphiert. Gegen zwölf telephonierte mir Hatzfeldt, die Antwort auf meine Depesche sei unterwegs und zustimmend. Da zu spät, um noch heute den Zug nach Warschau in Berlin zu erreichen, solle ich morgen fahren und es so einrichten, daß Pilsudski möglichst kurz in Berlin bleibe. Daher das geplante Frühstück bei Hiller mit Pilsudski, Hatzfeldt, Langwerth aufgegeben. Ich mache die Freilassung morgen früh und fahre mit beiden um eins nach Berlin, von wo sie um sechs nach Warschau Weiterreisen.
Nachmittags kam für mich über das Generalkommando vom Kriegsministerium Telegramm: ›Staatssekretär mit sofortiger Freilassung unter Berufung auf die Ihnen neulich gemachten mündlichen Erklärungen einverstanden. Es liegen neue politische Gründe vor, welche möglichst baldige Freilassung dringend erwünscht erscheinen lassen.‹
Schloessmann morgens bei mir in großer Aufregung, weil der Kommandierende ihm den Befehl geschickt hat, die Garnison in Alarmbereitschaft zu setzen. Er meint – was wohl richtig ist –, dadurch würden die Truppen nur nervös und zu Putschen geneigter; bat mich, zu intervenieren. Ich sagte, meine Mission gebe mir nicht das geringste Recht, in militärische Maßnahmen einzugreifen; wenn der Kommandierende aber meine Ansicht als Privatmann hören wolle, werde ich auffälligen und nicht unbedingt notwendigen Vorkehrungen widerraten. Gleich darauf wurde vom Generalkommando angeklingelt, der Kommandierende wünsche mich zu sprechen. Ich fuhr hinaus und hörte dort, daß inzwischen auch Hannover von den Roten genommen ist. Sie haben den Kommandierenden verhaftet und das Generalkommando besetzt. Man erwartet eine Abordnung roter Matrosen in Magdeburg heute nachmittag, hofft, sie am Bahnhof abzufangen. In den Kruppwerken wird gearbeitet, jedoch unter Unruhe.
Der Kommandierende, ein General der Kavallerie von Werder, ein fetter, müder Mann, der aus dem Kriege heimgekehrt und hier den Verhältnissen nicht gewachsen ist, saß ziemlich zusammengebrochen vor seinem Schreibtisch. Den Befehl zur Alarmbereitschaft hatte er bereits wieder zurückgezogen auf Vorstellungen des Polizeipräsidenten. Er fragte mich, wie man es in Berlin mache? Ich sagte, soviel ich weiß, benutze man möglichst die Arbeiter selbst, die Organisation der Gewerkschaften und Sozialdemokratischen Partei, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Werder meinte müde, das sei auch seine Absicht, möglichst die Arbeiter selbst vorzuschieben, ließ aber durchblicken, daß er sich nicht wundern würde, wenn ihn selber noch im Laufe des heutigen Tages die Revolutionäre abführten. Zu den Truppen hat offenbar weder er noch irgendeiner seiner Offiziere, die ich sprach, wirklich Zutrauen. Er sagte kleinlaut, ›er habe ja nichts da‹. Womit solle er einen Aufstand niederwerfen? Ich mußte an die Zeit in Lüttich im August 1914 denken, wo wir auch nichts hatten und dann der Aufstand wirklich kam, die gräßliche Unterdrückung. Man muß hoffen, daß wir das jetzt nicht in Deutschland erleben! Bisher sind die Vorgänge in Kiel, Lübeck, Altona, Hamburg, Hannover ziemlich unblutig. Aber alle Revolutionen fangen unblutig an. Der Durst nach Blut kommt erst allmählich mit den Anstrengungen, die die neue Ordnung kostet, um sie durchzuführen.
Auf der Straße hier grüßen die Mannschaften prompt und stramm, ihre Straßendisziplin hat bisher nicht gelitten.
Die Physiognomie der Revolution beginnt sich abzuzeichnen: allmähliche Inbesitznahme, Ölfleck, durch die meuternden Matrosen von der Küste aus. Sie isolieren Berlin, das bald nur noch eine Insel sein wird. Umgekehrt wie in Frankreich revolutioniert die Provinz die Hauptstadt, die See das Land: Wikingerstrategie. Vielleicht kommen wir so gegen unseren Willen an die Spitze des Sklavenaufstandes gegen England und das amerikanische Kapital. Liebknecht als Kriegsherr in diesem Endkampf; die Flotte hat die Führung.
Magdeburg. 8. November 1918. Freitag
Die sozialdemokratische Parteileitung hat gestern nachmittag um fünf durch Ebert und Scheidemann dem Reichskanzler eine Erklärung überreicht, in der unter anderem gefordert wird, daß die Abdankung des Kaisers und des Kronprinzen bis heute mittag bewirkt würde. Der Kanzler ist zum Kaiser ins Hauptquartier gefahren.
Schloessmann kam morgens um achteinhalb, um mir zu sagen, daß der Bahnverkehr mit Berlin unterbrochen sei. Ich beschloß, ein Militärauto zu requirieren und Pilsudski im Auto nach Berlin zu bringen. Während Schloessmann telephonisch deshalb verhandelte, kamen Nachrichten, daß sich ein großer Demonstrationszug auf dem Breiten Weg gebildet habe, daß Offizieren die Achselstücke abgerissen und der Degen abgenommen würden. Die Arrestlokale seien gestürmt und die Gefangenen befreit worden. Offenbar war es höchste Zeit, wenn ich Pilsudski überhaupt noch aus Magdeburg hinausbringen wollte. Ich ging daher mit Schloessmann zum Kommandanten der Kraftfahrtruppen, dem Rittmeister von Gülpen, und bat diesen, mir sofort ein Auto zur Verfügung zu stellen. Gülpen, ein äußerst energischer Mann, der die Armeniergreuel und den Krieg bei den Türken im Kaukasus mitgemacht hat, erbot sich, selbst zu fahren. Fraglich war, ob die Meuterer bereits die Elbbrücken besetzt hätten. Wir beschlossen daher, uns zu trennen. Gülpen sollte das Auto aus der Stadt hinausbringen und an der Berliner Chaussee jenseits der Elbe warten, während ich mit Schloessmann in die Festung ging und Pilsudski befreite.
Da man als Offizier nicht mehr unbelästigt über die Straße gehen konnte, zogen Schloessmann und Gülpen sich in Zivil um; ich lieh mir von Gülpen wenigstens einen Zivilmantel und Zivilhut. In diesem Aufzuge gingen Schloessmann und ich durch Seitenstraßen zur Zitadelle. Hier war noch alles ruhig. Etwa zwei Dutzend Soldaten von der Genesenden-Kompanie lungerten vor dem Tor. Auf der Wache bat der wachhabende Unteroffizier um Verhaltungsvorschriften.
Wir hielten uns nicht auf, sondern eilten über den Hof zum Hause, in dem Pilsudski und Sosnkowski interniert waren. Beide gingen zusammen im Garten auf und ab: Pilsudski in polnischer Uniform, Sosnkowski in Zivil. Ich trat auf sie zu und sagte, ich freute mich, ihnen sagen zu dürfen, daß sie frei seien. Der Reichskanzler und die Regierung hätten auf Grund des Berichtes, den ich ihnen über mein Gespräch mit Pilsudski erstattet hätte, und der darin zum Ausdruck gekommenen Gesinnung Pilsudskis seine Freilassung beschlossen und mich beauftragt, ihm davon Mitteilung zu machen sowie ihn und den Obersten Sosnkowski nach Berlin zu bringen, damit sie von dort noch heute abend nach Warschau führen. Pilsudski und Sosnkowski verbeugten sich schweigend, während ich ihnen die Hand drückte. Jetzt mußte ich ihnen aber auch noch sagen, daß der Eisenbahnverkehr mit Berlin unterbrochen sei, daß in der Stadt Demonstrationen stattfänden, wir daher zu Fuß über die Eibbrücke und bis auf die Berliner Chaussee hinausgehen müßten, wo uns ein Auto erwarte. Sie möchten das Nötigste zusammenpacken und gleich mitkommen.
Schloessmann, der befürchtete, daß die Meuterer die Zitadelle stürmen könnten, mahnte zur Eile. In einer Viertelstunde hatte jeder sein Päckchen gepackt, und wir zogen, Pilsudski mit mir, Sosnkowski mit Schloessmann, zur Zitadelle hinaus, die allgemeine Neugier der herumstehenden Soldaten erregend. Pilsudski ging in seinem alten, abgetragenen Soldatenmantel, eine Decke über dem Arm, etwas gebeugt neben mir, nachdenklich und ernst. Er meinte, wir hätten zu lange gewartet; er kenne die Psychologie der Revolution: man müsse entweder sofort energisch unterdrücken (er machte mit der Faust eine Handbewegung) oder sofort Konzessionen machen. Jetzt sei es schon für beides zu spät. Deutschland werde schwere Zeiten durchmachen. Der Bolschewismus passe nicht für zivilisierte Länder, die gut organisiert seien. Unsere Roten wüßten offenbar selber nicht, was sie wollten. Auch für Polen passe der Bolschewismus nicht. Ich sagte, Polen brauche wie Deutschland Ruhe; weil auch er diese Auffassung habe und daher Frieden mit Deutschland wollte, sei er freigelassen worden. Er murmelte: "Selbstverständlich." Dann fragte er, ob ich wisse, warum er und Sosnkowski das Eiserne Kreuz, zu dem sie Gerok eingegeben habe, nicht bekommen hätten? Es sei eine Dekoration für tapfere Männer, die man gern trüge.
Hinter einer Vorstadt stand Gülpen und führte uns zum Auto. Schloessmann verabschiedete sich; der Wagen wurde angekurbelt, wir fuhren los. Es war ein frühlingswarmer, himmelblauer Tag, etwas feucht und erschlaffend, so daß draußen zwischen Wald und Acker der Gedanke an Feindschaft, Krieg, Revolution bei uns allen vieren in die Ferne schwand. Pilsudski, der hustete und sich einen alten Filzhut zum Schutz vorm Luftzug vor den Mund hielt, stieß mich einmal an und sagte, so sei die Gegend bei ihm zu Hause, ganz heimatlich, dieser arme Boden, die Kiefern und Waldstückchen, nur hügeliger sei es, wo er aufgewachsen sei auf dem Familiengut bei Wilna. Seine Familie sei mit dem Lande von alters her verwachsen, heiße eigentlich Ginet (Ginaitis), nach dem Gute aber Ginet-Pilsudski. Sie seien Litauer; er selbst könne aber nur Polnisch, kein Litauisch. Auch Sosnkowski taute auf, fand Gefallen an den Erzählungen von Gülpen aus Armenien.
In Genthin machten wir halt bei einem Molkereibesitzer Ballhöfer, der auf Gülpens Weisungen ein Mittagsmahl gerüstet hatte, friedensmäßig, mit schöner und reichlicher Butter, einer Milchsuppe, Fleisch, Käse, Sahne zum Kaffee. Wir saßen im Molkereigebäude im oberen Stock. Pilsudski lag glücklich in einem bequemen Rohrstuhl, Sosnkowski meinte, es sei wie ein Märchen ›Tischleindeckdich‹.
Eine Anfrage in Brandenburg beim Garnisonältesten ergab, daß dort alles ruhig sei. Bald nach zwei fuhren wir weiter. ›Komfortabel‹, wie Sosnkowski beim Losfahren bemerkte.
Plaue und Brandenburg waren ganz ruhig. Erst in Wustermark trat die Unruhe wieder zutage. Das Dorf auf den Beinen, am Bahndamm versammelt, kurz dahinter ein Posten von Landwehrleuten, die uns anhielten, mitten dazwischen ein Husarenoffizier, der jede Kenntnis oder Verantwortung ablehnte. Eben fuhren zwei dicht mit Matrosen besetzte Züge in der Richtung auf Berlin durch; ›Deputationen‹, wie der Unteroffizier des Postens erläuterte. Niemand dachte daran, sie aufzuhalten.
Am Reichskanzlerplatz, wo Gülpen wohnt, machten wir Station und stiegen zu ihm hinauf. Frau und Kinder empfingen uns, etwas überrascht. Ich telephonierte an Hatzfeldt, um ihm unsere Ankunft mitzuteilen. Er antwortete, weiterreisen könne Pilsudski heute nicht, da der Eisenbahnverkehr eingestellt sei. Zimmer seien im ›Continental‹ bestellt. Pilsudski und Sosnkowski sehr niedergeschlagen, als ich ihnen dies mitteilte. Pilsudski seufzte: "Einen Tag zu spät"; Sosnkowski fragte, ob sie nicht morgen auf einem Extrazuge oder Auto wenigstens bis an die Grenze kommen könnten? Ich brachte sie ins ›Continental‹. Beim Abschied bat mich Pilsudski, ob ich ihm nicht einen Degen verschaffen könne, da er in Uniform ohne Degen hier nicht ausgehen könne. Ich sagte ja, aber allerdings nur einen preußischen, wenn ihn das nicht störe? "Nicht im geringsten", antwortete er. Ich versprach ihm, einen morgen früh zu bringen.
Berlin. 9. November 1918. Sonnabend
Der Kaiser hat abgedankt. Die Revolution hat in Berlin gesiegt. Vormittags von zu Hause fortgehend sehe ich einen Soldaten im Hofe des Potsdamer Bahnhofs neben der aufgefahrenen MG-Kompanie eine Menschenmenge harangieren. Auf den Straßen (Friedrichstraße – Linden) ist um diese Zeit (zehneinhalb bis elf) alles still. Ich gehe in Uniform unbehelligt bis zur Disconto-Gesellschaft gegenüber von der Bibliothek. Von da zu Pilsudski ins ›Continental‹. Der Diener, dem ich den Auftrag gegeben hatte, mir für Pilsudski einen Degen zu besorgen, wartete am ›Continental‹, um mir zu sagen, daß alle Waffen in den Geschäften beschlagnahmt, ein Degen deshalb nicht zu bekommen sei. Ich ging zu Pilsudski, sagte es ihm, schnallte mein altes Feldzugsseitengewehr ab und gab es ihm als Erinnerung an unsere frühere Waffenbrüderschaft.
Wir sprachen dann noch einmal in Anwesenheit von Sosnkowski über Politik. Ich wiederholte, daß eine schriftliche Bindung Pilsudskis auf mein ausdrückliches Betreiben und im Einverständnis sowohl mit dem Reichskanzler Prinzen Max wie mit Groener und dem Kriegsminister unterblieben sei, weil ich es für klüger hielte, mich ganz allein auf seine Ehre und seinen Patriotismus zu verlassen, die ihm eine für Deutschland genehme Bahn wiesen, nämlich Frieden mit Deutschland, um Ruhe zum inneren Aufbau zu gewinnen. Pilsudski sagte, dieses sei um so richtiger, als Polen nicht selber über seine Grenzen zu bestimmen habe, sondern sie von der Entente bestimmt bekommen würde. Was die Entente ihnen schenke, würden sie gewiß nicht zurückweisen; aber selber würden sie kaum gefragt werden. Ich sagte, es gebe Geschenke, die dem Beschenkten nicht zum Vorteile gereichten. Eine Zerstückelung Deutschlands durch Herausreißen von Westpreußen würde eine Revanche und Irredentabewegung hervorrufen, die weder Polen noch Deutschland je zur Ruhe kommen ließe. Allerdings wäre eine solche Unruhe für Amerika und England durchaus erwünscht, nicht aber für Deutschland und Polen, die nur in gegenseitiger Hilfe und guter Nachbarschaft vorwärtskommen könnten.
Von Pilsudski ging ich ins Amt zu Hatzfeldt, um einen Extrazug für die beiden Polen zu besorgen; sie müssen, auch nach Hatzfeldts Wunsch, noch heute abreisen. Hatzfeldt erzählte mir hierbei vertraulich, zu einem Waffenstillstand im bisher erwarteten Sinne werde es wahrscheinlich nicht mehr kommen, da inzwischen in Frankreich ähnliche revolutionäre Zustände eingetreten zu sein schienen wie bei uns. Hintze habe aus dem Hauptquartier telephoniert, daß sich an unserer und an der französischen Front Soldatenräte gebildet hätten, die direkt miteinander über den Frieden verhandelten. Das sei unsere Rettung, wenn es wahr wäre. Ich ging einen Augenblick zu Langwerth in sein Zimmer, um ihn zum Frühstück mit Pilsudski einzuladen; während wir sprachen (es war ein Uhr), wurde er angeklingelt und bekam die Nachricht, daß eben die Maikäferkaserne gestürmt sei. Damit ist die Revolution auch in Berlin erfolgreich ausgebrochen.
Hatzfeldt und ich gingen ins Kriegsministerium, um den Zug für Pilsudski zu besorgen. Hier arbeitete alles noch wie gewöhnlich. Ein Major, der im alten Schnodderton sprach (von Pilsudski als ›der Kerl‹), wies uns an die Linienkommandanten am Schöneberger Ufer. Durch die Königgrätzer Straße zog eine Demonstration gegen den Potsdamer Platz; wir kamen hinten daran vorbei. An der Ecke der Königgrätzer und Schöneberger Straße wurden Extrablätter verkauft: ›Abdankung des Kaisers‹. Mir griff es doch an die Gurgel, dieses Ende des Hohenzollernhauses; so kläglich, so nebensächlich, nicht einmal Mittelpunkt der Ereignisse. "Längst überholt", sagte Ow schon heute morgen. Ich zog mir zu Hause Zivil an, weil Offizieren die Achselstücke und Kokarden abgerissen wurden; ging dann zu Hiller. In der Wilhelmstraße sah ich das erste rotbeflaggte Auto, ein feldgraues mit dem kaiserlichen Adler.
Von zu Hause ging ich, um Schickele zu treffen, in die Viktoriastraße zu Paul Cassirer, wo der ›Bund Neues Vaterland‹ tagte; in den Sälen unten hielt Pfemfert eine Rede. Wir aßen ohne Cassirers in ihrem Eßzimmer mit Hugo Simon und seiner Frau. Schickele warf den Gedanken auf, das Elsaß durch Matrosen zu revolutionieren, als rote Republik auszurufen und so für das deutsche Volk zu retten. Währenddessen hörte und sah man aus dem Hinterzimmer die Schießerei beim Schloß. Langsames Infanteriefeuer, einzelne Schüsse am Himmel aufleuchtend wie in einer stillen Nacht an der Front. Das Schloß war nach Nachrichten bereits in den Händen der Revolutionäre, der Marstall noch zum Teil von Offizieren und Jugendwehr besetzt.
Um den Einfall ins Elsaß zu besprechen, gingen Schickele, Kestenberg und ich gegen zehn in den Reichstag. Vor dem Hauptportal steht in den Scheinwerferstrahlen von mehreren feldgrauen Autos eine Nachrichten abwartende Menge. Leute drängen die Stufen hinauf ins Portal. Soldaten mit umgehängten Karabinern und roten Abzeichen fragen jeden, was er drinnen will. Kestenberg bringt uns auf den Namen Haase anstandslos hinein. Innen herrscht ein buntes Treiben; treppauf, treppab Matrosen, bewaffnete Zivilisten, Frauen, Soldaten. Gut, frisch und sauber, vor allen Dingen sehr jung sehen die Matrosen aus; alt und kriegsverbraucht, in verfärbten Uniformen und ausgetretenem Schuhzeug, unordentlich und unrasiert die Soldaten, Überreste eines Heeres, ein trauriges Bild des Zusammenbruchs. Wir werden zuerst in ein Fraktionszimmer hinaufgewiesen, wo am grünen Tisch drei blutjunge Matrosen Waffenscheine ausstellen, mit dem Ernst und dem Willen zur Wichtigkeit von Schuljungen prüfend, bewilligend, verwerfend.
Dann geht es auf die Suche nach Haase. Unter den Säulen der Wandelhalle liegen und stehen auf dem mächtigen roten Teppich Gruppen von Soldaten und Matrosen; Gewehre sind zusammengestellt, hier und da schläft einer auf einer Bank lang hingestreckt: ein Film aus der russischen Revolution, Taurisches Palais unter Kerenski. Die Tür des Sitzungssaals fliegt auf. Während die Wandelhalle ziemlich dunkel ist, ist dieser grell beleuchtet, Bogenlicht. Mir fällt zuerst nur seine Häßlichkeit auf; nie ist er mir so würdelos und kneipenhaft vorgekommen, dieser lächerliche ›altdeutsche‹ Kasten, eine schlecht imitierte Augsburger Truhe. In ihm wogt zwischen den Bänken eine Menschenmenge, eine Art Volksversammlung, Soldaten ohne Kokarden, Matrosen mit umgehängtem Karabiner, Frauen, alle mit roten Schleifen, dazwischen Abgeordnete, um die sich kleine Gruppen bilden: Dittmann, Oscar Cohn, Vogtherr, Däumig. Haase steht vorgebeugt über den Bundesratstisch und spricht auf einen jungen Zivilisten ein, einen der Hauptbolschewisten, wie erzählt wird. Endlich dringen wir zu ihm durch; Schickele begrüßt ihn und stellt mich vor. Er ist auf die Idee eines Matroseneinbruchs ins Elsaß scheinbar vorbereitet, geht kurz darauf ein, schlägt morgen eine Besprechung vor. Dann ziehen ihn andere ins Gespräch.
Wir drängen uns wieder zum Sitzungssaal hinaus; steigen einige Stockwerke hinauf in ein Sitzungszimmer, wo eine Frau, anscheinend die eines Abgeordneten, Legitimationen austeilt. Auf Kestenbergs Empfehlung erhalte ich eine Karte, wonach ich als ›Inhaber dieses Ausweises‹ beauftragt bin, ›den Ordnungs- und Sicherheitsdienst in den Straßen der Stadt zu versehen‹. Gezeichnet: Oscar Cohn, Vogtherr, Dittmann. Ich bin also sozusagen Schutzmann in der roten Garde. Außerdem bekomme ich eine Legitimation auf meinen Namen vom Arbeiter- und Soldatenrat, daß ich vertrauenswürdig und berechtigt sei, ›frei zu passieren‹. Beides mit dem Stempel des Reichstages.
Kestenberg und Schickele gehen nach Hause. Ich durchschritt auf Grund meiner neuen Papiere die Absperrung am Potsdamer Platz und ging gegen das Schloß zu, wo noch einzelne Schüsse fielen. Die Leipziger Straße war menschenleer, die Friedrichstraße mäßig belebt von dem üblichen Publikum; die Linden gegen die Oper dunkel. In der Schinkelschen Wache sah man im hellen Licht Qualm und viele Soldaten. Auf der Schloßbrücke niemand. Die weißen, nackten Krieger mit ihren Siegesgöttinnen allein. Im Schlosse waren einzelne Säle hell beleuchtet, aber alles still. Patrouillen ringsherum, die mich anriefen und durchließen. Am Marstall lagen viele Steinsplitter. Der Posten sagte, ›Lausejungens‹, Pfadfinder, seien noch verborgen, sowohl im Schloß wie im Marstall. Es gebe geheime Gänge, durch die sie flüchteten und wieder auftauchten. In der Enckestraße schössen aus einem Hause noch zwei Offiziere und einige kaisertreue Mannschaften. Autos, die mit Bewaffneten über die Schloßbrücke heranbrausten, wurden angehalten, umgedreht und nach der Enckestraße 4 gewiesen. Jenseits der Schloßbrücke wieder eine Absperrung. Dahinter lichtscheues Gesindel in kleinen Rudeln an beiden Ecken der Königstraße, von den Posten zerstreut, aber immer wieder sich sammelnd. Ein Unteroffizier sagte zu mir, sie warteten auf das Plündern; man müsse sie fortbringen. Ich ging von hier langsam nach Hause.
In der Leipziger Straße rannte mir flüchtendes Publikum entgegen; ich fragte, wovor? Einige riefen, Gegentruppen seien aus Potsdam angekommen, gleich werde geschossen. Ich bog durch die Wilhelmstraße ab, hörte nichts. Einige Schüsse sollen aber am Potsdamer Platz um diese Zeit gefallen sein. Zu Hause war ich gegen eins. So schließt dieser erste Revolutionstag, der in wenigen Stunden den Sturz der Hohenzollern, die Auflösung des deutschen Heeres, das Ende der bisherigen Gesellschaftsform in Deutschland gesehen hat. Einer der denkwürdigsten, furchtbarsten Tage der deutschen Geschichte.
Berlin. 10. November 1918. Sonntag
Bei Cassirer Gespräch mit Schickele und anderen über die Lage. Die meisten beurteilten sie pessimistisch. Alles dreht sich jetzt um die Frage, ob die Liebknechtleute und mit ihnen der rote Terror oder ob der gemäßigte Teil der Sozialdemokratie siegen wird. Schickele meinte, die Bolschewisten hätten schon gesiegt. Haase treibe eine zweideutige Politik. Alle Anstrengungen müßten darauf gerichtet sein, Haase und den rechten Flügel der Unabhängigen vom Bolschewismus fernzuhalten und auf die konstituierende Nationalversammlung einzustellen. Während wir sprachen, wurde beim Reichstag geschossen. Anscheinend Maschinengewehrfeuer. Nachher hörten wir, daß die Schießerei während einer Volksversammlung vor dem Bismarckdenkmal gewesen war.
Abends aß ich bei Schickeles im "Excelsior" mit seinem Freund Dr. Licktrig und Theodor Däubler. Schickele wird durch den Frieden, wenn er nicht optiert, Franzose, Däubler Italiener; beides deutsche Dichter, schon dadurch die ganze Unsinnigkeit und die Brüchigkeit des projektierten Friedens beleuchtend. Schickele erklärte seine feste Absicht, nach Berlin überzusiedeln, obwohl er Norddeutschland nicht mag. Die Person des Kaisers, der das Preußentum verschandelt und dadurch zugrunde gerichtet hat, wurde mit Verachtung besprochen. Daß Deutschland Republik wird, scheint schon nicht mehr fraglich. Der König von Sachsen ist heute abgesetzt worden. Der Großherzog von Hessen befindet sich, wie Schickele erzählt, in Schutzhaft. Die Wahl der neuen Regierung hat Schickele und alle, die ich sprach, sehr beruhigt.
Der Chef der roten Garde, der das Excelsior-Hotel bewacht, ein Kamerad vom Matrosenregiment Nr. 1, entwickelte mir sein Programm, das Gehorsam gegen die neue Regierung, Wahrung von Ordnung und Ruhe, Feindschaft gegen alle Gewalt einschließlich von Plünderungen umfaßte – ein junger Mensch von etwa dreiundzwanzig bis vierundzwanzig Jahren, der die Revolution seit Kiel mitmacht; ein einfacher Mann, der die Gesinnung der großen Mehrheit unserer Revolutionäre ausspricht. Alles in allem war trotz der Schießereien die Haltung des Volkes in den beiden bisherigen Revolutionstagen ausgezeichnet: diszipliniert, kaltblütig, ordnungsliebend, eingestellt auf Gerechtigkeit, fast durchweg gewissenhaft. Ein Gegenstück zur Opferfreudigkeit im August 1914. Ein so großes und tragisches Erleben, so reinen Sinnes und tapfer getragen, muß es innerlich zusammenschweißen zu einem Metall von unzerstörbarer Spannkraft. Wenn nur der politische Sinn nicht so selten wäre! Das, was jeder italienische Makkaronihändler hat!
Den Schluß des Abends bildete ein komisches Intermezzo. Däubler, der seiner Schwester versprochen hatte, wegen der Gefahren der Straße die Nacht im Hotel zu bleiben, sich aber als "Österreicher" einschrieb, wurde vom Direktor als Hotelgast energisch abgelehnt, weil er als "Ausländer" keinen Ausweis habe. Es gab eine Szene, bis ich als Beauftragter des Arbeiter- und Soldatenrates, der auf Grund meiner Karte für Sicherheit und Ordnung zu sorgen hatte, einschritt und dem Direktor kraft meiner Autorität befahl, Däubler zu behalten; worauf der Direktor nach guter, alter preußischer Art vor der Disziplin, wenn auch revolutionären Ursprungs, sich beugte und Däubler ein Zimmer anwies. Alles ist wie ausradiert, nur nicht der Knick in der Wirbelsäule.
Berlin. 11. November 1918. Montag
Die furchtbaren Waffenstillstandsbedingungen sind heute unterschrieben worden. Langwerth sagt, etwas anderes sei nicht möglich gewesen, da unsere Front in voller Auflösung begriffen sei.
Der Kaiser ist nach Holland geflohen.
Berlin. 12. November 1918. Dienstag
Nachmittags im Reichstag im Fraktionszimmer des "Bundes Neues Vaterland". Auf Kestenbergs Anfrage sagte ich zu, in den Vorstand einzutreten. Wie in der Französischen Revolution bilden sich Klubs, in denen die politisch wichtigen Fragen vordebattiert und entschieden werden. Ihren Sitz haben sie sich in den Fraktionszimmern des Reichstags erobert: der "Bund Neues Vaterland", die "Aktivisten" (Kurt-Hiller-Gruppe) und andere, die neben den Soldaten- und Arbeiterräten dort tagen. Das Bild des Reichstags hat sich trotz der strengen Absperrung (man kommt nur noch mit dem roten Passierschein des Soldatenrates hinein) seit der ersten Revolutionsnacht nicht geändert, bis auf den größeren Schmutz, der sich anhäuft. Überall Zigarettenstummel, fortgeworfene Papierstücke, Staub, Straßendreck auf den Teppichen. Gänge und Wandelhalle wimmeln von Bewaffneten, Soldaten und Matrosen. In der Halle stehen auf dem Teppich die Pyramiden zusammengestellter Gewehre; in den Klubsesseln liegen Matrosen. Eine große Unordnung, aber Ruhe. Die alten Diener in ihren Livreen gehen dazwischen machtlos und schüchtern herum als letzter Rest des früheren Regimes. Die Abgeordneten der bürgerlichen Parteien sind ganz verschwunden.
In der Stadt ist heute alles ruhig; die Fabriken arbeiten wieder. Von Schießereien ist nichts bekanntgeworden. Bemerkenswert übrigens, daß während der Revolutionstage trotz der Straßengefechte die Elektrischen regelmäßig gefahren sind. Auch das elektrische Licht, Wasserleitung, Telephon haben keinen Augenblick ausgesetzt. Die Revolution hat nie mehr als kleine Strudel im gewöhnlichen Leben der Stadt gebildet, das ruhig in seinen gewohnten Bahnen drum herumfloß. Auch gab es trotz dem vielen Schießen merkwürdig wenig Tote oder Verwundete. Die ungeheure, welterschütternde Umwälzung ist durch das Alltagsleben Berlins kaum anders als im Detektivfilm hindurchgeflitzt.
Berlin. 13. November 1918. Mittwoch
Um eins ging ich zu Haase ins Reichskanzlerpalais. Im schönen Empirevestibül viele wartende Bittsteller in Schlapphüten. Nie ist hier ein solches Gedränge gewesen. Ein kleiner Junge, der als Laufbursche amtiert, wies mich in den ersten Stock, wo noch einige befrackte Diener aus der früheren Zeit ihren Dienst versehen. Zum letzten Male war ich vor acht Tagen, noch unter dem Prinzen Max zu Anfang des débâcle, hier; seitdem rapider Fortschritt in der Verwahrlosung. Die Boheme ist eingedrungen. Der Kongreßsaal war leer bis auf einen Literaten mit einer roten Schleife im Knopfloch, der mit mir wartete.
Haase kam aus einem der Salons links heraus und holte mich zu sich hinein. Er ist ein kleiner, unscheinbarer Mann mit einer freundlichen jüdischen Manier; erinnerte mich, ins Semitische transponiert, an Chlodwig Hohenlohe. Er sitzt an Bismarcks Schreibtisch, erkennbar an der Kupferplatte. Ich kam wegen der Anknüpfung mit Frankreich, namentlich jetzt sofort mit den französischen Sozialisten. Haase sagte, am liebsten wäre er selber nach der Schweiz gekommen; augenblicklich sei das aber nicht möglich. Aber die Franzosen wüßten, daß er schon vor August 1914 gegen den Krieg gewesen sei und nur mitgemacht habe, um die Einigkeit der Partei nicht zu gefährden, bis es ihm schließlich unmöglich geworden sei. Schickele solle die Sache machen, ich mitwirken. Auch die kulturelle Anknüpfung, die in meinen Händen liege, sei äußerst wichtig. Ich sagte, selbstverständlich stellte ich mich weiter zur Verfügung; aber wenn ihm oder der neuen Regierung eine andere Persönlichkeit lieber wäre, würde ich sofort zurücktreten. Haase antwortete, ihm sei ich sehr recht, er müsse aber noch die Sache bei seinen Kollegen vorbringen; er bäte mich, ihn vor meiner Abreise noch einmal zu besuchen.
Um fünf bei Paul Cassirer, wo noch Schickele. Beide reisen heute abend über München nach der Schweiz. Cassirer ist erfüllt von der Gefahr einer Reaktion. Das ganze Bürgertum habe schon heute die Revolution satt. Die Potsdamer Regimenter, die ihre Offiziere in den Soldatenrat gewählt haben, könnten mit leichter Mühe alles wieder umstoßen. Schickele und Cassirer machten beide einen mißmutigen, verschlossenen, verlegenen Eindruck.
Von hier ins Auswärtige Amt, wo ich Langwerth sehen wollte wegen der Anknüpfung mit den französischen Sozialisten und Ferdinand Stumm wegen anderer Dinge. Langwerth über das mit Haase und Solf Besprochene informiert. Dann einen Augenblick bei Hatzfeldt, der über Pilsudskis Tätigkeit in Warschau sehr erfreut: Pilsudski ist vom Regentschaftsrat als eine Art von Diktator eingesetzt und hat als erste Amtshandlung den deutschen Soldaten die Waffen wiedergegeben. Wenn er so weiterregiert, ist meine Politik glänzend gerechtfertigt. Riezler, den ich traf, erzählte, am Sonntag habe Liebknecht einen wüst aussehenden "Hauptmann Wagner" zum Reichskanzler Ebert geschickt mit einem roten Zettel, auf dem sofortige Gestellung eines Autos zur Befreiung von Pilsudski verlangt wurde. Ebert schickte den Mann zu Riezler, der ihm sagen konnte, daß Pilsudski längst in Warschau sei.
Berlin. 14. November 1918. Donnerstag
Vormittags bat mich Hatzfeldt zu einer Besprechung und fragte mich, ob ich den Gesandtenposten in Warschau annehmen würde. Die polnische Regierung verlangt die Abberufung von Lerchenfeld und Oettingen und die sofortige Ernennung eines Gesandten. Meine Hauptaufgabe werde zunächst sein, dafür zu sorgen, daß unsere Truppen aus Polen und aus der Ukraine herauskommen. Eine äußerst schwere und verantwortungsvolle Aufgabe. Ich nahm an.
Gleich nachher traf ich im Amte Erzberger. Er zog mich in ein Zimmer und meinte, ich hätte hierbleiben sollen. Jetzt würden energische Männer hier gebraucht, sonst bekämen wir keinen Frieden. Mit der jetzigen Regierung werde die Entente keinen Frieden schließen, wenn nicht bürgerliche Elemente hineinkämen. Er bedauere, daß er während der Revolution abwesend gewesen sei; sonst wäre keine rein sozialistische Regierung zustande gekommen. Er unterschätzt jetzt wieder wie in der Abdankungsfrage die Linkskräfte, die der Krieg bei uns entwickelt hat. Seine Reise ins französische Hauptquartier hat bei ihm einen sehr schlechten Eindruck hinterlassen. Die Behandlung sei gemein gewesen; Foch eisig und ganz von oben herab.
Zum Tee bei der Gräfin Bernstorff, wo auch er, der Botschafter, und ihre Schwiegertochter. Bernstorff bereitet sich auf die Reise nach den Haag zu den Friedensverhandlungen vor.
Nachher im Amt nochmals bei Hatzfeldt, dem ich meine Wünsche für meine Gesandtschaft vortrug: als erstes sofort einen im Eisenbahnwesen erfahrenen, tüchtigen Generalstabsoffizier, der mir bei den Verhandlungen über den Abtransport der Truppen hilft. Dann einen jüngeren Diplomaten, der in polnischen Dingen schon gearbeitet hat. Ferner einen guten, polnisch redenden Journalisten. Schoeber als meinen persönlichen Adjutanten. Gülpen als Stütze in brenzligen Lagen und als Freund von Sosnkowski. Schließlich ein ausreichendes Budget, auch für Repräsentation. Hatzfeldt gestand dies alles zu. Ich bat ferner um Weisungen in den Grenzfragen und über das Verhältnis zu Oberost. Hatzfeldt sagte, für die Grenzfragen solle ich auf die Friedenskonferenz verweisen, die bestimmen werde, welche Gegenden rein polnisch seien. Die Truppen in Polen unterstünden noch dem Oberbefehlshaber Ost. Mit diesem muß ich mich also verständigen. Langwerth gratulierte mir im Gang; er schien wohlwollend und erfreut. In Wirklichkeit werden wohl die wenigsten diesen Posten begehren.
Heute um eins, als ich die Linden hinunterging, kam die Schloßwache vom Brandenburger Tor mit dem Hohenfriedberger Marsch anmarschiert, genau wie früher, nur mit roten Revolutionsfahnen, die Mannschaften ohne Kokarden und die Unteroffiziere oder Ordner mit schwarzrotgelben großdeutschen Armbinden. Die Leute marschierten etwas lässiger als die Garde vor dem Kriege, aber in guter Ordnung und durchaus soldatisch. Eine große Menschenmenge mit roten Schleifen und Armbinden begleitete sie. Vor der in den Revolutionstagen arg zerschossenen Passage stimmte die Musik die Weise an: ›Es liegt eine Krone im grünen Rhein.‹ Sie klang wie ein Trauermarsch; mir schnitt sie ins Herz. Ich dachte an das verlorene Elsaß, das französische linke Rheinufer. Wie werden wir im Gefühl das jemals verwinden? Mag der Völkerbund noch so schön werden, diese Wunde kann er nur verewigen.
Viele Soldaten tragen jetzt wieder die schwarzweißrote Kokarde über der roten revolutionären, die an die Stelle der preußischen getreten ist.
Berlin. 15. November 1918. Freitag
Früh um neun bei Erzberger in der Budapester Straße. Ich warnte davor, die jetzige Regierung durch Hineindrängen Bürgerlicher zu erschüttern. Augenblicklich sei die Hauptsache die Front gegen Spartakus, daneben die Vorbereitung der Wahlen zur Nationalversammlung. Erzberger beschimpfte die Feigheit der bürgerlichen Klassen und namentlich der Offiziere, die der Revolution überhaupt keinen Widerstand entgegengesetzt hätten. Der Chef des Gardedukorps, der den Soldaten verboten habe zu schießen, gehöre erschossen. Jetzt müsse man wenigstens nicht wieder vor den Spartakusleuten kampflos das Feld räumen. Für den Präliminarfrieden entwickelte Erzberger folgende Grundsätze: er wolle ihn mit der größten Beschleunigung, womöglich innerhalb von acht Tagen, abschließen, um das linke Rheinufer vor der Besetzung zu retten. Das Besetzungsrecht gelte nur für den Waffenstillstand. Um den Präliminarfrieden schnell fertigzubringen, wolle er Elsaß-Lothringen preisgeben; anders bekomme er ihn nicht zustande, und Elsaß-Lothringen sei doch nicht für uns zu retten. Polen wolle er zurückstellen für den großen Frieden, im Präliminarfrieden nur grundsätzlich ein neutrales Polen zugestehen und Vorarbeiten ethnographischer und anderer Art besprechen. Keine Grenzen für Polen im Präliminarfrieden. Oberschlesien dürften wir unter keinen Umständen verlieren; es sei wirtschaftlich für uns unentbehrlich, kein unzweifelhaft polnisches Gebiet, habe nie zu Polen gehört, die Polen seien nur eingewandert. Oberschlesien sei Kernpunkt. Danzig könne Freihafen werden, oder wir könnten den Polen als Freigebiet einen anderen Mündungsarm der Weichsel zugestehen und ein Stück am Haff; Geldfrage.
Auf der Straße am Potsdamer Platz sah ich zum ersten Male seit der Revolution wieder einen Offizier mit Achselstücken.
Das Auswärtige Amt für die Republik ... Vor acht Tagen wäre diese Vorstellung geradezu grotesk erschienen, wo alles noch die monarchische Gesinnung als selbstverständlich voraussetzte. Und doch glaube ich, daß die wahre Gesinnung jetzt herauskommt. Der monarchische Gedanke war durch das völlige Versagen des Kaisers, namentlich im Kriege, aber auch schon durch seine glitzernde und beunruhigende Unfähigkeit vorher langsam abgetötet worden. Das konstatiert heute abend in der ›Deutschen Tageszeitung‹ Ernst Reventlow selber, der mit fliegenden Fahnen zur Republik übergeht.
Berlin. 16. November 1918. Sonnabend
Hatzfeldt zeigt mir heute vormittag eine Bleistiftnotiz von Solf: die Regierung scheine mich als Gesandten abzulehnen, weil sie eine Frau nach Warschau schicken wolle. Hatzfeldt meint, es handele sich um eine theoretische Liebhaberei von Haase, der wünsche, daß die sozialistische Regierung mit einer weiblichen Ernennung in der Diplomatie anfange. Natürlich könne eine Frau in dieser furchtbaren Lage in Warschau nichts ausrichten. Solf war nicht zu sprechen, da er in einer Sitzung des Kriegskabinetts war und bis zwei nicht gestört werden durfte. Ich schlug vor, Breitscheid als Adlatus von Kautsky um seine Vermittlung zu bitten. Inzwischen sind von verschiedenen Arbeiter- und Soldatenräten, von der deutschen Kolonie in Warschau und von Oettingen dringende telephonische Bitten um sofortige Entsendung des neuen Vertreters eingelaufen. Auch das Hauptquartier Oberost schickt einen Notschrei im selben Sinne.
Hatzfeldt und ich besprachen die Sache mit Bussche und gingen dann ins Ministerium des Inneren zu Breitscheid, der mit Gerlach zusammensaß. Breitscheid erklärte sich bereit, mit Kautsky zu sprechen, fand die Liebhaberei für weibliche Vertretung in diesem Augenblick unbegreiflich, da er sich keine Frau denken könne, die sie im Auge hätten. Kautsky war dann aber auch nicht zu sprechen, da er ebenfalls im Kriegskabinett saß. So gingen Hatzfeldt und ich zum Unterstaatssekretär David, einem ausgesprochen kleinbürgerlichen, pedantischen grauen kleinen Mann von etwas abstoßendem Mangel an Wärme (früher Lehrer), der gegen weibliche Vertretung in Warschau ziemlich stark polemisierte, ohne aber irgendeinen praktischen Vorschlag zu machen, wie meine Ernennung schnell gefördert werden könne. Es blieb nichts übrig, als auf den Schluß der Kabinettssitzung zu warten. So geht wieder ein halber oder sogar ein ganzer Tag verloren, so wie es unter der alten Regierung aus denselben Desorganisationsgründen bei der Freilassung Pilsudskis war. David machte außerdem ängstlich darauf aufmerksam, daß die Bestätigung des Kriegskabinetts für meine Mission nicht genüge; ich müsse außerdem eine Vollmacht vom Vollzugsrat haben, sonst würden mich die Arbeiter- und Soldatenräte nicht anerkennen.
Nachmittags um fünf war Sitzung des Kriegskabinetts, in der David meine Ernennung in Solfs Auftrage zu vertreten hatte. Hatzfeldt und David baten mich, während der Beratung im Vorzimmer bei der Hand zu bleiben. Die Sitzung fand in der Reichskanzlei, links hinter dem großen Kongreßsaal statt. Ich wartete in einer Art von Eßzimmer, wo der Schreibtisch Bismarcks aus der Konfliktszeit steht und noch zwei Kaiserbilder hängen. Nacheinander kamen Landsberg, Ebert, Scheidemann, Dittmann und verspätet Haase. Den mir noch nicht Bekannten ließ ich mich vorstellen. Ebert mit seinem schwarzen Knebelbart und seiner breiten, untersetzten Figur sieht aus wie ein Südfranzose, ein Schiffskapitän aus Marseille. Alle bis auf Landsberg und Haase waren sehr reserviert und, wie mir schien, mißtrauisch. Daß der erste von der Deutschen Republik ernannte Gesandte ein Graf und Garde-Kavallerie-Offizier sein soll, ist offenbar allen ungemütlich und nicht geheuer; obwohl die ›Freiheit‹, das Organ der Unabhängigen, mir heute früh, wahrscheinlich durch Breitscheid, ein gutes Zeugnis ausstellt.
Ich ging auf dem Bismarckischen Speisesaalteppich auf und ab, nicht ohne die Eigenart der Situation zu empfinden. Nach etwa drei viertel Stunden kam David heraus und sagte mir, das Kabinett habe meine Ernennung gebilligt, sie bedürfe aber noch der Bestätigung durch den Vollzugsausschuß des Arbeiter- und Soldatenrates, der gegenwärtig die Stelle des Souveräns vertritt und von Brutus Molkenbuhr und R. Müller geleitet wird. Es werde gewünscht, daß ich den sozialdemokratischen Rechtsanwalt Rawicki aus Bochum, der polnisch spreche und gute Beziehungen zu den polnischen Sozialdemokraten habe, mitnehme. Der Sozialdemokrat Brahe, der neue Chef der Reichskanzlei, ein überaus schätzenswerter Mann, gab mir außerdem ein Empfehlungsschreiben für den sozialistischen polnischen Ministerpräsidenten Daszynski mit. So ausgestattet wanderte ich wieder ins Amt, wo Hatzfeldt, Langwerth, Victor Wied mich als republikanischen Gesandten begrüßten. Mein Agrément durch die polnische Regierung wird noch heute nacht, ohne die Entscheidung von Brutus Molkenbuhr und R. Müller abzuwarten, nachgesucht, um möglichst wenig Zeit zu verlieren. Ich soll am Montag abend mit dem polnischen Vertreter in Berlin Niemozecki nach Warschau abreisen. Als Sekretär habe ich mir Ow und vertretungsweise, bis er aus Spa heran ist, den Dr. Meyer ausgebeten. Als Eisenbahnsachverständiger schließt sich in Thorn ein vom Kriegsministerium empfohlener Baurat an. Auch der juristische Vertreter wurde von Hatzfeldt in privater Stellung zugestanden.
Berlin. 17. November 1918. Sonntag
Erster Sonntag nach der Revolution. Am späten Nachmittag bewegten sich große Massen von Spaziergängern über die Linden bis zum Marstall, um die Spuren der Gefechte an den Gebäuden zu sehen. Alles sehr friedlich in spießbürgerlicher Neugier; namentlich die sehr auffallenden Einschläge am Marstall wurden begafft. Das einzige gegen frühere Sonntage im Straßenbild Veränderte ist das Fehlen der Schutzleute und die nicht sehr zahlreichen bewaffneten Matrosen, Wachen und Patrouillen, Ferdinand Stumms Leute.
Vormittags im Amt verschiedene für meine Mission in Betracht kommende Leute besucht. Zuerst Nadolny, um über Ukraine Auskünfte zu erhalten. Er sagt, unsere Soldatenräte nähmen in der Ukraine in Übereinstimmung mit unserer Regierung gegenüber allen Wirren und Kämpfen eine neutrale und abwartende Haltung ein. Das Einrücken der Entente in die Ukraine stehe bevor; unsere Truppen hätten dann dort keinen Zweck mehr, da sie nur den Schutz gegen die Bolschewiki bildeten. Sie sollen sich daher dort halten, bis die Entente hereinkommt, dann aber sofort abbauen. Ich solle in Warschau mit Hochdruck arbeiten, damit der Durchtransport durch Polen gewährt werde. Dazu nötig Verständigung mit Oberost.
Sodann zum Botschafter Bernstorff. Er will wie Erzberger die polnische Frage für die große Friedenskonferenz zurückstellen. Ich solle bei jeder Gelegenheit öffentlich und privatim sagen, daß wir die internationale Regelung der polnischen Frage zugestanden hätten gemäß Wilsons Punkt XIII; sie sollten daher jetzt keine Dummheiten machen.
Von Bernstorff zu Solf. Dieser fügte den Aufklärungen von Erzberger und Bernstorff nichts hinzu, warnte aber dringend vor Verbindung mit dem Zionismus oder jüdischen politischen Tendenzen, da dieses Pilsudski mißtrauisch gegen mich machen würde. Ich solle möglichst gute Beziehungen zu Pilsudski pflegen und diesem auch sagen, Solf habe sehr bedauert, ihn bei seiner Durchreise durch Berlin nicht gesehen zu haben. Solf sagte, er habe ziemlich hart kämpfen müssen, um meine Ernennung bei der Regierung durchzusetzen, weil diese eigentlich einen Sozialdemokraten und am liebsten ein sozialdemokratisches Frauenzimmer geschickt hätte. Ebert habe ihn aber unterstützt und ebenso Landsberg.
Berlin. 18. November 1918.
Montag Ich bin noch immer in Berlin trotz der flehentlichen Hilferufe der Deutschen in Polen nach einem deutschen Vertreter. Erst heute abend um acht bekam ich mein von Ebert und Haase unterzeichnetes Beglaubigungsschreiben bei der polnischen Regierung. Die schriftliche Bestätigung des Vollzugsrats der Arbeiter und Soldaten steht noch immer aus. Allerdings telephonierte mir Breitscheid mittags, sie sei im Prinzip erteilt. Spätabends meinen neuen Legationssekretär Dr. Meyer ins Herrenhaus geschickt, um die Unterschrift des Vollzugsrats unter meiner Ernennung zu erwirken.
Wenn morgen das Agrément der polnischen Regierung eintrifft, können wir morgen abend reisen.
Morgens meldete sich bei mir wieder der mir beigegebene sozialdemokratische Rechtsanwalt Rawicki. Ich bat Hatzfeldt, ihn für die Dauer seiner Tätigkeit in Warschau zum Legationsrat ernennen zu lassen, damit er nach mir die erste Stelle einnimmt. Bis vor zwei Monaten war er Armierungssoldat und als solcher meistens vorne. Er erzählte vom großen Haß der Soldaten gegen die Offiziere, ähnlich wie Wieland Herzfelde, hauptsächlich wegen der Bevorzugungen und des rücksichtslosen Gebrauchs, den die Offiziere davon machten. Am schlimmsten und verhaßtesten seien die Feldwebelleutnants gewesen. Die Verpflegung für die Soldaten sei zum großen Teil unterwegs hängengeblieben. Man gewinnt doch allmählich den Eindruck eines großen moralischen Fehlschlagens des Offizierkorps, wodurch eigentlich der Krieg verlorenging, zum Beispiel in der unrechtmäßigen Aneignung von Verpflegung, in einem unleidlichen Dünkel und Ton, in stellenweise direkter Bestechlichkeit. Die preußische Armee war nicht auf materielle Gesinnung des Offizierkorps zugeschnitten. Der ungeheure Aufschwung hat sie unterwühlt.
Nachmittags um vier Versammlung der jüngeren Beamten des Auswärtigen Amtes, die den Aufruf unterzeichnet haben im ›Kaiserhof› im Hohenzollernsaal. Ferdinand Stumm präsidierte. Farbe etwas akademisch, Riezlerisch. Ich versuche, soweit ich kann, sie nach links festzulegen; verlangte Knochen, irgend etwas Hartes, worauf man baue und von dem man nicht ablasse. Drum herum könne meinetwegen auch Molluskenhaftes sein zum Aufputz, über das man handeln könne; aber ein Rückgrat, und ein absolut steifes, sei irgendwo im Programm und in der Gesinnung nötig. Das, was bisher als Skelett der ganzen Staatsanschauung gegolten habe, die monarchische Gesinnung, habe sich als durch und durch morsch erwiesen. Daher gelte es jetzt, ein neues Gerüst zu finden. Ich möchte als solches auf dem definitiv anzuerkennenden Boden der Republik und des Sozialismus den Kampf um das Selbstbestimmungsrecht und die möglichste Freiheit des Individuums. Trotz Sozialismus, oder gerade weil Sozialismus, keine Staatssklaven, sondern freie Menschen. In der auswärtigen Politik Selbstbestimmungsrecht der Völker und gerechte Rohstoffverteilung, den wachsenden oder schwindenden Bedürfnissen der Völker jeweilig angepaßt. Kein starrer Völkerbund. Freiheit der Meere und Häfen für die Schiffahrt. Also: freie Meere, freie Völker, freie Menschen. Selbstbestimmungsrecht der Völker innerhalb des Völkerbundes, Selbstbestimmungsrecht des einzelnen innerhalb des sozialistischen Staates. Es wurden drei Kommissionen eingesetzt: 1. für Ausarbeitung des Programms, 2. für Propaganda und Werbung, 3. für Ausarbeitung einer deutschen Verfassung. In die Propagandakommission wurde ich gewählt, Ferdinand Stumm als mein Vertreter.
Berlin. 19. November 1918.
Dienstag Ich erhielt heute meine Ernennung zum Gesandten, unterschrieben von Solf und bestätigt vom Vollzugsrat des Arbeiter- und Soldatenrates. Sie haben unter Solfs Unterschrift vermerkt:›Einverstanden. Der Vollzugsrat des Arbeiter- und Soldatenrates Berlin. 18. November 1918. Molkenbuhr. Müller.› Ihr beigefügter Stempel lautet: ›Vollzugsrat des A. u. S.-Rates von Groß-Berlin. Deutsche Sozialistische Republik.›
Nachmittags Abschiedsbesuche und Scherereien, um mein Personal zusammenzubekommen, im Amt. Berger war empört, daß sich ein Gesandter die Bestätigung des Vollzugsrates der Arbeiter und Soldaten holen müsse; ›eine Frechheit!› Auch sonst voll Sorge wegen der Zukunft; sie könnten in der Wilhelmstraße jeden Tag ausgehoben werden.
Morgen findet die feierliche Bestattung der Revolutionsopfer statt. Ein ungeheurer Zug bewegt sich durch das Brandenburger Tor und die Linden hinunter; etwas anders, als man sich die Feier des Kriegsendes gedacht hatte. Hatzfeldt sagte mir, er gehe um elfeinhalb aus dem Amt fort, ›um nicht abgeschnitten zu werden›. Die Spartakuspartei mit ihrer ›Roten Fahne› und ihren drei starken Leuten, Rosa Luxemburg, Liebknecht, Mehring, wirkt als Schreckgespenst.
Abends um zehn Uhr dreiundvierzig von der Friedrichstraße abgefahren in dem nur für die Dauer meiner Gesandtschaft zur Verfügung gestellten Extrazug: ein Salonwagen, Schlafwagen, Speisewagen – etwas amerikanisch-milliardärhaft. Ich nahm den polnischen Geschäftsträger Niemozecki nebst Frau mit und von der Gesandtschaft Rawicki, Dr. Meyer, Gülpen, den Attache von Strahl, Otto Fürstner, einen Feldjäger und das Unterpersonal, Chiffreure, Bürovorsteher, Stenotypistinnen usw. Alles in allem etwa zwanzig Personen. Mit Niemozecki und den anderen Herren bis zwölf im Salon geplaudert, dann ruhig geschlafen. Morgens gegen sieben in Alexandrowo meldeten sich bei mir sehr stramm und militärisch der Präsident des deutschen Soldatenrates, ein junger Soldat, und mit ihm zusammen ein polnischer Legionsoffizier. Hier ist alles ruhig. Die Schienen, die aufgerissen waren, sind wieder geflickt. Wir können glatt nach Warschau durchfahren. Der Pendelverkehr von Flüchtlingen aus Polen und aus Deutschland geht seit einigen Tagen ungestört vonstatten; nur brachte der Soldatenrat durch seinen Präsidenten bei mir eine Beschwerde vor, daß die Polen dreihundert Waggons schuldig geblieben seien. Die Pünktlichkeit und Ordnungsliebe unserer Leute hat durch die Revolution nicht gelitten. Sie haben sich auch wieder einen Offizier herangeholt, einen Leutnant von Oppen, der irgendwo in der Nähe amtiert. Viele Offiziere seien allerdings, wie der junge Präsident mir sagte, ›fort›.
So fahre ich in meinen neuen Wirkungskreis ein, in diesen Osten, den ich liebe, der irgendeine unformulierbare, tiefe Schönheit für mich hat.
Warschau. 20. November 1918. Mittwoch
Unterredung mit Niemozecki im Speisewagen beim Frühstück. Er betont seinen Wunsch nach einem engen freundschaftlichen Verhältnis mit Deutschland. Ich bejahte und sagte, dieses sei nur möglich, wenn sowohl Polen wie Deutschland Opfer brächten und auf gefährliche Hoffnungen verzichteten. Wir hätten die Wilsonpunkte angenommen und damit gewisse Gebietsabtretungen; Danzig könnten wir aber nicht hergeben. Niemozecki bestätigte: "Unmöglich!" Ich fuhr fort, am besten würden Polen und Deutschland eine gegenseitige dauernde Freundschaft vorbereiten, wenn sie miteinander direkt verhandelten und ein gemeinsames Programm auf die Friedenskonferenz mitbrächten. Voraussetzung hierfür seien aber starke Regierungen sowohl in Polen wie in Deutschland. Wenn Pilsudski Fuß fasse, so sei direkte Verständigung vielleicht möglich. Niemozecki: Die Entente spiele ein Doppelspiel zum Zwecke, Polen und Deutschland dauernd zu entzweien. Den Polen habe sie große Versprechungen gemacht, scheine davon aber jetzt abzurücken.
Niemozecki erzählte, er wolle aus der diplomatischen Laufbahn ausscheiden und in Warschau bleiben. Hier hoffe er mir gute Informationen geben und Dienste leisten zu können. Mir scheint, er will mich einfangen.
Mittags im Salon für Niemozecki, Rawicki, Meyer, Gülpen, mich servieren lassen. Wir fahren durch die großen, berühmten Stellungen der Jahre 1914 und 15. Noch einzelne Ruinen. In Warschau begrüßten mich am Bahnhof ein Vertreter des polnischen Ministers des Auswärtigen, ein Vertreter des Kriegsministeriums, ein Adjutant von Pilsudski und noch ein halbes Dutzend Legionsoffiziere. Ein polnisches Militärauto fuhr uns ins Hotel (wahrscheinlich eines von unseren beschlagnahmtem, mit dem polnischen roten Adler bemalt).
Im ›Bristol‹ abgestiegen. Gleich nach Ankunft besuchte mich der Major Ritter, der Vertreter der Obersten Heeresleitung in Warschau. Er hatte es offenbar eilig, den Vertretern des Soldatenrates zuvorzukommen. Aus seinen zurückhaltend vorgebrachten Schilderungen ging die jämmerliche Haltung des Generalgouverneurs der Kommandantur, des Chefs Nelke, gegenüber den meuternden deutschen Soldaten und den aggressiven Legionären am Montag vor acht Tagen deutlich hervor. Der Generalgouverneur ließ sich als erster abtransportieren. Nelke sei zusammengebrochen und hilflos dagesessen. Die Polen ›übernahmen‹ ohne Schwertstreich für Hunderte von Millionen Munitionsdepots, Rohstofflager, Pferde, Büroausstattungen. Natürlich muß jetzt darüber abgerechnet werden. Ein Rumpf des deutschen Soldatenrates hat sich ohne Ermächtigung als ›Liquidationskommission‹ aufgetan, sich selber hohe Diäten und andere Annehmlichkeiten zuerkannt. Ritter verlangte, daß ich sie absetze.
Bald nachher erschienen die Vertreter des Soldatenrates, zuerst ein Hauptmann von Knoblauch, später zwei Journalisten, Roth und Brunner. Ich stellte mich auf den Standpunkt, daß deutsche Militärpersonen nach unserem Versprechen an die polnische Regierung nichts mehr in Warschau zu suchen hätten. Die Militärs im Soldatenrat müßten die Liquidation einstellen und sofort abreisen. Ich werde für ordnungsgemäße Erledigung durch einen höheren Intendanturbeamten sorgen. Alle drei fügten sich.
Mit Knoblauch kam ein Pfarrer Geisler, der mir die halbe Million Deutschstämmiger in Polen ans Herz legte. In der Tat eine große und wichtige Frage, da sie durch die Schuld unserer Okkupationsbehörden jetzt dem Haß und Ruin ausgesetzt sind.
Dann kam ein Herr Sarnow, der Sekretär von Lerchenfeld. Er hat dessen Akten und noch einige andere gerettet; möchte gern bei mir ankommen. Lerchenfeld und Oettingen sind heute früh abgereist. Unser Funkspruch, der meine Ankunft meldete, ist ihnen von der polnischen Regierung, die die Funkerstation besetzt hat, nicht übermittelt worden. Sie sind abgereist, ohne zu wissen, daß ich heute ankam. Sarnows Schilderungen vom Zusammenbruch stimmten ungefähr überein mit denen von Ritter.
Auf Sarnow folgte ein Herr Korff, Präsident des deutschen Hilfsvereins. Er hat die Legationskasse in Verwahrung genommen, möchte sie mir übergeben. Er ist ein großer Fabrikant, lebt seit über fünfzehn Jahren in Warschau, sagte, er schäme sich, seinen polnischen Freunden zu begegnen, gehe nur noch nachts aus dem Hause, so unwürdig hätten sich unsere Truppen und Beamten von oben bis unten benommen. Der Schaden, der den Deutschen erwachsen sei, sei unermeßlich und nicht wiedergutzumachen. Die Schuld trifft, wie er zugab, die Offiziere, die sich um ihre Leute nicht mehr kümmerten und zum Teil, ebenso wie die Beamten, bestechlich waren. Verlust jeder moralischen Autorität.
In meine Unterredung mit Korff platzte ein Adjutant von Pilsudski herein, derselbe Franzose, der mich am Styr führte. Pilsudski lasse sich entschuldigen, daß er mich gleich am ersten Tage so brüsk in Anspruch nehme, ehe noch zwischen uns die offiziellen Formalitäten erfüllt seien. Aber es handele sich um sehr Wichtiges. Deutsche Truppen aus Brest-Litowsk hätten in den Dörfern Biala und Miedzyrzec, angeblich als Repressalie für Entwaffnungen, Häuser angesteckt und Gefangene fortgeschleppt, die sie sofort zu erschießen gedroht hätten. Ich möge einschreiten, damit sie wenigstens ordnungsgemäß abgeurteilt würden; sonst könnten sehr ungünstige Rückwirkungen eintreten. Ich versprach, an Oberost zu telegraphieren. Tat dieses und schickte dann eine Verbalnote an das Ministerium des Äußeren, daß das Telegramm fort sei, ich gleichzeitig aber darauf aufmerksam mache, daß fünfzehn Reichsangehörige von den Polen ohne Prozeß eingekerkert seien, worunter einer angeblich schon erschossen sei. Ich bäte auch in diesen Fällen Rücksicht auf unsere Beziehungen zu nehmen.
Nachdem Pilsudskis Adjutant fort war, sagte mir Korff, er glaube nicht, daß Pilsudski sich halten könne. Er sei kein Politiker, stütze sich jetzt ausschließlich auf die Sozialisten, habe ein rein sozialistisches Ministerium gebildet. Das ließen sich die polnischen Bourgeois und Bauern auf die Länge nicht gefallen.
Ein Vertreter des Ministers des Auswärtigen kam, um mir zu sagen, daß der Minister mich zur Überreichung meines Beglaubigungsschreibens morgen empfangen werde.
Das Verhalten der deutschen Offiziere und Beamten in Polen am 11. November ist gewiß schmachvoll. Aber in Berlin war es am 9. nicht viel besser, und man hat das Gefühl, daß überall nicht einzelne Menschen, sondern ein System versagt hat, das schließlich nur noch die nackte Gewalt als Mittel kannte und hilflos zusammenbrach im Augenblick, wo diese ihm entglitt.
Warschau. 21. November 1918. Donnerstag
Alles war auf dem Prestige aufgebaut. Als dieses im Westen und in Bulgarien zusammenbrach, stürzte auch die Verwaltung in den besetzten Gebieten zusammen. Deshalb trifft Beseler und Nelke nur eine indirekte Schuld, sowenig ihr persönliches Verhalten am Schluß zu verteidigen ist. Der Krieg war schließlich eine ungeheure Spekulation, deren Mißlingen alles andere mitriß; der größte Krach aller Zeiten.
Um elf machte ich dem Minister des Äußeren Wassiliewski meinen Antrittsbesuch. Er empfing mich mit seinem Unterstaatssekretär Filippovicz. In den Vorzimmern, auf Treppen und Gängen herrschte eine große Unordnung, weil das Ministerium gerade einzog, natürlich in eine ›besetzte‹ deutsche Behörde. Vor acht Tagen war hier noch die Presseabteilung des Gouvernements. Tische, Sofas, kleine Jungens bewegten sich durcheinander: ein Ausverkauf, ein Chaos von Altem und Neuem, von Nachlaßgut und Anfängen eines neuen Staates. Das haben wir mit unserem Blute erreicht; aber die Schuld ist an uns, weil nichts war in unserem Volke, um das kostbare junge Blut auszuwerten. Ich sagte bei Überreichung meines Beglaubigungsschreibens dem Minister einige freundliche Worte, auf die er ähnliche, aus einem Manuskript verlesene erwiderte. Was echt, was falsch daran war, ließ sich bei diesem ersten Zusammentreffen nicht erkennen. Positives wurde nur besprochen in bezug auf die festgesetzten Deutschen. Filippovicz, der außer Polnisch nur Englisch spricht, sagte mir zu, über diese bis heute nachmittag um fünf mir Nachricht zu geben und ihre baldige Freilassung erwirken zu wollen.
Nachmittags um fünf empfing mich in feierlicher Audienz Pilsudski im Palais am Sachsenplatz. Ich überreichte ihm das Original meines Beglaubigungsschreibens und hielt eine kleine Ansprache. Er erwiderte als Staatsoberhaupt. Bemerkenswert, daß er dabei von ›unserer (seiner und meiner) Aufgabe‹ in bezug auf die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen sprach. Ich griff den Ausdruck auf und sprach meine Freude aus, daß er von einer ›gemeinsamen Aufgabe, die ihm und mir zugefallen sei‹, gesprochen hätte. Er ergänzte: ›die gemeinsame Aufgabe, unsere beiden Völker aus der alten Feindschaft in eine neue Freundschaft überzuführen‹. Er sieht sehr krank aus, das Gesicht blaß und eingefallen, aber noch immer mit dem alten Ausdruck von Energie und Güte; und er sprach lebhaft und heiter. Er wolle möglichst bald das Land in einen konstitutionellen Zustand überführen; die irreguläre Macht, die ihm zugefallen sei, ablegen. Dem Sozialismus müsse man in Worten weit entgegenkommen; die Zeit verlange das. Ob die Ausführung mit den Worten Schritt halten würde, sei eine andere Frage. Sehr beunruhigt sprach er sich über die Zustände im Etappengebiet Bug aus. Unsere Soldaten schössen dort Dörfer in Brand, verschleppten Gefangene. Das sei sehr gefährlich für die von uns beiden angestrebte Freundschaft. Er möchte möglichst bald durch Verhandlungen hier klare Zustände schaffen. Ich sagte ihm, daß ich für meine Gesandtschaft einen Verbindungsoffizier vom Oberbefehlshaber Ost bereits angefordert habe. Pilsudski nahm dieses mit sichtbarer Erleichterung auf. Ich kam dann auf unsere Gefangenen im Gefängnis hier. Meine sehr vorsichtig ausgesprochene Hoffnung, daß er sich halten werde, verstand er richtig als Frage und erwiderte, Gefahren sehe er nur im Südosten und Südwesten: im Südosten die russischen und ukrainischen Bolschewiki und Banden, im Südwesten die sehr unruhigen Zustände im Gebiet von Dombrowa, wo der revolutionäre Funken aus Deutschland nach Polen überspringen könne. Im übrigen gehe er seinen Weg und lasse die anderen schreien. In der posenschen Opposition sehe er keine Gefahr, denn diese werde sich immer in legalen Bahnen bewegen. Wir sprachen dann noch einiges Private, alte Erinnerungen, die Pilsudski jedesmal beglücken. Seine schönste Zeit, seine eigentliche Jugend, ist doch offenbar die gewesen, wo er mit seinen Legionären kämpfte.
Warschau. 22. November 1918. Freitag
Früh um halb neun kam der Major Ritter zu mir, um über heute bevorstehende Verhandlungen mit den Polen wegen Abtransports der Truppen aus der Ukraine zu berichten. Um halb elf besuchte ich Nieniewski, den stellvertretenden Chef des Generalstabes, mit dem ich bei Gerok im Stabe zusammen war.