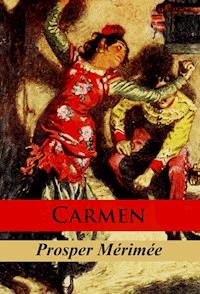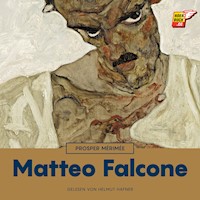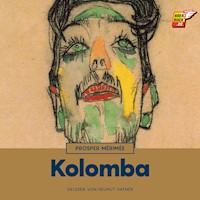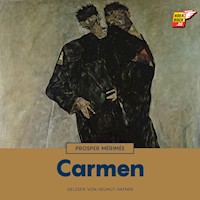Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl GmbH & Co. OHG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Sklavenhandel um 1820 in ungewöhnlicher Perspektive: Der französische Kapitän Ledoux, ein tüchtiger Seebär mit einem dehnbaren Begriff von Menschlichkeit und großem Einfallsreichtum in Sachen Profitmaximierung, segelt trotz Sklavereiverbot zur senegalesischen Küste. Dort kauft er dem schwarzafrikanischen Menschenhändler Tamango 160 Gefangene ab, bestimmt für die Neue Welt. Weil er sich bei der ganzen Feilscherei hemmungslos betrunken hat, schenkt Tamango dem Kapitän obendrein eine seiner Frauen, der er besonders zugetan ist. Als er am nächsten Morgen erwacht und ihm klar wird, was er getan hat, verfolgt er das Schiff – mit schrecklichen Folgen für die Besatzung und die Gefangenen. Gleich, ob sie auf hoher See oder in der korsischen Macchia spielen wie Mateo Falcone, in der gehobenen Gesellschaft des ländlichen Südfrankreich wie in der Venus von Ille oder unter Vampiren in Illyrien, Prosper Mérimée erzählt in seinen meisterlichen Novellen mit kühlem Herzen und in kristallklarer Sprache von großen Gefühlen, von Verrat, Mord, dem Tragischen und Unheimlichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben von Andreas Nohl
Prosper Mérimée
Tamango
Drei Novellen
Steidl Nocturnes
Aus dem Französischen von Arthur Schurig und W. Gerhard (»Über Vampirismus«), überarbeitet von Claudia Glenewinkel und Andreas Nohl.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Tamango
Mateo Falcone
Die Venus von Ille
Anhang
Über Vampirismus
Nachwort des Herausgebers
Anmerkungen
Tamango
Kapitän Ledoux war ein erfahrener Seebär; er hatte es vom einfachen Matrosen bis zum Steuermannsgehilfen gebracht. Bei Trafalgar hatte ihm ein Holzsplitter die linke Hand durchbohrt. Sie musste amputiert werden, worauf man ihn mit gutem Zeugnis des Dienstes entließ. Nichtstun behagte ihm wenig, und wie sich Gelegenheit bot, wieder aufs Wasser zu kommen, nahm er die Stelle des zweiten Offiziers eines Kaperschiffs an. Etliche gute Prisen gestatteten ihm, Bücher anzuschaffen, so dass er sich zur Ergänzung seiner gründlichen praktischen Fähigkeiten auch mit der Theorie der Seefahrt vertraut machte. Mit der Zeit wurde er Kapitän eines anderen Kaperschiffs, einem Logger, der drei Geschütze und sechzig Mann Besatzung an Bord führte; die Küstenfahrer von Jersey erinnern sich noch allzu gut an seine Taten. Der Friedensschluss war ein Schlag für ihn: Während des Krieges hatte er ein kleines Vermögen zusammengerafft, das er auf Kosten der Engländer zu vermehren gedachte. Nun sah er sich genötigt, seine Dienste friedlichen Handelsschiffen anzubieten; und da man ihn als Mann von Entschluss und Erfahrung kannte, überließ man ihm ohne weiteres ein Schiff. Seit der Sklavenhandel verboten war, und es somit nicht nur darauf ankam, die französischen Hafenzöllner zu täuschen, was nicht besonders schwierig war, sondern es auch galt, den britischen Kreuzern zu entgehen, was etwas mehr Wagemut erforderte, wurde Kapitän Ledoux für die Ebenholzhändler (so nannten sich die Sklavenhändler selbst) ein überaus wertvoller Mann.
Sehr im Gegensatz zur Mehrzahl der Seeleute, die wie er lange Zeit auf untergeordnetem Posten abstumpfenden Dienst geleistet hatten, war ihm jene Abscheu vor Neuerungen und der Geist der Routine, den sie nur zu häufig in die höheren Dienstgrade mitschleppten, gänzlich fremd. Kapitän Ledoux war im Gegenteil der Erste gewesen, der seinem Reeder die Einrichtung von eisernen Behältern zur Wasseraufnahme und -frischhaltung vorschlug. Auf seinem Schiff waren die Handschellen und die Ketten, mit denen ein Sklavenschiff ausgestattet ist, nach einem neuen Muster gearbeitet und zum Schutz vor dem Verrosten sorgfältig lackiert. Was ihm aber unter den Sklavenhändlern am meisten Ehre eintrug, das war der von ihm geleitete Bau einer besonders für diesen Handel bestimmten Brigg, eines schneidigen Seglers, schmal, lang wie ein Kriegsschiff und demnach imstande, eine sehr große Zahl von Schwarzen aufzunehmen. Er nannte sie Espérance. Die engen Zwischendeckabteile, die er einziehen ließ, waren nur drei Fuß vier Zoll hoch, da er meinte, dieses Maß erlaube Sklaven von vernünftiger Größe, bequem zu sitzen; und wozu sollten sie auch aufstehen?
»Wenn sie erst in den Kolonien sind«, sagte Ledoux, »werden sie übergenug auf den Beinen sein müssen.«
Die mit dem Rücken an die Schiffswände gelehnten, in zwei gegenüberliegenden Reihen sitzenden Schwarzen ließen in der Mitte zwischen ihren Füßen einen Raum frei, der auf allen anderen Sklavenschiffen als Durchgang diente. Ledoux kam auf den Gedanken, in diesem Zwischenraum weitere Schwarze zu verstauen, im rechten Winkel zu den übrigen. Auf diese Weise fasste sein Schiff etwa zehn Sklaven mehr als ein anderes vom selben Tonnengehalt. Streng genommen hätte man noch mehr unterbringen können; aber Menschlichkeit ist Pflicht, und man muss einem Sklaven, für eine Überfahrt von sechs Wochen oder mehr, mindestens einen Spielraum von fünf Fuß in der Länge und zwei in der Breite zugestehen: »Denn schließlich«, so rechtfertigte Ledoux seinem Reeder gegenüber diese freisinnige Maßregel, »sind die Schwarzen im Grunde ebenso Menschen wie die Weißen.«
Die Espérance stach, wie sich abergläubische Leute hinterher erinnerten, an einem Freitag von Nantes in See. Den Aufsichtsbeamten, die die Brigg gewissenhaft untersuchten, entgingen sechs große Kisten, gefüllt mit Ketten, Handschellen und jenen Eisen, die man, ich weiß nicht warum, »Schranken der Gerechtigkeit« nennt. Sie zeigten sich auch keineswegs erstaunt über den ungeheuren Wasservorrat, den die Espérance mit sich führte, die den Papieren zufolge nur nach dem Senegal fuhr, um dort Handel mit Holz und Elfenbein zu treiben. Gewiss, die Überfahrt ist nicht lang, aber schließlich kann ein Mehr an Vorsichtsmaßregeln nicht schaden. Wenn überraschenderweise Windstille eintrat, was tat man da ohne Wasser?
Mit tüchtigem Takelwerk und mit allem wohl versehen, lief also die Espérance an einem Freitag aus. Ledoux hätte gern etwas kräftigere Masten gehabt; indessen, seit er das Schiff befehligte, hatte es keinen Anlass zur Klage gegeben. Die Überfahrt zur afrikanischen Küste ging glücklich und rasch vonstatten. Im Fluss nahe Joale (glaube ich) wurde geankert, in einem Augenblick, da die englischen Kreuzer dieser Küstenstrecke keine Aufmerksamkeit schenkten. Alsbald kamen einheimische Handelsleute an Bord. Die Gelegenheit konnte nicht günstiger sein: Tamango, ein berühmter Krieger und Menschenhändler, hatte eben eine große Menge Sklaven an die Küste gebracht und schlug sie zu einem günstigen Preis los; war er doch ein Mann, der Macht und Mittel besaß, den Markt prompt wieder mit Vorrat zu versehen, sobald es an Ware mangelte.
Kapitän Ledoux ließ sich zum Ufer übersetzen und stattete Tamango seinen Besuch ab. Er fand ihn in einer Strohhütte, die man ihm in aller Eile errichtet hatte, in Gesellschaft seiner beiden Frauen sowie einiger Zwischenhändler und Sklaventreiber. Tamango hatte sich zum Empfang des weißen Kapitäns herausgeputzt. Er war mit einer alten blauen Uniform bekleidet, an der sich noch die Korporals-Tressen befanden; aber von jeder Schulter hingen je zwei goldene Epauletten, die, am selben Knopf festgemacht, nach vorn und hinten herunterbaumelten. Da er kein Hemd auf dem Leib trug und der Rock für einen Mann seiner Größe etwas kurz war, zeigte sich zwischen den weißen Umschlägen des Rocks und der langen Unterhose aus weißem Baumwollstoff ein beträchtlicher Streifen schwarzer Haut, der sich wie ein breiter Gürtel ausnahm. An der Seite hatte er an einem Strick einen großen Kavalleriesäbel hängen, und in der Hand hielt er eine schöne Doppelbüchse englischer Herkunft. So ausgestattet übertraf der afrikanische Krieger seiner Meinung nach an Eleganz noch den vollendetsten Stutzer von Paris oder London.
Kapitän Ledoux betrachtete ihn eine Weile schweigend, während Tamango, aufrecht wie ein Grenadier, der vor einem fremden General paradiert, den Eindruck auskostete, den er auf den Weißen zu machen glaubte. Ledoux maß ihn mit prüfendem Kennerblick und wandte sich darauf zu seinem Ersten Steuermann mit den Worten: »Das ist ein Kerl, für den ich wenigstens tausend Taler bekäme, wenn ich ihn gesund und heil nach Martinique brächte.«
Sie setzten sich, und ein Matrose, der die Sprache der Wolof ein wenig verstand, diente als Dolmetscher. Nachdem die ersten Höflichkeiten ausgetauscht waren, brachte ein Schiffsjunge einen Korb mit Branntweinflaschen. Man trank, und der Kapitän verehrte Tamango, um ihn in gute Laune zu versetzen, ein hübsches kupfernes Pulverhorn, das mit dem Reliefbild Napoleons verziert war. Nachdem das Geschenk mit gebührendem Dank in Empfang genommen war, verließen sie die Hütte und nahmen im Schatten Platz, vor sich die Branntweinflaschen. Tamango gab das Zeichen, die Sklaven zu bringen, die er zu verkaufen hatte.
Sie erschienen in einer langen Reihe, die Körper vor Müdigkeit und Furcht gekrümmt. Jeder Hals steckte in einer Gabel von mehr als sechs Fuß Länge, deren zwei Enden im Nacken durch ein Querholz verschlossen waren. Wenn sich die Truppe in Bewegung setzen soll, nimmt einer der Treiber den Stiel der Gabel des ersten Sklaven auf seine Schulter; dieser belädt sich mit der Gabel des ihm Folgenden; der zweite trägt die Gabel des dritten Sklaven und so alle übrigen. Soll haltgemacht werden, so stößt der Anführer das zugespitzte Ende seines Gabelstiels in die Erde, und der ganze Zug hält an. Man sieht leicht ein, dass man kaum auf den Gedanken kommt zu fliehen, wenn man einen schweren Stock von sechs Fuß Länge um den Hals trägt.
Bei jedem männlichen oder weiblichen Sklaven, der an ihm vorbeikam, zuckte der Kapitän die Achseln, fand die Männer zu schmächtig, die Frauen zu alt oder zu jung, und erging sich in Klagen über den Niedergang der schwarzen Rasse.
»Alles kommt herunter«, sagte er, »früher war das ganz anders. Die Weiber waren fünf Fuß sechs Zoll hoch, und von den Männern hätten vier allein die Winde einer Fregatte gedreht und den großen Anker hochgezogen.«
Gleichwohl traf er, noch während er herummäkelte, eine erste Wahl unter den stärksten und schönsten Schwarzen. Für diese würde er den üblichen Preis zahlen; für die übrigen jedoch verlangte er einen bedeutenden Nachlass. Tamango seinerseits verteidigte aufs nachhaltigste seine Forderungen, rühmte seine Ware und sprach vom Mangel an Menschenmaterial und von den Gefahren des Handels. Schließlich nannte er einen Gesamtpreis (ich weiß nicht welchen) für den Teil der Sklaven, den der weiße Kapitän auf sein Schiff zu laden gedachte.
Sobald der Dolmetscher das Angebot Tamangos ins Französische übersetzt hatte, schien Ledoux vor Überraschung und Entrüstung schier hintenüberzukippen. Doch dann erhob er sich unter einigen fürchterlichen Flüchen, als wollte er jede weitere Verhandlung mit einem so unvernünftigen Menschen abbrechen. Da hielt ihn Tamango zurück; es gelang ihm jedoch nur mit Mühe, den Kapitän zu bewegen, wieder Platz zu nehmen. Eine neue Flasche wurde geöffnet, und das Feilschen begann von vorn.
Nun war die Reihe an dem Schwarzen, das Angebot des Weißen aberwitzig zu finden. Sie schrien und stritten lange und sprachen dabei ausgiebig dem Schnaps zu; aber der Branntwein rief bei den beiden Parteien durchaus verschiedene Wirkung hervor. Je mehr der Franzose trank, desto mehr verminderte er seine Angebote; je mehr der Afrikaner trank, desto mehr gab er in seinen Forderungen nach. Auf diese Weise erzielte man, als alle Flaschen im Korb geleert waren, auch eine Einigung. Schlechte Baumwollzeuge, Schießpulver, Feuersteine, drei Fässer Branntwein, fünfzig schlecht überholte Flinten wurden im Tausch gegen hundertsechzig Sklaven gegeben. Um den Handel abzuschließen, schlug der Kapitän in die Hand des mehr als halbbetrunkenen Schwarzen, und sogleich wurden die Sklaven den französischen Matrosen übergeben, die sich beeilten, ihnen ihr hölzernes Joch abzunehmen, um ihnen dafür Halseisen und Handschellen anzulegen: ein trefflicher Beweis für die Überlegenheit der europäischen Zivilisation.
Etwa dreißig Sklaven waren übriggeblieben: Kinder, Greise, entkräftete Frauen. Das Schiff war voll.
Tamango, der nicht wusste, was er mit diesem Ausschuss anfangen sollte, bot dem Kapitän an, sie ihm für eine Flasche Branntwein das Stück zu überlassen. Das Angebot war verlockend. Ledoux erinnerte sich, in Nantes bei der Aufführung der Sizilianischen Vesper gesehen zu haben, wie sich eine erkleckliche Anzahl dickbäuchiger Leute in einen bereits gefüllten Zuschauerraum drängte und dennoch, dank der Nachgiebigkeit des menschlichen Körpers, Platz zum Sitzen gefunden hatte. Er nahm von den dreißig Sklaven die zwanzig schlanksten.
Hierauf verlangte Tamango nur noch ein Glas Branntwein für jeden der zehn übrigen. Ledoux überlegte, dass Kinder in öffentlichen Fuhrwerken nur die Hälfte zahlen und auch nur einen halben Platz einnehmen. Er nahm also noch drei Kinder, erklärte aber zugleich, nun wolle er sich mit keinem einzigen Schwarzen mehr belasten. Als Tamango sah, dass er immer noch sieben Sklaven am Hals hatte, ergriff er seine Büchse und legte auf die erstbeste Frau an.
»Kauf sie!«, sagte er zu dem Weißen, »oder ich töte sie. Ein kleines Glas Branntwein, oder ich schieße.«
»Und was zum Teufel soll ich mit ihr anfangen?«, erwiderte Ledoux.
Tamango gab Feuer, und die Sklavin fiel tot zu Boden.
»Weiter! Der Nächste!«, schrie er und nahm einen gebrochenen Greis aufs Korn. »Ein Glas Branntwein oder …«
Eine seiner Frauen stieß ihm den Arm weg, und der Schuss ging fehl. Sie hatte in dem Greis, den ihr Mann töten wollte, einen Zauberer oder Sänger, einen Griot erkannt, der ihr prophezeit hatte, sie werde eine Königin werden.
Tamango, den der Branntwein wütend gemacht hatte, verlor alle Beherrschung, als er sah, dass seinen Wünschen nicht entsprochen wurde. Aufs roheste versetzte er seiner Frau mit dem Gewehrkolben einen Hieb. Dann wandte er sich an Ledoux:
»Da! Ich schenke dir diese Frau.«
Sie war hübsch. Ledoux sah sie lächelnd an; nahm sie bei der Hand und sagte:
»Ich werde sie schon irgendwo unterbringen.«
Der Dolmetscher war menschlich gesonnen. Er schenkte Tamango eine Schnupftabakdose aus Pappmaché und ließ sich von ihm die sechs übrigen Sklaven geben. Er befreite sie von ihren Gabeln und ließ sie laufen, wohin sie wollten. Sogleich machten sie sich aus dem Staub, der eine dahin, der andere dorthin, freilich in völliger Ratlosigkeit, wie sie in ihre Heimat zurückgelangen sollten, die wohl fünfhundert Meilen von dieser Küste entfernt war.
Inzwischen verabschiedete sich der Kapitän von Tamango und beeilte sich, seine Ladung einzuschiffen. Es war nicht klug, länger auf dem Fluss zu bleiben; die englischen Kreuzer konnten wieder auftauchen, und er wollte am andern Morgen wieder in See stechen. Tamango streckte sich im Schatten aufs Gras hin und schlief seinen Branntweinrausch aus.
Als er erwachte, war das Schiff bereits unter Segel und glitt flussabwärts. Tamango, noch benebelt von der Ausschweifung des vorigen Tages, rief nach seiner Frau Ayché. Man entgegnete ihm, unglücklicherweise habe sie sein Missfallen erregt, und er habe sie dem weißen Kapitän zum Geschenk gemacht, der sie mit auf sein Schiff genommen habe. Bei dieser Auskunft schlug sich Tamango entsetzt vor die Stirn, ergriff sein Gewehr und eilte, da der Fluss mehrere Windungen machte, bevor er sich ins Meer ergoss, auf schnellstem Wege zu einer kleinen Bucht, die eine halbe Meile von der Mündung entfernt war. Hier hoffte er einen Nachen zu finden, mit dem er die Brigg noch erreichen konnte, deren Fahrt sich wegen des mäandernden Flusslaufs verzögern musste. Er täuschte sich nicht; in der Tat hatte er noch Zeit, in ein Boot zu springen und das Sklavenschiff einzuholen.
Ledoux war überrascht, ihn zu sehen, noch mehr aber, zu hören, dass er seine Frau zurückforderte.
»Geschenke kann man nicht zurückfordern«, antwortete er und wandte ihm den Rücken.
Der Schwarze gab nicht auf und bot an, einen Teil der Gegenstände, die er zum Tausch für die Sklaven erhalten hatte, zurückzugeben. Der Kapitän lachte und meinte, Ayché sei eine vortreffliche Frau, und er wolle sie behalten. Da vergoss der arme Tamango einen Strom von Tränen und stieß Schmerzensschreie aus, gellend wie die eines Unglücklichen unter dem Messer des Chirurgen. Bald wälzte er sich auf dem Verdeck und rief nach seiner teuren Ayché, bald schlug er seinen Kopf auf die Planken, als wollte er sich umbringen. Ungerührt wies der Kapitän aufs Ufer und mahnte, es sei Zeit für ihn, sich davonzumachen; aber Tamango blieb hartnäckig. Er erhöhte sein Angebot; ja auch seine goldenen Epauletten, sein Gewehr und seinen Säbel wollte er darangeben. Alles umsonst.
Während dieser Auseinandersetzung sagte der Leutnant der Espérance zum Kapitän:
»Diese Nacht sind uns drei Sklaven gestorben; wir haben Platz. Warum nehmen wir nicht diesen Hünen, der allein mehr wert ist als die drei Toten?«
Ledoux überlegte, dass sich für Tamango sicher gut tausend Écu erlösen ließen. Die Fahrt, die ihm einen tüchtigen Profit verhieß, war wahrscheinlich seine letzte. Sein Vermögen war bereits gemacht. Wenn er also den Sklavenhandel aufgab, brauchte ihm wenig daran zu liegen, ob er an der Küste von Guinea einen guten oder einen schlechten Ruf genoss. Zudem lag das Flussufer verlassen da, und der afrikanische Krieger war ganz in seiner Gewalt. Es handelte sich nur darum, ihm die Waffen abzunehmen, denn es wäre gefährlich gewesen, Hand an ihn zu legen, solange er sie noch besaß. Ledoux bat ihn also um sein Gewehr, als ob er es untersuchen und sich versichern wollte, ob es so viel wert sei wie die schöne Ayché. Indem er die Federn der Büchse spielen ließ, trug er Sorge, das Pulver aus der Zündpfanne fallen zu lassen. Der Leutnant seinerseits probierte den Säbel. Als Tamango derart entwaffnet war, stürzten sich zwei kräftige Matrosen auf ihn, warfen ihn auf den Rücken und machten sich daran, ihn zu fesseln. Der Schwarze leistete heldenhaften Widerstand. Nach anfänglicher Bestürzung und trotz seiner unvorteilhaften Lage rang er lange Zeit mit den beiden Matrosen. Dank seiner ungeheuren Kraft gelang es ihm, sich zu erheben. Mit einem Fausthieb streckte er den Mann nieder, der ihn am Kragen hielt; ein Stück seines Rocks ließ er in den Händen des anderen Matrosen, und nun warf er sich wie ein Rasender auf den Leutnant, um ihm seinen Säbel zu entreißen. Dieser hieb ihm damit auf den Kopf und fügte ihm eine breite, wenn auch nicht tiefe Wunde zu. Tamango stürzte zum zweiten Mal nieder. Sofort fesselte man ihn an Füßen und Händen. Er setzte sich wild zur Wehr, stieß wütende Schreie aus und gebärdete sich wie ein Eber, der in die Falle gelaufen ist; als er aber sah, dass jeder Widerstand nutzlos war, schloss er die Augen und rührte sich nicht mehr. Nur sein heftiger und beschleunigter Atem zeigte, dass er noch lebte.
»Bei Gott!«, rief Kapitän Ledoux aus. »Die Schwarzen, die er verschachert hat, werden ordentlich was zu lachen haben, wenn sie sehen, dass er nun selber ein Sklave ist. Jetzt wissen sie, dass es eine Vorsehung gibt.«