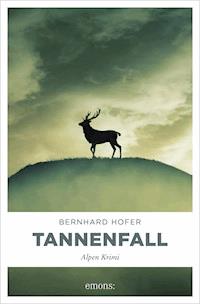Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – alle Tannenfall-Schicksale in einem einzigen Abenteuer vereint. In der Welt von Elia Khalberg sind Kunst und Bücher tabu. Abgeschieden lebt sie mit ihrer Tochter und ihrer Enkelin auf einem Maiensäß in den Schweizer Bergen. Als die beiden eines Tages spurlos verschwinden, verlässt Elia notgedrungen ihre selbst gewählte Isolation und begibt sich auf die Suche nach ihnen. Diese führt sie zu den mysteriösen »Tannenfall«-Büchern, deren vierter und letzter Teil noch ungeschrieben ist. Elia erkennt, dass sie ihre Familie nur retten kann, wenn sie ihre Überzeugungen aufgibt und den Roman selbst verfasst – eine Geschichte, die erschreckend eng mit ihrem eigenen Leben verknüpft ist.. Der lang gehütete Rätsel um Tannenfall endlich entschlüsselt, Fulminant, bildgewaltig, phantastisch
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Handlung und die handelnden Personen dieses Romans sind ebenso frei erfunden wie die Orte und Geschehnisse. Jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder Gemeinden und Regionen ist nicht beabsichtigt und wäre rein zufällig.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, unter Verwendung eines Motivs von photocase.de/goegi
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-575-6
Roman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Kunst ist nicht dazu da, unsere Wohnung zu schmücken. Sie ist eine Waffe, mit der wir unseren Feind besiegen.
ELIA
0
»Sie kommt sicher bald und macht die Fenster zu. Dann wird dir wieder warm, Viktor.«
Ich drückte meinen Teddy fest an mich und hoffte, dass ihm nicht noch kälter würde, wenn er auf meinen nassen Kleidern lag.
»Du musst nicht zittern, Viktor. Schau, ich zittere auch nicht mehr.«
Ich sah zum Fenster des dunklen Schlafsaals. Auf dem Boden lagen die Schatten der geöffneten Fensterläden. Ihnen war kalt, genau wie mir. Der Lichtkegel des Turms im Hof schaufelte Licht zwischen unseren Betten hindurch. Das Licht schwappte zur Wand und dann wieder zurück zum Fenster, wo es hinaussprang wie ein Dieb.
Die anderen Kinder rührten sich nicht. Sicher schliefen sie längst. Ich aber wollte warten, bis Frau Barbara die Fenster wieder zumachte. Nicht nur das eine bei mir, durch das sich die kalte Luft zu mir und Viktor legte, sondern auch die anderen. Wir würden uns ja sonst erkälten und husten. Das wollte Frau Barbara sicher nicht. Sie wäre bestimmt verärgert, dass unsere Nachthemden noch immer nass waren. Aber als sie uns in die Duschen geschickt hatte, hatte sie gesagt, dass wir sie nicht ausziehen dürften. Dann hatte sie vergessen, uns neue, trockene zu geben.
Frau Barbara wollte, dass es uns gut ging. Schließlich mussten wir nicht in den schmutzigen, überfüllten Sälen nebenan schlafen, bei den anderen Kindern, die so unruhig waren die ganze Zeit und so komische Geräusche von sich gaben. Wie ein Würgen oder ein Keuchen oder ein dumpfes Gemurmel, das ich nicht verstand. Und da es bei den anderen immer so scharf nach Medizin roch, machte Frau Barbara oft die Fenster auf, weil es im ganzen Gebäude überall so stank, dass man den harzigen, klebrigen Geruch gar nicht mehr aus der Nase bekam.
Diese Kinder seien »geistig tiefstehend«, hatte Frau Barbara einmal zu einem Gespenst mit einem langen weißen Kittel gesagt. Ich wusste nicht, was sie damit gemeint hatte, aber ich wusste, dass sie weder richtig sprechen konnten noch gut laufen. Diese Kinder würden »niemals brauchbare Menschen«, hatte Frau Barbara auch gesagt. Deshalb waren auch immer die weißen Gespenster bei ihnen und kümmerten sich um sie und steckten so lange Spritzen in die verkrampften Arme, bis die Grimassen der Kleinen, die sie oft machten, aus ihren Gesichtern fielen wie vertrocknete Blätter von Bäumen, wenn der Winter kam. Ich hatte Angst, dass die weißen Gespenster auch eines Tages zu uns kommen würden, aber solange Frau Barbara sich um uns kümmerte, fühlte ich mich sicher.
Wo Frau Barbara bloß ist, dachte ich und sah in die mit schwarzer Farbe bemalte Nacht, die vor dem Fenster bei meinem Bett lag. Sicherlich war sie bei den anderen Kindern der »Fachabteilung«. Ich wusste nicht, was das Wort »Fachabteilung« bedeutete, aber ich hatte es von einem Gespenst aufgeschnappt, das vor dem Fenster mit einem anderen auf und ab ging, als würde es Wache halten. Es war ein schwarzes Gespenst. Schwarze Gespenster trugen Helme und hatten Binden am Arm mit einem seltsamen Kreuz drauf. Hinter dem Fenster, am anderen Gebäude, waren viele schwarze Gespenster, unter denen auch weiße waren. Viele von denen hinkten, und vielleicht bekamen sie auch Spritzen, weil es ihnen nicht gut ging. Die, die hinkten, wohnten an einem Ort, den Frau Barbara »Lazarett« nannte.
Frau Barbara hatte mir und Viktor einmal erzählt, dass sie heimlich gegen die Gespenster gekämpft hatte, die uns hier festhielten, weil wir anders waren als die Kinder in den anderen Sälen. Ich wusste nicht, was sie damit gemeint hatte. Viktor auch nicht. Aber sie hatte gesagt, dass sie uns stark machen wollte und wir viel von diesem Tee und diesen bitteren Kräutern essen müssten. Ich mochte den Tee und die Kräuter nicht. Allein das Wort »Tee« hatte für mich einen Geruch. Ich übergab mich dann immer, weil mir übel war und mein Kopf viele schreckliche Bilder malte und alles verbog und verdrehte, was sonst gerade und eben war. Dabei hatte ich sehr große Angst vor den Bildern.
Zurzeit sah ich keine Bilder und schaute nur mit Viktor auf das offene Fenster. Es war so kalt, und ich hoffte, dass wir nicht erfrieren würden, bevor Frau Barbara zurückkam. Ich hatte Angst, dass sie wieder mit uns schimpfen und uns ermahnen würde, es uns nicht leicht zu machen, indem wir einfach starben.
Wenn ich größer gewesen wäre, hätte ich die Fenster selbst geschlossen. Aber die goldenen Griffe waren zu hoch. Ich wäre nicht einmal an sie herangekommen, wenn ich mich auf einen Stuhl gestellt hätte. Es hätte auch nichts gebracht, Viktor mit meiner ausgestreckten Hand zu halten und nach den Fensterläden greifen zu lassen. Seine kalten, weichen Ärmchen waren zu kurz und zu schwach.
»Atme in mein Herz hinein«, flüsterte ich Viktor zu und drückte seinen Kopf an meine zitternde Brust. »Dann verschwinden die kleinen Wölkchen vor deinem Mund. Barbara kommt sicher bald und macht die Fenster zu. Du musst keine Angst haben.«
Ich schluckte die kalte Luft und blickte durch das Fenster auf den Platz mit seinem großen weißen Ziegelturm mit dem achteckigen Aufbau darauf, der aussah wie eine große schwarze Kugel. Als mich Viktor einmal gefragt hatte, was es mit dieser großen Kugel auf dem Turm auf sich hätte, hatte ich ihm erklärt, dass uns von dort die Gespenster beobachteten. Und dass wir Glück hätten mit Frau Barbara, weil sie auf uns aufpasste und nicht zuließ, dass uns die Gespenster wegbrachten mit diesen großen Bussen.
Ich wusste, dass mein Teddy sich vor diesen Bussen fürchtete. Er hatte gesehen, wie alle Kuscheltiere in eine große Kiste gelegt wurden, bevor die Kinder ohne ihre Kuscheltiere weggefahren wurden. Und wie die Gespenster Feuer in die Kiste geworfen hatten und sich die vielen Tiere in Rauch verwandelten und in schwarzen dünnen Fäden in den Himmel hinaufstiegen.
»Ich werde dich niemals loslassen, Viktor. Du musst keine Angst vor dem Feuer haben. Ich und Frau Barbara passen auf dich auf.«
Auf einmal tauchte draußen ein neuer Lichtkegel mit viel Geschrei auf und kletterte an den Wänden in unser kaltes Zimmer, wie es manchmal vorkam, wenn die Busse nicht losfahren konnten, weil einige Kinder schrien und weinten. Frau Barbara kümmerte sich dann meistens um sie und verscheuchte die Gespenster, und dann war es immer gleich ruhig draußen. Viktor wollte schon aufstehen und nach draußen schauen, aber er konnte sich nicht bewegen, so kalt war ihm.
Ich hob meinen Kopf und sah zu den anderen Betten, wo Medora, Lya und Jakob lagen. Sie waren in den letzten Tagen still geworden und hatten weniger gespielt, als sie es sonst immer taten. Oft war Frau Barbara in unser Zimmer gekommen und hatte mit ihnen geschimpft, dass sie endlich schlafen sollten. Vielleicht schliefen sie ja wirklich schon, dachte ich und legte mich zurück auf mein nasses Kissen, das von alldem nichts wusste.
»Du musst keine Angst haben, Viktor«, flüsterte ich meinem Teddy ins Ohr, als ich das Schlagen einer Tür hörte, die zu unserem Trakt gehörte. Es war sicher Frau Barbara. Das Geschrei hatte sie aufgeweckt. Sie würde sehr verärgert sein. Doch es war nicht Frau Barbara.
Als die Tür zu unserem Zimmer mit einem schweren Atmen aufging und eine Taschenlampe nach uns sah, machte ich ganz schnell die Augen zu. Mein Herz schlug wie wild, und ich drückte Viktor fest an mich. Schritte gingen durch das Zimmer und rochen nach kalter Erde und Autos.
»Elia, bist du wach?«, fragte plötzlich die Stimme eines Mannes. Es war der Geschichtenerzähler. Er war immer wieder zu uns in den düsteren Schlafsaal gekommen, nachdem Frau Barbara weggegangen war.
Ich erkannte ihn an seinen Schritten. Sie waren anders als die von Frau Barbara. Zurückhaltender. Leiser. Als wollte er nicht hier sein. Wenn der Geschichtenerzähler kam, ging er von Bettchen zu Bettchen und sah nach, ob wir schliefen. Wenn er in offene Augen blickte, dann setzte er sich an den Bettrand, streichelte unsere Arme und begann, seine Geschichten zu erzählen, bis wir darin Schlaf fanden. Dabei bebte sein Atem, und er kaute auf seinem ausgefransten Schnurrbart.
Ich glaubte, dass der Geschichtenerzähler alle Geschichten kannte, die es auf der Welt gab. Als ich ihn einmal danach gefragt hatte, sagte er, dass er viele Geschichten von seinem Vater gehört habe. Damals, bevor die Gespenster kamen, sei er in einem Wald einmal in eine Höhle gestürzt und habe eine andere Welt gesehen. Er habe so viel gesehen und erlebt, dass er alles in ein Buch geschrieben habe, damit er es nicht wieder vergaß.
Ich liebte diese Geschichten von der anderen Welt und spann sie dann in meinem Kopf weiter und erzählte sie Viktor, wenn er nicht schlafen konnte. Gerne mochte Viktor die Geschichten der Schneehexen, Waldläufer und Waldvampire. Mir gefiel die der mutigen Aussätzigen und der Windreiter. Doch am liebsten mochte ich die Geschichte von dem gruseligen Nachtvolk und der schwarzen Königin, die über alle Völker in der anderen Welt mit harter Hand herrschte.
Sie war so mächtig, dass nur der stumme Drache sie hätte besiegen können, aber der lag in einem unsichtbaren Tal ganz tief unten in der Erde, und nur der Fährmann wusste, wie man zu ihm gelangte und wie man ihn wecken konnte. Obwohl ich große Angst davor hatte, dass die schwarze Königin eines Tages aus der anderen Welt zu uns kommen würde, wollte ich die Geschichten über sie wieder und wieder hören, weil ich dachte, dass auch die Gespenster, die uns hier festhielten, Angst vor der Königin hätten.
»Elia?«, flüsterte der Geschichtenerzähler erneut. Seine Stimme klang irgendwie anders, als hätten Spinnfäden seinen Mund verklebt. Deshalb wollten Viktor und ich abwarten und bewegten uns nicht. Erst als ich hörte, wie eine Drahtfeder im Bett von Jakob stöhnte, öffnete ich die Augen und sah den Geschichtenerzähler in der schwarzen Tinte vor mir stehen. Sein Gesicht lag im Dunkeln, aber ich wusste, dass er mir in den Kopf blickte.
»Wir müssen gehen, steh auf und komm mit uns. Aber sei leise, wir wollen Frau Barbara nicht stören.«
Viktor und ich nickten. Ich stellte mich neben das Bett, dabei zitterten meine Beine so sehr, dass ich mich bei Viktor festhalten musste.
»Wo gehen wir hin?«, fragte Medora mit klappernden Zähnen.
»Wir fahren weg von hier, dorthin, wo es warm ist«, sagte der Geschichtenerzähler.
Ich hatte keine Erinnerung an einen anderen Ort, vielleicht gab es aber einen. Die Kinder vom anderen Schlafsaal hatten diesen Ort »Zuhause« genannt und weinten, weil sie dort nicht hindurften. Vielleicht fuhren wir jetzt auch nach »Zuhause«, dorthin, wo ich nicht mehr hungrig sein würde und wo mir früher einmal warm gewesen war.
»Aber wir fahren nicht mit dem Bus!«, sagte Lya mit blasser Stimme.
»Ihr müsst mir jetzt vertrauen. Legt eure Kuscheltiere hier in die Kiste und kommt mit mir mit. Ihr müsst nichts mitnehmen. Im Bus ist es warm.«
Ich drückte Viktor fest an mich und konnte nicht glauben, dass die anderen drei ohne Widerworte ihre Tiere in die Kiste warfen. Lya ihr kleines schmutziges Äffchen Moritz mit dem beinahe abgerissenen Kopf, Jakob seinen zitronengelben harten Teddy mit seinem borstigen Fell und Medora ihr Schlafkissen George, das aussah wie das Gesicht eines Hundes mit großen zotteligen Ohren. Sie alle mussten sich verabschieden.
Für einen Moment freute ich mich auch für die Kuscheltiere, denn wenn das Feuer in sie hineinflog, dann hätten sie es schön warm und könnten bald über die rauchigen Fäden nach oben in den Himmel fahren zu den anderen. Viktor aber wollte ich nicht hergeben.
Ich wartete einen Moment, bis niemand zu mir hersah, beugte mich über den Karton und tat so, als würde ich Viktor mit Georges Ohren zudecken. Dabei stopfte ich ihn unter mein hellblaues feuchtes Nachthemd. Ich dachte, wenn ich die Hände vor meiner Brust kreuzte, würde jeder denken, ich würde mich wärmen. Niemand würde erwarten, dass sich Viktor darunter versteckte. Mein Plan ging auf, denn als der Geschichtenerzähler mit seinem schwarzen Gesicht zu mir sah, nickte er mir zu, und ich stellte mich in die Reihe zu den anderen drei, die an der Tür warteten.
Draußen hörte ich, wie Frau Barbara mit den Gespenstern schimpfte. Wahrscheinlich ärgerte sie sich, weil sie sie mit dem Geschrei aufgeweckt hatten. Wir waren es jedenfalls nicht, denn wir waren leise und warteten an der schattigen Wand, bis der Geschichtenerzähler uns ein Zeichen gab, zum Bus zu gehen.
Der Bus war rot. Anders als die inzwischen von den Gespenstern grau bemalten.
Der Bus hatte vorne sein Maul geöffnet, das von altem Schnee angezuckert war. Ein schwarzes Gespenst stand davor und starrte hinein. Aus dem Bus stiegen Kinder. Sie sahen aus, als hätten sie ganz viel Angst. Es waren viele. Mehr, als ich Finger hatte. Sie gingen zu Frau Barbara, die auf der anderen Seite des Platzes stand, wo die anderen grauen Busse warteten. Gut, dass sie bei ihr in Sicherheit waren, dachte ich. Einem Kind riss sie ein kleines Stoffkätzchen aus der Hand, das sich verzweifelt festzukrallen schien, und warf es in den großen Karton. Dieser stand vor einem großen Schuppen, der ähnlich aussah wie der, aus dem wir gerade gekommen waren.
»Wer ist für die Wartung der Gekrat verantwortlich?«, schrie Frau Barbara mit bleichem Gesicht und großen Augen die Gespenster an. Ich wusste nicht, was sie meinte, und auch nicht, was Gekrat waren. Ich sah absichtlich nicht zu ihr hinüber, weil ich ihren Plan, die Gespenster zu besiegen, nicht vereiteln wollte.
Als der Lichtkegel auf die andere Seite des Hofes pendelte, gab uns der Geschichtenerzähler ein Zeichen, langsam zum roten Bus zu gehen. Wir stolperten durch das Geschrei und stellten uns taub. Auf seiner vom Hof abgewandten Seite bestiegen wir den Bus durch eine kleine geöffnete Tür über drei Stufen. Es war tatsächlich ein wenig wärmer, so, wie der Geschichtenerzähler es uns versprochen hatte. Die Scheiben hinten waren mit schwarzer Farbe bestrichen, vorne verhüllten Vorhänge die Fenster. Auf manchen Sitzen waren Gurte, auf anderen lagen Handschellen. Ich wusste nicht, wofür die waren, aber ich hatte das Wort bei Frau Barbara aufgeschnappt, als sie ein weißes Gespenst hatte abführen lassen, das womöglich ihren Plan durchkreuzt hätte.
Wir waren die Einzigen im Bus. Der Aufforderung des Geschichtenerzählers, unter die Sitze zu kriechen, damit uns die Gespenster nicht sahen, wenn die große Kugel des Turms ihr Licht wieder zu uns schickte, befolgten wir ohne Zögern, kauerten uns auf den Boden und hielten unsere Knie fest. Nur Viktor war so mutig und schielte durch die eisige Scheibe hinter dem Vorhang des Busses nach draußen und beobachtete den Geschichtenerzähler, wie er zum Maul des Busses ging, das Gespenst dort wegschickte und etwas im Inneren des Busses zusammensteckte. Als das Gespenst, das er weggeschickt hatte, zu Frau Barbara, den Kindern und den anderen Gespenstern gestoßen war, schloss er das Maul des Busses und stieg vorne ein.
Der Motor sprang ruckelnd an und ließ unsere kalten Knie wackeln. Als das Rütteln immer stärker wurde und der Bus zu fahren begann, brach draußen wieder großes Geschrei los.
»Wo fahren wir hin?«, fragte mich Viktor und sah mich mit seinen schwarzen Knopfaugen an.
»Ich weiß es nicht. Aber wir müssen Hilfe holen, und dann müssen wir zurückkommen und Frau Barbara vor den Gespenstern retten.«
Ich betrachtete den bleichen Mond und dachte an ein Glas Milch. Viktor war sicher auch durstig.
In der Reihe vor uns lag Lya zusammengerollt wie die kleine Katze, die wir einmal unter dem Tisch bei Frau Barbara im Behandlungsraum gesehen hatten. Lya hatte sie in die Hand genommen und mit ihren Fingern über ihren Bauch gestrichen. Dann hatte sie sie mir gegeben. Aber als das Kätzchen gefaucht und mir in meinen Finger gebissen hatte, hatte Frau Barbara gefragt, was ich jetzt tun wollte. Ich war unsicher gewesen und hatte zu Lya gesehen, die die Stärkste und Mutigste von uns war. Hätte sie zugelassen, dass das kleine Kätzchen sie biss? Warum hatte es Lya nicht gebissen? Warum mich? Schließlich packte ich den kleinen Hals des Kätzchens und drückte ihn mit dem Daumen zu. Als das Kätzchen tot war, sagte Frau Barbara, sie sei stolz auf mich. Auch ich war damals stolz auf mich gewesen, weil ich nun stark war wie Lya.
Neben Lya kauerte Medora. Sie hatte sich, so gut es ging, aufgesetzt und sah mich vorwurfsvoll mit ihren dunklen Augen an, als wollte sie mich verzaubern. Obwohl uns der Geschichtenerzähler aufgetragen hatte, unter den Sitzen zu bleiben, kroch Jakob vorsichtig unter seinem Sitz hervor und spähte neugierig nach vorn. Immer wieder sah er zu mir. Dass er die letzten Tage so still gewesen war, hatte mich traurig gemacht. Er war so schlau und wusste immer, was passieren würde, als wären seine abstehenden Ohren besondere Antennen. Jetzt, da ich sie wieder vor mir sah, wenn er sie mit seinem Kopf hin- und herdrehte, wusste ich, dass alles gut würde.
»Siehst du, Viktor?«, flüsterte ich. »Jakob ist es auch schon wieder wärmer, und es geht ihm besser. Du musst keine Angst haben.«
»Pst!«, machte Jakob, legte seinen schmutzigen Finger auf die Lippen und sah mich mit ernstem Gesicht an.
»Wohin bringt er uns?«, fragte ich und bemerkte erst dann, dass ich kaum sprechen konnte, da meine Zähne so klapperten, obwohl es im Bus wärmer war als in unserem frostigen Schlafsaal.
»Ich weiß es nicht. Vielleicht bringen sie uns ins Schloss zu den anderen«, sagte Jakob.
»Was passiert dort mit uns? Bekommen wir dort warme Sachen und Milch?«
»Bestimmt«, sagte Jakob und reckte seinen langen Hals, als könnte er so einen weiteren Blick aus den verdunkelten Scheiben erhaschen.
»Wenn sie uns trennen, sag, dass du ein Junge bist, dann passe ich auf dich auf.«
»Du musst nicht auf mich aufpassen. Viktor und ich passen aufeinander auf.«
»Viktor darf nicht hier sein. Wir kriegen mächtig Ärger«, sagte Jakob vorwurfsvoll, als er das Köpfchen unter meinem Nachthemd hervorlugen sah.
Ich nickte betroffen und blickte zu Lya, die sich vorsichtig aus ihrer wärmenden Haltung löste und zu uns sah. Ich glaubte, dass sie uns gehört hatte.
»Wir trennen uns nicht. Elia, hör nicht auf ihn!«, sagte Lya und wies Jakob mit einem strengen Blick zurecht.
»Und was ist, wenn sie Mädchen und Jungen trennen? Ich will nicht allein sein. Und niemandem wird auffallen, dass Elia ein Mädchen ist«, sagte Jakob und sah Lya so lange an, bis sie ihren Kopf zu Medora drehte.
»Weißt du, wohin wir fahren?«, fragte sie Medora, der die schweren schwarzen Haare an den Wangen klebten.
»Du hast doch gehört, was unsere Kleinste zu ihrem Bären gesagt hat. Wir fahren Hilfe holen«, sagte Medora mit einer Stimme, als würde sie sich über mich lustig machen. Als sie mich dann aber anstarrte, bekam ich Angst und musste weinen, ohne zu wissen, warum.
»Seid ruhig dahinten! In der letzten Reihe sind Decken. Lya soll euch welche holen, damit ihr euch wärmt. In zwei Stunden sind wir da. Aber bleibt um Gottes willen unten. Ich will nicht, dass euch jemand sieht. Habt ihr das verstanden?«
Viktor nickte unter meinem Nachthemd und schloss müde die Augen, als ich die graue Decke, die Lya mir aus dem Zwischengang herübergeworfen hatte, über seinen flauschigen Kopf mit den fingerlangen schneeweißen Zotteln zog.
»Ich bin hungrig und habe Durst, und mir ist kalt«, sagte ich und sah zu Lya, die sich wieder auf den mit Holzplanken beschlagenen Boden des Busses legte und die Decke bis über ihre Nase zog und »Versuch, ein wenig zu schlafen« murmelte. Ihr Gesicht war schmutzig. Es sah aus, als hätte jemand mit großen Fingern fünf Schlieren darüber gezogen. Vermutlich war es der Handabdruck des Geschichtenerzählers, der Lya im Lager zurück an die Wand gedrängt hatte, als das Licht vom Turm sie beinahe gefunden hätte.
Ob uns die Lichtkegel hier finden würden? Ich schielte durch die Vorhänge der vorderen Scheiben hoch zum Mond. Was, wenn der Turm im Lager wuchs? Wenn er die schwarze Kugel in den Himmel heben würde wie einen zweiten Mond? Was, wenn uns die Lichtkegel von dort aus suchten? Dann würden sie uns doch finden! Der Mond sah doch alles. Ich wickelte die Decke fester um mich, da es draußen kälter zu werden schien. Das beruhigte mich für einen Moment. Und als ich aus dem Busfenster vorsichtig nach draußen schielte, war ich erleichtert, denn der Mond war allein geblieben und in einem dichten Nebel verschwunden, der aussah, als würde er zittern. Es waren Schneeflocken. Sie fielen so dicht vom Himmel, dass der Bus langsamer fahren musste, und ich spürte, wie er immer wieder ins Rutschen kam.
Der Schneefall wurde so stark, dass der Boden des Busses unter meinen Beinen ruckelte. Der Geschichtenerzähler atmete jedes Mal auf, wenn der Schneefall kurz nachließ. Ich spürte, dass er Angst hatte.
Wann immer er die langen weißen Haare der Schneehexen sah, die wie seidig funkelnde Schneewasserfälle vom dunklen Himmel auf unsere Welt herunterfielen, stieß er einen gepressten Laut hervor. Und Viktor streckte seinen Kopf aus der Decke und suchte im Schneetreiben die gigantischen Körper der Hexen. Zum Glück hatte mir der Geschichtenerzähler von den Riesinnen auf dem Berg erzählt, sonst hätte ich jetzt unendliche Angst gehabt.
Plötzlich hielten wir an. Vor uns lag ein spärlich beleuchteter Bauernhof, umgeben von einem dichten, verschneiten Wald an einer ansteigenden Hügelkette, hinter dem ein hoher, dunkler Pass zu wachen schien, den der Mond, so gut er konnte, ausleuchtete. Bewegt vom Atem der Windreiter kämmten die weißen Hexenhaare von oben durch die Wälder. Und dahinter auf dem Gipfel sah es aus, als würde eine riesige schwarze Frau wie eine Königin auf einem Thron sitzen und auf uns warten.
Der Geschichtenerzähler stieg aus und stapfte durch den Schnee, der jetzt sanfter und luftiger fiel, zu einer gebückten Frau. Die stand direkt unter einem hellblauen, trichterförmigen Lampenschirm mit langen schwarzen Quasten und schien auf ihn zu warten. Die Frau wirkte verärgert, denn sie fuchtelte wütend mit den Armen, stieß ihn schließlich weg und schielte zum Bus. Es sah aus, als würde sie weinen. Durch das Licht, das aus der Stube nach draußen fiel, sah ich ihren dicken Bauch. Vielleicht bekam sie ein Baby. Möglicherweise wollte es dann einmal mit Viktor kuscheln, dachte ich und freute mich für die Frau.
Als der Geschichtenerzähler zum Bus zurückkam, lief ihm die Frau hinterher, als wollte sie ihn davon abhalten, wieder in den Bus zu steigen. Ich konnte ein paar Worte hören, verstand aber nicht, was sie bedeuteten.
»Sie werden uns alle erschießen, willst du das? Die Kinder in der roten Mordkiste kannst du nicht mehr retten. Nach allem, was man denen angetan hat, ist es auch besser, wenn sie sterben«, sagte die Frau und hielt dabei ihre Hände schützend vor ihren Bauch. Eisnägel aus Schnee durchbohrten ihre Hände. Welche Kinder sie wohl meinte? Ich drückte Viktor fest an mich, da ich seine Angst spürte.
»Du kannst bei dem Wetter nicht ganz nach oben zu den Höhlen«, hörte ich die Frau weitersprechen. »Da werden sie euch zuerst suchen. Du bist wahnsinnig wie dein verfluchter Vater!«, schrie die Frau, sodass ich Angst hatte, sie könnte mit ihrem Geschrei den Gespenstern verraten, wo wir waren.
»Ich verdamme den Tag, an dem der alte Leidemann in diese Höhle gestürzt ist und weiß Gott was alles gesehen hat. Er war ein Spinner, so wie du, so wie ihr alle mit eurem verdammten Rassenwahn.«
Der Geschichtenerzähler drehte sich von der Frau weg, und erst jetzt sah ich auf seinem Arm die Armbinde mit dem schwarzen, an den Enden geknickten Kreuz und dem roten Rand. Frau Barbara hatte auch so eine Schleife, aber sie zog sie immer vom Arm, wenn sie zu uns kam und den Tee brachte. Sie zeigte uns, dass sie nicht zu den Gespenstern gehören wollte, die alle so eine Binde trugen. Wenn sie die Binde abnahm, faltete sie sie ordentlich und legte sie sauber neben sich ab, bevor sie uns die Haare hielt, wenn wir uns übergeben mussten oder wenn sie das kochend heiße Wasser in die Badewanne schüttete.
Der Geschichtenerzähler schien nun ebenfalls zu weinen, zog die Binde vom Arm und zerriss sie vor den Augen der Frau. Dann bekreuzigte er sich, malte mit dem Daumen auch ein Kreuz auf den Bauch der Frau und verabschiedete sich von ihr. Doch sie verschwand noch einmal im Haus und kam mit ein paar Kleiderlumpen und ausgetretenen Schuhen zurück. Sie sagte irgendwas von »damit die Kinder nicht erfrieren da oben«. Der Geschichtenerzähler sprang ihr entgegen und hatte Mühe, alles auf einmal zu tragen, stolperte zum Bus und warf die Lumpen und Schuhe hinein. Wir sollten uns nehmen, was uns passte, sagte er und setzte sich wieder hinters Lenkrad.
»Wir fahren jetzt noch ein Stück mit dem Bus in ein Tal, und dann müssen wir ein Stück durch den Wald laufen. Es wird kalt werden, sehr kalt, aber ich verspreche, dass ich für euch da bin und dass ich wiedergutmache, was ich euch angetan habe.«
Ich verstand nicht, was der Geschichtenerzähler meinte.
Lya, Medora und Jakob krochen nach vorne und nahmen alles von den Kleidern mit, was sie zu fassen kriegten. Als sie zu mir und Viktor zurückkamen, sah ich die Tränen in ihren Augen. Wir teilten die Kleider, Jacken und Pullover auf und zogen alles an, auch wenn es nicht gut passte und nach Holz und Moder roch. Nur die Schuhe waren uns viel zu groß, außerdem waren es zu wenige, sodass Jakob sich ein Paar mit mir teilte, in dem ich hin und her rutschte wie ein Boot auf dem Meer. Als wir fertig waren, sahen wir uns an und reichten einander die Hände.
»Wenn wir uns treffen, krachen Donner aufeinander, und Blitze flammen auf«, sagte Medora. »Wir halten zusammen, egal, was passiert, ja?«
»Egal, was passiert«, sagte Lya.
»Egal, was passiert«, sagte Jakob.
»Egal, was passiert«, sagte ich, auch wenn ich nicht wusste, was Medora meinte. Aber da ich mit vier Jahren die Jüngste von uns vieren war, vertraute ich auf sie.
Nach diesem kurzen Moment war Medora die Erste, die zurücksank. Dabei verrutschte ihre Decke. Als sie sie wieder zu sich ziehen wollte, sah ich ihre gebrochenen, blutunterlaufenen Finger. Die anderen mussten ihr helfen, sich wieder einzuwickeln, da sie mit ihren krummen Händen den rauen Überwurf nicht richtig zu fassen bekam.
»Die Königin wird dir helfen«, sagte ich zu Medora und blickte in das dunkle Tal, in das der Geschichtenerzähler den Bus lenkte, nachdem er die kurvigen Straßen, die zum Bauernhof geführt hatten, verlassen hatte. »Sie wird uns allen helfen«, sagte ich und drückte Viktor fest an meine Brust.
Kurz darauf erblickte ich den dunklen Pass, und sofort begann mein Herz wild zu schlagen. Den Thron der Königin sah ich nicht mehr, aber ich war mir sicher, dass wir sie von oben, wo wir über die Wälder blicken konnten, auf einem der vielen Gipfel sitzen sehen würden.
Als der Geschichtenerzähler schließlich aus dem Bus stieg, hatte es aufgehört zu schneien. Ohne zu fragen, hüllten wir uns in unsere Decken und Lumpen und folgten ihm. Er sagte, dass wir dicht hinter ihm bleiben müssten, damit wir uns im Dunkelwald nicht verlieren würden. Der Weg sei hart und unheimlich, sagte der Geschichtenerzähler, aber wenn wir den Blick nach unten richteten und in einer Reihe hintereinander in seine Fußstapfen träten, dann würden wir gut vorwärtskommen und oben hinter dem Wald den Pass sehen. Daneben sei ein kleines Häuschen, wo wir uns wärmen könnten, sagte er mit belegter Stimme.
Wir nickten und bildeten eine Reihe, die Lya anführte. Danach folgten Medora und Jakob. Sie ließen mich und Viktor am Ende der Reihe gehen, weil dann der Schnee durch die vielen Schritte zusammengepresst war und ich leichter mit meinen kurzen Beinen durch den eisigen Wald gehen konnte. Neben mir gingen Bäume mit weißen Rinden, die bleicher waren als der Schnee, was Viktor Angst einjagte.
»Ich werde dich tragen«, sagte ich zu ihm und folgte den anderen.
Es war so kalt, dass ich meine Füße nicht mehr spüren konnte. Ich hatte den zu großen Schuh im Schnee verloren. Meine Zehen waren bläulich wie Eis, und ich hatte Angst, dass sie zerspringen könnten beim nächsten Schritt. Immer wieder drehten sich die anderen zu mir um. Mein Atem wurde immer schwerer und brannte dann plötzlich so sehr, dass ich die Luft anhalten musste. Als ich nach vorne fiel und der Schnee sein Nadelkissen in mein Gesicht stieß, wurde mir so übel, dass ich mich übergeben musste und Viktor, der beim Sturz aus meinem Nachthemd in den Schnee gefallen war, mit meinem Mageninhalt beschmutzte. Ich wollte nach ihm greifen und ihn sauber machen, aber alles drehte sich. Ich hörte nur noch, wie Lya sagte, dass sie mein Eselchen tragen würde, und spürte, wie die Hände des Geschichtenerzählers unter meinen Rücken fuhren und mich hochhoben. Viktor sei kein Esel, wollte ich Lya immer wieder sagen, hatte aber keine Kraft dazu. Ich sah nur Viktor in Lyas Hand baumeln, bevor meine Augen zufielen und der Wind biegsam durch die Äste schwamm.
Ein lauter Schuss holte mich aus der tiefen Schwärze. Über mir standen die Sterne, vor die sich Wolken schoben und neuen Schnee mitbrachten. Mein Kopf fiel zur Seite, und ich sah den Wald hinter mir, aus dem laute Stimmen kamen. Plötzlich hielt der Geschichtenerzähler an und setzte mich zurück auf die Erde. Meine Füße taten so weh und bluteten, dass ich beinahe umfiel, wenn Jakob mich nicht aufgefangen hätte.
»Schnell, lauft, dort vorne sind die Höhlen, lauft um Gottes willen und versteckt euch dort, bis ich euch hole«, sagte der Geschichtenerzähler und lief, so schnell er konnte, auf die Stimmen zu, die aus dem Wald drangen.
Obwohl Jakob nicht viel älter war als ich, fasste er mich unter den Armen und lief mit mir und den anderen in die Richtung, die uns der Geschichtenerzähler gezeigt hatte.
»Viktor, ich will Viktor haben!«, rief ich zu Lya, die immer wieder hinfiel und Viktor aus ihren Händen rutschen ließ. Jakob stürmte zu Lya, half ihr auf und gab mir Viktor. Er war so kalt und steif gefroren, dass ich Angst hatte, dass er gestorben war. Doch dann sah ich, dass seine Knopfaugen zu Medora blickten, die sich auf einer weiten felsigen Ebene gegen den aufkommenden Wind stemmte und uns mit heftigen Handbewegungen zu sich winkte.
Hinter uns liefen Männer in dunklen Mänteln durch das Weiß und riefen, dass sie unsere Mütter und unsere Väter töten würden, wenn wir nicht stehen blieben, aber ich wusste nicht, wen sie damit meinten, da wir vier Waisen waren, wie Frau Barbara mir einmal gesagt hatte. Erst jetzt erkannte ich, dass die Männer die Gespenster waren. Hinter ihnen standen schneeverwehte Tannen, Bäume, die Frau Barbara gerne mochte und mir auf einem von ihrem Vater gemalten Aquarell gezeigt hatte; dazwischen andere Bäume, wie das weiße Geweih vor den grauen Riesenzähnen ferner Berge. In der Ferne dämmerte es, und Vögel flogen im schwarzen Wind wie eine Perlenkette durch die Luft.
Als wir zu Medora aufgeschlossen hatten, sprangen wir alle in eine tiefe Felsspalte. Wir folgten Medoras Stimme, die uns in ein dunkles Labyrinth aus Felsen und Eis führte, und krochen auf allen vieren immer tiefer in einen engen, kalten Schacht, der sich unter der Felsspalte in den Berg drängte. Wir zwängten uns durch und fielen dann wie Steine in eine tiefer gelegene kleine Höhle. Es roch faulig und nach der toten Katze, die Frau Barbara uns einmal in den Schlafsaal gelegt hatte, weil wir nicht schlafen wollten. Es war stockdunkel, und ich hörte nur den Atem der anderen, während ich Viktors Herzschlag auf meiner Brust spürte.
Wir warteten im Dunkeln, dass etwas passieren würde. Aber nichts passierte.
»Seid ruhig«, sagte die unsichtbare Lya nach einer Weile. »Hört ihr das? Was ist das?«
»Hört sich an wie ein Wasserfall«, sagte Jakob, und ich bemerkte, dass er kaum Luft bekam. Vielleicht war er beim Sturz in die Höhle hart aufgeschlagen und seine Brust war zusammengedrückt.
»Sie sind da unten!«, rief plötzlich eine laute Männerstimme.
Wir erschraken und hielten den Atem an. Viktor musste ich den Mund zuhalten, damit er uns nicht durch sein Keuchen verriet.
»Ich komme da nicht hinunter, es ist zu eng«, hörte ich die Stimme des Geschichtenerzählers. »Wenn sie dort hineingefallen sind, sind sie sicher tot.«
»Leidemann, Leidemann, du kennst doch jeden Winkel hier. Du weißt genau, dass sie nicht tot sind. Steig da hinunter und hol sie, Verräter!«
Ich spürte, wie eine Kinderhand nach meiner fasste. Dann hörte ich Keuchen von oben, als würde sich jemand in die Höhle zwängen. Ich versuchte, nicht zu atmen, so wie die anderen, und wir hörten nur den Wasserfall. Ich drehte meinen Kopf in Richtung des Geräusches und stellte fest, dass sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Denn dort, wo das schwarze Wasser in die Tiefe zu fallen schien, leuchtete ein blasser Schimmer aus dem Abgrund herauf. Und vor dem unheimlichen Schimmer stand etwas, das aussah wie ein Hirsch.
»Ich glaube, ich habe ihn schon oben gesehen, zwischen den Bäumen, bei den Gespenstern. Er ist weiß wie Viktor«, sagte ich und hatte das Gefühl, als würde ein Hauch von Wärme vom Hirsch zu uns herüberwehen.
Die anderen rührten sich nicht.
»Die weißen Hirsche zeigen uns den Weg zur Königin«, sagte ich und spürte, wie mein Herz wild zu schlagen begann.
»Was redest du da?«, schalt mich Medora.
»Das hat doch der Geschichtenerzähler gesagt. Die weißen Hirsche bewachen die Grenze zur anderen Welt«, erklärte Viktor den anderen. Ich war stolz auf Viktors Mut und spürte meinen Herzschlag in ihm. Doch ich wusste nicht, ob sie ihn verstanden hatten, denn von draußen drang plötzlich wieder lautes Gebrüll. Und irgendjemand schrie mit lauter Stimme, dass der Geschichtenerzähler sich entscheiden sollte, auf welcher Seite er stand.
»Spreng die Missgeburten in die Luft und beweise, dass wir uns nicht in dir geirrt haben!«, rief eine weitere Stimme.
»Wir müssen sofort von hier verschwinden«, zischte Lya. Sie hatte recht, dachte ich und nahm Viktor in die Hand. Dann kroch ich an den anderen vorbei in Richtung des Hirsches.
»Pass auf, Elia«, sagte Medora, obwohl sie wusste, dass wir keine andere Wahl mehr hatten.
»Viktor sagt, wir müssen den Hirschen folgen. Wir müssen Viktor vertrauen«, rief ich und kroch weiter auf den weißen Hirsch zu, der regungslos wie ein Geist vor dem Abgrund stand.
Als er uns sah, setzte er sich in Bewegung und verschwand über einen Weg nach unten, den ich noch nicht sehen konnte. Erst als wir an der Stelle waren, wo vorher der Hirsch gestanden hatte, erkannten wir, dass es keinen Weg gab, den der Hirsch hätte gehen können. Nur ein tiefer Abgrund starrte uns entgegen wie das weit aufgerissene Maul eines Riesen.
»Hier kommen wir nicht weiter«, sagte Jakob. »Wir müssen –«
Ein ohrenbetäubender Knall erschütterte plötzlich die Höhle und ließ überall kalten Staub herabregnen. Im ersten Moment dachte ich, dass die Schneehexen zurückgekehrt waren und mit einem wütenden polternden Handstreich die Gespenster von der Oberfläche ihrer Welt geworfen hätten. Doch als das Echo des Knalls aus dem Inneren der Höhle zum Doppelschlag ausholte, erschrak ich so sehr, dass mir Viktor aus den Fingern glitt und in die Tiefe stürzte. Ich kroch, so schnell ich konnte, an den Rand des Abgrunds, doch während mich die anderen festhielten, konnte ich schon nicht einmal mehr seine schwarzen Knopfaugen sehen. Schließlich war er komplett im riesigen Maul verschwunden.
An die Ereignisse, die sich danach zutrugen, erinnere ich mich nur noch schemenhaft. Ich weiß lediglich, dass ich auf dem harten Felsboden aufwachte, zugedeckt mit vier Decken. Die anderen drei saßen eine Armlänge von mir, umarmten sich und rieben einander warm. Überall war es still und dunkel. Nur das fahle Licht vom Abgrund schimmerte herauf.
»Am verholchten Schai isch mir de biele muli tschant.«
»Gof?«
»Butzel.«
»Selber linstne ne zgwand zmenge, isch me abe gehochlt lori, drum delt ne mim olmische zem ne menge gwand.«
Ich drehte mich um. Sprach da jemand?
»Schwecher.«
»Bos mich.«
Gelächter. Plötzlich zwängte sich ein kleiner, schmächtiger Mann durch den schmalen Höhlentunnel, durch den auch wir gekrochen waren. Er hatte große, freundliche Augen und trug einen schwarzen Hut mit breiter schlapper Krempe. Eine blaue Blume steckte im Knopfloch seiner zerrissenen Jacke.
»Latscho dibes«, sagte der Mann, und ich wusste nicht, was er meinte. Dann wandte er sich um und fragte in seiner fremden Sprache etwas in die Dunkelheit hinter sich, aus der der Schein einer Fackel kroch.
»Vier butzel«, sagte der Mann, und als er unsere fragenden Gesichter sah, lächelte er uns an.
»Delt ne mim olmische zem ne menge gwand.«
»Olmisch? Fährmann.«
Ich verstand kein Wort. Aber ich wusste, dass uns diese Männer retten würden.
»Kommt ihr von der Königin? Hat euch Viktor gefunden? Wird sie uns helfen?«
Die Männer sahen aus wie Fledermäuse, die im zitternden Fackellicht an der Höhlenwand klebten. Doch bevor ich die Antwort, die ich ohnehin nicht verstanden hätte, abwarten konnte, fielen meine Augen wieder zu.
Die letzte Erinnerung, die ich wie einen kleinen Fetzen Stoff in mir trage, ist jene, als ich das Bauernhaus, vor dem der Geschichtenerzähler mit der gebückten Frau gesprochen hatte, noch einmal vom gegenüberliegenden Waldhang sah. Oder besser das, was davon übrig geblieben war. Denn dort, wo vorher das Haus gestanden hatte, war nur noch ein großer, verkohlter, schmutziger Fleck, als hätte jemand ein Stück aus einem großen beschneiten Tischtuch herausgebrannt.
»Die Gespenster reißen Löcher in unsere Welt«, sagte ich zu Viktor und suchte ihn unter meinem Nachthemd. Doch Viktor war nicht da, und ich begriff, dass ich auf fremden Armen lag. Ich wurde auf einem schmalen Weg zu einer kleinen Hütte mit einem steinernen Turm getragen, die am Ende des Pfades lag. Und dahinter tat sich offenbar ein tiefer Abgrund auf. Wieder fielen meine Augen zu und mit ihnen die Erinnerung. Ich wusste nur, dass es mit einem Mal wieder warm wurde, als hätte jemand die Fenster geschlossen. Endlich.
1
Am 29. September 2023, als der Morgen über den spitzen Gipfeln der Sciora-Gruppe hereinbrach, verließ die leidenschaftliche Frühaufsteherin Elia Khalberg wie jeden Tag das kleine Chalet, in dem sie mit ihrer Tochter und ihrer Enkelin lebte. Elia wollte den Tag beginnen wie all die anderen Tage, die sie hier auf dem Maiensäß verbrachte, einer großen gerodeten Fläche, tausend Meter über dem Schweizer Bergdorf Soglio.
Leise schloss sie die niedrige Tür des kleinen Häuschens, um Gloria und Laura – ihre Tochter und ihre Enkelin – nicht zu wecken. An diesem Morgen war die Bergluft kälter als am Tag zuvor, sodass Elia ihren alten grauen Mantel mit dem schwarzen verschlissenen Pelzkragen enger um sich schlang als sonst. Elia schlüpfte in die abgenutzten Holzschuhe, die vor der Tür standen, und ging zum Atelier ihres Mannes, das wenige Schritte vom Chalet entfernt stand.
Vor dem kleinen runden Gebäude, das einem Pavillon nachempfunden war, setzte sich Elia auf die kalte Holzbank und blickte in das Tal. Sie passte ihre tägliche Morgenroutine dem Sonnenaufgang an und wartete auch jetzt darauf, dass die Sonne ihre ersten Strahlen wie glühende Lanzen durch die schroffen Felskronen des Bergpanoramas stieß. »Nirgendwo ist das Licht schöner als hier an der Schwelle zum Paradies«, hatte ihr Mann gesagt, als er noch neben Elia auf der Bank gesessen hatte.
Während Elia auf die Sonne wartete, schloss sie die Augen und nahm durch die Nase sechzehn tiefe Atemzüge. Dabei achtete sie darauf, ihre Gedanken leer zu halten und sich nur auf ihren Atem zu konzentrieren, der wie die wilden Wasser der dunklen Schluchten im Tal durch ihre Lungen strömte. Nach dem letzten Atemzug erhob sich Elia von der kalten Bank und streckte sich im Licht der mittlerweile aufgegangenen Sonne. Obwohl sie schon zweiundachtzig Jahre alt war, war ihr hagerer Körper dennoch gut in Schuss. Nachdem sich Elia in den Himmel gestreckt hatte, begann sie, ihre Knie zu beugen, und vollendete mit fünfzig Kniebeugen und zehn abschließenden Liegestützen ihr morgendliches Sportprogramm.
Pustend und mit kaltem Schweiß auf der Stirn wandte sich Elia zum Atelier und sperrte die Tür zu einem kreisrunden Raum auf. Ihr Mann hatte das Atelier in den sechziger Jahren mit eigenen Händen nach dem Vorbild des Engadiner Pavillons auf der Pariser Weltausstellung 1900 erbaut. Elia trat in den düsteren runden Raum, in dem das Morgenlicht von den Obergadenfenstern sanft hereinfiel und die blau bemalten Wände zart berührte.
»Guten Morgen, mein Stern«, sagte sie und entzündete die Kerzen des Ateliers, deren warmes Licht den Raum aufhellte. Von innen wirkte der Pavillon größer und höher als von außen. Wenn Elia mitten im Atelier ihres Mannes stand und auf die Bilder, Skulpturen und Bücherregale sah, die hinter dem Kerzenschein aus dem Schatten traten und sie umgaben wie alte Freunde, die zu einem Fest geladen worden waren, empfand sie demütigen Stolz.
Als die Freunde ihres Mannes das Atelier vor Jahrzehnten noch besucht hatten, war sie inmitten der diskutierenden Männer mit Abstand die Kleinste gewesen. Elia war mit ihren ein Meter sechzig nur ein wenig größer als ein Grundschulkind, was ihr aber nie zu schaffen gemacht hatte. Und trotz ihrer geringen Körpergröße war sie zwischen den Männern das heimliche Zentrum gewesen, hatte mit dem furchtlosen Selbstbewusstsein ihrer Sprache und ihren vor Wissensgier funkelnden Augen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und wenn ihr in jungen Jahren während aufregender Gespräche die braunen Haare in dichten Locken ins Gesicht gefallen waren, dann hatten viele der Kunstfreunde mitten in ihren Diskussionen innegehalten und ihr wie verzaubert in die ein wenig schielenden Augen gestarrt.
Einige fanden schon damals, sie sei »ein wenig wild«, ein Ruf, der sich hier auf dem Maiensäß und in den Dörfern bis nach Stampa bald verbreitet hatte wie vom Herbstwind fortgetragenes Laub. Doch als Elias Mann in den späten sechziger Jahren verschwunden war und sie seitdem aus Kummer und Gram das Maiensäß nicht mehr verlassen hatte, war aus der kleinen, zierlichen Wilden von einst die Verrückte mit der traurigen Gestalt geworden, die seit Jahrzehnten auf die Rückkehr ihres Geliebten wartete und auf den Bergen ihr Unwesen trieb.
Elia hatte von diesen Gerüchten lange nichts mitbekommen. Auch ihre Tochter, die an Werktagen als Lehrerin nach Stampa fuhr, erzählte ihr nichts von dem, was die Leute im Tal sprachen. Selbst ihre Enkelin, Laura, die stille und schweigsame Anmut, wie Elia sie nannte, brachte keine Geschichten aus dem Tal, obwohl die Sechzehnjährige in der Schule bestimmt darauf angesprochen und vermutlich gehänselt wurde.
Bevor Elia mit ihrer Morgenroutine fortfuhr, wandte sie sich noch einmal zur Tür und kontrollierte, ob sie diese ordnungsgemäß versperrt hatte. Sie wollte sichergehen, dass niemand überraschend in das Atelier eindringen konnte. Dabei holte sie den Schlüssel aus den Taschen ihrer Schürze hinter ihrem Mantel, wo sie ihn mit den Fingern jederzeit ertasten konnte.
Schließlich ging sie zu einem kleinen Tischchen, auf dem ein dickes Buch mit grünem Ledereinband lag, und öffnete es. »Dann wollen wir mal«, sagte sie und zog eine Füllfeder von der Lederschleife, die als Stifthalterung an das Buch angebracht war. Elia nahm das Buch und legte es auf ihren linken Unterarm, während sie begann, durch das Atelier zu gehen und die Bilder, Skulpturen und Bücher zu zählen und zu kontrollieren, ob noch immer alles auf seinem Platz war. Denn nichts fürchtete Elia mehr, als dass Gespenster in das Atelier eindrangen und Unordnung anrichteten oder gar Dinge entwendeten. Der Schmerz, den ihr die Gespenster zugefügt hatten, als sie ihr vor über fünfzig Jahren ihren Geliebten geraubt hatten, war so groß und tief, dass sie keinen weiteren Verlust verkraften konnte. Lieber würde sie sterben.
Elia hoffte nach wie vor, dass ihr Geliebter eines Tages zurückkehren würde, da ihn die Gespenster gehen ließen oder es ihm gelänge, ihnen zu entkommen. Dann sollte sich ihr Mann gleich wieder an die Arbeit machen können und sich in seinem Atelier wohlfühlen.
Elia ging sorgfältig den Bestand des Ateliers durch und machte hinter jedem Gegenstand, der im Buch aufgeführt war, einen kleinen Haken. So wie jeden Tag. Woche für Woche. Jahr für Jahr. Jahrzehnt für Jahrzehnt. Doch als Elia mit dem dicken Buch der Tausenden kleinen Häkchen vor das Bücherregal trat, lief ihr ein Schauer über den alten, hageren Körper.
»Das ist unmöglich!«, sagte sie mit zittriger Stimme und fasste sich erschüttert an den Mund, während sie auf den fingerschmalen Spalt starrte, der sich in der Bücherwand vor ihr auftat wie ein dunkles Portal in eine andere Welt.
»Nein, nein, nein«, stammelte sie und lief wie ein aufgescheuchtes Huhn durch das Atelier, auf der verzweifelten Suche nach dem fehlenden Buch. Seit Jahrzehnten waren die Bücher im Atelier nicht angerührt worden und hatten eine sichtbare Staubschicht angesammelt.
Dennoch fehlte jetzt eines der fünfhundertachtundzwanzig Bücher.
Elias Blicke sprangen wie blaue Murmeln hin und her, während sie angestrengt nachdachte. Sie wollte nicht glauben, dass nach all den Jahren die Gespenster wieder zugeschlagen hatten.
Oder war sonst jemand im Atelier gewesen? Konzentriert suchte sie die ebenfalls staubigen Dielen nach Fußspuren ab. Doch außer ihren eigenen, die sie seit Jahrzehnten hinterlassen hatte, war nichts zu sehen. War jemand in ihren Spuren gelaufen?
Sie fasste sich an die Schürze, und im nächsten Moment fiel ihr Laura ein. Als die am Vortag von der Schule zurückgekommen war, hatte sie gefragt, ob sie einmal ein Buch lesen dürfe. Und was ihr Großvater für Kunst gemacht habe. Fragen, die nicht gut waren für junge Menschen, da sie Gespenster anlocken würden.
»Nun haben wir den Salat«, schnaubte Elia wutentbrannt und verließ das Atelier, das sie sorgfältig abschloss.
Draußen floss würziger Herbstwind von den Bergen, und Sonnenlicht bemalte die Alm mit seiner reichen Farbpalette. Elia lief zurück zum kleinen Häuschen, und nach wenigen Schritten schlüpfte sie durch die niedrige Tür zurück ins Chalet.
»Laura! Laura, Gloria, kommt sofort herunter!«, schrie sie mit schriller Stimme, dass selbst der Hahn, der von den Hütten und Ställen auf der anderen Seite des Maiensäßes den Morgen begrüßte, kurz innehielt.
Nach wenigen Augenblicken erblickte sie Lauras nackte Füße auf der hölzernen Treppe. Sie war groß gewachsen, und ihre langen blonden Haare fielen in stillen und anmutigen Locken über ihr Nachtkleid. Ihr Blick, der sich bereits auf eine neuerliche Standpauke von Elia einzurichten schien, war schamhaft wie Laura selbst, die – kaum hatte sie das Ende der Treppe erreicht – ihre Hände vor ihre Brüste legte, die sich unter dem Nachthemd in der Kälte des Chalets hervorhoben.
Lauras Mutter, die dicht hinter ihrer Tochter aus dem ersten Stock herunterkam, wirkte wie stets derb und verhärmt. Es war schwer vorstellbar, dass Gloria mit ihren kurzen braunen Haaren und ihrem leeren Blick einmal fast so schön gewesen war wie ihre Tochter. Und wären da nicht die wenigen Familienfotos gewesen, die Elia zu Weihnachten aus einer verschlossenen Lade geholt und Laura gezeigt hatte, um mit ihr nach Ähnlichkeiten mit ihrer Mutter zu suchen, hätte es niemand für möglich gehalten, dass Gloria tatsächlich einmal jung und voller Leben gewesen war oder auch nur ein einziges Mal gelacht hatte, damals vor vierzig Jahren in den Kastanienhainen unten in Soglio.
»Warst du ohne Erlaubnis im Atelier und hast ein Buch gestohlen?«, fragte Elia mit strengem Blick ihre Enkelin.
Laura schüttelte den Kopf, ohne ihren Blick zu heben.
»Und du?«, fuhr Elia mit ihrer Frage fort und sah zu ihrer Tochter, die in einem ausgewaschenen und abgenutzten roten Morgenmantel wie eine Angeklagte neben Laura stand und ebenfalls Mühe hatte, Elia in die feurigen Augen zu sehen.
»Dann sind sie hier, die Gespenster«, rief Elia und streckte warnend die Arme in die Höhe.
»Was ist denn schon wieder geschehen?«, fragte Gloria müde.
»Ein Buch fehlt. Da ist ein Spalt, so groß«, sagte Elia und zeigte mit ihrem Zeigefinger und Daumen die Größe der Lücke, die sie in der Bücherwand des Ateliers entdeckt hatte.
»Aber wer von uns soll denn da hinuntergehen? Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr dort«, versuchte Gloria, Elia zu beruhigen, die immer wieder zum kleinen Fenster des Chalets sprang, als würde sie jeden Moment mit einem überraschenden Besuch rechnen.
»Ha, aber ihr wart einmal unten«, sagte Elia und fuchtelte mit dem Finger vor Glorias versteinertem Gesicht.
»Wie jedes Jahr, zum Geburtstag von Vater.«
»Wo ist das Buch?«, wiederholte Elia ihre Frage, da sie Gloria nicht glaubte, dann wandte sie ihren Blick wieder ihrer Enkelin zu.
»Ich habe geschlafen, Oma«, sagte Laura schüchtern und zitterte in dem klammen Vorraum des Chalets vor Kälte.
»Und warum hast du gestern am Tisch gefragt, ob du einmal ein Buch lesen darfst?«, fragte Elia und zeigte in das Esszimmer, das sich hinter dem Vorraum verbarg.
»In Stampa hat eine neue Buchhandlung eröffnet. Herr Ritter will, dass wir dorthin gehen und uns ein Buch aussuchen«, antwortete Laura.
»Herr Ritter hat keine Ahnung. Du schlägst keine einzige Seite auf, das verbiete ich dir. Bücher verdrehen den Geist. Ohne sie würde es da draußen keine Gespenster geben.«
»Mutter, Laura war nicht im Atelier«, mischte sich Gloria ein. »Ich auch nicht. Lass uns vernünftig sein und klar denken.«
Elia rollte die Augen, ging zu ihrer Tochter und fasste sie an beiden Händen. »Siehst du es denn nicht? Die Welt um uns löst sich auf. Überall reißen sie Löcher in die Welt. Es beginnt mit Gegenständen, die von einem Tag auf den anderen verschwinden, dann sind es Häuser, die noch da waren, als du zu Bett gegangen bist. Und dann kommen wir dran. Sie reißen uns einfach aus der Welt, als hätten wir nie existiert. Willst du das, Gloria? Ich mache mir Sorgen, Sorgen um Laura.«
»Es ist alles gut, Mutter. Da draußen gibt es keine Gespenster. Und sie haben auch nicht Vater geholt.«
»Du weißt, dass das nicht stimmt«, sagte Elia, während sie ihre Hände ruckartig von denen ihrer Tochter löste.
»Alles ist gut, Mutter«, sagte Gloria erneut und suchte in ihrer Stimme nach Sanftheit, was ihr nicht gelang.
Doch bevor Gloria ihre Mutter weiter beschwichtigen konnte, begann Elia wieder, mit den Händen zu fuchteln, und sagte unter Tränen, aber mit fester Stimme: »Wir wollen nicht über deinen Vater reden. Alles bleibt, wie es ist.«
Gloria nickte, dann wies sie Laura leise an, wieder nach oben zu gehen und sich anzuziehen, da sie bald losmüssten.
»Laura geht heute nicht in die Schule. Nie wieder. Ich verbiete es. Erst wenn sie wieder weiß, was gut für sie ist, und aufhört, dumme Fragen zu stellen.«
Gloria schwieg. Sie kannte die Haltung ihrer Mutter und wusste, dass, wenn sie jetzt nicht nachgab, die flammenden Reden aus ihrer Mutter herausbrächen, in denen sie vor der wachsenden Irrationalität und Unmoral warnte, die durch die Bücher und Schulen vorangetrieben würden. Gloria hatte schlecht geschlafen und keine Kraft zum Streiten. Also stimmte sie dem Wunsch ihrer Mutter zu. Wie so oft.
»Ich sag, dass du krank bist«, sagte Gloria zu ihrer Tochter.
»Aber ich will in die Schule.«
»Siehst du? Es ist schon zu spät«, fluchte Elia. »Es hat schon begonnen. Man müsste alle Schulen, Galerien und Bibliotheken niederbrennen oder wenigstens für immer verschließen. Diese Traumwelten, die dort heraufbeschworen werden, wiegeln die Jungen und Unerfahrenen auf.«
Laura, die die ganze Zeit vor sich auf den Boden gestarrt hatte, fasste allen Mut zusammen und sagte mit leiser Stimme: »Opa war doch selbst Künstler, wie kannst du nur so sein, Großmutter?«
Elia presste die Lippen zusammen und nahm einen tiefen Atemzug durch die Nase. »Die Zeit der Kunst ist vorbei. Für immer. Sie zerstört. Sie macht uns verrückt. Sie führt zum Aufstand. Es ist vorbei, Laura. Ich weiß, wovon ich spreche. Sei froh, dass ich dich beschütze. Eines Tages wirst du mir dankbar sein.«
Eine Träne lief Laura über die Wange, aber sie hatte nicht den Mut, ihrer Großmutter erneut die Stirn zu bieten, und lief heulend nach oben.
»Du kämpfst gegen Windmühlen, Mutter«, sagte Gloria und ging an Elia vorbei, um im Zimmer nebenan Licht zu machen und einen Tee aufzustellen.
»Ich bin nicht Don Quijote! Und ich will hier im Haus nicht mit einer literarischen Figur verglichen werden. Und jetzt basta. Kein Wort mehr über diese Dinge, hast du mich verstanden?«
Gloria schwieg, zündete sich eine Zigarette an und zog hustend den Rauch in ihre Lungen, während sie neben dem Herd saß und auf das kochende Wasser wartete. »Jawohl, Mutter«, sagte sie schließlich, »kein Wort mehr über Kunst, Literatur und Poesie.« Lass uns nur noch über Gespenster reden, fügte sie in Gedanken hinzu und schloss müde die Augen.
Elia stand schweigend an der Tür und sah zu ihrer Tochter, die rauchend neben dem Herd auf einem Holzstuhl saß und ihren Kopf in den Händen vergraben hatte, während von oben Lauras Schluchzen nach unten drang.
»Am Wochenende beginnt das Kastanienfestival. Wir müssen noch zu unseren Bäumen«, sagte Elia in dem Bestreben, mit dem Themenwechsel ihre zusammengesunkene Tochter wieder zurück in den Alltag bringen.
»Wir kommen natürlich mit zur Ernte«, erwiderte Gloria, zog erneut an der Zigarette, ohne ihre Mutter anzusehen, die wie eine Gräfin aus alter Zeit an der Eingangstür stand und stolz mit den Fingern auf den Schlüssel klopfte, den sie in der Tasche ihrer Schürze spürte.
»Ich sehe noch nach Rosinante«, sagte Elia und wartete vergeblich auf eine Antwort.
Schließlich trat sie wieder nach draußen und blickte in das Tal vor sich, das unter den Bergen lag. Das magische Licht leuchtete inzwischen das ganze Bergell, wie die Gegend hier genannt wurde, mit seinen kräftigen Farben aus. Auf der Suche nach Ordnung in ihrem Kopf ging Elia zum Stall, der neben dem Chalet lag und mit einer kleinen Holzkirche sowie zwei weiteren Schuppen ein Ensemble wie ein kleines Bergdorf bildete. Gestärkt von der Pracht der Bergwelt gab sie einem klapprigen Gaul, der im zugigen Stall sein Dasein fristete, sein Futter und tätschelte seinen Hals, als wäre er der Einzige, der sie verstand. Rosinante war ein alter, abgemagerter Gaul mit dünnen, wackeligen Beinen und weißem, von grauen Sprenkeln übersätem Deckhaar.
Dann lief Elia zurück ins Atelier, um sicherzugehen, dass sie die Tür auch tatsächlich ordentlich versperrt hatte. Als sie beim Eingang war, rüttelte sie daran und nickte erleichtert, bevor ihr plötzlich einfiel, dass sie das große Buch, mit dem sie jeden Tag den Bestand des Ateliers kontrollierte, nicht auf seinen Platz zurückgelegt hatte.
Verärgert über ihre Nachlässigkeit sperrte sie erneut auf und ging noch einmal ins Atelier. Sie nahm das Buch, das vor dem Regal auf dem Boden lag, überprüfte die Häkchen und sah nochmals besorgt zum Bücherregal und zu dem dunklen Spalt, den das fehlende Buch hinterlassen hatte.
Vielleicht lag es am Licht, das immer intensiver von oben ins Atelier fiel, oder an ihrer mangelnden Sorgfalt, aber das Buch, das sie vorhin vermisst hatte, stand umhüllt von einer dicken Staubschicht auf seinem Platz, als hätte es ihn nie verlassen.
»Ach, was hast du mir nur für einen Streich gespielt?« Elia setzte ihr letztes Häkchen in das große grüne Buch und legte es zurück auf den Holztisch. Anschließend verließ sie das Atelier.
Doch bevor der Tag sich weiterdrehte und sie sich um den Garten hinter dem Chalet kümmern wollte, fasste sie eine folgenschwere Entscheidung. Sie beschloss, mit Rosinante nach Stampa zu reiten, um sich die Buchhandlung anzusehen, von der Laura erzählt hatte. »Ich werde dort wohl vorstellig werden müssen, um mit diesen Leuten ein ernstes Wörtchen zu reden«, sagte Elia zu sich selbst und blickte in das tiefe Tal vor sich, froh, dass die Gespenster an diesem Tag doch keine Löcher in die Welt gerissen hatten.
2
Die Herbstsonne zeigte sich endlich in ihrer ganzen Pracht über den Felsendornen der steinernen Bergketten, als Elia voller Zuversicht und Entschlossenheit ins Chalet zurückkehrte, um sich für den langen Ritt nach Stampa vorzubereiten. Gloria, die sich mittlerweile in ihr Zimmer zurückgezogen hatte und für die Fahrt zur Arbeit zurechtmachte, bemerkte nichts von Elias Vorhaben.
Aus einem großen, schweren Holzschrank in ihrem gedrungenen Schlafzimmer holte Elia ein Reitkleid, das sie mit einer Jacke und einem Hut kombinierte. Die Kleider waren allesamt weiß, abgetragen und stammten aus den sechziger Jahren. Die Kopfbedeckung bestand aus einem harten Körper und einem breiten Rand. Sie war aus Stroh geflochten und hatte eine tief sitzende Krone. Der Rand bot Schutz vor der Sonne und war mit einem Band verziert. Elia trug diesen Reithut mit einem kurzen Schirm aus Baumwolle. Reitstiefel, wie Gloria sie trug, wenn sie mit Rosinante ausritt, »damit der alte Gaul mehr sieht als die kümmerliche Scheune«, lehnte Elia energisch ab. Eine Frau hatte in der Öffentlichkeit elegant und feminin zu reiten. Eng anliegende Hosen, Kleider oder gar Stiefel verwirrten die Blicke der Männer. Und Elia wusste, dass ihr Mann – wenn er zurückkehrte – ihre Einstellung loben würde. Also zog sie normale Stiefeletten aus Leder vor, die sich mit ihren breiten und flachen Absätzen ebenso zum Reiten eigneten wie kniehohe Stiefel mit hohem Schaft.
Gut gerüstet und ohne dass Gloria es bemerkte, verließ Elia das Chalet und ging zum Stall, wo sie Rosinante mit müden Augen ansah.
Den Namen Rosinante hatte ihm Gloria gegeben, nach dem vermeintlichen Streitross von Don Quijote, der sich für den letzten fahrenden Ritter hielt. Sie war damals zwanzig Jahre alt gewesen und hatte eine alte Ausgabe von »Don Quijote« von Cervantes im alten Schuppen hinter dem Chalet gefunden. Die Geschichte des Ritters von der traurigen Gestalt, der auszog, um im Auftrag seiner Geliebten Dulcinea von Toboso in unzähligen Abenteuern für Recht und Ordnung zu sorgen, hatte Gloria gefallen.
Als Elia das Buch bei ihrer Tochter gefunden hatte, hatte sie es ihr wütend aus der Hand gerissen und ihr verboten, je wieder im alten Schuppen in der Vergangenheit zu graben. Als der damalige Hofgaul allerdings trächtig geworden war und ein Fohlen zur Welt gebracht hatte, hatte Gloria es Rosinante nennen dürfen. Warum Elia so unachtsam gewesen war, wusste sie bis heute nicht. Wie Bluthunde witterten die Gespenster auch nur die geringste Spur, um in unsere Welt zu gelangen, hatte Elia immer wieder gewarnt. Doch da Gloria im Laufe der Zeit immer weniger für Pferde übrighatte und ihre Sehnsucht nach Freiheit verblühte wie ihre ohnehin karge Schönheit, kam es, dass der Name Rosinante kaum noch auf dem Maiensäß erwähnt wurde. »Der Schindgaul« hieß es dann eher oder »der klapprige Klepper«.
Als Elia eine an vielen Stellen löchrige Karodecke über den Rücken des alten Pferdes warf und unter großer Kraftanstrengung einen Sattel hochhievte, trat Gloria in den zugigen Stall, in den jetzt auch die ersten Sonnenstrahlen durch kleine Löcher an den Wänden blitzten.
»Was machst du?«, fragte sie und musterte verwundert ihre offensichtlich verwirrte Mutter.
»Ich will nach dem Buchladen sehen, der angeblich in Stampa eröffnet hat. Wir haben eine Verantwortung für unser Land, mein Liebes. Ich werde nicht zulassen, dass die Gespenster von Stampa auch unser schönes Land fluten.«
Gloria knöpfte schweigend ihre ordentliche und funktionale braune Jacke mit müden Daunen zu, als könnte sie damit ihre Mutter von ihrem törichten Vorhaben abbringen. »Ruh dich doch ein wenig im Haus aus, Mutter! Da Laura heute zu Hause bleibt, kann sie dir etwas Schönes kochen, damit du die Aufregung von vorhin vergisst.«
Elia schüttelte den Kopf und kippte unter großem Keuchen den Sattel auf Rosinantes Rücken. »Wir dürfen nicht unachtsam sein, Kind. Die Gespenster warten doch nur darauf.«
»Wenn ich zurückkomme, können wir gemeinsam das Buch im Atelier suchen. Es ist sicherlich nur auf den Boden gefallen«, schlug Gloria vor.
»Das Buch ist wieder an seinem Platz«, sagte Elia.
Gloria rang sich ein Lächeln ab. »Na, dann ist ja alles in Ordnung.«
»Das ist es keineswegs, Kind. Sei nicht immer so leichtgläubig.«
Gloria seufzte, während Elia fortfuhr. »Es gibt mehrere Erklärungen für das, was passiert ist.«
»Gibt es die?«, fragte Gloria gelangweilt.
»Selbstverständlich. Mir ist natürlich klar, dass du nicht alle Möglichkeiten in Betracht gezogen hast.«
»Natürlich«, sagte Gloria in der Hoffnung, damit das Gespräch zu beenden. Sie durfte den Bus nicht verpassen, der in einer Stunde von Soglio nach Stampa fuhr.
»Möglichkeit eins«, begann Elia. »Laura hat das Buch entwendet. Sie ist in der Nacht über die Stufen nach unten geschlichen, hat den Schlüssel zum Atelier aus meiner Schürze genommen und das Buch aus der Reihe gezogen, in der Hoffnung, dass es mir nicht auffällt. Als ich ihr auf die Schliche kam, hat sie es wieder zurückgebracht.«