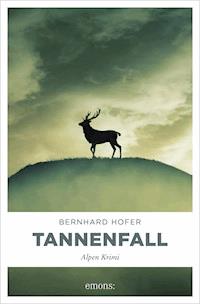14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein einzigartiger, visionärer Roman über das Wesen des Menschen und der Natur. Dorothea Almer, heute die mächtige Vorsitzende der Schwarzen Familie, war bereits als Kind sehr eigen. In ärmlichen Verhältnissen an der Amalfiküste aufgewachsen, flüchtete sie sich in andere Welten, wenn das Leben um sie herum es nötig machte. Doch sind die Halluzinationen, die sich so echt anfühlen, wirklich nur harmlose Phantasien? Mit dem Ziel, eine erfolgreiche Neurologin zu werden, begibt sie sich immer tiefer in das Gebiet der menschlichen Psyche und stößt dabei auf Wahrheiten, die ihr Leben für immer verändern. Schafft Dorothea es, das Meer zu unterwerfen und am Strand auf die zu warten, die von ihr gegangen sind? Oder steckt sie bereits zu tief in den verworrenen Zweigen der dunklen Familie?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Die Handlung und die handelnden Personen dieses Romans sind ebenso frei erfunden wie die Orte und Geschehnisse. Jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder Gemeinden und Regionen ist nicht beabsichtigt und wäre rein zufällig.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, unter Verwendung eines Motivs von daniel.schoenen/photocase.de
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-574-9
Roman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Es heißt, es gebe einen Spalt in der menschlichen Seele,
die nicht dafür angelegt wurde,
dem Leben vollends anzugehören.
Was die Leserinnen und Leser vor der Lektüre wissen sollten
Bevor Sie, geschätzte Leserinnen und Leser – Interessierte, Mitforschende? –, die nächste Seite aufschlagen, möchte ich Ihnen gern noch einmal den Kontext in Erinnerung rufen, da ich weder weiß, wie weit Sie schon eingetaucht sind in die Geschichte – die Materie, die Mysterien von Tannenfall –, noch, wie lange der letzte Abschnitt Ihrer bisherigen Reise zurückliegt. Und nur wer diesen Kontext kennt, zumindest in groben Zügen, wird all das verstehen, was die reinen Wörter begleitet. Die Welt hinter den bloßen Buchstaben bleibt sonst unsichtbar, regelrecht verschlossen.
Im Jahre 1914 bekommt der zurückgezogen lebende Bauer Franz Leidemann einen Einberufungsbefehl, um an der Front im Ersten Weltkrieg zu kämpfen. Er folgt seiner Pflicht und bricht zu Fuß von einem abgelegenen Dorf in der Nähe des Semmerings Richtung Graz auf. Doch der unbeholfene Bauer kommt vom Weg ab und verirrt sich in den steirischen Wäldern. Als er in einer Lichtung eine blaue Blume findet, verändert ihr Duft seinen Geist. Kurz darauf folgt er einem mysteriösen weißen Hirsch und betritt im Wahn eine Welt voller unheimlicher Wesen wie der Königin des sagenumwobenen Nachtvolkes.
In einem Tagebuch hält der völlig verängstigte Bauer seinen Schrecken fest.
Wochen später wird Franz Leidemann in den Wäldern von einem Suchtrupp gefunden und als Deserteur erschossen. Man wirft ihm vor, dass er sich in den Wäldern vor seiner Pflicht verstecken wollte. Nur der K.u.k.-Leutnant Marius Khalberg glaubt an Leidemanns Unschuld und nimmt nach dessen Tod sein Tagebuch an sich.
Nach dem verlorenen Krieg bezieht Marius Khalberg 1919 auf dem Semmering eine alte Villa. Der Nachkomme eines großen, einflussreichen Adelsgeschlechts, der sogenannten Schwarzen Familie, will sich von den neu aufkeimenden Allmachtsphantasien seiner Familie distanzieren, da er fürchtet, sie könnte die Welt erneut in einen Abgrund stürzen. In der gewählten Abgeschiedenheit widmet sich Marius Khalberg dem Tagebuch des Franz Leidemann, das er ihm nach dessen Tod entrissen hatte. Die Geschichten rund um die blaue Blume, den verschlungenen Weg in ein vermeintliches Paradies und um geheimnisvolle weiße Hirsche, die an einer unsichtbaren Grenze zu einer anderen Welt zu wachen scheinen, ziehen ihn immer mehr in den Bann.
Jahre später ist auch Konrad, der heißblütige Sohn von Marius Khalberg, besessen von der Idee, in den Wäldern des Semmerings den Zugang zu einer anderen Welt zu finden. Eine Besessenheit, die ebenfalls auf seine Frau überspringt. Die »Teufelin«, wie Konrad Khalbergs Frau in den umliegenden Dörfern genannt wird, ist überzeugt, dass die Schwarze Familie, deren Teil sie nach der Ehe mit Konrad nun ist, durch einen Zugang zu der anderen Welt und eine mögliche Allianz mit dem Nachtvolk wiedererstarken könnte.
Als die Teufelin beginnt, ihre eigenen Kinder mittels Kräuterexperimenten unter Drogen zu stellen, um mit Hilfe der kindlichen Phantasie einen Weg in die andere Welt zu finden und Kontakt zu der Königin des Nachtvolkes aufzunehmen, geht dies Konrad Khalberg zu weit.
Er wendet sich an den befreundeten Arzt Dr.Merten und lässt die vier kleinen Mädchen aus Tannenfall, wie die Teufelin die Wälder um den Semmering nennt, entführen, um sie vor der Besessenheit seiner eigenen Frau zu retten. Dr.Merten bringt die vier Mädchen schließlich an vier unterschiedliche Orte, wo sie getrennt voneinander aufwachsen, verbunden durch eine gemeinsame, ihnen unbekannte Kindheit.
Vier Mädchen, die getrennt voneinander aufwachsen, weil sie gemeinsam das vielleicht größte Geheimnis der Welt in sich tragen: das Geheimnis vom Übergang in eine andere Welt. Vier Mädchen, die mittlerweile zu vier Frauen herangewachsen sind. Marlene Castor, Greta Erdsegen, Dorothea Almer und Leonora Khalberg. Vier Frauen, vier Bücher, vier Sichtweisen. Vier fest miteinander verknüpfte Geschichten, die jeweils einen anderen Blick in die Welt von Tannenfall liefern.
Auch wenn ich – meinen eigenen »Begegnungen« folgend – einer bestimmten Route folgte, können alle Interessierten selbst entscheiden, mit welcher Geschichte sie in diese Welt eintauchen wollen. Denn wie bei einem Kreis führt jede Geschichte, jeder Übertritt – egal von welcher Seite er unternommen wird – unweigerlich zum Mittelpunkt, zum Herzen von Tannenfall, zur Wahrheit hinter dem geheimnisvollen Tagebuch von Franz Leidemann.
So kämpft die in Potsdam lebende Staatsanwältin Marlene Castor scheinbar vergeblich gegen die kriminellen Machenschaften einer übermächtigen Organisation, der Schwarzen Familie. Marlene Castor hat ihren Glauben an die Welt verloren und versinkt immer tiefer im Morast eines Burn-outs. Als sie sich deshalb mit ihrer Tochter Lya in den Wäldern des Semmerings erholen will, verschwindet diese. Und Marlene glaubt zu wissen, wo sie zu finden sein wird – eben an dem geheimnisvollen Ort, der auf keiner Landkarte zu finden ist, in Tannenfall.
»Der erste Schnee« erzählt von dieser Suche. Dabei strauchelt Marlene – und mit ihr der Chronist und wohl auch die Leser – immer wieder auf ihrer Suche nach Halt und findet ihn doch erst, wenn sie die Suche nach Orientierung aufgibt. Gemeinsam mit allen, die sie begleiten, stolpert sie durch das Spiegelkabinett einer phantasierten Reise. Alles versinkt in Marlenes Wahn, doch ist dieser Wahn der einzige Weg, um dort anzukommen, wo die andere Welt beginnt, hinter den augenscheinlichen – augenwischenden? – Regeln der vermeintlichen Realität, hinter dem Gewohnten.
Die an Epilepsie leidende Greta Erdsegen wiederum lebt, wie in »Das andere Licht« nachzulesen ist, in einer Nervenheilanstalt in der Nähe von Dresden und macht sich ebenfalls auf die Suche nach der anderen Welt. Dabei mahnt sie vor der großen Krankheit, die sie am Horizont zusammenziehen sieht. Greta sieht darin die Machenschaften der Schwarzen Familie, die mit der Krankheit die »Neue Ordnung« einleiten will. Greta geht nach Tannenfall, um das Heilmittel zu finden, wo sie auf ihre anderen Schwestern trifft.
Im Folgenden nun erzählt Dorothea Almer höchstpersönlich ihre Geschichte. Und die beginnt mit dem kleinen Mädchen, das bald nur noch ein Ziel vor Augen hat: das Meer zu unterwerfen …
Alle diejenigen, die wissen wollen, wie es Leonora Khalberg, der vierten Schwester, ergangen ist, müssen sich möglicherweise noch etwas gedulden. Mag sein, dass ihre Geschichte noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.
PROLOG. DIE VERSCHWUNDENE WELT.
Wie tollkühne Abenteurer drangen wir in die Welt ein, die die Erwachsenen vor uns geheim gehalten hatten. Wir tauchten hinab in die Tiefen der blauen Wälder unter Wasser, die sich auftaten, wenn wir ein wenig weiter hinausschwammen, als uns unsere Eltern erlaubt hatten. Wir folgten dem schmalen Steig, der in ein enges Tal führte, wo die Gespenster wohnten, die sich in der Nacht aus ihren Hütten unter der Erde schlichen, um Kinder zu jagen. Die aber vor uns flohen, wenn wir laut schreiend mit einem abgebrochenen Ast auf den rostigen Stahldeckel eines Küchentopfes schlugen, um uns unsere Angst nicht anmerken zu lassen. Wir stiegen auf den weißen Turm über der hohen Klippe und lehnten uns ganz weit vor, breiteten dann die Arme aus und flogen mit dem Wind davon, weit weg in andere Länder, in denen noch nie jemand gewesen war.
Unsere Welt des Staunens war eine Welt der Phantasie, in der sich jeder kleine Stein in ein Gebirge verwandeln konnte, auf dessen hohem Gipfel immer der wilde Sturm wütete. Eine Welt, glitzernd, funkelnd und geheimnisvoll, in der alle Blumen Schmetterlinge waren, die mit ihren bunten leuchtenden Flügeln die Luft so sehr aufwirbelten, dass sie surrte und wir darin schweben konnten. Niemand konnte in unsere Welt eindringen, denn sie gehörte uns. Weder die Touristen mit ihren lauten, stinkenden Autos oder die Jungs mit den schrill heulenden Motorrollern noch unsere Eltern mit ihren geschundenen Händen, ihren krummen alten Beinen und ihren müden Augen.
Und manchmal, wenn die Farben aus unserer Welt verschwanden und unsere Augen traurig und unsere Mägen hungrig waren, drangen wir in fremde Gärten ein, wo wir große feuchte Handtücher heimlich von den Wäscheleinen zogen. Wir banden sie um unsere Hälse und verwandelten uns in Superhelden und flogen hoch bis zu den Sternen. Von dort sahen wir in die Zukunft und suchten die Farben unserer Welt und flogen dann weiter, mit weit ausgebreiteten Armen, die zu Flügeln wurden, weiter bis über den Strand unseres Heimatdorfes, wo unsere Eltern besorgt unsere Namen riefen.
Wir waren glücklich. Aus unseren Mündern quoll lautes Lachen, unsere Knie waren aufgeschlagen und unsere Locken wild und verknotet. Und manchmal steckte in unseren Haaren eine kleine blaue Blume, die sich beim Spielen darin verfangen hatte. Wir waren sicher, dass sie der warme Wind aus einem anderen Land hinter dem Meer zu uns getragen hatte. Wir zogen sie dann behutsam aus den Nestern in unserem Haar und betrachteten sie mit großen leuchtenden Augen. Sie glitzerte in unseren kleinen schmutzigen Händen, als hätten Feen ein blaues Licht in dieser zarten Blume versteckt, die wir stolz unseren Eltern unten am Strand entgegenstreckten, wenn wir schuldbewusst unsere Blicke senkten und leise »Es tut uns leid« flüsterten.
Dieses Buch widme ich der verschwundenen Welt meiner Kindheit, dieses Buch ist für Giacobbe, meinen besten und einzigen Freund. Doch jetzt, da ich erwachsen bin, ist dieses Buch auch für ihn, meinen Vater, auf den ich bis heute auf dem Strand von Dante warte, in meiner Hand eine blaue Blume. Als ich am Ende des Meeres die schmalen, dünnen Rauchfäden sah, die sich in der Ferne bis zum Himmel erstreckten, war ich sicher, dass er zurückkommen würde, mit seinem Fischerboot, zurück zu mir, seinem kleinen Mädchen. Und er würde mich in den Arm nehmen und mir die Wahrheit ins Ohr flüstern. Die Wahrheit über die Gespenster.
DANTE
GESPENSTER. 1976.
»Tea? Es ist Zeit, aufzustehen.« Ich tauchte aus der dunklen Höhle meines Schlafes und öffnete meine Augen. Vater versuchte zu lächeln und strich mit dem Daumen über meine Wange. Er war schon angezogen und trug sein blaues Hemd, das er immer anhatte, wenn er aufs Meer hinausfuhr. Es roch nach Fisch und Zitronen. Unten klapperte Mutter mit einer Pfanne und rückte Stühle zurecht. Von früh bis spät war sie mit dem Haushalt beschäftigt.
»Kommt sie?«, hörte ich ihre scharfe Stimme.
»Aber dunkel es ist noch draußen«, sagte ich und sah zum Fenster, in dem das Meer unruhig rauschte.
»Aber es ist noch dunkel draußen«, korrigierte mich Vater und blickte ebenfalls zum Fenster. »Wenn wir am Meer sind, wird die Sonne bald aufgehen«, sagte er. »Aber jetzt komm, Mutter wartet.«
»Komm ich«, murmelte ich und zog meine warme Decke über das Gesicht. Vater schwieg, und ich nahm einen tiefen letzten Atemzug der Nacht, schob die Decke nach unten und stieg aus dem Bett. »Ich weiß, es heißt, ich komme«, sagte ich und lächelte in sein offenes vertrautes Gesicht, während von unten das Radio »Vivere ancora« spielte. Mein Italienisch war nicht so gut wie das im Radio oder das meiner Eltern. Aber dank meines Vaters wurde es jeden Tag besser.
Es war immer noch dunkel, als ich mit dem letzten Stück Brot das Olivenöl von meinem Teller wischte und es in meinen Mund steckte. Ich hielt den Kopf gesenkt, um meiner Mutter nicht in die Augen zu sehen, da ich das Gefühl hatte, es ihr nicht recht machen zu können.
»Es ist stürmisch draußen«, sagte mein Vater, drehte den Kopf übertrieben zur Seite und suchte im Dunkel hinter dem Fenster den tosenden Klang der hohen Wellen des Meeres.
»Sie soll nur mitkommen«, sagte Mutter und sah uns mit giftigen Blicken abwechselnd an. »Sie soll sich nützlich machen und arbeiten. Sonst ist sie wieder oben in Scala und denkt sich neuen Unsinn aus.«
Vater schob den Stuhl nach hinten und zog die Fischerjacke über, die hinter ihm hing. Sie roch nach Öl und Fisch. Ohne ein Wort zu sagen, hob er meine Jacke, eine dunkelblaue gewalkte Jacke mit silbernen Knöpfen, vom Haken und reichte sie mir über den Tisch.
»Mutter hat recht. Wenn wir dich aus den Augen lassen, bist du wieder weg, und sie macht sich Sorgen. Sie hat schon genug zu tun.«
Ich starrte auf meinen leeren Frühstücksteller und hörte das gepresste Schnaufen meiner Mutter, das sie immer von sich gab, wenn sie meinen Vater von ihrer Meinung überzeugt hatte. Früher hatte ich ihr oft widersprochen, aber es endete meist im Streit meiner Eltern. So wie mein Italienisch mit jedem Tag besser wurde, wurde ich auch immer besser im Umgang mit meinen Eltern und fand am Ende immer einen Moment, um auszubüxen. Dabei wollte ich weder Mutter noch Vater damit verletzen, noch wollte ich, dass sie sich Sorgen machten. Aber es gab hier so viel zu entdecken, was ich noch nicht gesehen hatte. Und bevor ich nach dem Sommer in die Schule ging, wollte ich mehr erleben, als meiner Mutter im Haushalt zu helfen oder durch die engen weißen Gassen von Dante hinunter zum Meer zu laufen und im Boot darauf zu warten, dass mein Vater es geduldig ins Wasser zog.
Mein Vater hatte recht: Der Morgen war stürmischer als sonst. Ich stellte den Kragen meiner Jacke auf und zog den Kopf dicht an meine Schulter. Ich folgte meinem Vater durch die engen, verwinkelten und schmutzigen Gassen. Mittlerweile kannte ich den Weg durch das Labyrinth zum Strand, und doch machte mir der Gedanke Angst, dass mein Vater hinter einer Ecke plötzlich verschwinden könnte! Irgendwo fauchte eine Katze, und eine Frau beklagte sich lautstark über die Trunkenheit ihres Mannes. Das Rauschen des Meeres kam immer näher und mit ihm der salzige Geruch.
Zwölfmal bogen wir um eine enge Ecke, bis wir den Vorhang der Nacht erreichten, hinter dem das dunkle unruhige Meer auf uns wartete. Erste Möwen riefen uns, und meine Beine versanken tiefer im weichen Boden des Strandes. Ich wartete, bis Vater auf das Boot stieg und seine Ausrüstung darin zurechtrückte. Ich beobachtete ihn, wie er auf das Meer sah und die Lichter musterte, die am Horizont tanzten. Sicher dachte er daran, dass er seine Fertigkeiten und Gewohnheiten, was den Fischfang betraf, den anderen Fischern anpassen musste. Ich spürte das Unbehagen, das ihn plagte, und die Angst, eines Tages ohne Fang nach Hause zurückzukehren.
Ich ertrug seinen Kummer nicht und wandte mich von ihm ab, bis er mich mit seiner ausgestreckten Hand auf das Boot zog. Atrani, wie mein Dorf hieß, hatte einen kleinen Strand und war umsäumt von einem Halbkreis aus übereinandergebauten Häusern, zwischen denen wie kleine Höhlen die Ausgänge aus den vielen engen Gassen liefen. An die hohe Häuserfront, die wie ein großer Staudamm wirkte, schmiegte sich ein mächtiger Bau, der einem Viadukt ähnelte und auf dem eine Straße entlangführte. Steil aufsteigende Felsen umschlossen Atrani, als beschützten sie das Labyrinth in ihrem Inneren, dort, wo irgendwo unser Haus stand, in Dante, dem ärmsten und kleinsten Viertel von Atrani.
Vater hatte einmal gesagt, dass es so klein und unbedeutend sei, dass es in den Prospekten, die die vielen Urlauber in ihren fremden Ländern lasen, gar nicht erwähnt wurde. Vater hatte uns einmal einen dieser Prospekte mitgenommen, und wir hatten ihn mit großen Augen über den Tisch ausgebreitet. Meine Mutter, die mit dem Lesen Schwierigkeiten hatte, hatte Vater angeherrscht, ihr vorzulesen, was unter den großen bunten Bildern unserer Heimat stand. Und obwohl sie die vielen Fremden, die seit Jahren kamen, um das Meer zu sehen, mit großem Argwohn betrachtete, war sie enttäuscht gewesen, dass nicht nur Dante im Prospekt völlig fehlte, sondern auch Atrani unerwähnt blieb.
Nur unser Nachbardorf, das hinter einem großen Berg ebenfalls in einer Felsfalte lag, hatte Eingang gefunden in die Werbung, die die ganze Welt zu uns einlud. Amalfi. Das Dorf, das unserer ganzen Küste ihren Namen gab. Die Amalfiküste. Ich war froh, dass die Touristen uns nicht besuchen kamen, dass sie nur mit ihren gelben und hellblauen Autos über das Viadukt donnerten. So hatte ich die geheimen Orte, die ich entdeckt hatte, für mich allein. Und so wusste die Welt weder von Dante noch von der Bedeutung des Eselspfades, des Nussbaumwaldes oder der Via Paradiso, die zum Tal der verlassenen Mühlen führte. Sie wusste auch nicht von Scala, diesem wunderbaren Ort dort oben über den Bergen, wo Atrani und Amalfi zu meinen Füßen lagen und das Meer mit weiten Armen auf mich wartete.
»Du willst nicht mitkommen, habe ich recht?«, fragte mein Vater mit warmer, aber durch den Seewind rau gewordener Stimme.
Ich nickte. Anscheinend hatte er meine Gedanken gelesen und gesehen, wie ich im Dunkel meinen Hals nach oben streckte.
»Aber wir müssen gemeinsam nach Hause kommen. Das ist unser Geheimnis. Mutter darf das nie erfahren.«
Ich nickte, und der Wind, der über dem Meer auffrischte, bewegte meine beiden Zöpfe unter der hellblauen Mütze.
»Und du musst mir versprechen aufzupassen. Als du damals vom Felsen gestürzt bist, sind deine Mutter und ich vor Angst um dich gestorben.«
»Dir verspreche ich.«
Mein Vater lächelte. Er verzichtete darauf, meine Grammatik zu korrigieren, denn er wusste, dass ich ihn verstanden hatte. Ich konnte mich nicht mehr genau daran erinnern, wie es zu dem Unfall damals gekommen war, aber mein Vater hatte mir erzählt, dass ich heftig mit dem Kopf aufgeschlagen war und seitdem Schwierigkeiten hatte, so gut Italienisch zu sprechen wie die anderen Kinder. Und auch wenn ihn die Sorge umbrachte, dass ich eines Tages vielleicht wieder abrutschen und in die Tiefe stürzen würde, wollte er mich nicht einsperren und mir – anders als Mutter – den Freiraum geben, den ich brauchte. Das war unser Geheimnis.
»Aber du gehst nicht zu den Mühlen, versprochen? Und du winkst mir zu, wenn du oben bist, ja? Und dort bleibst du auch so lange, bis ich wieder hier bin. Ich warte dann auf dich am Strand.«
Ich umarmte meinen Vater.
»Ich habe dich lieb«, sagte ich, drehte mich um und lief zurück ins Labyrinth, wo die ersten Schatten durch die aufgehende Sonne immer deutlicher wurden.
»Und diesmal keine Geschichten von Blumen, die sich in Schmetterlinge verwandeln, verstanden?«, rief er mir hinterher und stieg in sein Boot. Bevor ich wieder in das Labyrinth tauchte, drehte ich mich noch einmal zu ihm um und sah, wie er in seiner nassen Fischerjacke und seiner unbeholfenen Art ins Boot stieg. Ich wusste, er hatte in Wahrheit Angst, dass der Sturm stärker und das Meer umschlagen und es mit einem Mal gefährlicher würde, als wenn er mir erlaubte, hochzusteigen nach Scala, wo ich sicher war vor den dunklen Wäldern auf dem Meeresgrund. Ich hatte Angst vor dem Meer. Es war unberechenbar und wild. Niemand konnte es kontrollieren. Oben in Scala war ich sicher. Und wenn die Gespenster im Tal der Mühlen hinter dem Nussbaumwald mich angreifen würden, würde Giacobbe mich beschützen. Vater musste sich also keine Sorgen machen. Ich war in Sicherheit. Wenigstens vorerst.
Die Gespenster hatten uns umzingelt. Giacobbe hockte einen Steinwurf von mir entfernt hinter der zerfallenen, mit Efeu bewachsenen Steinmauer einer alten Schmiede. Sie war Teil einer in Ruinen liegenden ehemaligen Papierfabrik mit ihren einst großen Mühlen, die tief in die Wälder hineinreichten. Papa hatte gesagt, dass hier früher ein bedeutender Industriestandort gewesen war. Ich wusste nicht, was das bedeutete. Ich sah nur, dass die Natur die antiken Gebäude wieder zurückerobert hatte. Bäume und wild wuchernde Vegetation hatten die Mauern der einst weitläufigen Anlage umringt wie die Gespenster uns.
Auf der roten gewalkten Jacke von Giacobbe lagen die ersten Schatten der Morgensonne. Giacobbe war ein Jahr älter als ich und ging schon zur Schule. Ich war seine einzige Freundin. Für seine Mitschüler war sein sanfter Blick Ausdruck übertriebener Sensibilität und Schüchternheit. Zudem hatte er abstehende Ohren, die, wenn die Sonne hinter ihm stand, rot leuchteten. Ich fand in ihm einen idealen Freund, da er die Welt, die ich mit meinen Kinderaugen betrachtete, durch denselben Filter sah wie ich, den Filter der immaginazione, der Phantasie. Sooft ich konnte, lief ich von Dante hoch zu ihm, um in den verwunschenen Wäldern der alten Mühlen die Gespenster zu jagen, bevor die Sonne höherstieg, Giacobbe in die Schule musste und ich die Stimme meiner Mutter hörte, die besorgt meinen Namen rief und mich an den Ohren zurück nach Dante zog, bis auch sie rot waren.
Giacobbe hielt den Atem an und blickte auf die nahen Gipfel der Milchberge, die hinter den Wäldern im warmen Sonnenlicht durchschimmerten.
»Siehst du sie?«, fragte ich leise. Doch Giacobbe rührte sich nicht. Der leise murmelnde Wildbach, der aus dem Wald floss, schnappte mit seinem hellblauen Dunst in der feuchten Meeresluft nach meinen Worten. Ich hielt den Atem an. Ich war eine Atemkünstlerin. Wie Giacobbe. Wenn wir unsere Atemzüge reduzierten, dann konnten sie uns nicht finden, die Gespenster. Weil sie uns nicht hören konnten. Ich zog den Kopf ein und senkte meinen Blick.
Morgentau perlte von den Feldblumen, die vor mir aus der warmen Erde wuchsen. Sie vermischten sich weiter hinten mit wilden Orchideen und kleinen fleischfressenden Pflanzen und mit den Wurzeln wilden Farns. Als mein Blick den bunten Blumen folgte, hörte ich die Gespenster wieder. Sie gaben unheimliche schnalzende Laute von sich, als suchten sie uns damit. Papa hatte mir einmal erzählt, dass Fledermäuse lautlos schrien, damit sie sich orientieren konnten. Auch wenn ich eine Fledermaus noch nie schreien gespürt hatte, glaubte ich, dass sich die Gespenster mit ihrem Schnalzen ebenfalls orientierten.
Giacobbe meinte, dass uns die Gespenster nur mit diesen gruseligen Geräuschen entdecken konnten. Einmal, so hatte er mir erzählt, habe er vor einem großen Gespenst gestanden. Es war fast doppelt so groß wie er gewesen, und der Nebel, der es umgeben hatte wie eine bodenlange staubige Kutte, hatte nach einem feuchten, modrigen Keller gerochen. Giacobbe hatte sich nicht bewegt und den Atem angehalten. Kurz darauf war das Gespenst weitergezogen mit schnalzenden Lauten. »Sie sind blind. Sie können uns nur hören. Wenn wir leise sind, können wir eines Tages eines fangen.«
Erneut hielt ich die Luft in meinen Lungen und sah zu Giacobbe, der sich keinen Millimeter rührte. In der Ferne hörte ich das Rauschen von Wasserfällen, die über verschlungene Wege voller Schmetterlinge von versteckten Felsen fielen. Von den Zitronenhainen hinter den Wäldern frischte ein sanfter Wind auf und brachte den Geruch von Wildkräutern zu unserem Versteck. Als ich vorsichtig begann, wieder einzuatmen, roch es nach Thymian, wilder Pistazie und Rosmarin. Und plötzlich bewegte sich Giacobbe und starrte mit weit aufgerissenen Augen zu mir.
»Sie kommen.«
Ich erschrak, als ein kleiner schwarzer Vogel über die großen leuchtend gelben Zitronenbäume flog, die den Wald von außen umgaben. Sie füllten die Luft mit dem Duft ihrer Blüten und Früchte, die der kleine schwarze Vogel mit seinen wilden Flügelschlägen zu uns brachte wie den feinen Rauch einer Duftkerze. Aufgeregt flatterte er über unsere Köpfe hinweg. Er glitt über unser Versteck und verschwand im grünen Himmel der Baumdecke. Doch kurz darauf tauchte er wieder aus dem Blätterdach und landete auf einem großen Baum. Dieser trug wie eine große hölzerne Säule das riesige Blättergewölbe, das sich über die Ruinen spannte. Wie ein Verbündeter der Gespenster drehte der kleine schwarze Vogel den Kopf in alle Richtungen, als würde er in den verfallenen Gebäuden die Verstecke all der anderen Kinder suchen, die in unserer Phantasie gemeinsam mit Giacobbe und mir hier ihre Köpfe geduckt und die Lungen verschlossen hielten.
»Er ist am Beobachtungsturm und sucht uns«, sagte ich leise. Giacobbe legte sich den Zeigefinder auf den Mund und zeigte mir mit der flachen Hand, dass ich auf meinen Atem achten sollte. Er war angespannt, und seine Ohren leuchteten rot.
Ich nickte und sah – ohne den kleinen schwarzen Wächter auf dem Turm aus den Augen zu lassen – hoch zu den Monti Lattari, den Milchbergen. Sie stürzten beinahe senkrecht in das helle Blau des Meeres. Äcker, die nicht größer waren als die raue Decke meines Bettes, klammerten sich an die Felsen. Dort oben auf den Gipfeln leben sie, die ricchi, die Reichen. Auf steilen Pfaden wandelten sie über die Höhen und beobachten das Treiben ihrer Gespenster, auf der Suche nach uns Kindern, den poveri, den Armen. Ich war noch nie in meinem Leben auf einem der Berge der Monti Lattari gewesen, aber Giacobbe hatte mir erzählt, dass dahinter der Weg der Götter verlief, der zum Palazzo der ricchi führte. Einem großen, mächtigen, unheimlichen Hof. Dort würden alle Kinder hingebracht, wenn sie von den Gespenstern in den Wäldern entdeckt worden waren. Wer einmal dort war, kam nie wieder, hatte mir Giacobbe erzählt.
»Von dort oben kann man Pompei sehen, eine alte Stadt, die vom Vesuv lange vor unserer Zeit im Feuerregen versunken ist.« Und dahinter würde man sogar bis nach Neapel sehen, hatte er mir erzählt, oder – wenn man die Augen zusammenkniff – die beiden Inseln, Capri und Ischia.
In unserer Phantasie hatten es sich Giacobbe und ich zur Aufgabe gemacht, die Kinder auf den Bergen zu befreien. Wir wussten wenig über die ricchi. Aber wir reimten uns Dinge zusammen. Dinge, die wir aufschnappten. Dinge, die ich in den Gassen von Dante hörte und am Strand von Atrani und Giacobbe in der Schule in Scala. Es hieß, dass dort oben eine böse Familie wohnte, die die gefangenen Kinder quälte, um ihnen ihre Gedanken zu stehlen. Und wenn der letzte Gedanke des letzten Kindes verschwunden war, wollten sie die ganze Welt verdunkeln – so, wie es einst die Asche des Vesuvs mit Pompei getan hatte.
Wir wussten, dass wir beide nichts gegen diese famiglia ausrichten konnten. Also suchten wir Verstärkung und fanden sie in unserer Phantasie.
»Wir müssen uns vereinen und sie vom Thron stützen«, sagte ich und schob mein Kinn mutig nach vorne.
»Sie sind reich und mächtig. Wir sind arm. Alles, was uns bleibt, ist die Luft, die sie uns gelassen haben.«
»Wir müssen kämpfen. Giacobbe, wir müssen zum Turm und Verstärkung holen. Von den Reitern des Windes, von den Hexen im Schnee, von den Frauen in der Erde …«
»Tea, wir dürfen nicht zum Turm. Dort ist die Grenze. In die andere Welt.«
»Wir müssen uns alle zusammentun und gegen die famiglia in den Bergen kämpfen, bevor sie die Welt in den Abgrund stürzt. Die Welt braucht uns.«
»Auch wenn wir es schaffen, dass wir alle an einem Strang ziehen: Wir sind schwach. Wir haben keine Armee …«
Ich sah an Giacobbes besorgten Blicken, dass er wusste, woran ich dachte.
»Das ist gefährlich, Tea. Die Königin wird uns nie unterstützen. Sie hält sich an den Frieden, den sie mit den Menschen auf den Bergen geschlossen hat.«
»Es ist unsere einzige Chance. Sie hat das größte Heer. Ohne ihre Hilfe wird es uns nicht gelingen. Wir …«
Meine Stimme erstarb. Ich hatte etwas gesehen. Schatten aus den Wäldern. Der Vogel am Turm erhob sich und flog in die Sonne, zu den Bergen. Ich zog den Hals ein. Die Gespenster. Sie hatten uns entdeckt. Sie kamen vom Eselspfad. Ein schmaler Weg, der über Wildbäche aus dem Wald führte. Es waren andere als die Nebelgestalten mit den Schnalzlauten. Ich konnte ihre Gesichter nicht erkennen. Aber sie schimmerten in hellem Blau und mattem Gelb. Es waren fünf. Sie waren auf der Suche nach uns. Manche trugen so etwas wie Hemden, braun-orange gestreift. Andere Kleider, kariert. In Rot und Weiß. Manche hatten Sonnenbrillen mit dicken Rändern und Rucksäcke, andere machten Fotos, auf denen sie uns später in ihren Laboren suchten.
Ich sprang auf und verließ mein Versteck.
»Wo läufst du hin?«, rief mir Giacobbe nach.
»Wir müssen weg, bevor sie uns schnappen«, sagte ich und lief, so schnell ich konnte, weg von den Urlaubern, die von uns nur noch ein Knacken und Wispern hörten. Als Giacobbe die Eindringlinge sah, nahm auch er einen tiefen Atemzug und folgte mir durch das schattige Grün nach draußen.
Wir liefen durch den Nussbaumwald und waren außer Atem, als wir den Treppenpfad erreichten. Er wand sich hinauf und hinunter und führte uns entlang kleiner Häuser an der Küste. Wir konnten Amalfi sehen und Atrani. Sie lagen geduldig unten in ihren Mulden. Historische Wachtürme säumten die Küste, und bald erreichten wir Pontone, einen abgelegenen Ortsteil des Bergdorfes Scala, wo uns weiß getünchte Häuser und fröhliche Stimmen empfingen. Wir zogen die Köpfe ein, und obwohl wir kaum Luft bekamen, achteten wir auf unseren Atem, damit er uns nicht verriet. Kaum hatten wir Pontone hinter uns gelassen, zeigte sich der Torre dello Ziro. Beindruckend hatte er früher als Wachturm den Piratenüberfällen getrotzt. Jetzt war der hohe weiße Turm der Burg Scalella ein Aussichtsturm, der hoch über Amalfi und Atrani wachte.
Für uns war der Torre dello Ziro Teil einer großen Grenze, die von weißen Türmen bewacht wurde. Wir liefen, so schnell wir konnten, nach oben. Vor uns tat sich das Meer auf, und wir sahen das ewige Blau, das sich schon vor Jahrtausenden über der Amalfiküste niedergelassen hatte. Außer Atem lehnte ich mich an die Zinnen des Turmes und streckte mein unsichtbares Schwert in die Luft vor mir. Hinter mir folgten Giacobbe und die vielen Kinder, die sich in meinem Spiel mit mir und meinem Freund vor den Menschen in den Bergen versteckt gehalten hatten.
»Wir, die Völker der poveri, der Schneehexen, der Windreiter, der Erdfrauen, haben uns vereint! Große Königin, erhebe dich aus dem ewigen Blau und steh uns zur Seite mit deinem großen Heer. Lasst uns gemeinsam die Gipfel erstürmen! Vereinen wir uns, und gegen die bösen Reichen wir kämpfen!«
Meine Augen glänzten und zitterten, wie meine Stimme. In meiner Phantasie sah ich am Horizont die ersten Rauchsäulen der großen Armee der Königin. Sie erstreckten sich vom Ende des Meeres, wo die Fischerboote in der Vormittagssonne blitzten, wie dünne schwarze Seidenfäden bis in den dunstigen Himmel.
»Kämpfen wir gegen die bösen Reichen«, korrigierte mich Giacobbe, als er meinen Vater sah, der mit bleichem Gesicht unten vor dem Turm stand und mich mit nassen Augen ansah.
»Tea … es ist etwas Schreckliches geschehen!«, rief er. Und mit einem Mal verschwand all die Phantasie, die vor meinen Augen getanzt hatte. Die stolzen Reiter, die aus den Wolken gedrungen waren, die Schneehexen mit ihren glitzernden Kleidern, die sich aus weiter Ferne zu mir aufgemacht hatten, und die Erdfrauen, die sich aus ihren Mulden erhoben hatten, fielen wie Laub zu Boden und verschwanden.
Es ist etwas Schreckliches geschehen. Ich starrte auf die schwarzen Fäden am Horizont, wo das große Heer der Königin uns helfen sollte. Auch sie waren verschwunden. Meine Welt war verschwunden, und ich war wieder allein mit meiner Angst vor dem Leben in Dante.
»Was ist passiert, Papa?«, rief ich vom Turm nach unten.
»Deine Mutter … Es gab einen Unfall.«
DER TOD DER WUNDER. 1976.
Seine Stimme war ertrunken, als würde er unter Wasser sprechen. Ich wusste nicht, was mir mehr Angst machte: das, was ich bald erfahren würde, oder der große Schmerz, in dem mein Vater vor meinen Augen versank.
Ohne ein Wort zu sagen, folgte ich Papa über die Treppenwege nach unten. Ich hatte Mühe, ihm zu folgen. Kaum hatten wir das Labyrinth von Dante erreicht, hörte ich Stimmen. Schreie. Vorwürfe. Weinen. Scheppern von Töpfen. Der Geruch von Benzin und Öl. Papa lief immer schneller, und ich folgte ihm durch die engen Gassen wie ein Schatten, als wir endlich die Piazza Umberto erreichten.
Der Motorroller lag mit verbogenem Lenker in der Mitte der Piazza. Er schien mit voller Wucht gegen den Brunnen gekracht zu sein. Zwei junge Burschen mit hellblauen Hemden und um die Schultern geworfenen weißen Pullovern redeten aufgeregt mit einem Polizisten. Ich konnte sie nicht verstehen, da das Geschrei auf dem Platz zu laut war. Ich sah nur ihre wild gestikulierenden Hände und das betroffene Gesicht des Polizisten. Vor dem kleinen Laden, der zwischen zwei Restaurants Haushaltsgegenstände und persönliche Dinge verkaufte, hatte sich eine Traube von Menschen gebildet. Ich kannte sie alle. Sie alle lebten in Atrani, manche im Labyrinth, und sogar der Pfarrer der Chiesa Maria Maddalena hatte sich in die Traube gemischt und bekreuzigte sich ständig. Mit einem Mal bildete sich um mein Herz eine Mauer, und ich begann langsam zu begreifen.
Immer wenn wir vom Fischen zurückgekommen waren, war Mutter in den Laden gegangen. Sie kannte Gabriella, die Besitzerin, eine stolze Frau Mitte fünfzig mit schöner Haut. Sie waren wohl befreundet, obwohl sie so unterschiedlich waren. Mutter war grob, hatte große raue Hände und sehr breite Hüften. Gabriella war groß gewachsen, feingliedrig und trug sogar Schmuck um den Hals. Mutter hatte sich immer vorgenommen, zumindest einmal im Monat etwas bei ihrer Freundin zu kaufen, aber meist reichte dafür das Geld nicht. Sie kannten einander von der Schule, hatte Mutter einmal erzählt. Deshalb ging sie vermutlich jeden Tag zu ihr und trank einen Cappuccino, den Gabriella vom Laden nebenan holte, immer mit denselben Worten. Dass am nächsten Tag sie an der Reihe sei, für den Kaffee aufzukommen.
Ich denke, für Mutter war dieser regelmäßige Besuch ihrer Freundin wie der Besitz einer wertvollen Murmel, die sie als Kind gefunden hatte und seitdem fest verschlossen in ihren Händen hielt. Ich sah Mutter nie lachen, außer wenn sie bei Gabriella war. Doch sie achtete immer darauf, dass andere sie dabei nicht beobachteten, da sie sich schämte, zumal sie in ihrem Leben nicht viel zu lachen hatte. Wenn Touristen oder andere Leute den Laden von Gabriella besuchten, versteinerte sich sofort ihr Gesicht, und sie trat sogar ein wenig zurück, damit man sie nicht sehen konnte mit ihrer schmutzigen Schürze, die sie mit ihren unförmigen Händen zurechtstrich.
Ich vermute, dass Mutter Gabriella auch von uns erzählt hatte. Von Papa und mir. Wahrscheinlich hatte sie sich von Papa mehr erhofft, als dass er uns mit seiner Fischerei leidlich am Leben hielt. Vielleicht hatte sie sich durch ihn ein besseres Leben erhofft als jenes, das sie am Ende bekommen hatten.
Vielleicht war das auch der Grund, warum sie mir immer gesagt hatte, dass ich meine Zeit nicht mit dieser poesia verschwenden sollte. Sie spürte, dass mein Drang, die Welt um mich herum mit Phantasie anzureichern, am Ende des Tages nicht genügen würde, um damit ein Auskommen zu finden. Für sie war Arbeit, harte Arbeit, der einzige Weg, um aus dem schmutzigen Labyrinth des Lebens zu entkommen. Vater war in ihren Augen zu einem Müßiggänger geworden, der draußen auf den Wellen des Meeres in fremde Gedanken versank. Sah mein Vater in der Schule, in die ich nach dem Sommer gehen würde, die große Chance, eines Tages Atrani verlassen zu können und irgendwo auf dieser Welt ein besseres Leben zu führen, so betrachtete Mutter die Schule als Zeitverschwendung.
Insgeheim hoffte ich, dass Mutter mit Gabriella über diese Dinge sprach und dass Gabriella sie überzeugen würde, mir schon jetzt Bücher zu kaufen, damit ich mehr über die Welt lernen und endlich auch so sprechen konnte wie die anderen Menschen. Das hatte ich gehofft, wenn sie unser Haus verließ, wenn ich mit Papa vom Meer gekommen war. Warum hatte sie an diesem Tag früher das Haus verlassen? Warum hatte sie nicht gewartet, bis ich vom Torre dello Ziro heruntergestiegen und zu Papa an den Stand gelaufen war mit einer Feldblume in der Hand. Warum hatte sie nicht gewartet?
Der Krankenwagen hatte unbemerkt die ummauerte Piazza erreicht. Fremde Menschen hoben Mama in den Wagen, und als ich zu ihr laufen und ihr sagen wollte, dass ich mich um alles kümmern würde, den Haushalt, das Essen, ja selbst ihre Besuche bei Gabriella, hatten sie die Wagentür vor meiner Nase zugeschlagen. Ich spürte, dass Mama tot war. Sie war mit dem Kopf gegen den Brunnen geschlagen, als der Motorroller mit den betrunkenen Männern durch Atrani gerast war. Mutter war tot, und ich musste mich jetzt um meinen Papa kümmern, der zitternd meine Hand suchte.
Ich war das einzige Kind von Mama und Papa. Wir lebten in Dante in einer kleinen Wohnung ohne richtiges Tageslicht. Von der rot gefliesten Küche führte eine steile Treppe hinauf zu meinem Zimmer, wo mein Bett unter einer gewölbten Decke stand. Papa hatte Mühe, in meinem Zimmer aufrecht zu stehen. Obwohl Mama kleiner war, musste auch sie sich bücken, wenn sie mit der Wäsche durch mein Zimmer lief, um sie auf der kleinen Terrasse zum Trocknen nach draußen zu hängen. Die Terrasse verwendeten wir selten, da sie direkt zum Felsen hinausreichte und ein Blick aufs Meer nur möglich war, wenn man sich über das Geländer weit nach vorne lehnte. Es war in unserem Zuhause ohnehin fast immer dunkel, roch nach Wäsche und Fisch. Und von draußen drang ständig Geschrei in mein Zimmer – oder von unten, wenn meine Eltern stritten. Auch, wenn mein Vater die Tür zu ihrem Schlafzimmer zuzog, das gleich neben der Küche lag, damit ich nichts mitbekam. Ich schloss dann meistens die Augen ganz fest und atmete den salzigen Duft des Meeres ein, der in der Nacht zu mir hereinwehte und mich von einer anderen Welt träumen ließ.
Papa setzte sich unten an den Tisch und starrte auf den Teller vor sich. Ein Stück helles Brot lag darauf. An der Unterseite hatte es sich mit Olivenöl vollgesogen. Der Platz gegenüber von ihm war leer. Auch der Teller. Mutter hatte nichts gegessen, als wir aufgebrochen waren heute Morgen. Ich spürte, dass Papa Angst hatte, auf den leeren Platz zu sehen. Mama würde nie wieder zurückkommen. Ich wollte zu Papa gehen und mich an meinen Platz setzen, aber ich wusste nicht, was ich ihm sagen sollte. Ich selbst hatte ja noch gar nicht begriffen, was passiert war. Ich überlegte, ob ich nach oben gehen und warten sollte, bis Papa sich wieder geordnet hatte, als auf einmal Gabriella in der Tür stand. Sie war blass, und Tränen rollten über ihre Wangen. Ohne ein Wort zu sagen, ging sie zu Papa und setzte sich zu uns. Sie fasste seine Hand.
»Wenn du irgendetwas brauchst, ich bin für dich da«, sagte Gabriella und warf mir einen tröstenden Blick zu.
»Kommt Mama wirklich nie wieder?«, fragte ich sie, obwohl ich die Antwort längst wusste.
Obwohl Gabriella dunkle Ringe unter den Augen hatte, sah sie aus wie eine Frau, der es gelungen war, Dante zu verlassen. Sie trug rote Schuhe und hatte ein hellbraunes Kleid an mit goldenen Knöpfen. Meine Schuhe waren auch rot, aber sie waren schmutzig, meine Strümpfe waren dunkelblau und wie mein schwarzer Rock voller Erde. An meiner viel zu großen gewalkten Jacke hingen sogar noch Blätter, die an mir kleben geblieben waren, als ich mich mit Giacobbe vor den Gespenstern versteckt hatte. Wo war eigentlich Giacobbe?
»Ich werde euch helfen, mein Kleines, du kannst dich auf mich verlassen«, sagte Gabriella.
»Papa und ich, wir schaffen das schon«, sagte ich und zog ein Blatt von meiner Jacke. »Ich werde ihm helfen beim Fangen der Fische und zusehen, dass hier alles in Ordnung ist. Mama hat mir einmal gezeigt, wie man Ndunderi macht. Und die Wäsche. Wir schaffen das.«
Gabriella liefen Tränen über die Wange.
»Das musst du nicht. Du musst das nicht tun. Du bist noch ein Kind.«
»Mama hat immer gesagt, dass man hart arbeiten muss, wenn man es zu etwas bringen will.«
»Da hat sie recht. Aber du musst das nicht tun. Ich helfe deinem Vater, und ich helfe dir. Du gehst im Herbst in die Schule. Das ist wichtig.«
»In der Schule lerne ich doch nur Dinge von der poesia, von Dingen, die es gar nicht gibt. Nein, Frau Gabriella, ich und mein Papa werden hart arbeiten.«
Ich nickte und merkte, dass eine große Träne in meinen Mund lief.
»Die Schule ist wichtig. Du willst doch, dass deine Mama stolz auf dich ist, wenn einmal etwas ganz Großes aus dir wird.«
»Ich werde Mama nicht enttäuschen«, sagte ich und ging zum Tisch, um ihn abzuräumen. Ich bemerkte, dass Gabriella mich daran hindern wollte, aber dann davon abließ, da sie spürte, dass ich in der Ordnung einen Weg finden wollte, mit der Trauer in mir umzugehen.
»Die Polizei hat noch ein paar Fragen an mich«, sagte Gabriella und ging zur Tür. »Ich komme später noch einmal vorbei. Wenn ihr bis dahin irgendetwas braucht …?« Papa schwieg, und ich nickte und suchte im Küchenschrank nach einem Geschirrtuch.
Als Gabriella mein altes Zuhause verlassen hatte, befiel mich das Gefühl, als würde das Leben aus mir und meinem Vater fließen. Wir blieben zurück wie zwei seelenlose Hüllen, die aus dem engen, schmutzigen Labyrinth von Dante einen Ausweg suchten und wussten, dass sie nur Einsamkeit finden würden. Die Bewohner von Dante zählten zu den ärmsten von Atrani. Die meisten Familien von Dante lebten vom Fischfang, und das Meer war unsere einzige Chance zu überleben. Doch die vielen bunten Schiffe, die in der Nacht und in der Einsamkeit des Meeres nach dem Überleben suchten, wurden immer weniger.
Giacobbe hatte mir erzählt, dass es nicht immer so gewesen war. Er hatte geschildert, dass unsere Nachbarstadt Amalfi einst zum antiken Römischen Reich gehört hatte. Nach dem Untergang des Reiches hatte sich Amalfi gemeinsam mit den anderen Dörfern der Küste zu einem eigenen Land aufgeschwungen und war zu einem Staat der Seefahrer geworden. Die Dörfer hatten sich große Schlachten mit den muslimischen Sarazenen geliefert. Doch Amalfi hatte auch ein glückliches Händchen im Handel gehabt. Von hier waren Produkte nach Nordafrika geliefert worden, darunter Holz, Getreide, Eisen, Früchte und Wein. Im Gegenzug hatten Schiffe Seidenstoffe, Medizin, Luxusgüter, Gewürze, Parfüms, Perlen, Schmuck, Stoff und Teppiche aus der arabischen und byzantinischen Welt nach Amalfi gebracht. Somit war Amalfi damals so reich und mächtig wie Pisa, Genua und Venedig gewesen. Durch den Seehandel waren die Menschen der Küste immer mehr in Kontakt zu Arabern gekommen, die die Herstellung von Papier beherrschten. So waren in den Wäldern oberhalb von Atrani und Amalfi bereits im Mittelalter erste Papierfabriken entstanden.
Früher hatte es keine Straße zu den Dörfern der Küste gegeben. Man war nur über halsbrecherische Maultierpfade zu den malerischen Dörfern an der Küste gelangt. Als die Straßen gebaut worden waren, hatte sich die Amalfiküste mit dem restlichen Italien verbunden. Trotz der gemeinsamen Geschichte waren alle Dörfer entlang der Küste anders. Alle folgten eigenen Traditionen und Bräuchen. Und obwohl nun die Armut wie ein Stachel in der Küste steckte, zeugten die architektonischen Meisterwerke vergangener Zeiten von einer ruhmreichen Zeit: der sarazenische Turm von Cetara, die römische Kathedrale von Amalfi mit dem arabischen »Chiostro del Paradiso«, die Kirche San Salvatore de’ Bireto von Atrani, wo einst die Dogen von Amalfi ernannt wurden, und natürlich die große Kathedrale.
Diese Schönheit war es, die die Fremden anlockte. Giacobbe hatte mir erzählt, dass sogar der deutsche Komponist Richard Wagner unsere Küsten besucht haben soll. Aber er war nicht der Einzige gewesen, sondern es waren noch viele gefolgt. Und so hatten die Einwohner der Nachbarstädte ihre Fischerboote am Strand gelassen und ihr Geld fortan mit den Fremden verdient. Kochten für sie, zeigten ihnen die verschlungenen Wege und erzählten ihre Geschichten, verkauften Pasta, Kleider in knalligen Farben oder Kunsthandwerk. Die Fischerdörfer Cetara und Maiori zählten zu den beliebtesten Badeorten der Küste. Aber natürlich auch Sorrent, wo viele Schriftsteller und Maler ihre Sehnsucht stillten, oder Positano mit seinen bunten aufeinandergestapelten Häusern.
Papa hielt nichts vom Tourismus. Und wenn ihn sein Schiff weiter östlich führte, dann sah er Minori, das für ihn der schönste Ort der Küste war. Er nannte ihn das Eden der Amalfiküste, da dort eine ständige Meeresbrise und ein erfrischendes Klima herrschten, als wäre der Ort nicht von dieser Welt.
»An der Amalfiküste sucht die Menschheit ihre Sehnsucht. Doch was sie findet, ist die Einsamkeit«, sagte Papa einmal. »Aber ich liebe die Einsamkeit. Denn in ihr liegt die Wahrheit.«
Für mich war Atrani ein Ort im Paradies, in dessen Inneren Dante lag, mein heimlicher Eingang in die Hölle. Wer ihr entkommen wollte, musste hart arbeiten und durfte seinen Tag nicht mit Träumen vergeuden. Das war die Wahrheit. Sie brannte sich nach dem Tod meiner Mutter in mein Herz. Und als ich am Ende jenes Tages in meinem Bett den Schlaf suchte und draußen die Schreie der Menschen hörte, die sich gegen die Sehnsucht des Meeres wehrten, verstand ich ihren Schmerz.
»Tea? Es ist Zeit aufzustehen.« Die Stimme meines Vaters war so leise, dass ich sie kaum hörte. Ich hatte die ganze Nacht kein Auge zugetan, da ich nicht wusste, was der Tod meiner Mutter bedeutete. Papa strich über meine Wange und lächelte mich an.
»Lass uns aufs Meer hinausfahren«, sagte er. Seine Augen waren rot, als hätte er die ganze Nacht geweint. Ich setzte mich auf und suchte den Geruch von Fisch und Zitronen, doch ich fand nur den öligen Gestank von Papas blauem Fischerhemd. Unten rückte niemand Stühle oder klapperte mit dem Geschirr. Nur das Meer rauschte geduldig und schlug mit seinen Wellen an die Festungen unseres kleinen Zuhauses.
Es war der erste Morgen ohne Mama. Ich fuhr mit Papa aufs Meer und schwieg mit ihm in der kalten Stille der Wellen. In der Ferne klang das leise Tuckern anderer Fischerboote, und ich sah die schnellen Lichter von bunten Autos, die über die Hochstraße von Atrani rasten.
»Nach dem Sommer beginnt die Schule«, sagte Papa mit gebrochener Stimme. Er sah älter aus als sonst. Der Wind am Meer hatte seine Haut aufgerissen und seine Augen müde gemacht.
»Ich gehe nicht zur Schule.«
Papa schwieg und zog das Netz näher an das Boot. Seine Hände waren aufgerissen und an ein paar Stellen blutig.
»Diese Welt, die du hier siehst, wird verschwinden. Meine Hände braucht in der Welt von morgen niemand mehr. Du musst lernen, damit du etwas Besseres machen kannst als ich.«
»Die Leute werden immer Fische essen, Papa. Wir müssen nur hart arbeiten und zusammenhalten.«
Wieder schwieg Papa und blickte auf den dunklen Wall der Milchberge, die hinter Atrani im schwindenden Mondlicht leuchteten.
»Du musst dich nicht um mich kümmern. Ich bin dein Vater. Ich muss mich um dich kümmern. Du musst in die Schule gehen.«
Ich half Papa, das Netz ins Boot zu ziehen. Es war leer.
»Die ricchi haben sie getötet. Die ricchi töten uns alle«, sagte ich plötzlich und spürte, wie eine unbekannte Wut nach meinem Herz fasste.
»Dann geh zur Schule! Dann lerne! Lerne, so viel du kannst!«
Ich sah zu Papa. Er hatte Tränen in den Augen. Ich fasste seine Hand. »Ich lass dich nicht allein, Papa.«
»Das weiß ich. Aber du musst zur Schule gehen. Und dann, wenn du es geschafft hast, wenn du selbst eine ricca bist, dann wartest du auf mich am Strand.«
Ich schloss die Augen und verbarg die Tränen darin. Ich spürte, dass mein Papa ohne mich nicht zurechtkommen würde. Er würde irgendwann auf dem Meer verloren gehen.
Mein Papa nahm im schaukelnden Boot meine Hand. »Versprichst du mir das? Versprichst du mir, dass du am Strand auf mich wartest?«
»Ich dir versprechen«, sagte ich mit einem Knoten im Hals.
Ich verspreche es dir. Ich stellte die Worte in meinen Gedanken richtig. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Und der Wind trieb das Boot immer weiter hinaus aufs offene Meer.
Ein schwüler Sommermorgen hatte sich in unsere Zimmer gelegt und klebte an den schmutzigen Wänden wie Schimmel. Wir hatten wenig Erfolg mit unseren ersten Fischgängen nach Mamas Tod. Papa stellte sich unbeholfen vor den Tisch und nickte mir zu, als wollte er mir zeigen, dass er stark genug sei für uns beide und dass er bereit sei, unser beider Leben in den Griff zu bekommen. Aber ich spürte, dass er kaum Kraft für sich selbst hatte. Dann setzte er sich und begann zu weinen. Auch wenn er mir auf dem Meer gesagt hatte, dass er sich um mich kümmern würde.
Ich öffnete den kleinen Kühlschrank. Drei Zitronen lagen mit abgeriebenen Schalen darin. An einer Stelle hatte sich eine schwarze Stelle gebildet. Im Fach darunter stand ein fettiger silberner Topf. Ich holte ihn heraus, stellte ihn auf den Herd und entfernte den Deckel. In der Kälte erstarrte Ndunderi steckten darin in Sardinenfett. Mutter hatte sie noch gemacht. Ich suchte in den Schubladen neben dem Herd nach einem Kochlöffel, fand aber nur einen normalen Löffel, mit dem ich begann, unser Essen zu erwärmen, das Papa und ich unter Tränen aßen.
»Morgen fange ich uns Fisch. Ich werde diesmal früher aufbrechen«, sagte er, und ich nickte.
Zwischen uns lag eine Stille, die größer war als das Meer.
»Ich muss dann noch zur Polizei und andere Dinge erledigen.«
Wieder nickte ich und räumte die leeren Teller in die Spüle.
»Ich sorge für dich, mein Mädchen, ich verspreche es dir«, sagte er und strich meine Locke glatt nach hinten, die widerspenstig in mein Gesicht gefallen war. Dann verschwand er.
Da ich nicht wusste, wann Papa wiederkam, entschied ich, ebenfalls das Haus zu verlassen. Ich wollte zum Torre, um auf das Meer hinauszusehen. Bevor ich ging, schob ich einen Stuhl zur Spüle, um in den kleinen quadratischen Spiegel zu sehen – Mutter hatte ihn dorthin gehängt, ihr hatte der mit kleinen bunten Steinen verzierte Rahmen gefallen. Ich sah müde aus, meine Haut war schmutzig. Ich zog meine Mundwinkel nach oben und zeigte meine Zähne.
»Buongiorno, Signora«, sagte ich. Mein Italienisch klang viel zu hart und sprudelte weniger als bei den anderen. Vielleicht war das der Grund, warum mir die Touristen weniger Lire gaben, wenn ich am Torre mit offener Hand danach fragte. Vielleicht glaubten sie, ich sei eine Betrügerin. Manchmal hatten mich einige vertrieben. Ich sei eine Zigeunerin, hatten sie gerufen. »Buongiorno«, wiederholte ich meine Worte im Spiegel und kippte meinen Kopf mit einem breiten Grinsen hin und her. Dann sprang ich vom Stuhl und lief zum weißen Wachturm.
Der Torre war leer. Keine aufgeregten Menschen mit blauen Hemden, karierten Blusen und großen schwarzen Sonnenbrillen. Als er neben mich trat, sah ich nicht auf, sondern blickte auf das glitzernde Meer.
»Was ist passiert, Tea? Ich habe einen Krankenwagen gesehen.«
»Meine Mama ist tot.«
»Tea, das tut mir so leid!« Giacobbe legte einen Arm um meine Schulter. »Wie ist das passiert?«
»Die ricchi haben sie umgefahren.«
Giacobbe schwieg, und ich bemerkte, wie seine Worte in seinem Hals steckten.
»Papa sagt, dass ich nach dem Sommer auch in die Schule gehe. Ich werde auch eine ricca werden, und dann gehe ich mit Papa von hier weg.«
»Das wird du ganz sicher, Tea. Und die Windreiter und die Schneehexen werden dir dabei helfen«, sagte Giacobbe, und ich bemerkte, wie er sich aus seiner Erstarrung löste und übertrieben siegessicher auf das Meer blickte.
»Wir werden dann nicht mehr viel Zeit haben, um Gespenster zu jagen.«
»Aber die Kinder auf den Milchbergen? Wir müssen sie retten.«
Ich blickte zur Sonne und schloss meine Augen. Ein schwarzer Ball trat an ihre Stelle, wie ein dunkler Planet.
»Du weißt, dass das nicht wahr ist«, flüsterte ich und schämte mich für meine Worte, als würde ich meine Kindheit verraten.
»Ich helfe dir, Tea, in der Schule und beim Haushalt. Ich kann auch einkaufen gehen, aber wir müssen die Kinder da oben doch retten. Das ist doch unsere Pflicht …«
Ich drehte mich um, Tränen flossen über meine Wangen. Ich nahm seine Hände in meine. Sie schwitzten, und seine Ohren leuchteten rot. Giacobbe begriff nicht, was es bedeutete, eine Mutter zu verlieren. Er durfte weiter ein Kind bleiben, ich musste erwachsen werden.
»Aber die poesia …?«
»Ich muss lernen, die Welt so zu sehen, wie sie ist.«
Giacobbe löste seine Hände aus meiner Umklammerung und sah mir in die Augen. Sein schüchterner Blick fand Halt in einer tiefen Überzeugung.
»Sei vorsichtig, Tea! Die Welt da draußen ist viel gefährlicher als die Welt unserer Gespenster. Aber wenn einmal jemand kommt, der dir wehtun will, dann versteck dich und denk daran, deinen Atem anzuhalten. So, wie ich es dir gezeigt habe. Du bist eine Atemkünstlerin. Und auch wenn du es jetzt nicht siehst: In der Welt deiner poesia kannst du dich immer verstecken und Hilfe holen. Immer, hörst du? Die poesia kann niemand kontrollieren, auch die ricchi nicht.« Giacobbe sah zu Boden und verschwand, bevor die ersten Touristen lautstark auf den Turm stiegen.
Die Glocken der Chiesa Maria Maddalena schlugen. Aus Amalfi und Atrani drang Kindergeschrei. Vom Meer strich sanfter Wind an den Torre und schaufelte salzige Luft über die Zitronenhaine. Wieder hörte ich die Glocken. Ich drehte mich um in Richtung Scala. Ich hatte mich geirrt, es war nicht die Chiesa Maria Maddalena, es war der Duomo di San Lorenzo in Scala. Es waren seine Glocken, deren mächtige Klänge mit dem Meereswind über die grünen Hügel wehten. Bevor ich zurück zu Papa ging, musste ich mich mit Giacobbe vertragen. Sein plötzlicher Aufbruch steckte wie ein Schiefer in meinem Herzen. Warum war er plötzlich aufgebrochen? Ich lauschte den aufgeregten Schlägen der Glocken. Natürlich! Er musste zur Schule. Gab es heute nicht die Zeugnisse? Giacobbe hatte mir doch davon erzählt. Hatte er doch, oder? Wenn ich schnell genug über die Treppenwege lief, würde ich ihn bei der Scuola Elementare treffen und könnte ihm sagen, dass es mir schon gelingen würde, weiter mit ihm die Gespenster zu jagen. Ich konnte ihn doch nicht alleinlassen.
Ich war außer Atem, als ich den Dorfplatz in Scala erreichte. Die ersten Schülergruppen waren bereits dabei, sich wieder aufzulösen. Ich sah zur Grundschule, die – neben dem Rathaus und kleineren Geschäften – am mittelalterlichen Platz in Scala lag, wo der alte Glockenturm in den Himmel ragte. Stolze Eltern lasen Zeugnisse, und einige Jungen fuhren mit nagelneuen Fahrrädern mit Fahnen über den Dorfplatz. Ich kannte niemanden, suchte aber in der Menge Gesichter, die aussahen, als würden sie einem Lehrer gehören.
»Verzeihen Sie, Giacobbe, seine Klasse, wo ist die?«, fragte ich einen krummen Mann, der aussah wie ein durch starken Wind geformter dürrer Baum. Er trug eine kleine Brille auf der spitzen Nase und beugte sich wie ein dunkler Magier zu mir herunter. Kurz spielte ich mit dem Gedanken, wieder wegzulaufen, da mir der Mann Angst einjagte, aber als ich seine warme, verständnisvolle Stimme hörte, war ich froh, meinem Instinkt vertraut zu haben.
»Giacobbe? In welcher Klasse soll der sein?«
»Primo. Prima classe.«
»Du bist von hier, habe ich recht?«
Ich bemerkte, dass sich der Magier nach meinen Eltern oder anderen Erwachsenen umsah, in deren Obhut ich stand.
»Ich bin Tea aus Atrani. Mein Papa ist Fischer und Giacobbe mein Freund. Nach dem Sommer auch ich gehe in die Schule.«
»Atrani. Soso. Na, an deinem Italienisch müssen wir noch feilen«, sagte der große dunkle Mann. »Aber ich muss dich enttäuschen. Einen Giacobbe haben wir hier nicht. Wie heißt er mit Nachnamen?«
Mein Herz raste. Ich hatte Giacobbe nie nach seinem anderen Namen gefragt. Kinder brauchen nur einen Namen. Als ich dem Lehrer Giacobbe beschrieb und ihm erzählte, dass er aufgrund seiner rot leuchtenden abstehenden Ohren von den anderen Jungen verspottet würde, schüttelte der Mann abermals den Kopf.
»Hmm. So einen Jungen kenne ich nicht. Du musst dich irren. Und er hat gesagt, dass er hier in die Schule geht?«
Ich sah mich um. Suchte zwischen den vielen verschwitzten Köpfen der Kinder nach den roten Ohren. Aber nichts.
»Moment. Giacobbe!« Die Stimme des Lehrers klang mit einmal bestimmter. Wenig später lief ein großer Junge mit glatten blonden Haaren und dem Blick eines Sportlers zu uns.
»Ist das der Giacobbe, den du suchst?«
Ich verneinte. Und auch als der Lehrer bei den anderen Kindern fragte, ob ihnen ein schüchterner Junge mit einer roten Jacke aufgefallen war, erntete er nur Kopfschütteln.
»Vielleicht hast du dich ja geirrt, und dein Giacobbe geht gar nicht in die Schule, sondern er kommt mit dir diesen Herbst zu uns.«
Hatte ich mich tatsächlich geirrt? Vielleicht hatte mich aber Giacobbe auch belogen, und er ging noch gar nicht zur Schule. Ich verabschiedete mich von dem großen, gespenstischen Mann und zog enttäuscht zurück nach Atrani.
Die poesia kann niemand kontrollieren. Je öfter ich den letzten Satz von Giacobbe hörte, umso mehr ärgerte ich mich. Natürlich konnte sie niemand kontrollieren, weil es sie gar nicht gab. Ich versuchte, mich zu erinnern, ob Giacobbe bei unseren Spielen erwähnt hatte, wo das Haus seiner Eltern stand, aber vergeblich. Er hätte überall stecken können. Er hätte enttäuscht auf sein Zimmer gegangen sein können, wo er das Poster eines stolzen Ritters von der Wand riss. Vielleicht hatte der Lehrer recht, und Giacobbe würde im Herbst neben mir auf der Schulbank sitzen, bevor der Magier auf dem Pult sein dunkles, schweres Buch voller Staub aufschlug und mit einem spitzen Stab auf uns zeigte.
Papa war noch nicht zu Hause. Ich ging in mein Zimmer und riss – vermutlich wie Giacobbe – meine zerknitterten Poster, die Superheldinnen und Prinzessinnen zeigten, von der Wand. Unter dem Bett hatte ich eine kleine Sammlung von »Wonder Woman«-Heften. Da ich noch kaum lesen konnte, sah ich mir nur die Bilder an. Seit meine Mutter mir die Sammlung zum Geburtstag geschenkt hatte, war ich fasziniert von Wonder Woman. Bevor ich die Hefte in den Müll steckte, warf ich noch einmal einen kurzen Blick auf die erste Ausgabe. »Come back to me #1« stand darunter. Ich kannte nur die Buchstaben, ihre Bedeutung war mir fremd. Mich faszinierte der entschlossene Blick, mit dem Wonder Woman mit einer Peitsche in der Hand auf mich losstürmte. Hinter ihr waren Tiere auf der Flucht vor Männern mit Helmen und Äxten und einem großen Feuer. Am meisten faszinierte mich der große Hirsch hinter ihr. Er sah mich ebenfalls an. Ich hatte noch nie einen Hirsch gesehen, obwohl Papa gesagt hatte, dass er vor ein paar Jahren oben bei den Türmen einen gesehen hatte. Aber das war jetzt vorbei. Alles musste in den Müll.
An den Stellen, wo die Poster gehangen hatten, lagen nun helle Flecken, und ich dachte, dass mein niedriges Zimmer jetzt noch mehr einem Verlies ähnelte. Ich beschloss, die Wände zu streichen. Mutter hatte sicherlich irgendwo Farbe. Der Kloß in meinem Hals kam zurück, da ich in meiner Aufregung vergessen hatte, dass Mama mir nicht mehr sagen konnte, wo die Farbe war. Ich überlegte, ob ich mein Zimmer nicht in der Farbe des Fischerbootes meines Vaters bemalen sollte. Hellblau. Ich wollte ihn fragen, sobald er wieder hier war. Und ehe ich mich’s versah, hatte ich begonnen, einen Plan zu fassen. Ich musste erwachsen werden. Musste mein Zimmer ausmalen, alles wegwerfen, was mich an die Kindheit fesselte, musste lernen, Essen zu kochen, musste Wäsche waschen, die Zimmer sauber halten, einkaufen, vor der Tür fegen, die Fenster putzen und lernen, viel lernen. Als ich nach unten ging, sah ich Mama vor meinem geistigen Auge. Sie lächelte mich an und sagte mir, dass sie mich lieb habe.
»Du wirst stolz auf uns sein, Mama. Papa und ich, wir kommen schon zurecht. Wir haben alles unter Kontrolle.«
HEILIGENBILDER. 1976.
In der nächsten Nacht fuhr Papa wieder aufs Meer und blieb zwei Tage draußen, und ich fand in den Kochbüchern ein Bild von Ndunderi. Der Einband war verschlissen, und viele Fettflecken hatten dem Buch übel zugesetzt. Ich entzifferte die Buchstaben unter dem Foto und mischte die Zutaten in einer großen Aluminiumschüssel. Da ich meinen Papa überraschen wollte, verglich ich jeden Buchstaben im Kochbuch mit den Buchstaben auf der Verpackung. Ricotta, Mehl, Eier, Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Nirgendwo waren Eier zu finden, und ich wusste nicht, was eine Muskatnuss war. In der unteren Lade fand ich eine halbe Tüte Mehl und vermischte es mit dem Ricotta, den ich im Kühlschrank in einer schmutzigen Lade gefunden hatte. Ich schüttete Salz in die Schüssel und formte mit einer Gabel kleine Kügelchen. Ich hatte meine Mutter einmal beobachtet, wie sie mit dem Rücken einer Gabel Rillen in die Ndunderi gedrückt hatte. Dann stellte ich den Herd an, machte Wasser heiß und schüttete meine ersten Ndunderi ins kochende Wasser. Alle zerfielen. Und doch aß ich zum Frühstück, zu Mittag und am Abend die klebrige, salzige Pampe.
Am dritten Tag kam Papa zurück. Er stank und konnte sich vor Müdigkeit kaum mehr auf den Beinen halten. Er ließ sich aufs Bett fallen und gab ein tiefes Keuchen von sich.
»Hast du etwas gegessen?«
»Ich muss noch üben. Aber ich habe dir etwas übrig gelassen«, sagte ich nicht ohne Stolz und sah auf die restliche klebrige Masse im Topf.
»Ich war nicht so erfolgreich wie du«, sagte er.
»Kein Fisch?«
Papa richtete sich ächzend auf. Er hatte sich seit dem Tod von Mama nicht mehr rasiert und sah um zehn Jahre älter aus. Sein Blick fiel auf den Mülleimer, in dem meine Hefte von Wonder Woman und die zerrissenen Poster steckten.
»Was tust du? Du kannst das alles doch nicht wegwerfen!«
»Ich brauche die nicht mehr. Ich habe alles sauber gemacht, und alles, was wir nicht mehr brauchen, werfen wir auf den Müll.«