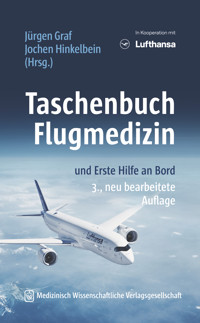
Taschenbuch Flugmedizin E-Book
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Notfallversorgung an Bord eines Linienflugzeuges ist eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten. Trotz der Limitationen an Bord ermöglicht die Notfallausrüstung professionelle Hilfe. Außerdem sind Helfer oft als Berater der Crews für das medizinische Management von Passagieren bzw. Patienten eingebunden. Dieses Buch vermittelt Wissen und umsetzbare Strategien zur Diagnostik, Therapie und Management von medizinischen Problemen, Krisen und Notfällen an Bord von Flugzeugen. Zudem enthält es die wichtigsten Informationen zu den (Notfall-)Bedingungen an Bord (Ausrüstung, Raumangebot und Limitationen) am Beispiel der Lufthansa. Relevante Rechtsfragen und Formalitäten werden ausführlich behandelt. Die 3. Auflage ist intensiv überarbeitet und vollständig aktualisiert. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Band auf verschiedenen Notfallsituationen, die an Bord auftreten können. Praxisnah wird dargestellt, wie in welchem Kontext reagiert und behandelt werden kann. Differenzierte Informationen finden sich außerdem zur Reisetauglichkeit von Flugpassagieren unter verschiedensten Vorbedingungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gebrauchsanweisung für dieses Buch
Wichtige Aussagen – z. B. Fehlerquellen und Gefahren bei der Beurteilung einer Situation oder der Anwendung einer Maßnahme
Spezifische medizinische Hinweise zu Besonderheiten an Bord, insbesonderebei ärztlichen Erwägungen zum Weiterflug versus außerplanmäßige Zwischenlandung
Wissenswerte Hintergrundinformationen (z. B. wissenschaftliche Daten) zu den Ausführungen im Text
Jürgen Graf | Jochen Hinkelbein (Hrsg.)
Taschenbuch Flugmedizin
und Erste Hilfe an Bord
Unter fachlicher Beratung von Dr. med. Thomas Schmitt
3., neu bearbeitete Auflage
mit Beiträgen von
N.-B. Adams | T.O. Bender | L. Dehé | G. Dultz | F. Eifinger | C. Ernst | F. Hohendanner | I. Hufnagel | S. Jansen | T. Lichtenstein | F. Liebold | M. Meyer | M. Miesen | W. Müller-Rostin | C. Neuhaus | S.C. Reitz | E. Roeb | J. Schmitz | T. Warnecke | S. Yücetepe
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Die Herausgeber
Prof. Dr. med. Jürgen Graf
Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender
Universitätsklinikum Frankfurt
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main
Univ.-Prof. Dr. med. Jochen Hinkelbein
Klinikdirektor
Johannes Wesling Klinikum Minden
Universitätsklinik für Anästhesiologie,
Intensivmedizin und Notfallmedizin
Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum
Hans-Nolte-Straße 1
32429 Minden
Fachliche Beratung:
Dr. med. Thomas Schmitt
Medical Center Frankfurt, FRA GM/F
Medical Services & Health Management Lufthansa
Group
Lufthansa Basis/Tor 21
60546 Frankfurt am Main
Planung und Fachredaktion:
Dr. med. Thomas Hopfe
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Berlin
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Unterbaumstraße 4
10117 Berlin
www.mwv-berlin.de
ISBN PDF 978-3-95466-924-0
ISBN ePub 978-3-95466-925-7
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Informationen sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Berlin, 2024
Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Im vorliegenden Werk wird zur allgemeinen Bezeichnung von Personen nur die männliche Form verwendet, gemeint sind immer alle Geschlechter, sofern nicht gesondert angegeben. Sofern Beitragende in ihren Texten gendergerechte Formulierungen wünschen, übernehmen wir diese in den entsprechenden Beiträgen oder Werken.
Die Verfasser haben große Mühe darauf verwandt, die fachlichen Inhalte auf den Stand der Wissenschaft bei Drucklegung zu bringen. Dennoch sind Irrtümer oder Druckfehler nie auszuschließen. Daher kann der Verlag für Angaben zum diagnostischen oder therapeutischen Vorgehen (zum Beispiel Dosierungsanweisungen oder Applikationsformen) keine Gewähr übernehmen. Derartige Angaben müssen vom Leser im Einzelfall anhand der Produktinformation der jeweiligen Hersteller und anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Eventuelle Errata zum Download finden Sie jederzeit aktuell auf der Verlags-Website.
Produkt-/Projektmanagement: Meike Daumen und Sarah Ullerich, Berlin
Lektorat: Monika Laut-Zimmermann, Berlin
Layout & Satz: zweiband.media, Agentur für Mediengestaltung und -produktion GmbH, Berlin
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Zuschriften und Kritik an:
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Unterbaumstr. 4, 10117 Berlin, [email protected]
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort zur 1. Auflage
In den vergangenen 50 Jahren hat sich der Weltluftverkehr rasant entwickelt. War es vor wenigen Jahrzehnten nur wohlhabenden Bürgern möglich eine Flugreise zu unternehmen, so ist heute im Zeitalter des Massentourismus und der „Schnäppchenpreise“ eine Flugreise für jedermann erschwinglich.
Die Passagierzahlen sind über die letzten Jahrzehnte konstant mit 5–7 % pro Jahr gewachsen; heute reisen pro Jahr mehr als 2 Milliarden Menschen in Flugzeugen. Seit wenigen Jahren, mit Aufkommen der sog. Billig-Airlines, sind Flugreisen über tausende von Kilometern zu dem Preis einer Straßenbahnfahrt möglich. Wer heute zeitlich flexibel und zum richtigen Zeitpunkt im Internet ein Flugticket bucht, kann für wenig Geld die Welt kennen lernen. Für den einzelnen Reisenden ist dies eine faszinierende Entwicklung, die ihn oft vergessen lässt, dass er in wenigen Stunden seinen Lebensmittelpunkt in völlig fremde Kulturen verlagert, unter völlig veränderten klimatischen Bedingungen leben muss, und im Falle einer Erkrankung unter an deren als den gewohnten medizinischen Standards versorgt wird. Gerade wenn es darum geht, als Schnäppchenjäger so billig wie möglich zu reisen, und als Last-Minute-Tourist heute noch nicht zu wissen, wo man morgen günstig Urlaub macht, ist es die Regel, dass eine solide medizinische Vorbereitung zumeist unterlassen wird. In der Erwartung auch in Entwicklungsländern grundsätzlich den medizinischen Standard eines deutschen Kreiskrankenhauses vorzufinden, geraten jedes Jahr viele tausend Touristen in finanzielle Not, wenn sie am Urlaubsort erkranken und plötzlich darauf angewiesen sind, so schnell wie möglich nach Hause repatriiert zu werden, um der Medizin des Entwicklungslandes zu entkommen. Hausärzten wie auch Reisenden ist zumeist unbekannt, welche Risiken bei einer Fernreise lauern, wenn sich Vorerkrankungen am Urlaubsort verschlimmern oder Unfälle einen Rücktransport, zum Beispiel in Ambulanz- oder Linienflugzeugen, erfordern. Hat der Flugreisende diese Risiken vor Antritt seines Urlaubs nicht bedacht und sich nicht durch Versicherungsschutz abgesichert, ist das Erstaunen über die finanzielle Belastung groß, wenn die Fluglinie den Rücktransport aus medizinischen Gründen ablehnt und der Transport im Ambulanzflugzeug einer Rückholorganisation erforderlich wird.
Dieses Buch beruht auf den langjährigen Erfahrungen der Autoren, die als Flugmediziner der Deutschen Lufthansa täglich über die Transportfähigkeit von verunglückten und erkrankten Flugreisenden entscheiden müssen. Es soll Ärzten und Flugreisenden eine Hilfe sein, die Besonderheiten und Belastungen von Reisen im Flugzeug zu verstehen und die Tücken und Fallstricke gerade bei Vorerkrankungen zu vermeiden. Werden die hier niedergelegten Erfahrungen und die wichtigsten gesetzlichen Regeln berücksichtigt, steht einer unbeschwerten Reise nahezu nichts mehr im Wege.
In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern wunderschöne Flugreisen und stets eine gesunde und glückliche Heimkehr.
Prof. Dr. Uwe Stüben
Vorwort zur 2. Auflage
Der kommerzielle Luftverkehr transportiert weltweit pro Jahr etwa 3 Milliarden Menschen zwischen Ländern und Kontinenten in immer größeren Düsenstrahlflugzeugen, die theoretisch bis zu 839 Menschen Platz bieten (Airbus A 380-800 in maximaler Sitzkonfiguration). Mit modernen Langstrecken- und Ultralangstreckenflugzeugen können Entfernungen von bis zu 19.000 km zurückgelegt und Nonstop-Flugzeiten von mehr als 18 Stunden erreicht werden.
Flugreisen sind dadurch immer kostengünstiger geworden und heute nahezu für jeden erschwinglich. Durch die zunehmende Globalisierung sind große Unternehmen weltweit tätig, oft mit Niederlassungen auf verschiedenen Kontinenten. Die dafür zwingend notwendige Mobilität für die vielen Geschäftsreisenden wird durch die zivile Luftfahrtindustrie garantiert.
Familien sind dadurch häufig über verschiedene Kontinente verteilt wohnhaft. Auch hier besteht ein hohes Bedürfnis, zusammenzufinden und Kontakte zu pflegen: Dadurch ist der Anteil älterer, gebrechlicher, oft auch chronisch kranker oder behinderter Passagiere stetig gestiegen.
Dieses stellt die Fluggesellschaften vor große Herausforderungen, da durch die Antidiskriminierungsgesetzgebung in Europa und in den USA eine Klärung der gesundheitlichen Flugreisetauglichkeit dieser Passagiere durch die Fluggesellschaften bzw. deren Ärzte im Vorfeld der Reise oft nicht mehr erlaubt ist. Eine zunehmende Zahl medizinischer Zwischenfälle während eines Fluges ist deswegen zu erwarten, sodass ärztliche Hilfe in solchen Situationen an Bord eines Flugzeuges häufiger gebraucht werden wird.
Um den helfenden Ärztinnen und Ärzten an Bord für die Versorgung von medizinischen Notfällen im Reiseflug die notwendigen flugmedizinischen und flugbetrieblichen Informationen zur Verfügung zu stellen, wurde 2007 die erste Auflage des Taschenbuch Flugmedizin vorgelegt. Die rasche Entwicklung in den zurückliegenden Jahren, sowohl in der Verkehrsfliegerei und den damit verbundenen Regularien als auch in der Medizin, machte eine gründliche Überarbeitung und Neuauflage des Taschenbuch Flugmedizin notwendig.
Obwohl erneut der Großteil der Autoren aus den Reihen des Medical Services & Health Management der Lufthansa Group stammt, sind die geschilderten Rahmenbedingungen an Bord von Verkehrsflugzeugen mit denen anderer Gesellschaften vergleichbar.
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und hoffen, dass unser Buch Ihnen Hilfe und Sicherheit gibt, in einem medizinischen Zwischenfall an Bord eines Verkehrsflugzeuges souverän zu reagieren!
Prof. Dr. Uwe Stüben und Prof. Dr. Jürgen Graf
Frankfurt am Main, im Oktober 2013
Vorwort zur 3. Auflage
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
es gibt einige wenige Orte, die im Rahmen von medizinischen Notfällen noch schlechter zu erreichen sind, als ein Verkehrsflugzeug. Dort halten sich allerdings im Vergleich zur zivilen Luftfahrt einerseits weniger Menschen auf und andererseits sind oftmals spezifische Vorkehrungen für einen medizinischen Notfall getroffen, um in isolierten Umgebungen gezielt medizinische Maßnahmen durchzuführen.
Obschon es auch in der zivilen Luftfahrt Vorkehrungen für die Versorgung medizinischer Notfälle gibt, sind diese vielen mitreisenden Medizinern und medizinischem Fachpersonal nicht geläufig. Gleiches gilt für die besonderen Bedingungen an Bord und auch für luftverkehrsspezifische Regelungen im Falle von medizinischen Zwischenfällen an Bord.
Mit dem vorliegenden Buch möchten wir aus einer medizinischärztlichen Perspektive auf einige physikalische und organisatorische Besonderheiten einer Flugzeugkabine hinweisen, Regelungen des weltweiten Flugbetriebs darstellen sowie Informationen zu einer Reihe von wiederkehrenden Symptomen bzw. Krankheitsbildern an Bord eines Flugzeugs vermitteln.
Für eine möglichst optimale Hilfe bei medizinischen Notfällen an Bord von Luftfahrzeugen ist es immens wichtig, diese Gegebenheiten überhaupt zu kennen. Des Weiteren sollen die Informationen aus diesem Buch helfen, Therapiemöglichkeiten bei Notfällen aufzuzeigen, um somit die medizinische Hilfe zu optimieren.
Notfälle an Bord von Flugzeugen sind nicht sehr ungewöhnlich, aber besonders. Daher wünschen wir den Lesern viele wichtige Impulse und hoffen, dass das Buch eine Hilfestellung beim nächsten Notfall ist.
Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Thomas Schmitt vom Medical Services & Health Management der Lufthansa Group, der das Werk mit seiner Expertise und aus der Sicht einer der größten Fluggesellschaften weltweit bereichert hat.
An dieser Stelle wollen wir auch Herrn Prof. Uwe Stüben, Mentor vieler Flugmediziner in Deutschland und Europa und als langjähriger Leiter des Medizinischen Dienstes der Deutschen Lufthansa Begründer und Begleiter des Taschenbuch Flugmedizin bis in die 3. Auflage, Dank und Anerkennung zollen!
Ursprünglich entstanden ist das Werk auf Idee und Initiative des Gründers und Verlegers der Medizinisch Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft, Herrn Dr. Thomas Hopfe, ein Visionär und Entrepreneur im medizinischen Verlagswesen, der die Herausgeber und Autoren über alle Auflagen dieses Buches (und vieler anderer Werke!) mit Empathie, Sachverstand, Konsequenz und nicht zuletzt fachlichem wie freundschaftlichem Rat jederzeit unterstützt hat!
Prof. Dr. Jürgen Graf und Univ.-Prof. Dr. Jochen Hinkelbein
im Juli 2024
Inhalt
IBasiswissen Flugmedizin
1Die DruckkabineChristoph Ernst
1.1Einführung
1.2Luftzufuhr
1.3Temperaturregulierung
1.4Luftfeuchtigkeit während des Fluges
1.5Druckabfall in der Kabine
1.6Die Gasgesetze
1.7Höhenstrahlung
1.8Luftqualität und Filterung
1.9Raumangebot und Mobilität
2Medizinische Ausrüstung an BordJan Schmitz
2.1Telemedizin
2.2Medizinische Ausstattung von Flugzeugen
2.3Rechtliche Situation für die medizinische Ausstattung von Flugzeugen
3Möglichkeiten und Grenzen von diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen an BordMirko Miesen
3.1Raum
3.2Lärm
3.3Vibration, Bewegungen und Turbulenzen
3.4Arzt an Bord?
3.5Dokumentation von medizinischen Notfällen an Bord
3.6Crew Ressource Management (CRM)
3.7Diversion (Flugumleitung) aus medizinischen Gründen
3.8Regelwerke zur Beförderung von kranken Passagieren
4Gesundheit und Fliegen – rechtliche AspekteWolf Müller-Rostin
4.1Haftung bei ärztlichen Hilfeleistungen an Bord eines Flugzeuges
4.2Honoraranspruch des Arztes, der hilfeleistenden Person
4.3Mögliche Verbreitung ansteckender Krankheiten im Flugzeug – rechtliche Aspekte
4.4Wachsende Rolle des Arztes in Luftfahrtprozessen – Büttel der Rechtsanwälte?
4.5Das sog. „Economy-Class-Syndrom“
IISpezifische gesundheitliche Risiken auf Flugreisen
1Dauermedikationen an Bord von FlugzeugenFelix Liebold
1.1Häufige Dauermedikationen
1.2Rechtliche Rahmenbedingungen für Medikamente und Spritzen
1.3Gesonderte Lagerung von Arzneimitteln
1.4Flugreisen und Tauchen Stefanie Jansen
2Reisetauglichkeit von Flugpassagieren bei vorbestehenden und chronischen KrankheitenThorsten Onno Bender, Felix Hohendanner und Lukas Dehé
2.1Allgemeine Empfehlungen
2.2Augenerkrankungen
2.3Zahnerkrankungen
2.4Hals-, Nasen- und Ohrenerkrankungen
2.5Thromboseneigung/Venenthrombose
2.6Bluterkrankungen
2.7Herz-Kreislauf-Erkrankungen
2.8Lungenerkrankungen
2.9Infektionserkrankungen
2.10Gastrointestinale Erkrankungen
2.11Nierenerkrankungen
2.12Stoffwechselerkrankungen
2.13Neurologische Erkrankungen
2.14Psychiatrische Erkrankungen
2.15Operationen
3Besondere Personengruppen und medizinische FlugreisetauglichkeitChristopher Neuhaus
3.1Passagiere mit kognitiven Einschränkungen
3.2Evaluation potenzieller Risiken von Personen mit kognitiven Einschränkungen
3.3Flugreisen und Schwangerschaft Niels-Benjamin Adams
3.4Besonderheiten bei der Reisetauglichkeit von (Klein-)Kindern Frank Eifinger
IIIManagement medizinischer Notfälle an Bord
1Reanimation an Bord – In-Flight Cardiac Arrest (IFCA)Tobias Warnecke
1.1Vorbereitung, Equipment und Allgemeines
1.2Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrtmedizin (DGLRM)
1.3Phasen der Reanimation
1.4Atemwegsmanagement
1.5Medikamentöse Therapie
1.6Postreanimationsbehandlung
1.7Kommunikation mit der Crew und Entscheidungsfindung
1.8Abbruch der Reanimation
1.9Seltene Spezialfälle der Reanimation
1.10Dokumentation und rechtliche Aspekte
2Management von Notfallsituationen bei Fluggästen in psychischen AusnahmesituationenTheresa Lichtenstein
2.1Akute Erregungszustände
2.2Management des Erregungszustandes an Bord
2.3Fixierung und Zwangsmedikation an Bord eines Flugzeuges
2.4Angst und Panik an Bord
2.5Psychisch bedingte Notfälle durch Alkohol, Medikamente und Drogen
3Management von Hals-Nasen-Ohren-Notfällen und Problemen bei der Anpassung an LuftdruckänderungenMoritz Meyer
3.1Barotrauma des Ohres
3.2Barotrauma der Nase und der Nasennebenhöhlen
3.3Fliegen bei stattgehabter Ohroperation
4Kardiovaskuläre Notfälle an BordIrene Hufnagel
4.1Kreislaufkollaps und Bewusstlosigkeit – Ersteinschätzung und Notfallmanagement
4.2Hypertensive Krise
4.3Akut auftretender Brustschmerz
4.4Lungenarterienembolie
4.5Akutes Koronarsyndrom
4.6Komplikationen mit Herzschrittmacher und Implantiertem Cardioverter-Defibrillator (ICD)
5Management bei akuter Atemnot und in pulmonalen NotfallsituationenFelix Liebold
5.1Unspezifische, akut auftretende Atemnot – Ersteinschätzung und Notfallmanagement
5.2Asthma bronchiale
5.3Bolusgeschehen Niels-Benjamin Adams
5.4Pneumothorax Niels-Benjamin Adams
6Notfallmanagement bei akut auftretenden Abdominalschmerzen und KolikenElke Roeb
6.1Abdominalschmerzen und Koliken
6.2Notfallmanagement bei Verdacht auf Intoxikation durch Lebensmittel
7Neurologische Notfallsituationen an BordSarah C. Reitz
7.1Schlaganfall
7.2Akute Hypoglykämie
7.3Epileptischer Anfall
7.4Akuter Bandscheibenvorfall (BSV)
8Management von starken Schmerzen an BordJan Schmitz
8.1Unfälle und Traumata
8.2Verbrühungen/Verbrennungen
8.3Zahnschmerzen
9Management von Notfällen durch Alkohol, Medikamente und DrogenGeorg Dultz
9.1Intoxikation durch Alkohol und Medikamente
9.2Alkoholentzugssyndrom
9.3Drogennotfälle
10Management von Notfällen bei KindernFrank Eifinger und Sirin Yücetepe
10.1Krampfanfälle beim Kind
10.2HNO-ärztliche Notfälle im Kindesalter
10.3Abdominelle Beschwerden beim Kind
10.4Bewusstlosigkeit beim Kind
Das Lufthansa Programm „Doctor On Board“
Sachwortverzeichnis
IBasiswissen Flugmedizin
1Die DruckkabineChristoph Ernst
1.1Einführung
Moderne Verkehrsflugzeuge fliegen in Höhen bis zu 43.000 ft, das entspricht etwa einer Höhe von 13.000 m. Während am Boden unter Standardbedingungen ein Luftdruck von 1.013 hPa herrscht, halbiert sich der Luftdruck in einer Höhe von 18.000 ft (5.500 m) und beträgt in einer Höhe von 36.000 ft lediglich noch ein Viertel des Ausgangsdruckes am Boden. Ähnlich verhält es sich mit der Temperatur. Unter Standardverhältnissen beträgt diese in Meereshöhe 15°C und nimmt um 2°C pro 1.000 ft ab.
3 ft entsprechen etwa 1 m und 1 ft entspricht etwa 0,3 m.
In einer Höhe von 36.000 ft beträgt die statische Außentemperatur dann nur noch –53°C. Die Abbildung 1 zeigt den exponentiell abnehmenden atmosphärischen Druck in Abhängigkeit von der Höhe über dem Meeresspiegel.
Unter diesen lebensfeindlichen Bedingungen ist die Druckkabine die Voraussetzung für einen sicheren und komfortablen Flug. Die Druckkabine kann als eine druckfeste Bauform von Passagierkabine, Cockpit und Frachträumen bezeichnet werden. Sie ermöglicht das Aufrechterhalten einer konstanten und angenehmen Umgebungsatmosphäre in einer sonst lebensfeindlichen Umgebung.
Abb. 1 Atmosphärischer Druck in großer Höhe
Die Druckkabine in einem Flugzeug ermöglicht das Aufrechterhalten einer konstanten und angenehmen Umgebungsatmosphäre in einer sonst lebensfeindlichen Umgebung.
Der Kabinendruck wird während des Fluges weitgehend automatisch gesteuert. Einflussfaktoren auf die Steuerung sind neben vielen technischen Faktoren die Höhe des Startflugplatzes, die Höhe des Zielflughafens und die Flughöhe während des Reisefluges. In der Regel sind zwei redundante Steuereinheiten für die Steuerung des Kabinendruckes zuständig, die sich im Falle einer Fehlfunktion automatisch ersetzen können. Neben der Automatik ist es den Piloten ebenfalls möglich, den Kabinendruck auch manuell zu regeln.
Die Kabinendrucksteuerung regelt den Kabinendruck in Abhängigkeit von der Flughöhe und dem herrschenden Außendruck und stellt sicher, dass der zulässige Differenzdruck, eine durch die Bauform der Kabine vorgegebene Größe, nicht überschritten wird. Abbildung 2 zeigt exemplarisch die Veränderung des Kabinendruckes in Abhängigkeit von der Flughöhe und der Flugphase.
Abb. 2 Verlauf des Kabinendruckes mit der Flughöhe und der Flugphase
Der Kabinendruck wird technisch über ein Ventil, das sog. outflow valve, in der Flugzeugaußenhaut reguliert. Während der Zustrom von Frischluft über die Klimaanlage weitgehend konstant ist, bestimmt man über die Öffnung des outflow valve den resultierenden Kabinendruck. Das outflow valve ist zumeist am Heck des Flugzeuges angebracht und ist beim Einsteigen über das Vorfeld gut in der Flugzeugaußenhaut zu erkennen.
Am Boden ist dieses Ventil in der Regel vollständig geöffnet und die Luft der Klimaanlage kann ungehindert ausströmen. In diesem Fall entspricht der Kabineninnendruck dem Außendruck und nur in diesem Zustand ohne Druckdifferenzen zwischen Außen und Innen können die Türen des Luftfahrzeuges gefahrlos geöffnet werden. Für den Fall einer bestehenden Druckdifferenz werden die Flugbegleiter durch eine Warnleuchte in der Tür gewarnt, den Druckabbau abzuwarten und die Tür nicht zu öffnen. Dies könnte zu schweren Verletzungen durch plötzliches und abruptes Aufschwingen der Tür führen.
Mit dem Setzen des Startschubes auf der Startbahn beginnt die Automatik bis zur Landung mit der automatischen Regulation des Kabinendruckes. Dabei wird die Öffnung des outflow valve so verändert, dass der gewünschte Druck innerhalb der Flugzeugkabine erreicht wird. In Reiseflughöhe herrscht dann ein Kabineninnendruck von etwa 8.000 ft, etwa 2.400 m maximal, in modernen Flugzeugen weniger.
Für den technisch Interessierten kann man die Funktionsweise vereinfacht so erklären: Während Start und Landung wird die Kabinenhöhe leicht unter das Flugplatzniveau abgesenkt. Das bedeutet, dass der Kabinendruck minimal erhöht wird, das outflow valve schließt sich geringfügig. Diese Druckerhöhung dient dazu, als unangenehm empfundene Druckschwankungen während der Start- und Landephase zu vermeiden. Im anschließenden Steigflug muss die Kabinenhöhe steigen, das bedeutet, der Luftdruck in der Kabine sinkt, das outflow valve wandert in eine etwas weiter geöffnete Position. Im Reiseflug besteht ein relativer Kabinenüberdruck und die Kabinenhöhe beträgt etwa 8.000 ft, entsprechend 2.400 m. Unter stabilisierten Bedingungen mit konstanter Kabinenhöhe ist die Luftmenge, die durch das Auslassventil fließt, gleich der Luftmenge, die von der Klimaanlage geliefert wird, das Auslassventil ist teilweise geöffnet. Im Sinkflug muss die Kabinenhöhe wieder sinken, das Auslassventil schließt etwas mehr. Es folgt die sukzessive Anpassung des Druckes an die Höhe des Zielflughafens.
1.2Luftzufuhr
Bei nahezu allen Verkehrsflugzeugen wird die Luft für die Klimaanlage aus den Triebwerken entnommen (sog. „Zapfluft“). Moderne Strahltriebwerke haben zwei voneinander getrennte Turbinen- und Kompressorsysteme. Ein System liegt zentral und beinhaltet die Brennkammer, in der der verdichteten Luft Kerosin zugesetzt und anschließend gezündet wird. Damit wird die Energie zur Schuberzeugung geliefert. Etwa 20% der Luft durchströmen diesen inneren Teil. Ein zweites, äußeres Turbinen- und Kompressorsystem erzeugt mit 80% den hauptsächlichen Schub, es ist von der Brennkammer getrennt, wird aber vom Abgasstrom des inneren Systems angetrieben. Aus diesem Bereich des Triebwerkes wird die Luft für die Klimaanlage abgezapft. Die Luft ist etwa 200°C heiß und steht unter einem Druck von mehreren bar. Über Umwandler und Kühler wird sie schließlich der Klimaanlage zugeleitet.
1.3Temperaturregulierung
Die Klimaanlage regelt am Boden und während des Fluges die Frischluftzufuhr an Bord. Generell kann man sagen, dass Frischluft in einem Flugzeug unidirektional von oben über Auslässe und Luftdüsen der Kabinenbelüftung zugeführt wird und im Bereich des Bodens die Kabine verlässt. Von dort wird die Luft über ein Rohrsystem entweder erneut in die Zirkulation der Kabine gespeist oder in die Frachträume geleitet, um diese zu belüften und zu klimatisieren. Ähnlich wie bei der Umluft-Einstellung im Auto wird nicht die gesamte Luft im Flugzeug ausgetauscht. Je nach Einstellung im Cockpit und Bauart des Flugzeuges wird ein vorgewählter Teil der Luft rezirkuliert und erneut der Kabine zugeführt. Meist ist dies ein Anteil von 60% Frischluft von außen. Dabei ist die Temperatur vom Cockpit aus und je nach Bauart und Hersteller des Flugzeuges teilweise auch aus der Kabine einstellbar. Neuere Verkehrsflugzeuge lassen eine unterschiedliche Einstellung für verschiedene Kabinenzonen zu, beispielsweise für die First Class und die Economy Class. Die Temperatursteuerung ist ebenfalls redundant aufgebaut und gewährleistet auch beim Ausfall mehrerer Komponenten noch eine Temperierung, jedoch meist mit weniger Eingriffsmöglichkeiten. Für die Frachträume ist im Besonderen bei Langstreckenflugzeugen ebenfalls eine Temperatureinstellung möglich. Je nach Art der Fracht kann der Frachtraum beheizt oder gekühlt werden.
1.4Luftfeuchtigkeit während des Fluges
Die Luftfeuchtigkeit in Verkehrsflugzeugen ist sehr niedrig. Sie erreicht zum Teil nicht einmal 10–15%. Der Grund dafür liegt in der Flughöhe und der damit verbundenen kalten Außenluft. Je kälter die Luft, desto geringer ist ihre Kapazität, Feuchtigkeit aufzunehmen. In dieser trockenen Kabinenluft kommt der Perspiratio der Fluggäste über die Atemluft eine besondere Bedeutung zu. In den Kabinenklassen mit geringer Bestuhlung (First Class) kann die Feuchte unter Umständen bei nur 5% liegen, während sie in Richtung Heck, bei dichterer Bestuhlung und höherer Passagierdichte, bis auf 15% ansteigen kann. Je nach Flugzeugmuster und Airline wird in der First Class die Luftfeuchtigkeit künstlich erhöht.
Die Luftfeuchtigkeit in Verkehrsflugzeugen beträgt während des Reisefluges meist 10–15%.
Beim Dreamliner, der Boeing 787, soll die Luftfeuchtigkeit rund 5% höher sein als bei anderen Langstreckenflugzeugen. Der Grund hierfür liegt in einem alternativen Verfahren zur Kabinendruckerzeugung. Der Dreamliner zapft die Luft für die Klimaanlage nicht aus den Triebwerken ab, sondern entzieht sie der umgebenden Luftströmung und verdichtet sie mithilfe elektrischer Kompressoren.
Die trockene Luft kann für Crew und Passagiere unangenehm sein und trockene Schleimhäute, trockene Augen und Kratzen im Hals hervorrufen. Gerade auf langen Flugreisen kann es so vermehrt zum Verlust von Flüssigkeit über die Perspiratio kommen. Daher wird generell empfohlen, auf Flugreisen ausreichend viel zu trinken.
1.5Druckabfall in der Kabine
Kommt es zu einem Druckabfall in der Kabine, kann dies entweder plötzlich oder schleichend erfolgen. Ein plötzlicher Druckverlust ist meist die Folge eines Strukturschadens, wie eines defekten Fensters, während ein schleichender Druckverlust beispielsweise durch defekte Dichtungen oder einen Ausfall der Klimaanlage verursacht sein kann.
Bei einem plötzlichen Abfall des Kabinendruckes kommt es schlagartig zum Druckausgleich mit der Umgebungsluft. Dies ist meist von einer lauten Luftströmung und unter Umständen mit Kondensation von Wasser und Nebelbildung begleitet.
In diesem Fall muss die Cockpitbesatzung umgehend einen Notsinkflug einleiten, um eine Flughöhe zu erreichen, in der den Passagieren ein Atmen ohne zusätzlichen Sauerstoff möglich ist (meist 10.000 ft).
Um die Versorgung der Passagiere und der Crew im Falle eines Druckverlustes mit Sauerstoff zu gewährleisten, sind auf Passagierflugzeugen Sauerstoffsysteme verbaut, die der Versorgung während eines Druckabfalles dienen.
Generell muss auf Flügen oberhalb einer Flughöhe von 25.000 ft eine Demonstration der Handhabung des Systems durch die Flugbegleiter erfolgen. Die Flugsicherheitsbehörde EASA schreibt die Versorgung mit Sauerstoff oberhalb einer Kabinenhöhe von 14.000 ft verpflichtend vor. Darunter gelten abweichende Vorschriften. Die Systeme, die in Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen verbaut sind, sind in der Regel Sauerstoffgeneratoren, die den Atemsauerstoff chemisch generieren.
Nach Öffnen einer Klappe muss dieser Generator manuell, im Allgemeinen durch Ziehen an der Maske, mechanisch aktiviert werden. Dann fließt je nach Bauart für etwa 20 Minuten Sauerstoff, der über die Maske eingeatmet werden kann. Dabei erzeugt der Generator thermische Energie, er wird warm.
Innerhalb dieser Zeit muss die Cockpitbesatzung einen Notsinkflug einleiten, der in einer sicheren Flughöhe endet. In Mitteleuropa ist dies zumeist eine Höhe von 10.000 ft, etwa 3.000 m. Dort kann die Maske abgesetzt und normal geatmet werden.
Auf Langstreckenflügen kann es die Besonderheit geben, dass eine sichere Flughöhe nicht innerhalb der Betriebszeit des Sauerstoffgenerators erreicht werden kann. Dies ist im Besonderen auf der Luftstraße L888 im Gebiet des Himalayas der Fall. Dort sind nach einem Notsinkflug aufgrund des Geländes häufig immer noch Flughöhen oberhalb von 20.000 ft notwendig. Außerdem dauert der Aufenthalt in diesen Flughöhen häufig länger als 20 Minuten und kann daher nicht mit Sauerstoffgeneratoren überbrückt werden. Diese Verkehrsflugzeuge haben eingebaute Sauerstoffflaschen und gewährleisten die Versorgung der Passagiere im Falle eines Druckverlustes über diese Flaschen.
1.6Die Gasgesetze
Während einer Flugreise kommt den Gasgesetzen eine besondere Bedeutung zu, sie werden im Folgenden näher erklärt.
Kommt es im Steigflug des Flugzeuges zu einer Abnahme des Umgebungsdruckes, wie vorher besprochen beispielsweise in einer Flughöhe von 5.500 m auf die Hälfte des Ausgangsdruckes, so dehnt sich das Gas um das Doppelte aus. Bei Lufteinschlüssen in Körperhöhlen oder Hohlorganen können sich schmerzhafte Auswirkungen ergeben. Der Druckausgleich kann beispielweise bei einer Erkältung erschwert oder unmöglich sein, mit den damit verbundenen Organkonsequenzen. Ebenso sind gastrointestinale Beschwerden möglich.
Eine konstante Temperatur und konstante Feuchtigkeit angenommen, sinkt im Steigflug der Luftdruck und damit bei gleicher prozentualer Zusammensetzung der Luft auch der Sauerstoffpartialdruck. Unter normalen atmosphärischen Bedingungen lässt sich in Meereshöhe an der Sauerstoffbindungskurve eine Sauerstoffsättigung von 97% beim Gesunden ablesen. In einer Kabinendruckhöhe von 8.000 ft oder 2.400 m erfolgt ein Abfall der Sauerstoffsättigung auf etwa 92% (s. Abb. 3). Dies ist für durchschnittlich gesunde Passagiere ohne Schwierigkeiten zu kompensieren.
Abb. 3 Abfall der Sauerstoffsättigung in großer Höhe
Die Geschwindigkeit der rein passiv ablaufenden pulmonalen Gasdiffusion bestimmt sich aus dem Druckgradienten zwischen beiden Kompartimenten und der Dicke und Permeabilität der Grenzmembranen sowie der Molekülgröße des diffundierenden Stoffes. So kommt es bei Lungenerkrankungen mit verdickten Alveolarmembranen und reduzierter Oberfläche zu einer Reduktion des arteriellen pO2 und der Sauerstoffsättigung. Das Gesetz von Dalton ist aus diesen Gründen für die Beurteilung der Flugreisetauglichkeit von vorerkrankten Personen von großer Bedeutung.
Das Henry’sche Gasgesetz ist in der Flugreisemedizin nur von untergeordneter Bedeutung. Seine Auswirkungen sind in der täglichen Praxis selten. Den Tauchern sollte es geläufiger sein, da es die Entstehung der Tauchkrankheit erklärt (Caisson-Krankheit).
1.7Höhenstrahlung
Als Höhenstrahlung bezeichnet man die Gesamtheit von hochenergetischen Teilchen, die aus den Tiefen des Kosmos stammen und mit Bestandteilen der Atmosphäre kollidieren. Dabei entstehen neue atomare Teilchen mit hoher Energie. Generell kann man sagen, dass die Belastung durch Höhenstrahlung von der geografischen Breite der Flugroute, der Flughöhe, der Flugdauer und der Sonnenaktivität abhängig ist. Dabei führen Routen in Polnähe zu einer höheren Strahlenbelastung als Nord-Süd-Routen.
Das Bundesamt für Strahlenschutz gibt die durchschnittliche Belastung durch Höhenstrahlung auf einem Flug von Frankfurt nach San Francisco mit 45– 110 Mikrosievert an, auf einer Nord-Süd-Route von Frankfurt nach Johannesburg sind es nur 18–30 Mikrosievert. Der Schwankungsbereich geht hauptsächlich auf den Sonnenzyklus und die Flughöhe zurück. Im Vergleich dazu beträgt die effektive jährliche Strahlenbelastung aus der natürlichen Strahlenexposition in Deutschland etwa 2.100 Mikrosievert.
Für den einzelnen Passagier ist die Belastung durch Höhenstrahlung in der Regel zu vernachlässigen. Für Vielflieger oder Crews können sich die Belastungen durch Strahlung jedoch addieren. Eine individuelle Ermittlung und Aufzeichnung der Strahlenbelastung ist für das fliegende Personal vorgeschrieben, kann aber auch mit Online-Tools individuell für den einzelnen Passagier berechnet werden, wenn Datum, Flugroute und Flughöhe bekannt sind.
Für Schwangere innerhalb des ersten Trimenons wird Zurückhaltung empfohlen. Gesicherte Erkenntnisse über eine eventuelle Fruchtschädigung liegen bisher nicht vor. Für Flugbegleiterinnen und Pilotinnen gilt in der Bundesrepublik Deutschland das Mutterschutzgesetz, das den weiteren fliegerischen Einsatz während der Schwangerschaft verbietet.
1.8Luftqualität und Filterung
Die Erde ist von einer Ozonschicht umgeben, deren Maximum in einer Höhe von 15 km bis 50 km liegt. Die Ausdehnung der Ozonschicht ist variabel und besonders im Frühjahr und Herbst kann es auch in niedrigeren Flughöhen zu einer Belastung der Kabinenluft mit Ozon kommen. Dann könnte es zum Überschreiten des MAK-Wertes (maximale Arbeitsplatzkonzentration) sowie des Werts für Kurzzeitexposition kommen. Um dies zu verhindern, sind moderne Verkehrsflugzeuge mit Ozon-Konvertern ausgestattet, die über 90% des Ozons aus der Kabinenluft eliminieren können.
Neben den Ozon-Konvertern haben die meisten größeren Verkehrsflugzeuge hocheffiziente Filtersysteme





























