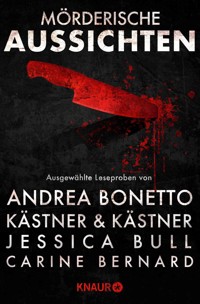9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Wasserschutzpolizei Hamburg
- Sprache: Deutsch
Hafen meets Kiez: Fall 3 für die Wasserschutzpolizei Hamburg »Tatort Hafen – Die letzte Fähre nach Dockland« ist der 3. Band der Hamburger Krimi-Reihe um die Wasserschutzpolizei: Hochspannung mit Regio-Flair und True-Crime-Elementen. Spät am Abend nimmt Melanie Cullmann die letzte Fähre nach Dockland und bittet ihren Mann Fred, sie am Anleger abzuholen. Sie hat ein ungutes Gefühl – zu Recht, wie sich herausstellt: Melanie kommt nie an, die Polizei kann nur noch ihre Leiche aus dem Hafenwasser bergen. Jonna Jacobi übernimmt die Ermittlungen, muss jedoch bald feststellen, dass niemand an Bord der Fähre etwas gesehen hat. Dafür scheint Fred Cullmann etwas zu verschweigen; jede Betreuung durch Charlotte Severin vom Opferschutz lehnt er vehement ab. Erst von Melanies Kollegen am Eurocon Containerterminal, dem pulsierenden Herzen des Hamburger Hafens, erfährt Jonna einige brisante Details: Offenbar hatte Melanie Kenntnisse, die für kriminelle Organisationen kaum mit Geld aufzuwiegen sind. War sie Täterin, Mitwisserin – oder ist sie jemandem zu nahe gekommen? Wasserschutzpolizist Tom Bendixen beschließt, seinen besten Mitarbeiter als Zivilfahnder auf das Terminal zu schleusen. Während die Ermittlungen stocken, zeigt sich, dass der Ehemann der Toten keineswegs so harmlos ist, wie es den Anschein hat. Getrieben von dem Verlust, schwört er Rache. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem Tom und Jonna den Täter finden müssen, bevor der verzweifelte Witwer das Gesetz in die eigenen Hände nimmt. Doch weder Tom noch Jonna können ahnen, mit wem sie es wirklich zu tun haben … Hamburg-Krimi mit Insider-Einblicken in die faszinierende Welt des Hafens – und die kriminelle Unterwelt des Kiezes Autorin und Psychologin Angélique Kästner und Hauptkommissar a.D. der Wasserschutzpolizei Andreas Kästner garantieren authentische Ermittlungen und Fälle, die sich bis ins letzte Detail echt anfühlen. Die Krimi-Reihe um die Wasserschutzpolizei Hamburg ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Tatort Hafen – Tod an den Landungsbrücken - Tatort Hafen – Tod im Schatten der Elbflut - Tatort Hafen – Die letzte Fähre nach Dockland
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kästner & Kästner
Tatort Hafen
Die letzte Fähre nach Dockland
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Spät am Abend nimmt Melanie Cullmann die letzte Fähre nach Dockland und bittet ihren Mann Fred, sie am Anleger abzuholen. Sie hat ein ungutes Gefühl – zu Recht, wie sich herausstellt: Melanie kommt nie an, die Polizei kann nur noch ihre Leiche aus dem Hafenwasser bergen.
Jonna Jacobi übernimmt die Ermittlungen, muss jedoch bald feststellen, dass niemand an Bord der Fähre etwas gesehen hat. Dafür scheint Fred Cullmann etwas zu verschweigen; jede Betreuung durch Charlotte Severin vom Opferschutz lehnt er vehement ab. Erst von Melanies Kollegen am Eurocon Containerterminal, dem pulsierenden Herzen des Hamburger Hafens, erfährt Jonna einige brisante Details: Offenbar hatte Melanie Kenntnisse, die für kriminelle Organisationen kaum mit Geld aufzuwiegen sind. War sie Täterin, Mitwisserin – oder ist sie jemandem zu nahe gekommen? Wasserschutzpolizist Tom Bendixen beschließt, seinen besten Mitarbeiter als Zivilfahnder auf das Terminal zu schleusen.
Während die Ermittlungen stocken, zeigt sich, dass der Ehemann der Toten keineswegs so harmlos ist, wie es den Anschein hat. Getrieben von dem Verlust, schwört er Rache. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem Tom und Jonna den Täter finden müssen, bevor der verzweifelte Witwer das Gesetz in die eigenen Hände nimmt. Doch weder Tom noch Jonna können ahnen, mit wem sie es wirklich zu tun haben …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Motto
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Glossar
Dank
Ausblick auf Band 4
Leseprobe »Der Fluch vom Moldauhafen«
Unter der Köhlbrandbrücke fließen Schicksale.
Kapitel 1
Sie hatte kräftig in die Pedale getreten und erreichte den Fähranleger Waltershof einige Minuten zu früh. Trotz der kühlen Brise der Aprilnacht schwitzte sie. Mit zitternden Händen öffnete sie den Reißverschluss ihrer Jacke und kettete das Fahrrad am Fahrradständer oberhalb des Anlegers an. Sie hatte gehofft, dass die körperliche Anstrengung das Feuer in ihrem Inneren ersticken würde, aber stattdessen brannten ihre Muskeln vor Erschöpfung, und ihre Beine waren bleischwer.
Tief atmete sie die Nachtluft ein, die seit einigen Tagen die kneifende Kühle des Winters verloren hatte und Hoffnung auf den nahenden Frühling hinterließ. Die letzte Fähre Richtung Dockland war noch nicht zu sehen, und so schlenderte sie bis zum Ende des betonierten Anlegers. Mit jedem Schritt hallten das Echo der langen Spätschicht und die Auseinandersetzung mit ihrem Kollegen in ihr nach.
Es hatte Probleme mit der Containerreihung auf dem Terminal gegeben. Ihr neuer Kollege war nicht nur jung, sondern auch sehr von sich überzeugt. Er plante seine Karriere genau und rannte alles um, was sich ihm in den Weg stellte. Ihr war es recht, umso schneller wäre sie ihn wieder los. Nur sollte sein Aufstieg nicht auf ihre Kosten gehen. Mit Sicherheit hatte sie den Container nicht an die falsche Position bringen lassen, das war sein Fehler gewesen. Der Container war für Oslo bestimmt und nun auf einem Schiff gelistet, das nach Istanbul fuhr. Ein katastrophaler, weil teurer Schnitzer! Benjamin hatte ihre Aufregung mit einem herablassenden Grinsen abgetan und angeboten, das Missverständnis mit ihr zusammen bei einem Gläschen Wein und einer Pizza auszuräumen. Er kenne da einen netten Italiener. Dabei hatte er die Frechheit besessen, ihr den Po zu tätscheln und sich so nah an sie heranzudrängen, dass ihr vom Geruch seines Herrenparfüms übel wurde.
Unfassbar. Beides.
Noch nie in ihrer langjährigen Arbeit auf dem Eurocon-Terminal war ihr ein solcher Fehler unterlaufen. Sie war geradezu zwanghaft perfektionistisch, und das zahlte sich in ihrem Job aus. Sie war die beste Disponentin hier im Central-Planning. Dem Platz im Hafen, der die Container dahin brachte, wo sie hinsollten. Da brauchte er sich mit seinem weißen Hemd, der Anzughose mit Bügelfalte und den polierten Schuhen gar nicht vor ihr aufzubauen und überheblich zu grinsen. Und überhaupt, wer trug schon Anzug im Hafen. Lächerlich!
Melanie zog die Jacke wieder enger um sich und verschob den drückenden Rucksack ein wenig, als die Erinnerung an sein »Ach komm, Melle, du biegst das doch im Handumdrehen gerade« sie frösteln ließ. Für diesen Widerling war sie immer noch Melanie. Klar war der Ton im Hafen rau, damit konnte sie umgehen. Aber kein Kollege hatte sie je auf diese Art begrapscht. Und fachlich war er auch ein Idiot. Der hatte nicht die geringste Ahnung, wie schwierig es war, den Container zurückzuholen. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, und sie schüttelte unwirsch den Kopf. Jetzt bloß nicht heulen.
Am Himmel verblassten die aquarellfarbenen Blautöne und kündigten damit die Nacht an. Der unverstellte Blick vom Ende des Anlegers auf die in der Dämmerung beleuchtete Köhlbrandbrücke lenkte sie für einen Moment vom Grübeln ab.
Die Schrägseilbrücke mit den beiden Pylonen strahlte eine erhabene Macht aus, die Melanie gerne in sich gespürt hätte. Am liebsten hätte sie dem Kollegen die Hand weggeschlagen, aber sie ahnte, dass seinem Narzissmus diese Kränkung nicht gefallen hätte. Sie musste sich vorsehen, er könnte ihr noch gefährlich werden, hatte er doch einen guten Stand bei ihrem Vorgesetzten.
Sie seufzte erneut, und ihre Augen suchten den Horizont nach der Fähre ab. Langsam verschluckte die zunehmende Dunkelheit das Ufer, und die Geräusche des Hafens hallten auf eine seltsam intime Weise wider. Das rhythmische Plätschern des Wassers mischte sich mit dem gelegentlichen Kreischen einer Möwe, die spät noch unterwegs war. Melanie schlenderte zurück in die Mitte des Anlegers, dorthin, wo die Fähre ihre Rampe herunterlassen würde. Sie war inzwischen auch nicht mehr allein. Drei Männer warteten ebenfalls auf ihr Transportmittel in den Feierabend, doch sie hatte keine Lust auf Small Talk. Sie wollte nur zu Fred und dem Frieden ihres Zuhauses.
Normalerweise erkannte Melanie die Pendler, die mit ihr auf dem Anleger standen. Im Laufe der Jahre sah man sich, wenn man am gleichen Tag Spätdienst hatte, sie grüßten sich und tauschten auch ein paar Worte. Heute kannte sie nur den Bärtigen, der eine Zigarette rauchte, die beiden anderen Männer hatte sie noch nie gesehen. Neue Hafenarbeiter? Dafür waren sie einen Tick zu teuer angezogen. Andererseits war edler Zwirn im Hafen offenbar ein heißer Trend. Endlich näherte sich das Schiff mit einem tiefen Brummen, einem beruhigenden Geräusch. Sie fand eine Art Trost in dem wiederkehrenden Anlegemanöver der Fähre. Das Knarren der hydraulischen Rampe, die mit einem Piepen auf den Anleger heruntergelassen wurde, das Knirschen des Schiffs. Ein Gefühl der Beständigkeit in dem immerwährenden Kreislauf von Abfahrt und Rückkehr. Heute fuhr die Altenwerder auf der Linie 61 zum Dockland-Fischereihafen. Der Anblick der knallgelben Fähre mit dem Schriftzug König der Löwen und dem gezeichneten Löwenkopf an den Aufbauten fühlte sich wunderbar vertraut an.
Die zwölf Minuten Fahrzeit vergingen wie im Flug, und am Dockland stieg sie wieder aus, um auf die Fährlinie 62 nach Finkenwerder umzusteigen. Ein wenig umständlich, aber Fred hatte heute das Auto mit Beschlag belegt, und der Bus brauchte länger. Außerdem liebte sie die alten »Bügeleisen«, wie die Hamburger ihre Hafenfähren wegen ihrer merkwürdigen Form nannten. Sie sah, dass fünf Männer mit ihr auf die Anschlussfähre warteten. Frauen waren heute Abend nicht mehr unterwegs. Der bärtige Raucher und die beiden Anzugträger vom Fähranleger Waltershof standen in ihrer Nähe. Seltsam, dass sie die gleiche Strecke fuhren. Touristen waren sie nicht, dafür war es zu spät. Die Typen warfen ihr immer mal wieder Blicke zu, als hätten sie noch nie eine Frau gesehen.
Der Bärtige, mit dem sie öfter nach Finkenwerder fuhr, lächelte sie an. Warum hatte sie ihn nie gefragt, wie er hieß, wo er wohnte, wo er arbeitete? Sein dichter, grau melierter Bart umrahmte ein wettergegerbtes Gesicht, und seine braunen Augen strahlten Wärme aus. Neidisch sah sie zu, wie er schon wieder eine Zigarette aus der abgewetzten Lederjacke hervorholte. Seit 142 Tagen hatte sie keinen Tabak mehr angefasst, aber der fiese Möchtegern-Macho aus dem Büro brachte sie beinahe dazu, rückfällig zu werden. Sie biss sich auf die Unterlippe und stellte sich zwei Schritte hinter den Bärtigen, um den Rauch, den er in die Nacht blies, einzuatmen.
Endlich kam die Fähre. Diesmal eine weiße namens HafenCity. In zwanzig Minuten würde sie auf Finkenwerder ankommen, weitere fünf Minuten später ihre Schuhe ausziehen und das Glas Wein in Empfang nehmen, das Fred ihr hoffentlich eingeschenkt hatte.
Langsam wurden die Blicke der beiden Kerle unangenehm. Und dann setzten sie sich auch noch direkt in die Reihe hinter ihr. Als ob es nicht genug freie Plätze gäbe, dachte sie. Was wollten sie von ihr? Sie umklammerte ihren Rucksack, weil ihr Nacken kribbelte und ihr Puls sich beschleunigte, als ob sie jeden Moment mit einem Übergriff rechnen müsste. Sollte sie den Bärtigen ansprechen? Wäre das peinlich und übertrieben?
Hektisch kramte sie ihr Handy aus dem Rucksack und schrieb Fred eine Whatsapp-Nachricht. Schon als sie das Telefon entsperrte, fühlte sie sich besser. »Hey, Liebling. Bin auf der Fähre und froh, wenn ich im Nest bin.« Ihre Finger zitterten, während sie tippte. Sie schickte noch einen Smiley hinterher. Hoffentlich sah Fred die Nachricht zeitnah.
Melanie ließ den Blick durch das Innere der Fähre schweifen und drehte sich dann ruckartig zu den Anzugträgern um. Sie schauten weg.
Ein kleiner Sieg. Was, wenn die Kerle sie gar nicht meinten und ihre Befürchtungen nur ihrer gereizten Verfassung zuzuschreiben waren?
Wenigstens war auf Fred Verlass. »Schlimmer Tag?«, schrieb er.
Sie kaute auf ihrer Wange, zögerte. Sollte sie ihm sagen, dass sie sich belästigt fühlte? Es war nur ein Eindruck, und der war vielleicht dem Verhalten ihres Kollegen geschuldet. »Ach, nur ein doofes Gefühl, erzähle ich dir später. Kannst du mich von der Fähre abholen?« Sie legte das Handy in den Schoß und nahm die Wasserflasche aus dem Rucksack. Ihre Kehle fühlte sich staubtrocken an. Auf der Fähre war sie in der Öffentlichkeit, und sicher würden die Typen sie hier nicht anmachen, aber der Fußweg nach Hause … da wäre sie allein.
»Es ist mir ein Vergnügen«, schrieb Fred.
Der Druck in ihrem Hals löste sich augenblicklich. Fred holte sie ab und würde sie beschützen. Ihr Ehemann, ihr Rettungsanker, ihre große Liebe.
Sie steckte das Handy in die Jackentasche und fummelte ein Feuerzeug heraus, damit ihre Hände beschäftigt waren. In diesem Moment räusperte sich der Bärtige ein paar Sitze rechts von ihr. Er hatte seine Zigarettenpackung herausgepult und hielt sie fragend hoch.
Melanie lächelte. Ein verlockendes Angebot.
Sie rutschte zwei Sitze auf und lehnte sich zu ihm hinüber.
»Danke! Ich hab aufgehört, aber darf ich sie trotzdem in der Hand halten und daran riechen?«
Der Bärtige lachte und zeigte dabei eine Reihe makelloser weißer Zähne.
»Ich will Sie nicht verführen!«, sagte er und hielt ihr weiterhin die Packung hin.
Da! Schon wieder starrten die beiden Männer zu ihr herüber! Quatsch, sie sah Gespenster.
Melanie zog sich eine heraus und schnupperte daran. Sie ließ ein wohliges Seufzen hören und wies auf die Tür. »Wir sind gleich da!«
Er nickte. Blieb aber sitzen.
Schade, er war ihr sympathisch.
Am Eingang war es kalt und zugig, doch sie bekam hier besser Luft. Sie schulterte ihren Rucksack und stellte sich direkt an die Außentreppe, mit Blick auf die Bordkamera. Dass die Kamera dort hing, hatte sie schon oft gesehen. Erstmals bekamen die Kameras eine neue Bedeutung. Sie schufen die nötige Sicherheit, die sie brauchte.
Voraus erschien der Anleger Bubendey-Ufer. Sollte sie eine Haltestelle zu früh aussteigen? Wenn die Männer ihr dann nachkämen … Unsinn, auf Finkenwerder wartete Fred auf sie. Der kleine rote Leuchtturm war in der Finsternis kaum noch auszumachen. Nur in den Fenstern des Lotsenhauses am Seemannshöft brannten Lichter.
Das dunkle Wasser zog vorbei, und das Rauschen der Wellen, die das Schiff verursachte, klang beruhigend. Noch wenige Minuten, dann würde Fred sie in die Arme nehmen, und ein schrecklicher Tag wäre zu Ende.
Sie drehte sich um, um ins Innere zu sehen, als die beiden Anzugträger auftauchten und ihr den Rückweg versperrten. Sie wich zurück und wandte sich wieder Richtung Ausgang. Voraus musste eh bald der Fähranleger in Sicht kommen. Die Männer folgten ihr. Plötzlich machte ihre Erschöpfung einem alarmierenden Adrenalinschub Platz. Ihr Herz schlug bis zum Hals. Wollten die Kerle sie hier vor allen Leuten angraben? Sie hatte schon gehört, dass es sogar in einer Fußgängerzone zu einer Vergewaltigung gekommen war. Angeblich hatte niemand etwas bemerkt. Nun, kommt nur näher, ich werde schreien, bis ihr taub seid!
Sie entschied sich, nicht abzuwarten, bis die näher kommenden Männer sie erreicht hätten. Bemüht gelassen stieg sie zwei Stufen auf der Treppe hoch, die zum Oberdeck führte, ihre Schritte bewusst ruhig haltend, um keine Panik zu zeigen. Doch ihr Verstand arbeitete fieberhaft. Ihr Hafen, sonst ein Ort der Sicherheit und Vertrautheit, fühlte sich plötzlich fremd und bedrohlich an. Was hatten die beiden Männer nur an sich, dass sie so in Unruhe verfiel? Sie redete sich ein, dass ihre Nervosität unbegründet sei, aber ihr Instinkt suggerierte ihr etwas anderes.
Mit einem Nicken entschloss sie sich. Sie war genau im Blickwinkel der Bordkamera und steckte sich demonstrativ die Zigarette des Bärtigen mit ihrem Feuerzeug an. Der Skipper konnte das auf seinem Monitor nicht übersehen und würde sie über das Bordmikrofon auf das Rauchverbot hinweisen. Er würde sie im Auge behalten. Und noch etwas fiel ihr ein. Fred. Er würde … sie kramte in ihrer Jackentasche nach dem Handy und tippte mit zitternden Fingern seine Nummer ins Display.
Sie traute sich nicht, sich nach den Männern umzudrehen.
»Na, vermisst du mich so sehr?«
Freds Stimme klang atemlos.
»Fred, bist du … schon auf dem Weg?« Sie merkte selbst, wie aufgeregt sie sich anhörte.
»Yep, bin fast am Anleger. Bist du schon da?«
»Nein, gleich, ich weiß nicht, irgendetwas stimmt nicht.«
»Was ist los?«
Sie merkte seiner Stimme an, dass er stehen geblieben war und seine ganze Aufmerksamkeit ihr galt. Ein warmes Gefühl durchflutete sie. Fred nahm sie immer ernst. Er machte sich nicht über sie lustig.
»Ich habe das Gefühl, dass ich … verfolgt … also beobachtet werde. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht bilde ich es mir nur ein …« Sie schloss die Augen, während sie auf seine Antwort wartete.
»Bist du auf der Fähre? Auf welcher Höhe seid ihr? Geh sofort zu anderen Menschen. Sprich sie an!«
Er klang alarmiert, und plötzlich beunruhigte Melle das Telefonat mehr, als dass es ihr half.
»Ich kann nicht … im Weg. Ich …«
Sollten die Männer sie belästigen … Sie sah hoch in die Kamera und nahm aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr. Einen lähmenden Augenblick glaubte sie, den Mann lächeln zu sehen. Dann spürte sie einen heftigen Stoß im Rücken. Der zweite Kerl riss ihr Bein schneller hoch, als sie sich wehren konnte.
»Melle, was war das? Melle? Bist du noch da? Melle?«
Sie hörte Fred noch schreien, als sie über die Reling stürzte.
In die tiefschwarzen Fluten.
Den Gedanken, dass sie Fred unbedingt sagen musste, dass die Männer sie nicht aufreißen, sondern töten wollten, brachte sie nicht mehr zu Ende.
Kapitel 2
Das Blaulicht warf flackernde Reflexe auf den von der Nacht noch nassen Asphalt, und das Martinshorn sorgte dafür, dass die Autos auf der linken Spur hastig nach rechts auswichen. Als der Streifenwagen die Steigung der Köhlbrandbrücke vom Roßdamm hinaufzog, genoss Tom den Augenblick. Die Weite der Aussicht, den Wind, der durch das offene Fenster strich, und das Gefühl, für einen Moment über der Stadt zu schweben.
Die Sonne hatte um kurz nach sieben Uhr morgens noch nicht genügend Kraft, um zu wärmen, doch sie ließ die Köhlbrandbrücke wie ein Tor zu einer anderen Welt erscheinen. In zweiundfünfzig Metern Höhe belohnte ihn die Brücke mit dem schönsten Blick über den Hafen.
Von hier oben breitete sich das Panorama über die sonnengelben Lagerhäuser der Reemtsma-Zigaretten oder das imposante Containerterminal Tollerort aus. Links blitzten die Silos der Ölmühle über die Leitplanke, unter ihnen schlängelte sich die Elbe glitzernd durch die Hafenlandschaft. Der Klang des Hafens stieg als leise Melodie empor und vermischte sich mit dem Wind, der über die Brücke wehte und die muffigen Gerüche der Raffinerie mit sich trug.
Als die Meldung vom Michel-Sprecher der Einsatzzentrale über Funk ins WSPK2 kam, hatte Tom nur zu gerne nach seiner Jacke gegriffen und war aus seinem Büro an den Wachtresen des Wasserschutzpolizeikommissariats geeilt. Natürlich war ein liegen gebliebener Pkw oder womöglich ein Lebensmüder, der von der Brücke springen wollte, kein schöner Einsatz, aber alles war ihm lieber, als am Schreibtisch zu sitzen und die regelmäßigen Beurteilungen über seine Kollegen zu schreiben, deren vorgefertigte Auswahlmöglichkeiten selten jemandem gerecht wurden. Diesen Teil seiner Aufgaben als vorgesetzter Dienstgruppenleiter hasste er. Deshalb war er nicht Polizist geworden.
Neben ihm starrte sein Kollege Tilo Andersen, aus guten Gründen Quetsche genannt, aus dem Beifahrerfenster, und auf dem Rücksitz kauerte Marvin. Der war eingeschüchtert ins Auto gestiegen, nachdem Quetsche Tom angemeckert hatte, dass er den Einsatz allein übernähme. Auf Toms Einwand, dass er gerne mitfahre, hatte Quetsche ihn schlecht gelaunt abgekanzelt.
»Spar dir den Eifer für deinen Schreibtischkram. Du wirst mir nur im Weg stehen.«
Marvin hatte sich sofort weggeduckt. Quetsche hatte schon öfter seine schlechte Laune der letzten Wochen an Marvin ausgelassen. Diesmal hatte es Tom getroffen.
»Die Beurteilungen können warten. Ich brauche ein bisschen Leben«, antwortete er sachlich. Er wollte keinen Streit mit Quetsche.
»Das bekomme ich schon selbst gebacken!«
Tom hatte sich auf kein Wortgefecht eingelassen, sich den Autoschlüssel vom Haken gegriffen, und Quetsche musste notgedrungen hinter ihm herlaufen.
Seit er aus dem Weihnachtsurlaub zurückgekehrt war, ging es mit Quetsches Stimmung rasend bergab. Seine einsilbigen Antworten und seine Gereiztheit passten überhaupt nicht zu seiner Persönlichkeit. Er war normalerweise ein gutherziger Riese, ein Genussmensch und Polizist mit einem inneren Kompass, der ihm stets zuverlässig die Richtung wies. Davon war derzeit nicht mehr viel übrig, und die Kollegen reagierten zunehmend ratlos auf seine Wesensveränderung.
Sie waren beinahe auf dem Scheitelpunkt der Brücke angekommen und sahen in Fahrtrichtung Waltershof einen roten Opel Corsa mit eingeschalteten Warnblinkern auf der rechten Spur stehen. Tom hielt gut zehn Meter dahinter an und ließ über den Signalgeber auf dem Dach des Streifenwagens die beiden roten Pfeile aufblinken, die den Verkehr aufforderten, auf die linke Fahrspur zu wechseln.
»Los, Marvin, du übernimmst«, forderte Tom mit einem Lächeln in den Rückspiegel den jungen Kollegen auf.
Quetsche stieg wortlos aus und steckte sich eine Zigarette an. Tom runzelte die Stirn. Rauchen war im Streifenwagen nicht nur verboten, es gab nicht einmal einen Aschenbecher. Neuerdings schaffte Quetsche nur noch kurze Fahrten, ohne anzuhalten und sich eine Zigarette anzuzünden. Er zog an dem Glimmstängel, als ob er damit seine Sorgen vertreiben könnte, doch offenbar klammerten die sich nur noch fester an ihn.
Er ignorierte Quetsche und wies Marvin mit einer Handbewegung an, rechts über die Leitplanke in den Betriebsgang zu klettern, um dort sicher zu dem Pkw zu gelangen.
Der Wagen hatte derart beschlagene Scheiben, dass Tom nicht erkennen konnte, ob jemand darin saß. Vorsichtig näherten sie sich von beiden Seiten. Marvin klopfte an die Fahrerscheibe.
Nichts passierte.
Der Motor lief, das Auto war fahrtüchtig, oder?
Marvin trommelte gegen die Scheibe. »Öffnen Sie das Fenster!«
Keine Reaktion.
»Eine Frau. Mittleres Alter«, sagte Marvin. »Guckt mich nicht an. Bewegt sich nicht.« Er sah ratlos auf. »Hallo! Öffnen Sie das Fenster!«, rief er mit Nachdruck.
Endlich kurbelte die Frau das Fenster herunter.
Tom trat zu Marvin, da die Frau allein im Wagen saß.
»Haben Sie eine Panne?«, fragte Marvin.
Die Frau starrte Marvin durch ihre Brille mit weit offenen Augen an, antwortete aber nicht. Sie war vielleicht Anfang vierzig, ihre Hände hielten krampfhaft das Lenkrad umklammert. Ihr Atem ging stoßweise, die Schultern bebten.
Tom beschlich eine Ahnung. Er entspannte sich, und seine Gedanken schweiften ab.
Vor fünf Monaten hatten sie gegen ein enormes Hochwasser im Hafen gekämpft, was sie an den Rand ihrer Belastungsfähigkeit gebracht hatte. Er und Quetsche hatten Hand in Hand gearbeitet und die Lage gemeistert. Als ob das nicht schon schwierig genug gewesen wäre, war gleichzeitig ein Mord an Bord des Containerfrachters Global Endeavour passiert. Die Zusammenarbeit mit Jonna Jacobi von der Mordkommission hatte sich für Tom als großes Abenteuer herausgestellt, aber angesichts des Hochwassers im Hafen auch als ausgesprochen kräftezehrend. Am Ende hatten sie den Täter aufgespürt …
»Tom? Sie reagiert nicht.« Tom hörte die Unruhe in Marvins Stimme. Es war ihm unheimlich, dass die Frau ihn mit Panik im Blick anstarrte und kein Wort von sich gab.
Tom zwang seine Gedanken auf die Brücke zurück. Er trat näher. Die Frau schwitzte stark. »Geht es Ihnen gut? Haben Sie medizinische Probleme? Schmerzen?«
Sie drehte langsam den Kopf, als müsse sie erst aus einer entfernten Welt zurückkehren. Dann fing sie an zu wimmern, bewegte die Lippen. Leider verstand Tom nicht, was sie flüsterte.
»Versuchen Sie es noch mal. Sie müssen hier von der Straße weg, Sie dürfen auf der Brücke nicht anhalten. Das ist streng verboten.«
Ihre Finger gruben sich ins Lenkrad, als wäre es das letzte Stück Realität, an das sie sich klammern konnte. Ihr Blick huschte seitlich aus dem Beifahrerfenster nach draußen – zum Geländer der Brücke. Ein scharfer Atemzug.
»Es geht … immer höher!« Ihre Stimme war so dünn, dass Tom Mühe hatte, sie über das Dröhnen der Motoren, die an ihnen vorbeirauschten, und dem Rauschen der Reifen auf dem nassen Teer zu hören. Auch der Asphalt unter den Füßen vibrierte deutlich.
Er hatte es geahnt. »Haben Sie Angst?«, fragte er so sanft wie möglich.
Sie nickte. »Ich kann … nicht weiter.«
»Wovor genau haben Sie Angst?«
»Es ist die Höhe … ich hab lieber angehalten. Ich …«
»Okay. Kein Problem. Sie müssen nicht weiterfahren.« Tom griff durch das heruntergelassene Fenster von innen an den Türgriff und öffnete die Tür. »Keine Sorge, wir sind da. Sie sind bei uns in Sicherheit!« Er wandte sich an Marvin. »Sie hat einen Höhenkoller. Wir bringen sie hier runter, bevor es einen Unfall gibt.«
Er hörte Quetsche funken.
»Michel von 52/1.«
»Michel hört.«
»Entwarnung. Pkw auf Köhlbrandbrücke kein Suizid. Frau mit Höhenangst. Wir begleiten das Fahrzeug nach Waltershof. Spur ist gleich wieder frei. 52/0, habt ihr das mit?«
»Ja, das haben wir mitgehört.«
»52/1, braucht ihr RTW?«
»Vielleicht später.«
»Michel-Sprecher hat verstanden.«
Toms Gedanken wanderten weg von der Frau, deren Brust sich hektisch hob und senkte, als hätte sie vergessen, wie man Luft holt.
Er musste sich etwas überlegen, was Quetsche betraf. Quetsche war mehr als ein Kollege, ein Freund. Sie lagen auf der gleichen Wellenlänge und arbeiteten harmonisch zusammen. Warum war Quetsche so auf Distanz gegangen und ließ niemanden mehr an sich heran? War es ein Freundschaftsdienst, ihn nicht länger zu bedrängen, sondern ihn in Ruhe zu lassen? Aber das war unmöglich, so wie Quetsche sich benahm. Freundschaften waren zerbrechlich, und Tom wusste, dass er ihm in stürmischen Zeiten beistehen musste – auch wenn es ihn zunehmend Kraft kostete, seine üble Laune zu ertragen. Er befürchtete, dass Quetsche die Kollegen vor den Kopf stieß und sich seinen Ruf versaute.
Marvin bat die Frau auszusteigen. Doch sie machte sich steif und klammerte sich nur noch fester an das Lenkrad.
»Kommen Sie, wir gehen nur auf die andere Seite, wir nehmen Sie in die Mitte, es passiert Ihnen nichts.«
»Es weht so furchtbar! Es wackelt! Die Brücke stürzt ein!« Ihr liefen Tränen über das Gesicht.
Ohne Vorwarnung keuchte Marvin auf. Ein Windstoß hatte ihm die Mütze vom Kopf gerissen. Er versuchte, sie mit einer Hand aus der Luft aufzufangen, doch die Mütze segelte direkt vor ihren Augen die Brücke hinunter.
Quetsche schnalzte missbilligend. »Die is’ weg«, murmelte er und sah der Mütze hinterher.
»O Gott, o Gott, wir werden sterben.«
»Na, ’n büschen Wind gibt es«, sagte Tom beruhigend, »aber die Brücke hält das aus.« Er überließ Marvin die Frau und wandte sich an Quetsche. »Wir müssen reden. So geht es nicht weiter!«
Quetsche zog trotzig an seiner Zigarette.
»Rutschen Sie rüber auf die Beifahrerseite. Wir fahren Sie runter!« Marvin redete mit Engelszungen auf die Frau ein. »Das schaffen Sie!«
Langsam hob sie ein Bein, um sich über die Schaltung auf den Beifahrersitz zu hieven. »Wir treffen uns unten«, sagte Tom. Er klopfte beruhigend auf das Dach, als wäre die Gefahr damit endgültig gebannt.
Marvin sprach der Frau, die sich in Zeitlupe auf den Beifahrersitz kämpfte, weiter Mut zu.
Tom griff zu seinem Funkgerät.
»Michel von 52/1.«
»Michel hört.«
»Köhlbrandbrücke Richtung Waltershof wieder frei.«
»Verstanden!«
Er setzte sich mit Quetsche zurück in den Streifenwagen. Der Kollege würde sich anhören müssen, was Tom ihm zu sagen hatte. Er schaltete das Blaulicht aus und fuhr langsam hinter Marvin in dem roten Corsa die Brücke herunter. Der Verkehr folgte ihm.
»Lass uns zusammen frühstücken«, sagte Tom. »Ich muss mit dir über die Kiste mit den Containerplomben sprechen. Es gibt Neuigkeiten.«
Quetsche murmelte Unverständliches.
Unten angekommen, lenkte Marvin das Auto auf den Zollhof und nahm die Personalien der Frau für seinen Kurzbericht auf. Sie hatte sich erstaunlich schnell erholt, und nun war es ihr peinlich, einen Polizeieinsatz verursacht zu haben.
Endlich war Marvin fertig, kam zu ihnen und setzte sich auf den Rücksitz.
Sie wendeten auf die andere Brückenseite, um zurück zur Wache zu gelangen.
»Ist echt ’ne Achillesferse von Hamburg, oder?«, fragte Marvin und lehnte sich zwischen die Vordersitze. »Wenn ein Auto stehen bleibt, ist sofort Stau, und nix geht mehr.«
Tom nickte. »Das kannst du laut sagen. Der ganze Verkehr von Ost nach West und umgekehrt quert die Elbe ja nur über diese zwei Brücken: die Köhlbrandbrücke im Norden und die Kattwykbrücken im Süden. Wird der Verkehr gestört, gibt es Rückstau, verspätete Lkw auf den Terminals mit dem entsprechenden Chaos. Hier donnern täglich 40000 Fahrzeuge drüber. Ein Drittel davon sind Lastwagen und Schwertransporte. Du kannst dir ausmalen, was passiert, wenn die Brücke gesperrt ist!« Tom warf Quetsche einen Blick zu. »Weißt du noch 1998, als der holländische Schwimmkran zwei Löcher in die Brücke gestanzt hat?«
Als die Einsatzmeldung damals kam, dass jemand die Köhlbrandbrücke gerammt habe, hatte Tom vermutet, dass ein Auto auf der Brücke gegen die Leitplanke gefahren war. Wie sollte irgendetwas vom Wasser aus die zweiundfünfzig Meter hohe Brücke rammen? Tatsächlich hatte ein Kapitän geglaubt, er passe mit seinem einundfünfzig Meter hohen Kran unter der Köhlbrandbrücke durch. Tja, die Flut hatte er nicht beachtet und lag damit zu hoch im Wasser. Dann krachte es auch schon.
»War das eine Aufregung. Wir hatten schon Angst, dass die Brücke einstürzt. Die Statiker und Stahlbauer haben sie, Gott sei Dank, schnell repariert.« Tom lächelte bei dem Gedanken daran. Er war dabei gewesen und würde die hektischen Minuten bis zur Vollsperrung der Brücke nie vergessen.
Quetsche würdigte ihn keiner Antwort. Die Luft im Streifenwagen war so dick und schwer wie ein Gewitter, das jeden Moment losbrechen konnte. Toms Kiefermuskeln spannten sich an, und er fixierte die Straße, als könne er durch bloßes Anstarren die Welt da draußen und die Konflikte hier drinnen verändern. Das monotone Brummen des Motors schwebte wie eine Drohung zwischen ihnen.
»Echt? Krass! Was, wenn die Brücke nicht hält, bis die neue gebaut ist? Sie ist fünfzig Jahre alt, und wenn sie einstürzt?« Marvin bekam von der Stimmung wenig mit, so faszinierte ihn die imaginierte Katastrophe.
Quetsche wirbelte zu Marvin herum. Seine Augen blitzten.
»Hat die Frau dir das eingeredet? Diese verdammte Brücke ist bestens in Schuss und wird noch dreißig Jahre stehen. Hier stürzt gar nix ein. Die neue Querung wird eh nicht kommen! Von diesem bekloppten Neubau haben die schon geredet, als ich 1992 zur Wasserschutz gekommen bin. Und? Siehst du eine neue Brücke?«
»Beruhig dich!«, erwiderte Tom scharf. »Er stellt nur eine hypothetische Frage. Er hat das Recht, zu wissen, was passieren könnte!«
Quetsche knurrte und drehte sich wieder nach vorn. »Hypothetische Frage? In unserer Welt gibt es nur Realitäten. Und die Realität ist, dass wir mit den Altlasten zurechtkommen müssen.«
Tom spürte sofort, dass Quetsche nicht mehr über die Brücke sprach. »Das stimmt. Das ist unsere Aufgabe, und die erledigen wir. Denn nach uns, nach der Polizei, kommt keiner mehr! Wir haben die Verantwortung, wir bringen die Lage unter Kontrolle.«
Tom fixierte Marvin im Rückspiegel, um ihm zu signalisieren, dass er sich aus dem Gespräch raushalten solle.
Quetsche schnaubte verächtlich. »Und wenn man keine Lust mehr hat, der Ausputzer zu sein? Ich frage mich, ob das alles überhaupt einen Sinn hat. Immer der Kerl zu sein, der den Dreck wegräumt. Den Bürger interessiert es sowieso nicht.«
Tom warf Quetsche einen langen Blick zu. Traute sich kaum zu atmen, um ihn nicht zu unterbrechen.
Quetsche zuckte mit den Schultern. »Manchmal spielt das Hirn einem Streiche. Man sieht Dinge, die man nicht sehen will. Erinnert sich an Sachen, die man lieber vergessen würde. Und jedes Mal kommt die Angst näher, frisst sich ins Gehirn wie ein verdammter Parasit! Warum müssen immer wir unser Kreuz hinhalten?«
Tom schluckte. Noch nie hatte er Quetsche so verletzlich hinter der harten Fassade erlebt – und erst recht nicht über den tödlichen Schuss sprechen hören.
»Das bringt der Job mit sich. Wenigstens können wir uns aufeinander verlassen«, sagte er leise. »Manchmal zählt jede Sekunde, und wir müssen handeln, bevor Zeit zum Nachdenken ist. Dein Instinkt hat uns schon mehr als einmal den Arsch gerettet.« Er ließ die Worte kurz wirken. »Und wenn’s drauf ankommt, gibt’s keinen, auf den ich mich lieber verlassen würde als auf dich!«
Kapitel 3
Zurück an der Wache, ging Tom direkt in die Küche und sortierte seine Gedanken und den Plan, den er Quetsche gleich unterbreiten würde. Er hatte lange darüber nachgedacht und seinen Eindruck eben auf der Köhlbrandbrücke bestätigt gesehen. Er musste handeln, so ging es mit seinem Freund nicht weiter. Er war nicht in der Lage, Quetsche aus seinem Unglück zu befreien, doch er wollte wenigstens versuchen, ihm einen neuen Weg aufzuzeigen. Eines war Tom klar geworden, Quetsche war nicht nur ein Kollege, er war sein engster Vertrauter. Und er vermisste ihn bitterlich.
Er stellte zwei vorbereitete Wurst- und Käseteller aus dem Kühlschrank auf ein Tablett, um es in den Aufenthaltsraum zu tragen. Dort hatten die Kollegen noch Frühstücksgeschirr, Brötchen und Marmeladen für sie stehen gelassen.
Vor fünf Monaten hatten Quetsche und er am Morgen der höchsten Sturmflut seit Jahrzehnten nicht nur eine Wasserleiche geborgen, sondern auch eine Kiste mit Containerplomben. Diese im Wasser treibende Alukiste wäre in den Händen von Straftätern viel wert, denn mit diesen Plomben ließen sich Container fälschungssicher neu versiegeln, und weder Polizei noch Zoll würde je auffallen, dass an den Containern manipuliert worden war. Jeder, der im Besitz solcher Siegel wäre, könnte Container bedenkenlos öffnen und etwas Illegales hineinpacken oder etwas entnehmen und sie wieder verschließen. Wenn dann noch die Frachtpapiere entsprechend auf die Siegelnummern ausgestellt wären, war der Schmuggel eine sichere Sache und ein offenes Tor für kriminelle Machenschaften.
Tom gab Wasser in die Kaffeemaschine, löffelte das Kaffeepulver in den Filter und stellte die Maschine an.
Er sah auf die Uhr. Zehn Minuten waren vergangen, und von Quetsche war weit und breit nichts zu sehen.
Tom konnte sich nicht vorstellen, woher die Kiste gekommen war, wie es jemandem gelungen war, an diese Originalplomben heranzukommen. Es gab nur wenige Möglichkeiten: die Polizei, den Zoll oder die Hafenfirmen, die auf dem Eurocon-Terminal tätig waren. Aus welcher Quelle stammte die Kiste, und wie war sie in der Elbe gelandet? Gab es womöglich noch weitere gestohlene Siegel?
Der Kaffee tröpfelte in die Kanne, und Tom entschied sich, noch Eier mit Speck zu braten. Das bevorstehende Gespräch hatte ihn so beschäftigt, dass zu Hause das erste kleine Frühstück des Tages ausgefallen war.
Endlich ließ sich Quetsche blicken. Mürrisch betrachtete er Toms Vorbereitungen.
»Wir gehen rüber. Die Kollegen haben das Frühstück stehen gelassen, und wir haben dort mehr Ruhe«, sagte er, ohne Quetsche anzusehen. »Ich habe vor ein paar Tagen einen Anruf vom LKA bekommen, von der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift.«
Quetsche zog eine Augenbraue hoch.
Tom brauchte ihm nicht zu erklären, dass diese Sondereinheit aus einem Zusammenschluss zwischen LKA und spezialisierten Kräften des Zollfahndungsdienstes den organisierten Drogenschmuggel im Hafen bekämpfte. Schade, dass Quetsche nicht wenigstens den Elan für eine Nachfrage aufbrachte.
»LKA und Zoll haben keine relevanten Ermittlungsergebnisse erzielt. Sie haben gefragt, ob die Containerplomben von uns stammen könnten.«
Quetsche grunzte empört. »Genau, wir machen jetzt mit der kriminellen Mischpoke gemeinsame Sache.«
»Ich hab ihnen das Vorgehen unserer HaSiBe erklärt.« Tom wollte im ersten Moment ähnlich reagieren wie Quetsche, aber er hatte dem Kollegen versichert, dass die Hafensicherheitsbeamten der Wasserschutz, kurz HaSiBe genannt, vor allem Gefahrgutcontainer daraufhin untersuchten, ob die Ladung sicher gestaut worden war. Anschließend versiegelten sie die Container neu, trugen das in die Frachtpapiere ein, und damit waren die Siegel jederzeit als Polizeisiegel zu identifizieren. Und nein, die lagen nicht stapelweise in den Diensträumen herum, sondern über die Plomben wurde streng Buch geführt. Tom hatte es überprüft: Es fehlte nicht ein einziges Siegel, es gab keine Unregelmäßigkeiten, die Wasserschutzpolizei hatte kein Leck. Der Zoll und eine letzte Hafenfirma hatten ihre Revision noch nicht abgeschlossen. Bis jetzt blieb alles ohne Ergebnis. »Die Gruppe hat die Zivilfahnder von LKA und Zoll von dem Fall abgezogen. Sie halten die Augen offen, aber …«
Quetsche würdigte ihn keiner Antwort. Das Blubbern der Kaffeemaschine und das leise Brutzeln des Specks waren die einzigen Geräusche, die den Raum erfüllten.
Tom merkte, dass seine Geduld sich dem Ende zuneigte. Er wollte endlich seinen Freund und kollegialen Sparringspartner zurück. Er brach die Eier mit einer ungewöhnlichen Sorgfalt in die Pfanne, als ob das kleinste Missgeschick seinen Geduldsfaden reißen lassen würde. Er musste jetzt Fingerspitzengefühl beweisen, sonst würde Quetsche dichtmachen.
»Ich habe gestern mit dem Revierleiter gesprochen, bevor er in die Schwerpunktrunde in den Stab gefahren ist«, sagte Tom. »Ich habe ihm eine Idee mit auf den Weg gegeben, die er unterstützt.«
Quetsche füllte den Kaffee in eine Thermoskanne, die er in der Hand behielt.
Vielleicht war er auch nervös?
»Ich möchte dich von der Schicht abziehen.«
Die Kanne krachte auf die Tischplatte, als ob Quetsche die Kraft ausgegangen wäre, sie zu halten.
Tom musterte ihn und suchte den Augenkontakt. »Ich möchte dich für einen Schwerpunkteinsatz auf dem Eurocon-Terminal haben. Wir schleusen dich in eine Sicherheitsfirma ein, und du hörst dich als ziviler Ermittler um. Das Terminal liegt im Reviergebiet vom WSPK1, und dort kennt man dich nicht. Du bist die ideale Besetzung dafür. Finde heraus, was es mit dieser Kiste auf sich hat. Ich bin sicher, wir übersehen irgendwas! Sei kreativ, und setz endlich deine Fähigkeiten wieder ein!« Tom nahm die Bratpfanne vom Herd und hielt sie wie eine Drohung zwischen ihnen. »Und, verdammt noch mal, sprich mit mir!« Er wedelte mit der Pfanne. »Reich mir mal zwei Teller.«
Tom kratzte die angebrannten Spiegeleier mit dem Speck auf die beiden Teller, die Quetsche ihm dann doch noch hinhielt, und sie gingen schweigend Richtung Aufenthaltsraum, um ein spätes Frühstück zu sich zu nehmen.
»Du willst mich loswerden«, murmelte Quetsche. »War ja klar!«
»Ich will dich aus der Schusslinie haben. Du verbreitest zu viel schlechte Laune, und außerdem bist du der beste Mann für diese Aufgabe!«
»Schusslinie …«, er lachte trocken auf, »… wie passend. Hast du Muffe, dass ich wieder jemanden abknalle?«
Tom ließ sich nicht zu einer schnellen Reaktion hinreißen. Seine Gedanken wanderten zurück in die Nacht des Hochwassers.
Sie hatten im Verlauf der Nacht auch einen Täter verfolgt, der einen blinden Passagier auf dem Terminal jagte. Quetsche hatte auf zwei kämpfende Männer im Wasser geschossen, und den Täter tödlich verletzt.
Die Schusswaffe zu benutzen, war eine Hochstresssituation für jeden Polizisten, und das Risiko, jemanden tödlich zu treffen, trug jeder von ihnen. Das wusste Quetsche nur zu gut. Was er nicht wusste, war, wie er diese Belastung verarbeiten sollte. Nirgendwo stand geschrieben, wie man selbst reagierte und wie man seinen inneren Frieden damit machte, für den Tod eines Menschen verantwortlich zu sein.
Offenbar hatte es Quetsche nicht getröstet, dass die dienstinterne Ermittlung ihn rehabilitiert hatte. Nach den Aussagen der beteiligten Kollegen und einer Security-Frau vom Terminal konnte eindeutig festgestellt werden, dass die Situation als Tötungsabsicht seitens des Täters gegen das Opfer gewertet und der Schusswaffengebrauch als Nothilfe eingestuft werden konnte. Leider hatten die Taucher die Tatwaffe im Elbschlick nicht gefunden. Der zweite Täter, der noch in Untersuchungshaft saß und auf seinen Prozess wartete, nutzte das, indem er behauptete, sie hätten den Mann aus dem Wasser retten wollen.
Quetsche hatte nicht wieder in den Tritt gefunden.
Gerade öffnete er die Tür zum Aufenthaltsraum und blieb so abrupt stehen, dass Tom beinahe in ihn hineingerannt wäre.
»Ach du Scheiße, die neuen Stühle sind gekommen. Sieht ja richtig nobel aus, die Hütte.« Er stellte die Teller mit den Spiegeleiern auf den Tisch.
Auch Tom sah sich erstaunt um. Die neue Bestuhlung für den Raum musste in seiner Freischicht geliefert worden sein.
Quetsche zog sich einen Stuhl heran und setzte sich. Vielmehr versuchte er vergeblich, sich zu setzen.
»Das ist doch wohl nicht wahr!«, rief er ungehalten.
»Was gibt es jetzt schon wieder zu motzen?«
Quetsche stand ihm gegenüber und zeigte mit einem ironischen Lächeln auf die neuen Stühle. »Schick! Aber unbrauchbar.«
Tom schüttelte den Kopf, zog sich ebenfalls einen Stuhl heran und wollte sich setzen. »Das …« Er lachte. »Ich gebe zu, das ist etwas, na ja, umständlich.« Er schnallte sein Koppel ab und legte es auf den Tisch. Tatsächlich hatten die modernen Stühle Armlehnen, die es unmöglich machten, sich mit der Waffe in den Stuhl zu setzen. Sie waren schlichtweg zu schmal. Ein glatter Fehlkauf.
»Ich will dich nicht loswerden, im Gegenteil«, sagte er und ignorierte den maulenden Kollegen, der sich immer noch nicht gesetzt hatte. »Ich meine, es war eine heikle Situation. Du hattest keine Wahl, du warst nur schneller, sonst hätte ich geschossen.«
Quetsche griff nach einer Tasse, schenkte sich Kaffee ein und setzte sich endlich in den Stuhl, nachdem auch er sein Koppel abgelegt hatte. »Ja, das sagen alle. Es fühlt sich aber anders an, wenn du wirklich abdrückst.« Er starrte in die dunkle Flüssigkeit, als ob dort Antworten lägen. »Wenn ich die Augen schließe, sehe ich ihn untergehen.« Er trank vorsichtig, als ob er darauf achtete, nichts zu verschütten.
»Ich wünschte, ich könnte etwas für dich tun«, sagte Tom. »Manchmal hilft es, wenn man darüber spricht«, sagte er schließlich. »Du hättest die Angebote der Polizeiseelsorger nicht ablehnen sollen.«
Quetsche legte sein Messer neben seinen Teller, nahm einen tiefen Atemzug und sah Tom an. »Manchmal reicht es, einfach hier zu sitzen«, antwortete er und stieß seine Gabel fest in das Spiegelei. »Ich brauche keinen Pfaffen.«
Ohne Vorwarnung schallte dröhnend eine Einsatzdurchsage durch die Lautsprecher des Reviers.
»Einsatz für das Boot. Die 35 besetzen. Einbruch gewesen auf Yacht Billwerder Bucht.«
Quetsche zuckte mit den Schultern und ließ sich nicht stören, er war nicht auf dem Boot eingeteilt.
Auch Tom kaute eine Weile schweigend, dann seufzte er. »Weißt du, du kannst dich nicht ewig vor dem Gespräch drücken. Wir sind Polizisten, wir reden ständig darüber, wie wir mit unseren Einsätzen umgehen. Ich sehe doch, dass die Sache dich immer mehr einholt. Soll das so weitergehen?«
»Ich weiß nicht«, murmelte er. »Vielleicht hab ich gehofft, dass es mit der Zeit besser wird.«
Tom schob seinen Teller ein Stück von sich weg, das Besteck klapperte leise. »Nichts wird von allein besser. Du weißt das so gut wie ich. Also, was auch immer du brauchst – eine Auszeit, ein Gespräch, meinetwegen einen verdammten Boxsack –, mach es. Sonst frisst es dich auf.«
Die Worte hingen schwer in der Luft.
»Okay, ich mime dir den Undercover-Ermittler mit Heimlichtuerei und allem, was dazugehört. Ich hab sogar eine Sonnenbrille für nächtliche Einsätze und einen Trenchcoat, der bei jedem Windstoß dramatisch weht. Du wirst schon sehen, was du davon hast.« Quetsche holte tief Luft. »Unter einer Bedingung!«
Tom zog eine Augenbraue hoch.
»Du stehst zu deinem Antitalent und kochst nicht mehr! Ganz ehrlich, selbst das Toastbrot springt lieber in den Mülleimer, als sich von dir rösten zu lassen. Wie hast du es geschafft, Spiegeleier in schrumpelige, angebrannte Lappen zu verwandeln?« Er runzelte die Stirn. »Und du sorgst dafür, dass diese Stühle wegkommen!«
Tom lächelte. Quetsches Art, sich zu entschuldigen und die neue Aufgabe anzunehmen.
Kapitel 4
Die Sonne tauchte als glühender Punkt über dem Wasser auf und überzog den Finkenwerder Yachthafen am Rüschkanal mit rosaroten Farben. Johann fand, dass es ein guter Morgen war. Die Luft roch frisch, die Elbe stand hoch, und die Möwen kreischten unruhig über ihm. Ein perfekter Tag zum Angeln.
Er pfiff leise eine Melodie, als er seine Angelschnur einholte. Wieder nichts dran. Vielleicht sollte er sein Glück etwas weiter rechts probieren. Er hatte seinen Wurmhaken ins Wasser gelassen, um bei der heutigen Flut ein paar Flundern aus der Elbe zu ziehen. Das klappte eigentlich immer und sorgte für ein leckeres Abendessen. Nur bei Ebbe war es hier zu flach zum Fischen.
»Der Bootsmann, das ist unser bestes Stück, heijo, und die Buddel mit Rum«, sang er mit tiefer Bassstimme und freute sich darüber, dass weit und breit kein Tourist in Sicht war, der ihm mit lauten Gesprächen den Fang vermieste. Penetrantes Geplapper vertrieb die Fische, seine Shantys fanden sie toll. Die kleine Parkfläche war leer, die alte U-Boot-Bunkeranlage gegenüber ließ sich vom Wasser sanft umspielen. Johann, genannt Schrotti, mochte die monströse Bunkerruine mit dem alten Tarnnamen Fink II. Ein Lost Place direkt neben dem schönen Yachthafen.
In den fünf riesigen Betonquadern waren im Zweiten Weltkrieg U-Boote gebaut und repariert worden. 1945 hatten sie den Bunker gesprengt, und lediglich das Fundament und die Außenwände der Boxen waren als Mahnmal erhalten.
Heute gehörte das steinige Ufer ihm ganz allein.
Er griff nach Eimer und Kescher und bewegte sich langsam über die Steine Richtung Osten. Mühsam kletterte er die Böschung hinunter, um weiter unten seine Angelrute erneut ins Wasser zu halten.
Nach ein paar Schritten sah er etwas halb im Wasser, halb auf den Steinen liegen. Er kniff die Augen zusammen, trat noch einen Schritt näher und zog dann überrascht die Augenbrauen hoch.
Seltsames Treibgut. Und mit Treibgut kannte er sich aus. Niemand hatte ein so gutes Händchen, Treibgut und Schrott zu sammeln, aufzubereiten und an Touristen, die auf der Suche nach einer urigen Lampe oder einer alten Boje waren, zu verkaufen. Jeder auf Finkenwerder kannte ihn, schließlich war er mit seiner Schrottsammlung und seinen kuriosen Geschichten aus dem Hamburger Hafen eine lokale Berühmtheit. Oder der verrückte alte Kauz. Je nachdem, ob die Leute ihn mochten oder nicht. Alle nannten ihn jedoch Schrotti und gaben seine Adresse an die Touristen weiter. Ein Ladengeschäft hatte er nicht, das war nichts für ihn, außerdem bot die Grünfläche um seinen umgebauten Kutter in direkter Nachbarschaft zur Bootswerft genug Platz für seine Fundstücke aus dem Hafen.
Er war nicht immer Schrottsammler gewesen, doch sein bürgerliches Leben war vorbei, und er erinnerte sich nicht mehr … Er kniff erneut die Augen zusammen. War das möglich?
Fischkisten und Bojen landeten hier häufiger mal an, sogar Autoreifen und Fahrräder, wenn bei Ebbe der Grund zu sehen war. Aber eine Schaufensterpuppe?
»Schrotti, mien Jung, du musst weniger trinken«, murmelte er leise und starrte weiter auf die Uferböschung und das schwappende Wasser.
Auch nach gefühlten Ewigkeiten sah er nichts anderes. Schrotti schüttelte den Kopf. Immer passierte ihm so ein Ärger. Das war nicht gut. Widerstrebend trat er ganz nahe heran. Und dann begriff er …
Er ließ sich auf ein Knie nieder, nahm seine Mütze, einen wollenen Elbsegler, ab und legte sie ehrfürchtig über seine Brust.
Leise stimmte er an: »What shall we do with the drunken sailor, what shall we do with the drunken sailor, early in the morning …«
Er beendete sein Lied mit einem langen Seufzer. Erste Tränen liefen ihm über die Wangen.
Die Augen der toten Frau starrten ins Leere.
»Ach, meine Liebe, was hat dich hierhergebracht? Die kalte Elbe ist ein grausamer Ort für eine gute Seele wie die deine.« Seine Hand strich behutsam über ihre kalte Stirn, an der das nasse Haar klebte.
Er wischte es beiseite … hob langsam den Kopf und sah in den strahlend blauen Himmel. Wolkenlos. Er stand auf und kramte sein Mobiltelefon aus der Hosentasche. Ihm blieb keine andere Wahl, denn weit und breit war niemand zu sehen. Wozu er sich eben noch beglückwünscht hatte, verfluchte er nun. Er ahnte den Ärger und die Verzweiflung, den dieser Fund mit sich bringen würde. Er kratzte sich die Kopfhaut unter seinen grauen Haaren und setzte die Mütze wieder auf.
»Hier ist Schrotti«, sprach er ins Telefon, als sich die Polizei meldete, »ich habe hier etwas gefunden, was ihr sehen müsst, nech!«
Sollte er ihren Mann holen? Nein, das war Aufgabe der Polizei. Er konnte nichts mehr an den traurigen Tatsachen ändern.
Er setzte sich zu ihr, um sie nicht allein zu lassen. Zu dieser wundervollen Frau, die ihn nie wieder anlächeln würde.
Es dauerte nicht lange, bis sich die Polizeisirenen näherten. Bis sie ihn fluchend aufforderten, sofort von der Leiche wegzutreten. Was er sich dabei denken würde? Ob er sie angefasst habe? Hatte er sie auf die Steine gezogen?
So viele Fragen, so viel Krach. Keinen Blick für die arme Frau.
Schrotti sah sofort, dass es nicht nur die beiden bekannten Schutzpolizisten der Außenstelle Finkenwerder waren, sondern Polizisten der Wasserschutz. Die hatten Streifen auf den Schulterklappen, die Schutzpolizei Sterne. Leiser waren sie aber auch nicht. Hatten sie denn gar kein Mitgefühl?
Während der eine in sein Funkgerät sprach, forderte ein anderer ihn auf, sich in den Streifenwagen zu setzen. Als ob Schrotti im Weg rumstünde. Er krabbelte langsam und mühsam die Böschung hoch, ging zu dem Streifenwagen, lehnte sich dagegen und sah zu, wie der Polizist sich zu der Toten herunterbeugte. Erkannte er sie?
Ganze Wagenkolonnen aus Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen trafen ein und bevölkerten den kleinen asphaltierten Parkplatz, der von Eichen umgeben war, deren Äste wie schützende Arme über die Fahrzeuge ragten.
Ein Boot der Wasserschutzpolizei näherte sich und blieb in der Einfahrt zum Rüschkanal liegen.
Immer mehr Leute lösten sich aus dem Schatten der Bäume, ihre Gestalten wurden größer, und sie kletterten mühsam und fluchend die Böschung hinunter zu Melanie. Menschen, die sie vermessen, untersuchen und fotografieren würden und nicht ahnten, was für eine wunderbare Frau sie gewesen war.
Er konzentrierte sich auf die kühle Brise des Flusses, das Licht und das leise Plätschern der Wellen. Das half ihm, nicht daran zu denken, dass Melles Jacke hochgerutscht und etwas von ihrem nackten Bauch gezeigt hatte. Die Flut musste sie über die Steine gespült haben. War sie von einem Steg im Yachthafen ins Wasser gefallen und in der Strömung des Flusses ertrunken? Auch erfahrene Schwimmer richteten gegen die Unterströmungen nichts aus. Wobei Melle natürlich nicht baden gewesen war, denn sie war vollständig bekleidet.
Die Spurensicherung fertigte unzählige Fotos von ihr an, als ob sie die letzten unaussprechlichen Momente ihres Lebens in ihrem kalten, unbarmherzigen Licht festhalten wollten. Solche Bilder, dachte er, möchte niemand jemals von sich machen lassen. In ihren weißen Schutzanzügen wirkten die Männer wie eine fremde Spezies, die mit bedächtiger Präzision jeden Millimeter des Ufers untersuchte. Sie knieten sogar am Boden und nahmen Proben vom Wasser und den Steinen. Wozu sollte das gut sein?
Eine Frau mit halblangen grauen Haaren und ein großer, schlanker Mann eilten vom Parkplatz herüber. Schrotti erkannte sofort, dass die beiden zum LKA gehören mussten, denn die uniformierten Polizisten stellten ihre Gespräche ein, sahen ihnen entgegen und richteten ihre ganze Aufmerksamkeit auf die beiden.
Mittlerweile glich das Ufer einem wimmelnden Treiben aus Einsatzkräften in einem sorgfältig inszenierten Drama. Einem Drama, dessen Dimension sie noch gar nicht erfassten. Noch hatten sie nicht mit Melles Ehemann gesprochen. Noch ahnten sie nicht, mit wem sie es zu tun bekamen.
Einen Moment später zeigte ein uniformierter Beamter erst auf die Leiche, dann auf Schrotti. Na wunderbar, jetzt war es zum Weglaufen zu spät.
Die beiden Kommissare verbrachten eine ganze Weile bei Melle. Die Männer in weißen Ganzkörperanzügen hievten sie an Land und legten sie auf der Bahre ab, die zwei Männer eines Beerdigungsunternehmens ihnen hinschoben. Der Tatort zog die Einsatzkräfte an wie Aas die Geier, während Schrotti nur an die arme Melanie denken konnte, die im Zentrum dieses düsteren Chaos lag.
Sein Blick schweifte über die große Schiffsschraube und die steinerne Tonne, die als Kunstwerke vor dem Parkplatz standen. Erstmals versagten ihm die Bauwerke den Trost.
Die Kommissare kamen direkt auf ihn zu.
»Johann Hansen? Jacobi, Landeskriminalamt. Mein Kollege Van der Waal. Sie haben die Frau gefunden?«
Die Kommissarin kam sofort zum Punkt. Das gefiel ihm. Er nickte.
Sie musterte ihn. Das wiederum gefiel ihm nicht. Trotzdem fragte er sich seit langer Zeit das erste Mal, was die beiden wohl sahen und über ihn dachten. Mit Anfang siebzig hatte er seine besten Tage hinter sich, das wusste er. Und man sah ihm an, dass er nicht viel zu bieten hatte. Die Haut sonnengebräunt und lederartig, die grauen Haare wirr unter seinem abgetragenen blauen Elbsegler, und der Bart ungepflegt. Der schmutzige Overall und die abgenutzten Stiefel waren schrottig. Na und? Er hatte vor langer Zeit aufgehört, die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Es war ihm egal, was sie über ihn dachten.
Er schwieg.
»Sie kennen sich hier aus? Ich denke, Sie wissen sogar, wer die Tote ist, nicht wahr?«
Die Frau überraschte ihn. Sie wälzte andere Gedanken, als er ihr unterstellt hatte. Er musste vorsichtig sein, sie war klug.
Ein angestrengtes, zittriges Atmen ließ ihn kurz die Augen schließen. »Es ist Melanie Cullmann. Die Ehefrau von Fred.«
Diesmal war sie es, die nickte. »So steht es in dem Ausweis, den wir in ihrem Rucksack gefunden haben.« Sie rollte mit dem Fuß ein paar Kieselsteine zur Seite. Der Mann schrieb in ein Notizbuch. Dabei hatte Schrotti ihnen noch nichts Neues erzählt.
»Haben Sie den Rucksack angefasst?«, fragte der Mann.
»Nee, mien Jung.«
»Wie gut kannten Sie Melanie Cullmann? Können Sie mir etwas über sie erzählen?«, fragte die Frau.
Er hätte gerne gewusst, von welcher Abteilung des LKA sie kamen. Vielleicht vom Kriminaldauerdienst? »Sie war eine freundliche Frau. Hat manchmal was bei mir gekauft. Ich verkaufe alte Sachen. Ihr Mann Fred arbeitet beim Sicherheitsdienst der Werft.« Er zeigte vage hinter sich. »Man kennt sich auf Finkenwerder.« So viele Sätze am Stück hatte er lange nicht mehr gesprochen. Es erschöpfte ihn beinahe. Oder erschöpfte ihn die Tatsache, dass er in der Vergangenheitsform von Melle geredet hatte?
»Sie verkaufen Schrott?«
Er neigte den Kopf. Sie hatte sich über ihn informiert. Das war zu erwarten gewesen, die beiden Schutzpolizisten der Außenstelle des PK47 kannten und mochten ihn. »Vieles ist alt und mitgenommen, aber nicht zwangsläufig Schrott und nutzlos.«
Sie sah ihn nachdenklich an. »Sie sprechen nicht nur von Ihrem Geschäft, oder?«
Genau in diesem Augenblick schoben die Bestatter die Bahre mit dem Leichensack an ihnen vorbei und erlösten Schrotti von einer Antwort.
»Ruhe in Frieden, meine Schöne«, murmelte er und war froh, dass die grauhaarige Kommissarin und ihr Kollege ebenfalls einen Moment innehielten.
»Ist Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Haben Sie jemanden gesehen?«
Er schüttelte den Kopf. »Kann ich jetzt gehen? Sie haben ja meine Adresse.«
»Was hat Melanie Cullmann hier gemacht? Könnte sie freiwillig ins Wasser gegangen sein?«, fragte die Kommissarin.
»Ist es das, was Ihr Beruf mit Ihnen macht? Immer nur schlecht über die Menschen denken?«
»Wenn sich jemand das Leben nimmt, heißt das doch nicht, dass ich negativ über ihn urteile!« Sie wehrte sich. »Vielleicht war sie depressiv?«
»Sie liebte ihr Leben.«
»Woher wissen Sie das?«
»Fragen Sie mich nicht, wenn Sie die Antwort nicht hören wollen.«
»Sie waren nicht immer Schrotthändler, stimmt’s? Was ist Ihnen passiert?«
»Um mich geht es hier nicht. Ich rate Ihnen, Fred nicht mit Ihrer Selbstmordtheorie zu kommen, das verkraftet er nicht!«
Sie sah ihn nachdenklich an. »Wir werden jetzt zu ihm fahren und ihm die traurige Nachricht überbringen.«
»Er weiß es schon!«
»Wie bitte?«, krächzte ihr schlaksiger Kollege.
Schrotti verspürte einen winzigen Moment lang ein Gefühl der Genugtuung. Sie hatten nicht halb so viel im Griff, wie sie dachten.
Er zeigte hinter sich, Richtung Yachthafen.
»Er stand in der Absperrung!«
»Das glaube ich nicht. Hätte er nicht versucht, zu seiner Frau zu kommen?«, fragte die Kommissarin, deren Namen er sich nicht merken wollte.
Er schüttelte den Kopf. »Ich habe keine Worte. Er auch nicht. Wir haben uns gesehen. Das reicht. Er weiß, dass ich bei ihr bin, solange es geht. Seine Welt ist zerbrochen.«
»Herr Hansen, wir werden Sie noch einmal kontaktieren und Ihre Zeugenaussage schriftlich aufnehmen. Bitte bleiben Sie für uns erreichbar.«
Die Frau verstand nicht, dass Fred sich niemals im Beisein all dieser fremden Menschen von Melle verabschieden würde.
Jeder trauerte eben auf seine Weise.
Kapitel 5
Also wenn dieser Mann sein Leben lang Schrotthändler war, bin ich eine internationale Geheimagentin! Seine Antworten … ehrlich, über den möchte ich mehr erfahren, bevor wir noch mal mit ihm sprechen.« Jonna wandte den Kopf zu Daan Van der Waal, der auf dem Beifahrersitz saß.
»Er war irgendwie … liebenswert … trotz seiner schroffen Antworten.« Er überlegte. »Die Art, wie er sich von der Frau verabschiedet hat, war berührend. Ich glaube, die waren enger befreundet, als er zugegeben hat.«
Jonna fuhr vom Tatort parallel zum Steendiekkanal den Hein-Saß-Weg herunter und steuerte auf das Wohngebiet der kleinen Landzunge zu. Dies war die eingetragene Wohnanschrift der Eheleute Cullmann. Traditionelle Rotklinkerhäuser reihten sich mit gepflegten Gärten aneinander.
»Vielleicht ist Tom dem Mann schon mal begegnet? Scheint ja ein Unikat zu sein, und Tom kennt doch seine Hafenleute!«
Daan grinste. »Du meinst, wir sollten Tom mal wieder so richtig in Schwierigkeiten bringen? Der Arme hat seit der Sturmflut bestimmt die Nase gestrichen voll von uns! Außerdem gehört Finkenwerder nicht in sein Reviergebiet, oder?«