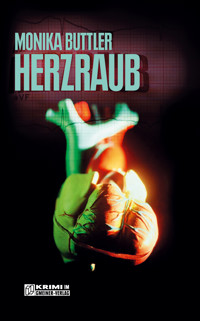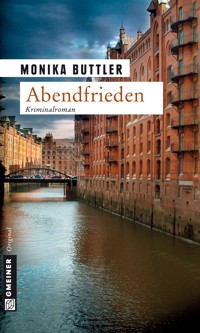9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Möwen, Morde und viel Meer
Zwischen Hamburg und der Nordseeküste gibt es so manchen Tatort und so manchen Ermittler – doch sie alle haben eins gemeinsam: Sie arbeiten dort, wo andere am liebsten Urlaub machen. Denn egal ob sonniger Sandstrand, glitzernde Elbe oder tosende See, das Verbrechen macht vor gar nichts halt!
23 Fälle, die es in sich haben – unsere Autorinnen nehmen Sie mit an die Tatorte im Norden und versprechen Spannung für den Urlaub oder einfach zwischendurch, auf jeder Seite.
Mit Kurzkrimis von Monika Buttler, Carola Christiansen, Heike Denzau, Kathrin Hanke, Franziska Henze, Eva Jensen, Svea Jensen, Anke Küpper, Alexa Lewrenz, Anja Marschall, Bettina Mittelacher, Regina Müller-Ehlbeck, Ricarda Oertel, Susanne Pohl, Alex Roller, Maja Schendel, Anette Schwohl, Stefanie Schreiber, Regine Seemann, Elin Seidel, Carolyn Srugies, Joyce Summer und Sabine Weiß.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
© 2022 by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Umschlaggestaltung von Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich Umschlagabbildung von Gabi Kuerverst / Shutterstock
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783749903245
www.harpercollins.de
Irrgäste
Sabine Weiß
Neuwerk – Scharhörn
Wie ein Suchscheinwerfer blitzte der Lichtkegel des Leuchtturms von Neuwerk in der Dämmerung auf. Während Henny durch ihr Spektiv die Insellandschaft beobachtete, lauschte sie den Stimmen der Natur. Der Wind trug unzählige Vogelgesänge zu ihnen. Henny erkannte alle, nicht umsonst war sie eine der besten Vogelbeobachterinnen Deutschlands. Oft schon hatte sie die Rangliste im Club300 angeführt, dessen Maßgabe es war, mindestens dreihundert wild lebende Vogelarten im Heimatland erspäht zu haben. Dabei war sie keiner dieser verabscheuungswürdigen Twitcher oder Spotter, die jedem seltenen Vogel hinterherreisten und beinahe über Leichen gingen, nur um ihre Liste aufzupeppen. Nein, sie betrieb ihre Leidenschaft mit der gebotenen Ernsthaftigkeit. Schließlich hatte die Vogelbeobachtung ihr auch über das Grauen der Vergangenheit hinweggeholfen. Es beruhigte sie, sich ganz auf die Natur zu konzentrieren. Im Lichte des Sonnenuntergangs wirkte die Insel mit ihren Wiesen, Deichen und dem sanft wogenden Meer besonders idyllisch. Kaum vorstellbar, dass einzig das trutzige Quermarkenfeuer Schutz geboten hatte, wenn die Nordsee bei Sturmfluten ihre Muskeln spielen ließ und der Rest des Eilands überspült worden war. Ohnehin waren Neuwerk und die vorgelagerten Inseln Scharhörn und Nigehörn eine Kuriosität: ein Stück Hamburg mitten im Wattenmeer. Zugleich waren sie Zentrum des Nationalparks Hamburgisches Wattenmeer.
Während Henny weiter mit ihrem Hochleistungsfernglas den Binnengroden und das Buschwerk um den Friedhof der Namenlosen absuchte, legte sie in Gedanken eine Liste der Vögel an, die sie hörte. Sie vernahm das »Ki-wiek« der Austernfischer, das »Üätt« der Knutts, die Rufe der Weißwangen- und Nonnengänse, der Lachmöwen und Brachvögel, der … unvermittelt hielt Henny inne. Erregung durchfuhr sie.
»Kampfläufer auf halb fünf«, wisperte Henny.
Zackig richtete Evelyn ihr Spektiv neu aus. »Wo? Wo?«, fragte ihre Vogelfreundin aufgeregt.
»Halb fünf, sagte ich doch. Die Kampfläufer brüteten früher auf Neuwerk. Heute sind sie eher selten. Wenn der Mensch nicht wär …«, murmelte Henny. Ehe sie sich in ein Lamento über die Bedrohung der Vogelwelt durch die Zivilisation hineinsteigern konnte, plusterte der Schnepfenvogel seinen kastanienbraunen Kragen auf, und sie verstummte ergriffen.
»Ah, da bist du ja! Wie wunderschön du bist! Ein richtiger Beau! Als ob du gleich auf Brautfang gehen würdest«, schwärmte Evelyn leise, als sie ihn endlich entdeckt hatte.
Unmut wallte in Henny auf. »Du immer mit deinen Vermenschlichungen! Dabei ist jetzt gar keine Balzzeit.«
Als sich einige Herren ihrer Reisegruppe näherten, löste Evelyn sich von ihrem Spektiv. Sie zupfte mit einer gezierten Geste die Löckchen unter der Wollmütze hervor und trug eilig eine neue Schicht rosa glänzenden Lipgloss auf.
»Für manche Individuen ist immer Balzzeit«, sagte Evelyn lächelnd.
Henny unterdrückte ein Seufzen. Erst hatte sie lediglich Mitleid mit Evelyn gehabt, dann hatten sie sich gegenseitig gestützt, und jetzt waren sie tatsächlich so etwas wie Gefährtinnen geworden. Dabei waren sie so unterschiedlich! Und manchmal schämte Henny sich auch für ihre Vogelfreundin. Jetzt beispielsweise, wo Evelyn hemmungslos mit ihren Reisegefährten flirtete und stolz damit angab, dass sie einen Kampfläufer entdeckt hatten.
Henny wandte sich ihrem Notizbuch zu. Sie hatte schon immer mit Vögeln mehr anfangen können als mit Menschen. Gewissenhaft trug sie den Kampfläufer auf ihrer Liste ein. Vogel Nummer 89 für heute, 378 im gesamten Jahr. Nicht schlecht für den Spätsommer. Damit hatte sie ihren Abstand auf der Rangliste der Vogelbeobachter in Deutschland erneut vergrößert. Als Expertin wäre sie von Fernsehsendern, Radiostationen und bei Verlagen also weiterhin gefragt. Henny hatte ihrer Leidenschaft alles untergeordnet, Beruf wie Privatleben, da taten die öffentliche Anerkennung und die entsprechende Honorierung gut. Der Gedanke an ihre prekäre finanzielle Lage ließ sie frösteln. Als ernst zu nehmender Birder hatte man unzählige Ausgaben.
Die Wärme des Tages war von der aufziehenden Nacht vertrieben worden. Evelyn kicherte albern über den Scherz eines vogelverrückten, aber solventen Birders mit silberner Haartolle. Genervt klappte Henny das Stativ ihres Fernglases ein. Hier war es viel zu trubelig für die Vogelbeobachtung! Entschlossen marschierte sie gen Nordvorland davon. Sie hatte da so eine Ahnung …
Hektisch packten die anderen ebenfalls zusammen. Wo Henny hinging, waren ornithologische Entdeckungen zu erwarten, das wussten sie. Vor ihnen malten Vogelschwärme bewegte Muster in die Dämmerung und senkten sich dann auf den schmalen Uferstreifen. Das Meer würde sich bald zurückziehen und das Watt freigeben, eine gedeckte Festtafel für jeden Vogel. Henny war es vorhin gewesen, als hätte sie eine der seltenen Elfenbeinmöwen im Schwarm gesehen. Allerdings würde ihr Instinkt die Möwen und Gänse bald zu ihren Schlafplätzen treiben. Sie musste sich also beeilen.
»Habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich Ihr letztes Buch verschlungen habe? Ich nehme an, Sie erwarten gleich, etwas Besonderes zu entdecken?«, meinte der Silberhaarige, der zu Evelyns sichtlicher Enttäuschung neben Henny marschierte.
»Wie viele Vögel haben Sie denn heute beobachtet? War ein Irrgast dabei?«, fragte ein dicker, schnaufender Herr mit einem verschwörerischen Lächeln, der auf der anderen Seite aufgetaucht war. Beim Anblick der teuren, nagelneuen Ausrüstung dachte Henny: Du bist auch so ein Irrgast, ein Vogel, der sich verflogen hat. Soweit sie wusste, war er früher Großbauer gewesen; einer derjenigen, die mit Monokultur und Düngemitteln zum Aussterben etlicher Vogelarten beitrugen.
Und wenn, dann würde ich es Ihnen nicht verraten, hätte Henny am liebsten gesagt, blieb aber höflich. Während sie über ihre Beobachtungen plauderte, scharten sich immer mehr Vogelkieker um sie. Dabei hatte Henny nichts für aufdringliche Männchen übrig, ob im Tierreich oder unter zweibeinigen Vogelfreunden. Aus leidvoller Erfahrung wusste sie, wie manche Herren aus diesen Reisegruppen waren; zeigte man einmal Schwäche, schnappten sie einem die Vogelsichtungen weg oder wurden handgreiflich. Evelyn mischte sich eifrig, aber weniger kundig in das Gespräch ein. Für sie waren die Vogelfreunde eine Mischung aus großer, solidarischer Familie und Heiratsmarkt. Henny hoffte nur, dass ihre Gefährtin ihre Vertrauensseligkeit nicht irgendwann bereuen würde.
Ein vielversprechender Aussichtspunkt war bald erreicht, schließlich war Neuwerk kaum mehr als drei Quadratkilometer groß. Henny hatte gerade das Spektiv ausgerichtet und mit der Suche nach der Elfenbeinmöwe begonnen, als sich aus der Ferne ein Dröhnen näherte. Wenig später scheuchte ein Motorboot die rastenden Zugvögel auf.
»Das gibt es doch nicht! Die armen Vögel! Bald ist Ebbe und außerdem finstere Nacht – welcher Idiot fährt denn um diese Zeit noch mit dem Boot nach Neuwerk? Der muss ja lebensmüde sein«, fluchte Evelyn neben ihr.
Das Boot machte fest. Ein einzelner Mann kletterte auf den Anleger. Henny erstarrte. Die hochgewachsene Gestalt, die in den Laternenschein trat, war auch aus der Ferne unverkennbar. Ausgebeulte Fotoweste, Schlapphut, viele Gürteltaschen.
»Was will denn Richard van Vanten hier?«, fragte Evelyn ebenso überrascht wie ehrfurchtsvoll. Dann bemerkte sie Hennys Entsetzen. »Der soll bloß wegbleiben!«
Henny presste die Kiefer aufeinander und schwieg. Ausgerechnet ihr Erzfeind. Sofort verbreitete sich Aufregung unter den Vogelkiekern. Richard van Vanten war eine lebende Legende. Ein fanatischer Twitcher, der sich über seine Informanten zutragen ließ, wo seltene Vögel gesichtet wurden, und dann dorthin raste, um sie als Erster – und am besten auch als Einziger – zu fotografieren. Dabei ging er aggressiver als ein Kasuar vor; und diese flugunfähigen Laufvögel aus Neuguinea hatten schließlich auch schon Menschen umgebracht. Dass sie van Vanten ein paarmal bei Sichtungen und auch in der Jahres-Bestenliste geschlagen hatte, ohne sich auf sein Niveau herabzulassen, machte Henny stolz. Ihn hatte sie damit jedoch auf eine andere Art und Weise gereizt, als ihr lieb gewesen war.
Als die Hobby-Ornithologen sahen, dass van Vanten auf den Gasthof zusteuerte, brachen die meisten auf. Henny blieb so lange auf ihrem Beobachtungspunkt, bis es so dunkel war, dass man beim besten Willen keinen Vogel mehr erkennen konnte. Leise maulend leistete Evelyn ihr Gesellschaft.
»Gehen wir auf unser Zimmer. Wir können ja sagen, wir haben Kopfschmerzen«, sagte Evelyn.
»Wir? Seit wann entscheidest du für mich?«, fragte Henny ärgerlich.
»Sei nicht böse, Henny. Ich habe es nur gut gemeint. Ich weiß, dass dieser van Vanten dich …«
»Schon gut!«, fiel Henny ihr ins Wort.
Normalerweise aßen sie zusammen mit den anderen Vogelkiekern und fachsimpelten noch stundenlang. Heute würde sich jedoch alles nur um Richard van Vanten drehen. Er würde jedes Gespräch an sich reißen, das hatte Henny schon oft genug erlebt. Ganz abgesehen von dem, was er ihr angetan hatte.
Henny spürte, wie ihr Magen krampfte. Es musste einen Grund dafür geben, warum van Vanten so überstürzt nach Neuwerk gereist war. Jemand hatte ihm einen Tipp gegeben. Hier musste ein Vogel gesichtet worden sein, den sie noch nicht entdeckt hatte. Vielleicht ein Irrgast. Ein Vogel von der Roten Liste der bedrohten Arten. Vermutlich eine deutsche Erstsichtung. Aber das konnte doch nicht sein! Wie hatte sie diese Besonderheit übersehen können? Sie hatte die Insel doch mit ihrem phänomenalen Spürsinn abgesucht! Sie musste herausfinden, was Richard van Vanten nach Neuwerk getrieben hatte. Und sie musste ihm zuvorkommen.
»Wir essen mit den anderen, wie immer. Ich lasse mich von diesem Mistkerl doch nicht einschüchtern«, sagte Henny kämpferisch, obgleich der Gedanke daran ihre Übelkeit noch verstärkte.
Vor der Gaststube diskutierte Richard van Vanten mit mehreren Insulanern, während die Vogelkieker in der Nähe standen und zu lauschen versuchten. Einige telefonierten auch oder wischten aufgeregt auf ihren Smartphones herum. So, wie es aussah, war van Vanten stinksauer, weil die Insulaner ihm etwas verweigerten. Nun schnaubte er, und die Ringellocken an den Enden seines Schnurrbarts bebten vor Wut. Er sah so affig aus! Aber wie immer war er perfekt ausgestattet. Aus den unzähligen Taschen seiner Weste lugten ein ausgezeichnetes Zoom-Fernglas, Kameraobjektive, sein altgedienter Militärkompass, ein Notizbuch und anderes Equipment. An seinem Gürtel hingen Handytasche und Klappmesser.
»Dann eben nicht!«, blaffte van Vanten jetzt. Wütend packte er seinen Kamerarucksack und stürmte davon. Als er Henny sah, schoss er auf sie zu. Er war einschüchternd groß, und Henny bemerkte, wie Evelyn, die gerade dabei gewesen war, ihr Make-up zu erneuern, unwillkürlich zurückwich.
»Hätte mir ja denken können, dass du ebenfalls hier herumlungerst. Aber du kommst mir nicht zuvor, du nicht!«, zischte er. Dann stieß er sie und Evelyn grob beiseite. Evelyn geriet ins Trudeln, klammerte sich an ihn, um nicht zu stürzen, doch ihr Rucksack rutschte von ihrer Schulter, und da er offen gestanden hatte, ergoss sich der Inhalt auf den Boden. Henny packte den Arm ihrer Vogelfreundin, bis diese sicheren Stand hatte.
»Sag mal, spinnst du?! Was glaubst du eigentlich, wer du bist?«, fauchte Henny ihn an.
Richard van Vanten klopfte sich ab, als sei er beschmutzt worden. »Wer ich bin? Deutschlands Vogelexperte Nummer eins! Und ihr seid unfähige Stümper! Solltet lieber bei euren Vogelfutterstationen bleiben, da könnt ihr nichts falsch machen!«
Beim Essen hielten sich die Verärgerung über Richard van Vantens ungehobelten Auftritt und die Neugier auf die Information, die er partout nicht mit ihnen teilen wollte, die Waage. Henny hatte sofort ihre Kontakte bei den Vogelschutzstationen an der Nordsee aktiviert, aber niemand hatte eine Information für sie gehabt. Nur die üblichen Verdächtigen der Vogelwelt waren zwischen Helgoländer Bucht und Außenelbe unterwegs.
»Van Vanten ist wirklich fanatisch! Einmal ist er von Sylt aus an den Bodensee gerast, nur weil dort ein Krauskopfpelikan gesichtet wurde. Auf dem Weg soll er zehnmal geblitzt worden sein – ist ihm egal. Angeblich hat er sogar einen Unfall verursacht, bei dem jemand ums Leben gekommen ist. Sein Anwalt hat ihn rausgehauen«, meinte der frühere Großbauer halb respektvoll.
»Bestimmt nur ein böswilliges Gerücht. Wer so fokussiert ist, macht sich eben Feinde. Andererseits: Geld hat er genug. Deshalb kann er ja auch seine Informanten schmieren, sodass die unsereinem nichts erzählen«, klagte die Silbertolle.
»Weibliche Birder soll er hingegen gerne um sich haben.«
Sein Gesprächspartner glättete grinsend seinen Haarschopf. »Da ist er polygam, wie manche unserer gefiederten Freunde. Macht ja auch evolutionstechnisch Sinn. Blaumeisen neigen zu Seitensprüngen, dann sind die Nachkommen genetisch vielfältiger und auch gesünder. Der Zaunkönig und die Prärieammer haben sogar gerne parallel zwei Weibchen und zwei Nester, wenn das möglich ist.«
Jetzt kicherte der Ex-Landwirt. »So ein Doppelleben wäre mir zu viel Stress.«
Henny ging dieses Gerede auf die Nerven. »Gegen van Vanten liegen diverse Anzeigen wegen sexueller Belästigung vor«, warf sie entschieden ein. Betretenes Schweigen.
Evelyn hatte sich die ganze Zeit ihrem Omelette mit Nordseekrabben und ihrem Nachtisch gewidmet. Jetzt sprach sie zu Hennys Entsetzen das aus, worüber diese schon die ganze Zeit grübelte. »Wir haben auf Neuwerk keine außergewöhnliche Vogelart entdeckt. Entweder haben wir etwas übersehen, oder van Vanten will nach Scharhörn weiter.« Evelyn konsultierte die Tidentabelle auf ihrem Handy, dann sah sie in die Runde und genoss es sichtlich, dass die Aufmerksamkeit der Männer auf sie gerichtet war.
Henny erhob sich abrupt. »Wir sollten zeitig zu Bett gehen. Komm, Evelyn.«
»Bis zu den Vogelinseln Nigehörn und Scharhörn sind es acht Kilometer«, sagte Evelyn unbeirrt. »Wenn wir morgen bei Dämmerung aufbrechen, können wir die Inseln gut zu Fuß erreichen. Oder wir nehmen einen Wattwagen.«
»Komm jetzt, es wird Zeit«, beharrte Henny.
Ihre Gefährtin führte gerade einen Löffel rote Grütze mit Vanillesoße zum Mund. »Aber mein Nachtisch … außerdem sind wir doch gerade hier in so angenehmer Gesellschaft.« Evelyn lächelte in die Runde. Henny konnte ihre Verachtung nicht verbergen. Sie zog sich allein zurück. Mit dieser Einstellung würde Evelyn nie ein führender Birder werden.
Leise schnarchte Evelyn vor sich hin, als Henny sich auf den Weg machte. Sie hatte alles genau durchgerechnet. Wenn sie jetzt losmarschierte, wäre sie zur Morgendämmerung auf Scharhörn und könnte den Irrgast suchen, ehe Richard van Vanten oder die anderen Vogelkieker ihr zuvorkamen. Natürlich war die Wanderung durch das nächtliche Watt eine gefährliche Angelegenheit, aber sie war ein Küstenkind, hatte Kompass, Karte und hohe Gummistiefel zum Durchqueren der Priele. Außerdem war sie schon öfters nach Scharhörn gewandert.
Henny schlich aus der Pension. Mondschein erhellte die Nacht, und die Luft war so kühl, dass sie sich kurz in ihr warmes Bett zurücksehnte. Zwischen den Wolkenfetzen blitzte ein Sternenhimmel auf, so klar, wie er nur an Orten strahlte, die von künstlichen Lichtern nicht verschmutzt waren. Beinahe zärtlich strich der Leuchtturmkegel über die Insel. Nur der Wind war zu hören, jetzt, bei Ebbe, schien sogar das Meer verstummt.
Wenig später breitete sich das Watt vor ihr aus. Wie gekämmt wirkte das sanfte Waschbrett des Sandes. Der Mond spiegelte sich in Pfützen, aber der Horizont verschwamm im Dunst. Das war doch nicht etwa Seenebel? Schnell schob Henny den Gedanken weg. Sie kontrollierte noch einmal die Wanderkarte und richtete den Kompass aus. Bei diesem Marsch durfte sie sich keinen Fehler erlauben. Auf die Pricken, die im Watt befestigten Reisigbündel, die den Weg markierten, wollte sie sich nicht verlassen. Die Priele zwischen Neuwerk und Scharhörn waren tief, die Strömungen schnell. Alljährlich wurden Wanderer im Watt von den Fluten überrascht, gerieten in Lebensgefahr oder ertranken sogar.
Während sie marschierte, dachte sie über ihre früheren Besuche auf Scharhörn nach. Obgleich die Küstenlinie durch Sturmfluten und Orkane abgeschliffen und neu geformt wurde, kannte man Scharhörn schon seit mehr als siebenhundert Jahren. Für frühere Seefahrer war die Sandplate ein gefährliches Riff gewesen, und tatsächlich lagen unzählige Wracks in den Tiefen vor Scharhörn. Genau genommen bewegte sich die wandernde Düneninsel ebenfalls, sogar ein bis vier Meter pro Jahr, hieß es. Um Scharhörn zu schützen, war vor über dreißig Jahren einen Flügelschlag entfernt eine weitere Insel aufgespült worden: Nigehörn. Heute waren beide Inseln ein Paradies für Zugvögel. Der einzige Zweibeiner, der für längere Zeit dort leben durfte, war der Vogelwart von Scharhörn, den der Verein Jordsand einsetzte. Die Insel Nigehörn durfte gar nicht betreten werden. Eigentlich hätte Henny sich bei dem Vogelwart anmelden müssen, aber sie wollte keine unnötige Aufmerksamkeit wecken, und bei ihrem Rang würde sie schon keine Schwierigkeiten bekommen. Was für einen Vogel es wohl nach Scharhörn verschlagen hatte?, grübelte sie.
Je weiter sie ging, desto schlechter wurde die Sicht, was Henny zu ignorieren versuchte. Sie würde auf keinen Fall umkehren. Feuchte Kälte stieg vom Meeresboden auf. Obgleich Henny lange Unterhosen trug, war ihr kalt. Jetzt verließ sie das härtere Sandwatt. Das Schmatzen ihrer Stiefel im Schlick durchschnitt die Stille. Nur nicht einsinken! Wenn sie stecken blieb oder sich den Knöchel verknackste, war sie verloren. Niemand wusste, dass sie hier war, nicht einmal Evelyn. Diese dumme Gans hätte sich nur verplappert.
Schmatzende Tritte in den Schlick. Schmatz, schmatz. Das Marschieren wurde anstrengend, die Stiefel vom Matsch schwer – und der Rucksack mit Spektiv, Stativ und Kamera erst!
Vor Henny breitete sich ein Priel aus. Diese mäandernden Wasserläufe konnten schnell vollströmen und vom Bach zum reißenden Fluss werden. Henny schlug einen Bogen um den Priel und blieb anschließend stehen, um den Kurs zu kontrollieren. Schmatz, schmatz. Sie fuhr herum. Ihr Herz raste unvermittelt. War da noch jemand im Watt? Oder hatten ihre Ohren ihr einen Streich gespielt? Ihre Augen durchkämmten die nächtliche Wattlandschaft. Im Seenebel glaubte sie überall Schemen zu erkennen, was die Sache nicht besser machte. Sie musste an die unzähligen ertrunkenen Seeleute denken, die am Scharhörnriff ihr Leben gelassen hatten. Viele hatten auf dem Friedhof der Namenlosen auf Neuwerk ihre letzte Ruhe gefunden. Oder irrten ihre Geister hier herum? Suchten diese Gespenster harmlose Wanderer heim? Warum war sie auch so blöd gewesen, allein loszulaufen?!
Nur die Ruhe! Henny ging weiter, lauschte angestrengt. Laut klang jeder ihrer Schritte. Der Wind zerrte flappernd an ihrer Jacke, pfiff zwischen ihren Beinen hindurch. Noch immer hämmerte der Puls in ihren Adern. Wieder blieb sie stehen. Stille. Sie musste sich geirrt haben. Also weiter. Schmatz, schmatz. Alle Haare an ihrem Körper stellten sich mit einem Mal auf. Da war jemand. Und er kam näher. Henny marschierte im Stechschritt durchs Watt, krampfhaft die kleine Taschenlampe auf ihren Kompass gerichtet. Wie lange war sie schon unterwegs? Wann wäre sie auf Scharhörn? Der Vogelwart würde sie sicher vor dem Verfolger beschützen. Sie würde sich entschuldigen müssen, weil sie sich nicht angemeldet hatte, würde sich ein Donnerwetter anhören müssen, weil sie so leichtsinnig gewesen war, natürlich …
Ganz nah waren die Schritte jetzt. Henny wagte es nicht, sich umzudrehen. Sah die von Fischen und Vögeln zerfressenen Gesichter der Ertrunkenen vor ihrem inneren Auge, die sie jagten. Andererseits: Vielleicht war es ja auch nur Evelyn, die ihr folgte. Aber warum gab ihre Freundin sich nicht zu erkennen?
In diesem Augenblick packte jemand ihren Arm und riss sie herum. Richard van Vanten ragte vor Henny auf. Das Zwielicht machte aus seinem Gesicht einen unheimlichen Scherenschnitt, doch das gefährliche Funkeln seiner Augen stach heraus. Sofort war die Erinnerung wieder da. Henny wurde schlagartig übel. Sie zerrte sich los. Eine heftige Wut wallte in ihr auf. Am liebsten hätte sie ihn geschlagen.
»Was treibst du hier?!«, fauchte van Vanten.
»Das Gleiche könnte ich dich fragen!«
»Spazierst hier mit deiner Taschenlampe herum wie ein Irrwicht. Du gehst sofort zurück nach Neuwerk, hörst du?!«
»Geh du doch zurück!«
Er packte sie an den Schultern, schüttelte sie. »Du treibst mich in den Wahnsinn mit deinem Ehrgeiz! Immer musst du versuchen, mich auszustechen, du kleines Luder!«
Henny bekam es mit der Angst zu tun. Sie wandte sich heftig in seinem Griff. »Lass mich los, du Monster!«
Sein heiseres Lachen klang unheimlich im einsamen Watt. Plötzlich zog er sie zu sich hoch. Ihre Füße baumelten in der Luft. Er küsste sie, schob drängend seine Zunge in ihren Mund, wie er es schon einmal getan hatte. Anschließend hatte er sie wochenlang gestalkt, hatte sie Hunderte Male pro Tag angerufen und ihr sogar aufgelauert. Henny würgte. Sie strampelte und schlug um sich, so gut sie konnte. Da fiel ihr der Kompass ein, den sie umklammert hielt. Sie holte aus – und hämmerte ihn auf van Vantens Nase. Fluchend ließ er sie los. Henny plumpste ins Watt, wankte unter der Last ihres Rucksacks, fing sich dann aber und trat ihm zwischen die Beine. Van Vanten heulte auf. Kopflos rannte Henny in das Dickicht des Seenebels. Sie würde sich nicht von ihm verscheuchen lassen, sie nicht!
Da hörte sie schon seine geräuschvollen Schritte, spürte den Windhauch, als er sie zu packen versuchte. Schneller! Sie wurde umgerissen, schlug langhin. Salzgeschmack, Sand und Blut in ihrem Mund. Henny kugelte herum, wollte aufspringen, was mit dem Rucksack schwierig war. Da war ihr Verfolger schon halb auf ihr. Richard van Vanten umklammerte ihren Hals. Das Blut hatte sich von seiner Nase aus über das Gesicht verteilt. Seine Züge waren zu einer Grimasse verzerrt.
»Das ist mein Irrgast, hörst du! Ich habe dir einmal angeboten, dass wir uns zusammentun, aber du bist dir ja zu fein dafür …«
Blanke Panik. Henny war ihm ausgeliefert. Niemand würde ihr helfen, niemand je davon erfahren. Was tun? Ihre Finger stachen in sein Auge, der Griff lockerte sich. Henny kam auf die Füße. Spurtete, ihre Schritte schmatzten erneut. Sie sank tief ein, zu tief. Hektisch versuchte sie, die Füße aus dem Schlick zu ziehen, doch ihre Gummistiefel blieben stecken. Mit jeder Bewegung grub sie sich tiefer in den Meeresboden ein. Bald steckte sie bis zu den Oberschenkeln im Schlamm. Sie bebte. Tränen der Wut schossen in ihre Augen. Ihr Spaziergang auf dem Meeresboden würde tödlich enden, wenn niemand ihr half. Wenn Richard van Vanten ihr nicht half.
»Hilf mir, bitte!«, rief sie verzweifelt. »Ich verspreche, dass ich nach Neuwerk zurückkehren werde. Dass ich dir den ersten Platz der Vogelexperten überlassen werde …«
Van Vanten hatte sich in sicherer Entfernung des Priels aufgebaut. Gelassen kräuselte er die Spitzen seines Schnauzbarts. Dann nestelte er an seiner Fotoweste und holte den Kompass aus einer Westentasche. »Ist schade um dich. So ein hübsches, fleißiges Vögelchen«, sagte er beinahe bedauernd. Dann marschierte er davon.
Wie eine prallgrüne Oase schälte sich Scharhörn aus dem Seenebel. Die aufgehende Sonne zerstreute den Dunst, in ein paar Stunden würde sie ihn ganz vertrieben haben. Auf einer der sanften, weiß gewölbten Dünen stand der Schreikranich und schaute sich um, irritiert, als wüsste er nicht, was ihn hierher verschlagen hatte. Es war ja auch ein weiter Weg von Kanada und Texas, seinem natürlichen Lebensraum, hierher. Da musste mit der Navigation ganz schön was schiefgegangen sein, dachte Evelyn. Sie konnte die Augen nicht von seinem weißen Federkleid, dem roten Fleck auf dem Kopf und dem schwarzen Schnabel abwenden. Der Schreikranich war einer der seltensten Vögel der Welt. Ihn auf Scharhörn zu sehen, war wirklich eine ornithologische Sensation. Und sie hatte diese Sensation entdeckt! Sie würde diesen Vogel hier, auf Scharhörn, als Erste und Einzige fotografieren.
Wie in Zeitlupe setzte Evelyn ihren Rucksack ab. »Wenn du das doch sehen könntest, Willy«, sagte sie leise. Aber ihr geliebter Mann lag ja in einem Sarg. Genau wie sein Mörder bald in einem nassen Grab liegen würde. Es war kein Gerücht, dass Richard van Vanten auf der Jagd nach einem seltenen Vogel einen Unfall verursacht hatte. Er hatte Willy totgefahren, ihren Mann. Willy hatte von einem Grünstreifen aus einen Mornellregenpfeifer beobachtet. Dieser hatte auf einem abgemähten Feld einen Feind durch ein Ablenkungsmanöver zu täuschen versucht; ein typisches Verhalten dieser Art. Richard van Vantens Wagen war mit überhöhter Geschwindigkeit herangenaht und auf dem Asphalt ausgebrochen. Mithilfe eines teuren Anwalts hatte van Vanten seinen Freispruch erkämpft. Angeblich sei Willy auf die Straße gelaufen – lächerlich. Sie aber hatte Willy gerächt. Van Vanten hatte nicht einmal gemerkt, dass sie bei dem Zusammenstoß in der Pension seinen Kompass ausgetauscht hatte. Das kam davon, wenn man als Vogelkundler mit seiner Ausrüstung derart prahlte und sie zudem in einer leicht zugänglichen Fotoweste herumtrug. Mit dem manipulierten Kompass war Richard van Vanten jetzt vermutlich gen Helgoland unterwegs und würde bald in den Tiefen des Meeres verschwinden. Und Henny? Auch ihre arrogante Vogelfreundin hatte eine Strafe verdient. Evelyn hatte aus der Ferne gesehen, wie van Vanten Henny im Schlamm hatte stecken lassen. Kurz hatte sie berechnet, wie schnell der Wasserpegel steigen würde. Die anderen Vogelkieker würden Henny wahrscheinlich retten. Und dann würde sie sehen, wer Deutschlands neue, beste Vogelexpertin war, dachte Evelyn, als die Sonne die Silhouette des Schreikranichs gegen den Himmel zeichnete und sie das erste Foto schoss.
Mit leisem Summen kommt der Tod
Joyce Summer
Hamburg
Der Rauch griff nach ihnen, umhüllte sie und brachte sie in Alarmbereitschaft. Irgendwo musste es brennen, ihr Signal, sich für die anstehende Gefahr mit Proviant einzudecken. Vollgesogen mit der süßen Masse warteten sie ab.
Prüfend hielt er den Rahmen mit den Waben in das Licht der aufgehenden Sonne, die sich über dem Schanzenpark zeigte.
Diesen Sommer wird es eine gute Ernte geben, dachte er zufrieden und schob den Rahmen vorsichtig in die oberste Zarge des Bienenstockes, ohne die umherkrabbelnden Bienen zu zerquetschen. Er liebte es, am frühen Morgen auf den Dächern von Hamburg nach seinen Bienen zu schauen. Bevor die Stadt langsam erwachte, sich aus den Morgenschleiern emporhob, um dann in ihrer Geschäftigkeit zu versinken. Heute war sein Volk etwas aufgeregter als sonst. Es musste daran liegen, dass er die letzten Tage nicht hier oben gewesen war. Wächterbienen umschwirrten ihn, und ihr lautes Summen übertönte die Geräusche der Stadt. Dennoch kein Grund für ihn, sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Behutsam streifte er eine der Wächterinnen von seinem Gesicht, bevor sie auf die Idee kommen konnte, seine Nasenlöcher zu erkunden. Wie immer trug er keinen Schutzanzug. Die wenigen Bienenstiche, die er über das Jahr bekam, gehörten zu seinem Beruf und störten ihn nicht. Er holte den nächsten Rahmen aus der Zarge. Dieser war fast reif für die Ernte. Die Bienen hatten angefangen, die ersten Waben zu verschließen. Mit dem kleinen Finger pikste er vorsichtig in das weiß-goldene Konstrukt. Klebrig weich ergoss sich der klare Honig über den Finger. Als er ihn ableckte, schmeckte er die Aromen der Stadt. Nach den vielen Jahren als Imker konnte er alle benennen: den nussigen Geschmack des Ahorns und die Süße der Linde. Dazu das zarte Bouquet der wenigen Blumen des Parks, die dem Honig seine individuelle Note gaben. Die wenigsten wussten, dass Bienen Vorlieben hatten und es durchaus sein konnte, dass der Honig zweier Bienenvölker mit gleichem Standort unterschiedlich schmeckte. Er zuckte zusammen. Das gab es doch nicht? Ihn hatte tatsächlich eine Biene gestochen. Reflexartig wischte er über den Nacken, um das Tier loszuwerden, dann widmete er sich wieder dem prall gefüllten Rahmen in seiner Hand. Vorsichtig streifte er abermals die Insekten ab, um den Rahmen ohne große Verluste wieder in die Zarge zu schieben. Seine Hand fing an zu zittern, und der Schlitz, den er anpeilte, verformte sich zu einer Zickzacklinie. Die Farben vor seinen Augen lösten sich auf und wurden grau. Seine Zunge klebte an seinem Gaumen, und Hitze stieg in ihm auf. Was zum Teufel war das? Seine Beine stimmten in das Zittern seiner Hände ein, und er klammerte sich an den Bienenstock. Der ganze Stock vibrierte. Verdammt, was ist nur los mit mir? Er versuchte, tief durchzuatmen, aber das gelang ihm nicht. Seine Lunge fing an zu brennen, und sein Magen verkrampfte. Das Grau vor seinen Augen wurde immer dunkler, als würde jemand einen Vorhang zuziehen. Sein Herz fiel in das vibrierende Orchester seiner Hände und Beine mit einem schwer pochenden Stakkato ein. Wütend versuchte die Lunge, gegen die vehementen Stimmen dieser verzweifelten Symphonie an Luft zu gelangen. Seine Blase entließ widerstandslos den Kaffee, den er heute Morgen getrunken hatte. Die Wärme des Urins, welcher seine Hose durchdrang, gelangte schon nicht mehr in sein Bewusstsein.
***
Avila kam aus der Dusche und rubbelte sich mit dem Handtuch über die Haare. Im Zimmer war Leticia gerade dabei, der widerstrebenden Felia die Kleidung für den heutigen Tag anzuziehen. Die Wahl ihrer Mutter gefiel dem Kind nicht. Bockig strampelte es mit den Beinen, um es Leticia unmöglich zu machen, die Strumpfhose darüberzustreifen.
»Will keine Hose«, protestierte Felia und hielt mit ihrer kleinen Hand die Strumpfhose fest.
»Ich zieh dir auch gleich das Kleid mit den rosa Streifen an, das du so gerne magst.« Kurz lockerte Felia den Griff, und Leticia schaffte es, eines der zappelnden Füßchen in die Strumpfhose zu stecken. Quittiert wurde ihr Erfolg mit einer krähenden Unmutsbekundung aus Felias Mund.
»O meu amor, mein Liebes, kann ich dir irgendwie helfen?« Avila hatte sich schnell T-Shirt und Hose übergestreift.
»Nein, Felia und ich bekommen das hin. Denn Felia ist ein großes Mädchen, richtig? Sag dem Papa, dass du ein großes Mädchen bist.«
»Go’ßes Mädchen.« Felia strahlte ihren Vater an und ließ los. Die Strumpfhose baumelte lose an ihren Füßen.
»Bom, gut, dann lass ich euch alleine.« Innerlich atmete Avila auf. Die morgendlichen Anziehorgien mit seiner Tochter mochte er nicht besonders. Dabei konnte sie sonst ein so liebes Mädchen sein. »Ich warte auf der Bank vor dem Hotel, auf der wir gestern Abend noch gesessen haben. Lasst euch so viel Zeit, wie ihr braucht.«
»Aber nicht, dass du doch kurz beim Frühstücksbuffet vorbeischaust, um dir die Wartezeit zu versüßen!« Leticia hob mahnend den Zeigefinger, um diesen dann in seine üppig umhüllten Rippen zu bohren. »Es gibt nur unser Übliches. Wir wollen doch heute Abend schön essen gehen. Dann kannst du es auch ohne schlechtes Gewissen genießen.«
Leticia hatte für sie beide beschlossen, dass sie während ihres verlängerten Wochenendes in Hamburg das große Frühstücksbuffet des Hotels ausließen. Schließlich entsprach das nicht ihrer Lebensweise. Weder sie als Spanierin noch er als Portugiese hielten sich morgens mit einem üppigen Frühstück auf. An dieser Routine sollte auch ein überbordendes Buffet nichts ändern, hatte Leticia ausgeführt und dabei die deutliche Wölbung oberhalb seines Gürtels gemustert.
»Außerdem möchte ich in meinem Kleid nicht wie eine Presswurst aussehen, wenn wir in die Elbphilharmonie gehen.«
»Sério? Wirklich? Wir gehen in die Elbphilharmonie? Ich hatte mich schon gewundert, warum du dein rotes Kleid eingepackt hast. Das erklärt es.«
»Schließlich musste ich ausnutzen, dass du für deinen Vortrag am Montag vor der Polizeiakademie dein gutes Jackett mitgenommen hast. Aber bitte sei vorsichtig mit deiner hellen Hose. Das ist die einzige, die wir für dich eingepackt haben. Nicht, dass dort wieder ein Kaffeefleck oder etwas anderes darauf landet.«
»Mach dir keine Sorgen. Außerdem, wenn du dein rotes Kleid trägst, könnte ich neben dir sogar nackt gehen, es würde keinem auffallen.« Er streichelte Leticia zärtlich über die Wange.
Sie kicherte. »Tipo Louco! Verrückter Kerl! Jetzt geh schon. Wir treffen uns vor dem Hotel. Deine beiden Frauen werden sich beeilen.«
Kurze Zeit später stieg er in den Fahrstuhl, um hinunter zur Rezeption zu fahren. Als er den mit rotbraunen Backsteinen gemauerten Gewölbegang, der von der alten Geschichte des Gebäudes erzählte, entlangging, wunderte er sich. In der Eingangshalle hatte sich eine Menschentraube gebildet. So früh am Morgen? Vielleicht eine Reisegruppe. Er schaute sich um und sah die junge Frau, die Leticia und ihn gestern im Hotel so herzlich begrüßt hatte. Da das »International Office« der Polizeiakademie auf den Namen »Comissário Avila und Frau« ein Zimmer im Hotel reserviert hatte, hatte Avila seinen Beruf nicht vor der Rezeptionistin verheimlichen können. Mit großen Augen hatte ihn die junge Frau angesehen und gesagt, sie hätte bisher nur im Fernsehen einen echten Kommissar gesehen. Verwundert stellte er jetzt fest, dass ihr Gesicht gerötet war und sie sich mit einem Taschentuch über die Augen wischte. Als sie ihn sah, steckte sie das Taschentuch in die vordere Westentasche ihrer dunklen Hoteluniform und eilte auf ihn zu.
»Ach, Comissário Avila! Ich hoffe, Sie wurden nicht gestört. Die Polizei …« Sie schluckte.
»Die Polizei?« Avila hob die Augenbrauen und blickte sich genauer um, ob er eventuell einen deutschen Kollegen unter den Menschen in der Halle entdeckte.
»Die sind gerade weg.« Eine einzelne Träne quoll aus ihrem rechten Auge und glitzerte im Licht der großen kupfernen Schalen mit ihren hellen Glühbirnen, die ein Architekt als Deckenleuchten installiert hatte.
»Und weswegen waren sie hier?«
»Herr Harmsen, unser Imker, er ist tot.«
»Tot? Was genau ist passiert? Herr Harmsen machte gestern Abend einen sehr gesunden Eindruck.«
»Ich habe ihn vorhin auf dem Dach gefunden. Wie fast jeden Tag war er heute kurz vor halb sechs an der Rezeption und hat gebeten, dass ihm der Aufgang zum Dach aufgesperrt wird. Aus versicherungstechnischen Gründen darf er leider keinen Schlüssel haben. Wenn er mit seinen Bienen fertig ist, zieht er die Tür zum Dach hinter sich zu und sagt Bescheid, damit eine von uns wieder absperrt. Normalerweise dauert das maximal eine halbe Stunde. Aber als er heute kurz nach sieben Uhr immer noch nicht da war, habe ich meiner Kollegin die Rezeption überlassen, um nachzusehen. Da lag er regungslos zwischen seinen Bienen. Er sah furchtbar aus. Das Gesicht ganz rot geschwollen. Wäre ich doch nur früher hochgegangen, vielleicht hätte ich den Notarzt recht…« Sie schluckte. Avila klopfte ihr beruhigend auf den Rücken.
»Sie sind so freundlich. Ganz anders als der Kommissar, der hier ankam. Er hat mich total von oben herab behandelt. Sie hätten das bestimmt nicht getan.«
»Ich möchte den Kollegen jetzt nicht in Schutz nehmen, aber er macht nur seine Arbeit. Manche von uns kommen dann etwas arrogant rüber. Das tut mir sehr leid.«
»Oh nein, mir tut es leid! Sie denken jetzt sicher, ich bin hysterisch. Aber ich mache mir solche Vorwürfe. Zufällig habe ich gehört, wie einer der Polizisten zu einem anderen von einem anaphylaktischen Schock sprach. Da zählt doch jede Minute.« Sie tupfte sich noch einmal über die Augen. Avila stellte sich vor, dass Felia in achtzehn Jahren ähnlich aussehen könnte wie diese junge Frau. Mitleid stieg in ihm auf. Er hoffte, dass die deutschen Kollegen dem Mädchen nicht zu sehr zusetzen würden.
Wenn das meine Mitarbeiter wüssten. Sie würden sagen, ich werde im Alter weich, dachte er. Da sieht man mal, was das Vatersein mit mir macht. Ich bin nicht besser als meine jungen Sergeanten, die sich von einem schönen Gesicht um den Finger wickeln lassen.
Die Rezeptionistin beruhigte sich allmählich und besann sich wieder auf ihre Arbeit.
»Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ist alles in Ordnung mit Ihrem Zimmer?«
»Alles bestens. Das Zimmer ist sehr schön. Wir wollten jetzt gleich einen Ausflug in die ›Schanze‹ machen, wie Sie es gestern vorschlugen, und in einem von den portugiesischen Cafés eine Kleinigkeit essen.«
»Aber wir haben doch so ein schönes Frühstücksbuffet!«, protestierte die junge Frau.
»Da bin ich mir sicher. Aber in Portugal ist das Frühstück nicht so wichtig, und außerdem muss ich ein bisschen aufpassen. Schließlich möchte ich nicht wieder auf Madeira bei einem Schläfchen am Kiesstrand von Naturschützern ins Wasser geschoben werden, weil sie mich für einen gestrandeten Wal halten, den es zu retten gilt.« Avila strich sich über den Bauch.
Die Rezeptionistin verkniff sich ein Lachen.
»Also ich weiß nicht, so schlimm …« Sie unterbrach sich und blickte ihn schuldbewusst an.
»Meine Frau sieht das etwas anders.« Avila zwinkerte ihr zu. »Aber genug von meiner nicht existierenden Bikinifigur. Ich überlasse Sie jetzt den übrigen Gästen.«
Fünf Minuten später saß er auf der Bank in der Sonne. Eigentlich hatte er sich vorgestellt, sein Referat über »Die deutsch-portugiesische Zusammenarbeit in der Polizei« noch einmal im Kopf durchzugehen. Er wollte von seiner Zeit bei der Polizei in Münster erzählen und den Erfahrungen, die er durch diesen Austausch erlangt hatte. Aber seine Gedanken kehrten zum gestrigen Abend zurück, an dem er aus Neugier dem angebotenen Vortrag über Stadtimkerei im Hotel gelauscht hatte. Leticia hatte es vorgezogen, ein langes Bad in der großen Wanne mit Panoramablick über die Stadt zu nehmen, nachdem sie die von der Anreise erschöpfte Felia ins Bett gebracht hatte. Avila langweilte sich meistens nach spätestens fünfzehn Minuten in der Wanne und war seiner Neugier gefolgt. Unter Stadtimkerei konnte er sich nichts vorstellen. Auf Madeira standen die Bienenstöcke mitten in der Natur. An den Levadas, im Laurazeenwald oder auch mal oben im Fanal auf der Hochebene zwischen den Erika. Tatsächlich hatte er erfahren, dass es sehr viele Imker in der Stadt gab und die Bienen entgegen seiner laienhaften Einschätzung länger und mehr Material zum Honigmachen fanden als auf dem Land. Sogar auf dem Wahrzeichen der Stadt, dem »Michel«, gab es Bienenvölker. Er hatte sich vorgestellt, wie es wäre, wenn Bienen auf der Kathedrale Sé, mitten in Funchal leben würden. Würden sie ihren Honig aus den blühenden Jacaranda-Bäumen auf der Avenida Arriaga produzieren? Und wenn ja, würde der Honig einen lila Schimmer wie die Bäume haben? Seine Gedanken kehrten wieder zu dem Gespräch mit der Rezeptionistin und dem Tod des Imkers zurück. Anaphylaktischer Schock? Wie passte das zu dem Mann, der gestern Abend bei seinem Vortrag über das Stadtimkern noch erzählt hatte, dass ein Bienenstich kein großes Problem sei? Es wäre wie Medizin, gut gegen Gicht, hatte der Imker ausgeführt. Und diese Medizin sollte ihn jetzt umgebracht haben? Vor allem, warum sollte jemand, der eine Allergie hatte, ohne Schutzkleidung arbeiten? Der Imker hatte ihnen gestern erzählt, dass es beim Umgang mit den Bienen vor allem auf die Schnelligkeit ankam und der Rauch völlig ausreiche, um sich zu schützen. Zudem würde er aus Respekt vor seinen Bienen keine Schutzkleidung tragen und sie ihn daher auch so gut wie nie stechen. Kein Mensch wäre so verrückt, sich bei einer schweren Allergie darauf zu verlassen.
Avila lehnte sich nach hinten und schloss die Augen. Der Geruch von frisch gemähtem Gras stieg ihm in die Nase. Er hörte Vögel zwitschern und die gedämpften Stimmen von vorbeigehenden Passanten. Der Wind strich durch die großen Linden und ließ die Blätter leise rascheln. Er entspannte sich und ließ die Geräusche und Gerüche auf sich wirken. Das Rätsel um den Tod des Imkers blieb dennoch in seinem Gehirn haften. War es wirklich ein natürlicher Tod gewesen? Oder steckte etwas anderes dahinter? Zumindest gestern Abend hatte der Imker einen sehr freundlichen Eindruck gemacht. Vielleicht etwas speziell, was seinen Umgang mit den Bienen betraf. Hatte der Imker Feinde gehabt? Mit Avilas beschränkten Möglichkeiten als Tourist war es müßig, über ein Motiv nachzudenken. Aber Gedankenspiele über den Tathergang … Avila ging davon aus, dass die Kollegen bereits überprüft hatten, ob der Aufgang zum Dach wirklich nur vom Imker und später von der Rezeptionistin genutzt worden war. Avila schloss aus, dass die Hotelangestellte als Täterin infrage käme. Nicht nur, weil sie von Anfang an durch ihre mädchenhafte Art väterliche Gefühle in ihm geweckt hatte, sondern weil es auch von den Fakten, die er bisher kannte, eher unwahrscheinlich war. Der Imker musste kurz nach seiner Ankunft auf dem Dach gestorben sein. War ein Mord also unmöglich? Nach den Erzählungen der Rezeptionistin war die Morgenroutine des Imkers immer die gleiche gewesen und daher ein Mord einfach zu planen. Avila öffnete die Augen und blickte den Hügel hoch. Von hier aus konnte man das Dach des Anbaus, auf dem die Bienenstöcke standen, sehen. Es musste sogar möglich sein, den Imker dort oben auszumachen. Ein Mörder brauchte eine tödliche Substanz, die eine ähnliche Reaktion wie einen schweren allergischen Schock auslöste. Ein passendes Gift würde sich bestimmt finden lassen, welches er aus der Entfernung, ohne selbst in der Nähe zu sein, verabreichen könnte. Avila dachte an eine Tierdokumentation, die er neulich im Fernsehen gesehen hatte. Der Tierarzt hatte mit einem Blasrohr Betäubungspfeile auf einen Löwen aus sicherer Entfernung geschossen. Gab es eine Erhöhung, von wo aus der Täter einen Pfeil abschießen könnte? Vielleicht aus einem der Turmfenster? Die Frage war, inwieweit sie sich öffnen ließen und ob es mit dem Winkel funktionierte. Er schloss wieder die Augen und stellte sich vor, wie jemand mit einem Blasrohr aus einem der Zimmer auf den Imker zielte. Ein aufdringliches Summen ertönte in seinem Ohr, dann bekam er einen Schlag gegen die Schulter.
»Oh nein!« Hastige Schritte näherten sich ihm, und als er die Augen öffnete, kniete ein etwa sechsjähriger Junge vor ihm, der sich um seine abgestürzte ferngesteuerte Drohne kümmerte. Einer der vier Propeller machte einen leicht verbogenen Eindruck. Das musste das Ergebnis der Kollision mit seiner Schulter gewesen sein.
»Ist sie noch heil?«, wollte Avila von dem Jungen wissen.
»Ich glaub’ ja. Das mit den Propellern kenn’ ich schon. Kann ich zu Hause wieder richtig biegen. Jetzt hat sie etwas Schieflage, aber das kann ich durchs Steuern ausgleichen.« Fachmännisch beäugte der Junge den Propeller von allen Seiten und drehte ihn leicht. Er zögerte kurz, als er sah, dass Avila sich die Schulter rieb.
»Tut mir leid, dass ich Sie getroffen habe.« Er schob seine blaue Schirmmütze in den Nacken und schaffte es, seinem sommersprossigen Gesicht einen schuldbewussten Ausdruck zu verleihen.
»Tudo bem, alles gut«, beruhigte Avila das Kind. »Es ist bestimmt nicht einfach, so ein Flugobjekt zu steuern.«
»Das stimmt! Aber ich bin richtig gut darin. Wollen Sie mal sehen?« Bevor Avila antworten konnte, fing der Junge an, mit seiner Drohne ein paar Kunststücke vorzuführen. Er flog zwischen zwei großen Linden hindurch, malte eine Acht in den Himmel und steuerte dicht über einen Hund hinweg, der sich gerade am Rand der Rasenfläche erleichterte. Dann ließ das Kind die Drohne direkt zu Avilas Füßen im frisch gemähten Gras landen.
»Alle Achtung!«
»Wenn ich größer bin, möchte ich bei diesen Drohnenrennen mitmachen. So richtig im Stadion mit ganz vielen Zuschauern. Kennen Sie das?«
»Bisher nicht. Ich sehe die Drohnen nur immer, wenn Touristen sie benutzen, um Fotos zu schießen.« Avila brachte es nicht fertig, dem Jungen zu sagen, was er von diesen nervtötenden Flugungeheuern hielt. Inzwischen brummte es sogar auf den Levadas, weil Hobbyfilmer sich in den Kopf gesetzt hatten, spektakuläre Filme vom Überfliegen der Wälder und Schluchten von Madeira zu drehen. Nirgendwo hatte man seine Ruhe vor den Dingern.
»Drohnen kann man für ganz tolle Dinge verwenden!« Der Junge kletterte auf die Bank neben Avila, die Steuerung für seine Drohne um den Hals.
»Erzähl mal«, bestärkte Avila das Kind gutmütig.
»In China haben die Flammenwerfer-Drohnen! Damit holen sie Papierlaternen oder Papierdrachen vom Himmel. Die schießen mit Feuer, wenn die sich in Leitungen verfangen haben und so. Das möcht’ ich haben. Aber meine Mama erlaubt das nicht.« Er schob die Unterlippe vor. Im Stillen bedankte sich Avila bei der Mutter des Jungen. Eine Kollision seiner Schulter mit einer flammenwerfenden Drohne wäre sicher nicht so glimpflich ausgegangen.
»Oder sie schießen damit Pfeile ab! Zum Impfen von Tieren in Afrika. Müssen Sie mir glauben, habe ich gesehen! Das sieht fast aus wie in den Ritterfil…«
»Linus! Ich habe dich schon überall gesucht!« Vor ihnen stand eine schlanke Frau in einem geblümten Sommerkleid, eine große Sonnenbrille wie einen Haarreif über die blonden halblangen Haare geschoben. »Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht fremde Leute mit deinen Geschichten belästigen.« Sie wendete sich an Avila. »Es tut mir leid, ich hoffe, mein Sohn hat Sie nicht gestört.«
»Não, não o fez. Nein, hat er nicht. Es war sogar sehr interessant. Ihr Sohn weiß sehr viel über Drohnen.«
»Oh ja, das tut er. Er ist ganz versessen auf diese Dinger.« Sie nahm ihren Sohn an die Hand und zog ihn von der Bank.
»Ich wollte doch noch von den Drohnen mit den Pfeilen erzählen«, maulte Linus und stemmte sich gegen seine Mutter.
»Der nette Herr möchte bestimmt seine Ruhe haben. Komm, wir gehen nach Hause. Da mach ich dir einen schönen Becher Kakao.« Sie hob die Drohne auf und zog Linus mit sich in Richtung Parkausgang.
Avilas Gedanken kehrten zu dem toten Imker zurück. Vielleicht könnte auch eine Kameradrohne zur Vorbereitung eines Mordes helfen, kam es ihm in den Sinn. Avila sah sich um. Die Menschen im Park wirkten nicht so, als ob sie Notiz davon nahmen, was ihre Mitmenschen um sie herum so trieben. Eben schrieben zwei weitere Männer mit ihren Fluggeräten in den Hamburger Himmel. Niemand würde merken, wenn eines der Geräte zum Ausspähen eingesetzt würde. Könnte man auch das Gift per Drohne injizieren? Für die von Linus beschriebene Impfung musste eine Startvorrichtung, eine Art Katapult, auf dem Fluggerät installiert sein. Aber würde der Imker nicht merken, wenn die Maschine sich näherte? Avila konzentrierte sich auf die Geräusche im Park. Er vernahm das Bremsen und Anfahren der Züge auf dem nahen Bahnhof. Das reichte aber nicht, um das penetrante Summen einer Drohne zu überdecken. Summen? Ich Idiot! Seine eigenen Bienen würden das Geräusch für den Imker überdecken. Avila kratzte sich am Kopf. Es gab immer noch ein Problem in dem Plan: Wie sollte der Täter den Pfeil wieder verschwinden lassen? Es war zu vermuten, dass der Pfeil herausfiel, wie bei den Tierdokus im Fernsehen. Entweder durch reine Muskelkontraktion oder weil der Imker von einem Bienenstich ausging und mechanisch den Pfeil mit der Hand abstreifte. Aber so einen Pfeil würde spätestens die Spurensicherung entdecken, und der perfekte Mord wäre dahin. Es hieße also, ihn einzusammeln, bevor die Spusi vor Ort war. Avila erinnerte sich daran, wie der Junge die Drohne zielgenau vor seinen Füßen hatte landen lassen. Wenn schon ein kleines Kind so gut damit umgehen konnte, wie einfach war es dann für einen Profi? Aber da blieb immer noch das Problem mit dem Tatwerkzeug. Einen Greifarm montieren? Das klang jetzt wirklich nach Q von James Bond oder einem von Butler Alfred ausgetüfteltem Batman-Spielzeug. Nein, Blödsinn. Es musste einfacher gehen. Sein Blick schweifte erneut durch den Park. Zwei junge Männer waren dabei, eine Slackline aufzuspannen. Einer von ihnen führte eine Schlinge um einen kräftigen Ahorn. Eine Schlinge? Könnte der Täter eine Schlinge oder eine Art Mini-Lasso benutzt haben, welches er an der Drohne befestigt hatte? Wie die Cowboys beim Kälberfang, nur dass die Schlinge sich nicht um den Hals eines Kalbes, sondern um den Pfeil festzog, um ihn hochzunehmen? Avila neigte den Kopf hin und her. Dafür wäre viel Präzision erforderlich, aber mit genügend Übung … Er schaute auf seine Füße und das frisch gemähte Gras. Ihm fiel ein, dass etwas davon an der Unterseite von Linus’ Drohne geklebt hatte, als die Mutter sie hochnahm. Kleben? Wie wäre es mit doppelseitigem Klebeband oder dieses Klebezeug, woraus man diese furchtbaren Fliegenfänger machte? Er erinnerte sich an die Küche seiner Großtante Sophie, in der diese Dinger gespickt waren mit schwarzen Fliegen, die einmal darauf gelandet nicht wieder loskamen und immer leiser summend auf ihren Tod warteten. Mit dem Klebeband auf der Unterseite des Fluggerätes musste der Täter nur noch gezielt auf dem Pfeil landen, um dann mit dem Beweis hoch in den Hamburger Himmel zu verschwinden. Das Ergebnis wäre ein fast perfekter Mord. Selbst wenn die Rechtsmedizin später das Gift bei der Obduktion finden würde. Die Tatwaffe wäre unauffindbar und der Mörder weit …
Auf dem Hügel am Hotel erschienen seine beiden Frauen. Leticia winkte ihm zu, Felia auf dem Arm. Er stand auf und streifte Reste des Grases von seinen Schuhen. Der von der Nacht noch feuchte Boden gab leicht unter seinen Füßen nach, als er die kleine Anhöhe hochstieg und ihnen entgegenging.
Nachtrag
Der portugiesische Comissário Avila ermittelt normalerweise auf Madeira und ist die Hauptfigur einer Krimireihe von Joyce Summer. Diesmal darf er zum ersten Mal in einer Kurzgeschichte in Hamburg seine Spürnase für Verbrechen beweisen.
Föhrflixt
Heike Denzau
Föhr
Arno Moll warf einen Blick zu den Nachbarn links und rechts, als er aus seinem Häuschen trat. Wenn man in der Mitte eines Dreiparteienreihenhauses wohnte, konnte man sich, wie seine schlechtere Hälfte Gerda, beobachtet fühlen. Oder behütet. Lächelnd betrachtete er die gelben und orangefarbenen Ringelblumen, die bei den Haferkamps am Aufgang wucherten und mit den Stockrosen an der Hauswand um die Wette leuchteten. Einen Moment lang sah er den Hummeln zu, die mit viel Gedröhne ihrem täglichen Geschäft nachgingen und immer wieder in den pastellfarbenen Blüten der Stockrosen verschwanden. Rechts, bei Hanna Kranenberg lockte Lavendel die Schmetterlinge an. Zwei Kohlweißlinge gaukelten frisch verliebt über den lilafarbenen Blüten.
Arno betrachtete seinen Vorgarten. Bei ihnen gaukelte nichts. Buchsbaum, akkurat von ihm beschnitten, bildete eine stramme grüne Grenze zu einem gänseblümchenfreien Rasen. So liebte Gerda es. Sein Blick verfing sich an einem winzigen gelben Tupfer am Rand der Hecke. Ein Hornveilchen, dessen Samen der Wind wohl von den Haferkamps herübergeweht hatte. »Oh, oh«, seufzte Arno. Wenn Gerda das entdeckte … Er wandte sich dem weißen Briefkasten zu, an dem der Rost hungrig nagte. Ihm gefielen die asymmetrischen braunen Flecken, die vom Fressen des weißen Lacks immer fetter wurden.
Er nahm zwei Briefe heraus. Die Telefonrechnung und … Mit zusammengezogenen Brauen las er den Absender auf dem weißen Umschlag. Frauke Janssen, Tat-Bohns-Warft, Wyk auf Föhr. Der Brief war an ihn gerichtet. Er drehte und wendete ihn, während er ins Haus zurücktrat. Dann riss er den Umschlag mit dem Finger auf. Die blaue Überschrift war in Versalien gedruckt und sprang direkt ins Auge. KLASSENTREFFEN!!!
Darunter prangten zwei Fotos. Eines von der Schule am Rebbelstieg und ein Gruppenfoto der Klasse. Es musste in der neunten Klasse aufgenommen worden sein.
Arno wurde mulmig, obwohl er noch nicht einmal den ersten Satz gelesen hatte. Ein Klassentreffen … Er sollte seine ehemaligen Mitschüler wiedersehen? Das erschien ihm absurd. Er blickte noch einmal auf den Briefumschlag. Doch, da stand sein Name. Hatte sich irgendjemand an ihn erinnert? Nein, vermutlich hatten die Veranstalter – Frauke und Torsten hatten unterschrieben – die Einladungsliste anhand des alten Klassenbuchs erstellt. Arno konnte sich nicht vorstellen, dass es anders sein konnte, schließlich war er Arno Moll. Klein. Aschblond. Unsichtbar. Zumindest fühlte es sich seit dreiundfünfzig Jahren so an.
Sein Blick wanderte über das Klassenfoto. Sofort ins Auge fielen am Rand der hinteren Reihe Stefan Behrendt und Ingo Frahm. Friesengewächs, groß, kräftig, blond. Beide trugen weiße T-Shirts und verwaschene Wrangler und sahen gelangweilt in die Kamera, weil sie zum Lächeln viel zu cool gewesen waren. Es gab noch zwei weitere Stefans. Und drei Thomasse. Wie hatte er sie immer beneidet um ihre Namen.
Arno Moll. Wenn er wenigstens Dur mit Nachnamen geheißen hätte. Das hätte Klang gehabt. Aber er war eben ein Moll. A-Moll … einmal hatte er gewagt, diesen Gag zu bringen. Aber seine Mitschüler hatten ihn nur blöd angeglotzt. Vielleicht hatten sie es auch nicht kapiert? Musik hatte nicht den gleichen Stellenwert besessen wie Mathe oder Deutsch. Oder vielleicht hatten sie sich auch nur gefragt: Wer ist das denn?
Er hatte immer neben Gero Meier gesessen, von der Fünften bis zur Neunten. Gero war das gewesen, was man heute wohl Klassennerd nannte. Er, Arno Moll, hatte nicht mal das geschafft. Er war der blasse Kokoslakritz, der, den niemand wollte aus der Haribo-Tüte mit den bunten Fruchtgummis und Perlenhütchen.
Vor seinem Wechsel in die Zehnte waren sie von der Frieseninsel weggezogen, weil sein Vater sich beruflich verändert hatte. Sein Abitur hatte er in Itzehoe gemacht, ebenso die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadtverwaltung. Und da war er heute immer noch.