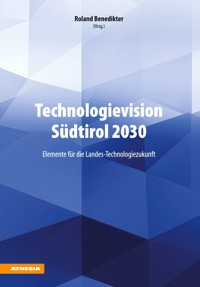
Technologievision Südtirol 2030 E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Athesia Tappeiner Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Welche Zukunftstechnologien werden Südtirol in den kommenden Jahren prägen? Und wie können sie bestmöglich zum Wohl von Bürgern und territorialer Gemeinschaft eingesetzt werden? Diese Fragen bilden den Hintergrund für eine Landes-Technologievision. Für diese Vision werden in diesem Buch leicht zugänglich, allgemein verständlich und auf wissenschaftlicher Grundlage Elemente bereitgestellt. Die Autorinnen und Autoren zeigen Ansätze und Optionen für Südtirols Technikzukunft in einer gesamtgesellschaftlichen und offenen Entwicklungsperspektive auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Drucklegung dieses Buches wurde ermöglicht durch die Südtiroler Landesregierung / Abteilung Deutsche Kultur.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Franz Schöpf
Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen der Landesverwaltung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol
Einleitung
Roland Benedikter
Eurac Research Bozen, Center for Advanced Studies und UNESCO-Lehrstuhl für Interdisziplinäre Zukunftsvorwegnahme und Global-Lokale Transformation, Zukunftskreis des Deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für die deutsche Bundesregierung 2019–2023
KAPITEL 1
Digitale Transformation, Blockchain, Künstliche Intelligenz, Big Data: Wohin geht die Reise? Welche Zukunft erwartet Südtirols Menschen und Betriebe? Die Politik muss ihre Digitalkompetenz aufrüsten
Paul Köllensperger, Gert Lanz, Helmuth Renzler (†)
Südtiroler Landtag / Parlament der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol
KAPITEL 2
Voraussetzungen für eine ganzheitliche Technologievision Südtirol: Die drei Bausteine Zukunftstechnologien, soziale Ökosysteme und Wissensökologie miteinander verbinden
Roland Benedikter
Eurac Research Bozen, Center for Advanced Studies und UNESCO-Lehrstuhl für Interdisziplinäre Zukunftsvorwegnahme und Global-Lokale Transformation, Zukunftskreis des Deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für die deutsche Bundesregierung 2019–2023
Der idealistische Ausgangspunkt für kommende Innovationswellen: Befreiungstechnologie
Die erste Phase
Die zweite Phase
Wachsende Chancen und Risiken erfordern die umfeldangepasste Integration von Zukunftstechnologien
Die großen Leitlinien stimmen überein
Drei Grundbausteine für eine ganzheitliche Strategie
1. Zukunftstechnologien: Zwischen Zukunft bisheriger Technologien und der Vorbereitung auf neue Technologien in der Zukunft
Nicht eine, sondern viele Zukunftstechnologien unterschiedlicher Geschwindigkeit und Anwendungsbreite
Vieldeutige („tiefenambivalente“) Perspektiven: Die Zweischneidigkeit der neuen Techno-Kybernetik
Die Beispiele „radikaler“ Innovation häufen sich
Die fünf großen Transformationen
Systemtechnologien als Systeminstrumente
Datenwirtschaft kann bedingungsloses Grundeinkommen ermöglichen
Immersive Techno-Realitäten und Neue Humantechnologien
Die Folge: Realitäten definieren wird wichtiger
Zukunftstechnologien werden zu Lebens-Umschlagspunkten
Gesellschaftstransformation durch Zukunftstechnologien: Die Europäische Union steht mittendrin – und mit ihr auch Südtirol
2. Soziale Ökosysteme
Mittel-Technologie
Technik-Ökonomie als Sinnökonomie
Näheres zur Abonnement-Wirtschaft: Ihre Wirkung auf das Gesellschaftssystem könnte bald über ihre bisherigen Grenzen hinausreichen
Die Zusammenführung von Mittel-Technologie, Sinnökonomie und Abonnement-Wirtschaft mit sozialen Ökosystemen schafft Vertrauen in Technologie-Zukünfte
3. Wissensökologien
Die Kernanforderung an eine integrierte Technik-Strategie: Die drei Bausteine verbinden
Was bringen die kommenden Jahre?
KAPITEL 3
Smart City – Smart Home – Smart Mobility
Wolfgang Müller-Pietralla
Ehemaliger Direktor Zukunftsforschung und Trendtransfer, Volkswagen AG, und Zukunftskreis des Deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für die deutsche Bundesregierung 2019–2023
KAPITEL 4
Künstliche Intelligenz I
Giuseppe Stefano Quintarelli
Nettuno Università Telematica Internazionale, Parlament der Republik Italien, und Beratergremium der Vereinten Nationen/CEFACT
KAPITEL 5
Künstliche Intelligenz II
Federico Giudiceandrea
Microtec, Akademie für Künstliche Intelligenz Brixen und Südtiroler Wirtschaftsring (SWR)
KAPITEL 6
Blockchain
Marco Vitale
Quadrans Foundation CH/I, Foodchain.it und Blockchain-Strategie-Initiative des Italienischen Ministeriums für Wirtschaftsentwicklung
KAPITEL 7
Data ownership / data trading / privacy
Elena Pasquali
Ecosteer/NOI-Technologiepark Bozen
KAPITEL 8
Neue Technologien und die Zukunft des Alterns
Nicola Palmarini
Direktor des UK National Innovation Centre for Ageing NICA, Regierung Großbritanniens und Newcastle University
KAPITEL 9
Zukunftstechnologien im Gesundheitswesen / New Health Technologies: Präzisionsmedizin / Gendermedizin
Katharina Crepaz
Eurac Research Bozen und Technische Universität München
KAPITEL 10
Mensch-Maschine-Konvergenz. Ethische Überlegungen zur Notwendigkeit techno-humaner Multi-Resilienz
Karim Fathi
Zukunftskreis des Deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für die deutsche Bundesregierung 2019–2023
KAPITEL 11
Futures literacy (einschließlich Tech literacy)
Riel Miller
Ehemaliger Direktor Zukunftsforschung und Zukunftsbildung, UNESCO Paris und Norwegian University of Science and Technology NTNU
KAPITEL 12
Leben und Arbeiten in Südtirol 4.0
Ingrid Kofler
Freie Universität Bozen
KAPITEL 13
Zusammenfassung: Technologievision 2030. Zukunftstechnologien unter den Rahmenbedingungen der zwei Leitstrategien Südtirols: der Forschungs- und Innovationsstrategie für Intelligente Spezialisierung RIS3 und der Nachhaltigkeitsstrategie
Roland Benedikter
Eurac Research Bozen, Center for Advanced Studies und UNESCO-Lehrstuhl für Interdisziplinäre Zukunftsvorwegnahme und Global-Lokale Transformation, Zukunftskreis des Deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für die deutsche Bundesregierung 2019–2023
Die gesellschaftspolitische Grundlage: Technologiereflexion und Ethik
Die kritische EU-Selbstreflexion: „Ungenutzte Möglichkeiten“
12 Punkte für Südtirols Technologiezukunft
1. „Vorausschauende Politikgestaltung“ – Predictive policy-making
2. Ausbau angewandter Instrumente inter- und trans-disziplinärer Risiko-Antizipation
3. Gesamtgesellschaftlicher Dialog
4. Koordination mit den Leitstrategien des Landes
5. Stärkung des Schnittpunkts Zukunftstechnologie-Nachhaltigkeit: Künstliche Intelligenz für den Planeten
6. Teilhabe an Signalprojekten wie „Zweite Erde“ und „Neuer Planet“ mittels Technologie-Schwerpunktbeteiligungen
7. Fähigkeitenstärkung: Futures Literacy (FL) und allgemeines Zukunftsbildungs-Konzept
8. Methodenstärkung: Anticipatory Innovation Governance (AIG)
9. Kompetenzakquisition im Rechtsbereich: Beispiel neues Feld Datengerechtigkeit
10. Ausbau der Start-up-Finanzierung
11. Talente-Akquisition und Ansiedlung von Nischen-Bereichen
12. Dezentrale Technologie-Räte
Der verbindende Grundansatz: „Glokal“ oder „kosmolokal“?
Kulturelle Perspektiven technologischen Wandels: Die Zukunftstechnologien verändern den Kulturgebrauch rasant
Die kommenden Jahre: Südtirols Technologiezukunft baut auf gute Voraussetzungen
KAPITEL 14
Ausblick: Handlungsansätze. Praktische Instrumente und Optionen
Roland Benedikter
Eurac Research Bozen, Center for Advanced Studies und UNESCO-Lehrstuhl für Interdisziplinäre Zukunftsvorwegnahme und Global-Lokale Transformation, Zukunftskreis des Deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für die deutsche Bundesregierung 2019–2023
Das positiv veränderte Umfeld: EU-Chips-Offensive und mehr
Südtirols Selbstverortung in der Technologielandschaft ist keine statische, sondern eine dynamische Angelegenheit
Zeit ist Innovation: Ein ständig neuer Strauß an Zutaten
Drei Praxisfragen
1. Allgemeine Grundsätze
Innovations-Leitlinien erweitern
Technologische Neuerungen gesellschaftlich einbetten
Projekte zeitverschoben wiederaufgreifen und aus Vergleichserhebungen lernen
Schnittstelle Technologie – Kunst – Ethik
Ethik ist notwendig – doch wie sie konkret in Technologie-Zukünfte einfügen?
Erstbeweger oder Früher Anpasser?
Die Zukunft des Südtiroler Wissenschaftsbereichs unter KI- und Chatbot-Bedingungen
Wir brauchen neue Methoden, Chatbots und KI wissenschaftlich zu prüfen
Südtiroler Gesellschaftspolitiken in entstehende EU-Regelwerke einpassen
Will, kann oder soll Südtirol im Feld der Digitalen Diplomatie tätig werden?
Braucht Südtirol eine eigene trans-territoriale Technologie-Investitionsstrategie?
2. Angewandte Praxisinstrumente
Rahmenreports
Instrumente und Vorbild-Initiativen
Zukunftskomitee für Parlament und Regierung
Mögliche Maßnahmenpakete: Perspektiven für die Landes-, Städte- und Gemeindeverwaltungen
Weitere verwertungs- und anwendungsorientierte Themenbereiche für die – langfristig ausgerichtete – Diskussion
Entwicklung der Wissenschaftsstützung im Hintergrund („Scientific Backing“)
Strukturveränderung der angewandten Sozialwissenschaft und die neue Wissenschafts-Ethik der Chatbot-Gebräuche
Die Perspektive technologisierter Wissenschaft und Forschung: Zwischen Neuaufstellung und „KI-Anpassung“
Philosophisch-ethische Offensive
Ausblick: Zuversicht und kritischer Optimismus sind angesagt
Nachwort
Franz Schöpf
Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen Landesverwaltung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol
Anhang 1
Südtiroler Landtag, Beschlussantrag, Nr. 437/2021
Landtagshearing: Digitale Transformation, Blockchain, Künstliche Intelligenz, Big Data: Wohin geht die Reise? Welche Zukunft erwartet Menschen und Betriebe? Die Politik muss ihre Digitalkompetenz aufrüsten.
Anhang 2
Programm Landtagshearing: „Zukunftstechnologien Südtirol 2030“ (BA 437/21)
Die Autor:innen
Wissenschaftliches Komitee dieses Buches
Impressum
Vorwort
Franz Schöpf
Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen der Landesverwaltung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol
Dieses hoch konzentrierte Buch gibt einen spannenden Einblick in die wichtigsten Technologiethemen der Zukunft: einer Zukunft, die unseren Alltag in Südtirol heute schon erobert. Im Haushalt, bei der Arbeit oder auf Reisen sind wir bereits mittendrin im Strom der Veränderung. Zukunftstechnologien begleiten unser Leben, beeinflussen unsere Gewohnheiten und prägen unsere Gemeinschaft. Wir haben die Möglichkeit, über Grenzen hinweg zu kommunizieren, Wissen auszutauschen und die Welt in einem noch nie dagewesenen Ausmaß mittels Daten und Information zu erkunden.
Wir müssen aber auch über den heutigen Stand hinaus weiterdenken. Denn die Art und Weise, wie wir arbeiten, lernen, miteinander interagieren und die Welt um uns erleben, wird sich in den kommenden Jahren weiter grundlegend verändern. Zukunftstechnologien werden unsere Werte von Liberalismus und Freiheit beeinflussen. Es wird nicht nur neue Geschäftsmodelle geben, sondern auch neue Gesellschaftsmodelle werden notwendig sein. Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft werden vor der Herausforderung stehen, die Chancen der technologischen Innovations-Veränderung zu nutzen, ohne dabei das Wohl von Mensch und Umwelt aus dem Blickfeld zu verlieren.
Diese Herausforderung ist nicht völlig neu. Südtirol verdankt seine Stellung als Wirtschafts- und Innovationsstandort mit hoher Lebensqualität seit jeher der Fähigkeit, sich frühzeitig auf neue Herausforderungen und Trends einzustellen. Überall im Land entstehen ständig neue Ideen, Technologien, Produkte und Dienstleistungen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung nehmen laufend zu und haben im Jahr 2020 erstmals die Marke von knapp einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes erreicht (laut ASTAT vom September 2022). Eine zentrale Rolle spielt dabei die kooperative Wertschöpfungskette zwischen heimischen Unternehmen, Start-ups, führenden Forschungseinrichtungen wie Eurac Research und der Freien Universität Bozen sowie die Verfügbarkeit der notwendigen Forschungsinfrastruktur, wie sie im NOI-Technologiepark Bozen und Bruneck mit seinen über 40 Labors errichtet wurde.
Für eine weiterhin zukunftsfähige Entwicklung des Landes dient die Forschungs und Innovations-Strategie für Intelligente Spezialisierung – RIS3, englisch: Research and Innovation Smart Specialisation Strategy – als Wegweiser. Aufbauend auf der Analyse standortspezifischer Stärken, vorhandener Forschungskompetenzen und für Südtirol relevanter Schlüsseltechnologien der kommenden Jahre steckt diese Strategie klare mittelfristige Ziele für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
Vor diesem Hintergrund gilt für die kommenden Jahre: Nur durch die gemeinsame, zielgerichtete Anstrengung und ein koordiniertes Handeln aller am Innovationsprozess beteiligten Akteure kann eine „Technologiezukunft Südtirol 2030“ Einzug halten, die Entwicklung und Fortschritt ermöglicht, unsere Lebensqualität verbessert und nachhaltige Lösungen für gesellschaftlich relevante Themen bereitstellt. Die vorliegende Publikation unter Leitung von Roland Benedikter ist ein überaus wertvoller Schritt in diese Richtung.
Einleitung
Roland Benedikter
Eurac Research Bozen, Center for Advanced Studies und UNESCO-Lehrstuhl für Interdisziplinäre Zukunftsvorwegnahme und Global-Lokale Transformation, Zukunftskreis des Deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für die deutsche Bundesregierung 2019–2023
Dieses Büchlein stellt Elemente für den Weg zu einer integrierten und partizipativen Technologievision Südtirols bereit. Es
beschreibt kurz und allgemein verständlich Bausteine dazu;
entwirft ein Grundmodell für die mittel- bis langfristige Ausrichtung;
und verweist auf „beste Praktiken“ verschiedener Kontexte und Länder.
Bei alledem nimmt es eine Landes-Technologiestrategie nicht vorweg, sondern erarbeitet – in offener Weise – Voraussetzungen und Ansätze dafür.
Die vorliegende Studie wurde auf Anregung des Südtiroler Landtags: des Parlaments der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, als Grundlage für Diskussionen auf wissenschaftlicher Basis erstellt. Sie soll politische Entscheidungen und operative Ausarbeitungen für eine bestmögliche Beteiligungspraxis anregen und informieren. Adressaten sind Entscheidungsträger, Politik und Zivilgesellschaft sowie, langfristig mit am wichtigsten, Jugend und Bürgerschaft im umfassenden Sinn.
Die folgenden Beiträge wurden zum ersten Mal bei einer internationalen Anhörung für die Südtiroler Politik in Bozen vorgebracht. Der Südtiroler Landtag hielt im Februar 2022 auf Initiative der III. Gesetzgebungskommission ein Hearing zu jenen neuen Zukunftstechnologien ab, die für das Land in den kommenden Jahren relevant sein können – teilweise auch über bereits bestehende Schwerpunkte hinaus. Ziel war es, durch Beiträge von internationalen Experten und regionalen Sachverständigen einen Überblick über Technologien mit hohem gesellschaftlichem Veränderungspotential zu gewinnen. Weitere Ziele waren die Erkundung des wechselseitigen Bezugs dieser Technologien zueinander und ihrer gebündelten Anwendbarkeit auf das Territorium; ihre möglichen Wirkungen im Landes-Kontext, und zwar sowohl als Kontinuitäts- wie Unter brechungsfaktoren; die Steigerung der Technologiekompetenz der politischen, sozialen und zivilen Gestalter; und generell die Intensivierung der Debatte zwischen den politischen Lagern, um innovative Entwicklungsstrategien anzuregen.
Das Ergebnis der Anhörung war – gerade in der Vielfalt der Beiträge – eindeutig. Es ist im Sinne eines partizipativen Entwicklungsprozesses wünschenswert, dass Südtirol in den kommenden Jahren eine erweiterte, in manchen Punkten bisherige Schwerpunktsetzungen ergänzende, langfristig und interdisziplinär ausgerichtete und mit einem institutionell verankerten, sozialwissenschaftlich fundierten Selbstreflexions- und Ethik-Ansatz verbundene Technologievision implementiert, die sich in die heute bereits bestehenden Ansätze eingliedert. Das sollte möglichst noch im – und für den – aktuellen 5. Kondratieff-Zyklus der „intelligenten Technologiesysteme“ geschehen. Dieser Zyklus wird nach Ansicht der meisten Experten um das Jahr 2030 vollends reif und dann gesamtgesellschaftlich wirksam sowie in seinen Instrumenten vernetzt für das Gemeinwohl umsetzbar werden.
Sicher ist aber schon heute: Zukunftstechnologien werden sich laufend vervielfältigen, stärker als bisher in den Alltag eindringen und damit auch die Südtiroler Gesellschaft in den kommenden Jahren stark verändern. Deshalb gilt es, wie die folgenden Seiten zeigen wollen, drei Grundbausteine frühzeitig mit Augenmaß und Weitblick zu verbinden:
Zukunftstechnologien,
soziale Ökosysteme, und
neue Wissensökologien.
Von der Qualität der Verbindung dieser drei Bausteine wird – wie auch in anderen Gesellschaften weltweit – immer mehr an Innovationsfähigkeit, Fortschritt und sozialem Frieden in unserem Land abhängen. Wissenschaft kann dazu Elemente der Orientierung ebenso bereitstellen wie philosophisch-sozialwissenschaftlich und ethisch begründete Technologiereflexion, Technologieantizipation und Technologiebildung (Tech Literacy).
Im Ergebnis zeichnete die Landtagsanhörung vom Februar 2022 Elemente für eine mögliche Entwicklungsvision auf, ohne diese Vision selbst auf bestimmte Aspekte einzugrenzen. Daraus eine Strategie zu entwickeln, ist Aufgabe der Politik selbst in Zusammenarbeit mit den Unternehmern, ihren Forschungsabteilungen und Verbänden, Institutionenvertretern des NOI-Technologieparks und der Landesabteilung für Innovation und Forschung sowie den Wissenschaften und ihrer Experten. Dazu steht zur Zusammenführung verschiedener Entwicklungsstränge die Integrationsmethode der UNESCO-Zukunftsbildung (Futures Literacy) als ethischer Reflexionsansatz und Diskussionsplattform bereit. Sie ist am UNESCO-Lehrstuhl von Eurac Research am Center for Advanced Studies in Bozen angesiedelt. Einer der „Väter“ dieser Methode – Riel Miller – ist in diesem Buch vertreten..
Für das vorliegende Buch lieferten die Sprecher des Landtagshearings schriftliche Zusammenfassungen ihrer Beiträge, die nicht vollständig mit ihren mündlichen und medialen Präsentationen übereinstimmen, sondern zum Teil überarbeitete und erweiterte Versionen darstellen. Das Buch, das der Leser in Händen hält, steht für einen verständlichen, sprachlich und inhaltlich voraussetzungslosen Zugang zur Debatte nicht nur für die Politik, sondern auch die Zivilgesellschaft. Damit ist es für jeden Bürger und für die größtmögliche Verbreitung unter allen Bevölkerungsschichten geeignet. Es soll dadurch den Dialog zwischen Politik, Experten und Zivilgesellschaft fördern.
Eine letzte Bemerkung zum Ton der folgenden Darstellungen. Das vorliegende Buch stellt die wichtigsten neuen Zukunftstechnologien ganz bewusst vorwiegend positiv dar, um ihre Chancen für die Landesentwicklung in den Vordergrund zu stellen. Das stimmt mit dem Ansatz der meisten zeitgenössischen Experten sowie globaler Organisationen wie den Vereinten Nationen überein, eine positive Nutzung in den Vordergrund zu stellen, um neue Kräfte freizusetzen und die Jugend mitzunehmen. Ziel ist es, von einem allzu oft von einseitiger Sorge geprägten, apokalyptischen Ton zu einer konstruktiv sorgenden Haltung überzugehen. Der US-Analytiker Peter Leyden hat das 2022 so dargestellt:
„Die Idee [ist], eine positive Geschichte zu erzählen … Wenn man zu irgendeinem Zeitpunkt in der Geschichte zufällig in eine menschliche Kultur hineingeboren würde, würde man sich eher in unserer als in einer anderen Epoche wiederfinden wollen. Fast jeder weiß, dass wir uns mitten im Übergang zu einer technologisch vernetzten Wirtschaft und Gesellschaft befinden, und dass es sinnvoll ist, alle an Bord zu holen … Wir befinden uns eindeutig in einer technologisch vernetzten Welt, aber ich würde behaupten, dass wir jetzt in eine solche Gesellschaft übergegangen sind sowohl im Guten wie im Schlechten.“1
Die Hervorhebung beider Seiten ist also wichtig: Risiken und Chancen, mit Schwerpunkt auf letzteren. Die positive Darstellung neuer Technologien soll aber nicht heißen, dass viele der im folgenden beschriebenen Technologien nicht auch vieldeutig sind. Die charakteristische Vielgestaltigkeit der Entwicklungen will natürlich auch in Südtirol beachtet und reflektiert werden. Dieses Büchlein will in diesem Sinn eine Anregung sein, über die dargestellten Sachverhalte gemeinschaftlich nachzudenken und sie vielleicht auch in einigen Aspekten vorauszudenken.
Der Auftraggeber des Landtagshearings im Februar 2022 war die III. Gesetzgebungskommission des Südtiroler Landtags unter dem Vorsitzenden L.-Abg. Helmuth Renzler (†). Die Initiatoren des Hearings waren L.-Abg. Helmuth Renzler, L.-Abg. Paul Köllensperger und L.-Abg. Gert Lanz. Der Beschlussantrag wurde eingebracht von L.-Abg. Paul Köllensperger, L.-Abg. Gert Lanz und L.-Präsidentin L.-Abg. Rita Mattei. Die wissenschaftliche Koordination und Leitung hatte ich. Die Übersetzungen aus dem Englischen, Deutschen und Italienischen ins Deutsche verantworte ich in Zusammenarbeit mit Marco Armani und den Autoren. Besondere Verdienste um Zukunftstechnologie als Politikthema für Südtirol und die Veröffentlichung dieser Beiträge erwarb sich L.-Abg. Maria Rieder.
1 Christoph Drösser: Peter Leyden: „Die Idee war, eine positive Geschichte zu erzählen.“ In: Die Zeit, 25. Juli 2022, https://www.zeit.de/digital/2022-07/peter-leyden-wired-zukunftsszenarienklimawandel-pandemie.
KAPITEL 1
Digitale Transformation, Blockchain, Künstliche Intelligenz, Big Data: Wohin geht die Reise? Welche Zukunft erwartet Südtirols Menschen und Betriebe? Die Politik muss ihre Digitalkompetenz aufrüsten
Paul Köllensperger, Gert Lanz, Helmuth Renzler (†)
Südtiroler Landtag / Parlament der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol
Zukunftstechnologien werden für Südtirol zum zentralen Thema der kommenden Jahre. Im Jahrzehnt bis zum Jahr 2030 – das die Vereinten Nationen und UNESCO zum Entwicklungszeitraum und Prüfstein nachhaltiger und humaner Entwicklung erklärt haben – bergen neue Technologien voraussichtlich das mit größte Entwicklungs- und Wachstums-Potential. Allerdings ist damit auch die Notwendigkeit richtungsweisender Entscheidungen verbunden. Das geht mit besonders viel Verantwortung einher. Es geht um nichts weniger, als die Weichen für die vor uns liegende Ära neuer Humantechnologien zu stellen. Inwiefern? Und was genau ist damit gemeint?
Wie uns die Experten unter der Leitung von Roland Benedikter im Februar 2022 in einer Landtagsanhörung zeigten, sind digitale Transformation, Blockchain, Künstliche Intelligenz und Big Data Vorreiter einer neuen Ära der Techno-Demokratie. Technologie kann in den kommenden Jahren zu mehr Bürgerbeteiligung und gleichzeitig zur Entlastung von Politik, Verwaltung und Regierung beitragen. Datenproduktion, Datenwirtschaft, Datenwissenschaft und Dateneigentum der Bürger:innen sowie datengestützte automatisierte Arbeit sind Elemente, die für eine ganze Gesellschaft Sprünge in Qualität und Quantität ermöglichen. Sie weisen voraus in einen neuen sozialen Technologiegebrauch – vor allem dann, wenn sie in ihrem Potential ganzheitlich erfasst und eingerichtet werden.
Dazu muss die Politik als ersten Schritt ihre Digitalkompetenz aufrüsten. Hier gilt: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Südtirol kann vom Zusammenfluss technologischer Innovationen in den kommenden Jahren schon in mittleren Zeiträumen profitieren – wenn neue Technologien frühzeitig, gesellschaftsrelevant und sozial verträglich eingesetzt werden.
Was dazu nötig ist, ist Vision – nicht nur für wenige, sondern für alle. Viele Bürger wissen noch nicht genau, was in den und durch die neuen Technologien geschieht: was genau sie können und bewirken. Das gilt es auch vonseiten der Politik besser zu verstehen, zu erklären und zu vermitteln. Unser Land ist in Nischen- und Transformationsbereichen in Wirklichkeit bereits auf dem Weg zum Spitzentechnologieland – vor allem mittels Privatwirtschaft und NOI-Technologiepark in Bozen und Bruneck. Wenn die Politik diesen Weg weiter kompromisslos unterstützt und ausbaut, kann Südtirol auf mittlere Frist sogar Maßstäbe auf regionaler Ebene setzen. Dafür sind mit Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen wie Eurac Research und Freier Universität Bozen, privaten Initiativen wie der (informellen) Akademie für Künstliche Intelligenz in Brixen, sowie einer Vielzahl neu gegründeter Start-ups zu Blockchain, Dateneigentum und Privatsphäre als Inkubatoren und Vernetzer gute Voraussetzungen gegeben. Vor allem aber sind es die Bürger Südtirols mit ihrem hohen Ausbildungsstand und ihrem Interesse an Innovation, die in den kommenden Jahren den Unterschied machen.
Wohin also geht die Reise? Und welche Zukunft erwartet Südtirols Menschen und Betriebe?
Die Antworten finden sich auf den folgenden Seiten. Sie sind als Bausteine für die weitere Diskussion gedacht – sowohl die politische wie die zivilgesellschaftliche. Die Südtiroler Politik sollte sich um ein mittel- bis langfristiges Gesamtkonzept kümmern – jetzt und nicht erst später. Neben der Nachhaltigkeits- und der RIS3-Strategie – der Forschungs- und Innovations-Strategie für Intelligente Spezialisierung, die die EU all ihren Regionen vorschreibt – ist für Südtirol eine ebenso gezielte wie ganzheitlich einbeziehende Technologiestrategie sinnvoll, um den sozialen Frieden zu wahren und auszubauen. Die Situation hinsichtlich Humankapital ist dafür günstig. Junge Südtiroler:innen arbeiten bereits heute an den internationalen Technologie-Hochburgen mit – in Italien, Österreich, der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Schweden, Großbritannien und den USA. Sie gilt es an unser Land zurückzubinden, im Idealfall dauerhaft hier zu halten. Die Umkehrung des „Technologie-Brain-Drain“ mittels einer landesweiten Technologie-Offensive kann zu noch breiterer Innovation im Land führen. Einer Innovation, die als Basis-Treiberin quer durch alle Gesell schafts- und Wirtschaftsbereiche agiert, und von der über kurz oder lang alle Bürger:innen profitieren.
Was bedeutet das? Ausschlaggebend werden in den kommenden Jahren grundsätzlich mehr Investitionen in technologische und Innovationsektoren sein. Wir brauchen Attraktions- und Akquisitionsstrategien im High-Tech-Bereich; und wir brauchen den entschlossenen Ausbau der Grundlagen- und anwendungsorientierten Wissenschaft in inter- und transdisziplinärer Blickrichtung.
Das Landtagshearing „Technologiezukunft Südtirol 2030“ vom Februar 2022 war dazu eine Auftakt- und Signalveranstaltung. Es war der Beginn einer intensiveren Auseinandersetzung der Volksvertreter und Gesetzgeber im Landtag mit dem Technologie-Zukunftsthema in der größeren Blickrichtung, die das Land nun benötigt.
KAPITEL 2
Voraussetzungen für eine ganzheitliche Technologievision Südtirol: Die drei Bausteine Zukunftstechnologien, soziale Ökosysteme und Wissensökologie miteinander verbinden
Roland Benedikter
Eurac Research Bozen, Center for Advanced Studies und UNESCO-Lehrstuhl für Interdisziplinäre Zukunftsvorwegnahme und Global-Lokale Transformation, Zukunftskreis des Deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für die deutsche Bundesregierung 2019–2023
Wirtschaft und Technologie bilden heute eine immer stärkere Einheit. Ihr Überschneidungspunkt entfaltet auch für den Standort Südtirol zunehmende Bedeutung. Die Konvergenz von Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft und ganzheitlich geplanter Zukunftsvorwegnahme erfolgt am Schnittpunkt zu Kernbereichen wie Industrie, Finanzwesen, Bauwesen, Dienstleistungssektor, Landwirtschaft und Tourismus, die ebenfalls allesamt von Technologie immer stärker beeinflusst werden. Technologie wird in den kommenden Jahren zum Brücken-, Integrations- und Umgestaltungstreiber, der ins Zentrum unserer Gesellschaft rückt. Südtirol hat sich bereits seit Jahren darauf vorbereitet. Unser Land hat die wichtigsten Weichen gestellt, um Technologiezukünfte für Anziehungskraft und Sektoren-Innovation in der Gemeinschaft zu nutzen. Dabei sollte, so alle Landes-Entwicklungspläne, das Gemeinwohl im Mittelpunkt stehen, um Teilhabe zu erweitern und Ungleichheit zu vermindern.
Der idealistische Ausgangspunkt für kommende Innovationswellen: Befreiungstechnologie
Die Situation, dass Technologie für Territorien wie Südtirol mit jedem Jahr einflussreicher wird, ist nicht neu. Die Lage entwickelt sich schnell – und präsentiert immer neue Möglichkeiten und Herausforderungen. Nach Anlauf- und Inkubationsphasen seit den 1990er Jahren kann Technologie-Innovation in den 2020er Jahren laut Forschungseinrichtungen wie Max-Planck-Gesellschaft und Universitäten wie Stanford und MIT erstmals tatsächlich zur Befreiungstechnologie für Gesellschaften werden – wenn sie ganzheitlich, systematisch, sozial integriert, dialogisch und partizipativ erfolgt.
„Befreiung“ bedeutet in diesem Bereich: Zukunftstechnologie kann sowohl die Beteiligung wie die Autonomie der Bürger verbessern. Sie kann sowohl Selbsttätigkeit und Initiative wie Vernetzung, Interaktivität und Gemeinschaftsbewusstsein stärken. Damit kann sie besser als in vergangenen Entwicklungsphasen dazu beitragen, persönliche Freiheit in einer solidarischen Gesellschaft weiterzuentwickeln. Das gilt in erster Linie für Territorien, die sich frühzeitig um die Einführung, Zusammenführung, Anpassung und Anwendung neuer Technologie-Entwicklungen im öffentlichen Interesse kümmern – und sie territorial und zwischen den Sektoren ausgeglichen umsetzen, wobei den Schnittstellen eine besondere Bedeutung zukommt.
Die erste Phase
Wichtig als Voraussetzung für den – zunächst idealistisch gemeinten – Einsatz von Technologie als „Befreiungstechnologie“ ist, den Qualitätssprung in der sozialen Wirkungsvielfalt von Technologie zu sehen, der sich in den vergangenen Jahren vollzogen hat. Wir erleben derzeit den Übergang von der ersten zur zweiten Phase der Befreiungstechnologie. Die erste Phase erfolgte seit Anfang der 2000er Jahre. Sie verstand „Befreiung durch Technologie“ als die Kombination von Computer und Internet, die nötige Bildung zu deren Gebrauch und die weitestmögliche Verbreitung dieser drei Grundpfeiler der digitalen Gesellschaft. Das sollte für die Emanzipation aller Bürger mittels gleichen Zugangs zu Information und Wissen sowie für die Ausbildung entsprechender Fähigkeiten der Selbstorientierung und der Eigenaktivität auch bei den nachwachsenden Generationen sorgen. Später meinte „Befreiungstechnologie“ den Einsatz von Smartphones und anderen Aufzeichnungsgeräten zur Steigerung von Transparenz, Dokumentation und Bekämpfung unlauterer Praktiken und zur Verbesserung von Regierungs- und Verwaltungsabläufen mittels interaktiver Bürger-Rückmeldungen samt Möglichkeit jederzeitiger Veröffentlichung zum Beispiel in sozialen Medien. Diese Ansätze wurden von den Sozialwissenschaften in demokratischen Gesellschaften der Welt begleitet und gefördert. Dazu wurden nach und nach auch ganze akademische Programme gegründet, darunter das für ähnliche Initiativen beispielgebende „Programm für Befreiungstechnologie“ (Program on Liberation Technology) an der Stanford Universität in Silicon Valley.2
Diese erste Phase der bewussten Verwendung von Technologie für das – zunehmend als unauflöslich gedachte – Tandem von individueller Emanzipation und gemeinschaftlichem Fortschritt löste große Begeisterung aus, und zwar sowohl bei jenen, die sie betrieben, als auch bei denen, die in ihren Genuss kamen. Regierungen und Verwaltungen sahen dies als Profilierung und Schulterschluss in progressiver Weiterentwicklung von Demokratie. Die erste Phase stieß aber mit der raschen Veränderung des Technologiebereichs, insbesondere der Computer-Internet-Schnittstelle, mittels
immer umfassenderer – und trans-sektorial vernetzter – Kommerzialisierung von Internet, sozialen Medien und Information,
dem Aufstieg der „Datenausbeutungswirtschaft“
(data extraction economy
) und
dem steigenden Einfluss von Monopolen
schon bald an ihre Grenzen. Viele sprachen ab den 2010er Jahren statt von Befreiung von einer zunehmenden Gefahr der Verengung gesellschaftlicher Spielräume durch Technologie: nämlich von „Algokratie“ – also der „alles durchdringenden“ wirtschaftlichen, politischen und sozialen Herrschaft der Algorithmen, die die Gesellschaft schon bald unter ihre Fittiche nehmen würde.
Die zweite Phase
Die seit Mitte der 2010er Jahre einsetzende zweite Phase der Befreiungstechnologie erkennt dieses veränderte Umfeld und arbeitet mit ihm. Ihr Ziel ist, die Ansätze der ersten Phase auf eine neue Ebene zu heben. Dazu findet, wie in anderen gesellschaftlichen Sektoren, eine gewisse Entpolitisierung statt, was traditionelle ideologische Richtungen betrifft. Im Unterschied zur ersten (linksprogressiven) Phase will die aktuelle zweite Phase nichts mehr mit Ideologie zu tun haben – auch keiner technophil fortschrittsorientierten. Ziel sind jetzt fast ausschließlich pragmatische Verbesserungen des Alltagslebens. Die zweite Phase der Befreiungstechnologie versteht sich als politisch nur mehr insofern, als sie das Soziale verbessern will.
Dabei ist der Übergang von der bisherigen Parallelentwicklung zum systematischen Verschmelzungsmechanismus neuer Technologien entscheidend. Es sind inzwischen intelligente und interaktiv lernende globale Netzwerke entstanden, die sehr verschiedene, zunehmend dezentralisierte Technologien miteinander kommunizieren lassen – und sie in vielen Einzelanwendungen gezielt auf Kontexte bezogen integrieren. Dadurch entsteht ein Netz von „Knotentechnologien“, die sich gegenseitig ständig weiter vorantreiben, indem sie sich immer neu an unterschiedliche Realitäten anpassen – und dabei an ihren Erfahrungen ständig weiter lernen, indem sie diese transversal austauschen.
Diese neuen Knotentechnologien dringen nach und nach in die meisten Arbeits- und Lebensbereiche ein. An ihren Überschneidungspunkten sind sowohl graduelle Steigerungen wie disruptive „Sprünge“ bestehender Technologieanwendungen im Vollzug. Als Treiber agieren die Verbreitung von 5G, die Entstehung neuromorpher Netzwerke, der Erwerb deduktiver Sinneswahrnehmung durch Künstliche Intelligenzen, die Entstehung und Vernetzung immer mehr verschiedener, nämlich unterschiedlich kontextualisierter und individualisierter „generativer“ Künstlicher Intelligenzen, und der Übergang des Computers zum lernenden Hybrid aus Quanten- und Biocomputer, der ein Vielfaches bisheriger Leistungen erbringen kann und damit auch alle anderen Digitalisierungsbereiche auf ein neues Niveau heben wird.3
In Kombination dieser und weiterer Entwicklungen ist die „zweite Phase“ der Befreiungstechnologie voraussichtlich bis in die 2030er Jahre hinein imstande, tiefer in die Sozial- und Lebensstrukturen einzugreifen, als es die erste, aus heutiger Sicht noch eher traditionell emanzipationsorientierte Welle ahnen konnte. Als Preis für diese höhere Effizienz birgt die aktuelle Technologie-Entwicklung aber auch größere Mehrdeutigkeiten und Risiken. Darunter ist eine rasch steigende Anzahl von „Dual-Use“-Entwicklungen und -Anwendungen. Das sind Anwendungen, die widersprüchlich und oft sogar gegensätzlich genutzt werden können, was traditionelle ethische oder politische Regelungen schwer bis unmöglich macht. In der Fachsprache charakterisiert die Wissenschaft deshalb die zweite Phase der Befreiungstechnologie durch die Kombination von Hypertechnologie mit Tiefenambivalenz.4 Weil vieles in der aktuellen Technologiephase durch Irreversibilität gekennzeichnet ist, können wir hinter diese Kombination gesteigerter Möglichkeiten mit gesteigerten Risiken kaum mehr zurückgehen. Wir müssen, wie alle Länder und Gemeinschaften, versuchen, sie positiv zu fassen und bestmöglich zu nutzen – ohne die Herausforderungen zu unterschätzen.
Wachsende Chancen und Risiken erfordern die umfeldangepasste Integration von Zukunftstechnologien
Für beides: Chancen und Risiken sind die Voraussetzungen dynamischer Weiterentwicklung gegeben. Beide erweitern und verbreitern sich ständig. Um die Chancen zu nutzen, müssen Gesellschaften auf der Höhe der Zeit gewisse Risken eingehen. Und um die Risiken zu minimieren, müssen diese Gesellschaften Chancen nutzen und verschiedene Zukunftstechnologien in ethisch-gesellschaftspolitischer Perspektive so zusammenführen, dass sie sich gegenseitig korrigieren und ausgleichen. Ziel ist die demokratieverträgliche Integration in die offene Gesellschaft.
Die Zusammenführung verschiedener Technologien zum Zweck ihres Ausgleichs ist auch deshalb nötig, weil zahlreiche aktuelle Transformationstechnologien mit Langzeitwirkung auf Territorien und soziale Gemeinschaften inzwischen selbstverändernd funktionieren und Eigendynamiken entfalten. Darunter sind zum Beispiel das Spektrum Künstlicher Intelligenzen, Blockchain und Datenwirtschaft. Je weiter sie fortschreiten, desto mehr nehmen sie Fahrt auf und verzweigen sich trans-sektoral. Umso mehr können sie – eben deshalb – aber auch an Territorien und Bevölkerungen mittels gezielter Selektion und Kombination angepasst: also „umfeldangepasst“ oder „kontextualisiert“ werden. Die Chance auf maßgeschneiderte Anpassung ergibt sich auch deshalb, weil viele dieser Technologien heute zunehmend mit progressiven sozialen Innovationen wie der Möglichkeit zur Personalisierung des Dateneigentums und dezentralisiertem Datenhandel einhergehen. Dafür hat die Europäische Union die Europäische Datenschutz-Grundverordnung 20165, die Europäische Datenstrategie 20206 und das Europäische Daten-Governance-Gesetz 20207 erlassen. Sie alle basieren auf der Charta der Grundrechte der Europäischen Union aus dem Jahr 2012.8 Weitere EU-weite Normen für Einzelaspekte der aktuellen Technologie-Evolution sind in Ausarbeitung begriffen.
Diese Gesamt-Entwicklung geht mit der dynamischen Anpassung von Wertevorstellungen im Spannungsfeld zwischen privat und öffentlich einher, die durch den Einsatz und die Art und Weise des Gebrauchs von Innovations-Technologien zum Ausdruck kommen. Die neuen Werte, die dazu erst im Entstehen begriffen sind, müssen von Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft gemeinsam legitimiert, validiert, eingesetzt und gesteuert werden – und zwar nicht nur gesamteuropäisch, sondern auch regional und territorial.9
Gemeinsam können neue techno-partizipative Werte in den kommenden Jahren in eine Welt führen, die eine erste wirkliche Techno-Demokratie eröffnen kann – das heißt eine schnellere, autonomie- und unabhängigkeitsorientiertere, personenzentriertere und effizientere Demokratie, in der Politik und Bürger gemeinsam mittels Realzeit-Interaktionstechnologien das Soziale gestalten und wo sowohl die Gemeinschaft wie jeder einzelne von öffentlicher Technologieinvestition, Technologieentwicklung und -ansiedlung profitiert.10
Die großen Leitlinien stimmen überein
Die zweite, „kapillare“ Phase der Befreiungstechnologie bis in die 2030er Jahre wird zusammenfassend nicht vorrangig durch Einzelentwicklungen, sondern erst in der anwendungs- und umfeldspezifischen Integration verschiedener Zukunfts-Technologien möglich. Damit ihre Integration das volle Potential für die Weiterentwicklung bestehender Gesellschaftsvoraussetzungen entfalten kann, ist es sinnvoll, dass die Entscheidungsträger frühzeitig die Weichen in Richtung Ganzheitlichkeit stellen – wenn möglich in enger Zusammenarbeit der Sozialpartner und mit Experten internationaler Organisationen wie OECD und UNESCO sowie der Europäischen Union. Die autonome und zugleich europäisch vernetzte, in sich hoch differenzierte Territorial-Gemeinschaft Südtirol weist dafür gute Voraussetzungen auf. Für die Zusammenarbeit bietet sich die Kenntnisnahme von und der dauernde, systematische Austausch mit bestehenden Zukunftsvisionen und -strategien von Nachbarregionen, Nationen, der EU und internationalen Organisationen an. Wichtige Leitlinien zeichnen zum Beispiel die Visions- und Strategiepapiere der Task Force Vorausschau (Foresight) des Deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung11, das European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS)12, der EU Forward Look13, die Zukunftstechnologiestrategie Japans (eine der mittlerweile erfahrensten und langlebigsten der Welt, mit fast ausschließlich technologischgesellschaftlichem Schwerpunkt bereits seit den 1990er Jahren)14 und die Zukunfts-Antizipations-Prozesse von UNESCO15, anderer Teilorganisationen der Vereinten Nationen wie der Anticipatory Action Task Force AATS16, des United Nations Department for Economic and Social Affairs17, aber auch von World Economic Forum (WEF)18, Weltbank19 und OECD20. Es ist interessant, dass die meisten Bausteine, aber auch die Zielräume der von diesen Organisationen skizzierten Technologie-Vorwegnahmeprozesse trotz unterschiedlicher politischer und sozialer Umfelder bezogen auf das Jahr 2030 sehr weitgehend konvergieren, ja in vielen Aspekten sogar übereinstimmen, obwohl sie unabhängig voneinander entworfen wurden.21
Drei Grundbausteine für eine ganzheitliche Strategie
Vor diesen Hintergründen, und von Erfahrungen gegenseitig lernend, ist es für Südtirol aus sozialwissenschaftlicher Sicht grundsätzlich sinnvoll, als Voraussetzung für eine produktive, gemeinschaftliche und integrative technosoziale Entwicklung bis in die 2030er Jahre vor allem drei Grundbausteine zusammenzuführen und in ihrer Verbindung fruchtbar zu machen. Diese drei Bausteine sind:
Zukunftstechnologien;
soziale Ökosysteme und
das Konzept der Wissensökologie(n).
Was genau ist damit gemeint? Und warum sollten sich Südtirols Politik und Zivilgesellschaft ausgerechnet auf diese drei Bausteine konzentrieren – maßgeschneidert auf unser Land, und mit Blick auf Prozessqualität und Allgemeinwohl? Gehen wir sie im einzelnen durch!
1. Zukunftstechnologien: Zwischen Zukunft bisheriger Technologien und der Vorbereitung auf neue Technologien in der Zukunft
Zukunftstechnologien werden in den kommenden Jahren zum zentralen Entwicklungstreiber für alle entwickelten Gesellschaften. Sie bilden bereits heute die inter- und trans-disziplinäre Drehscheibe für viele andere Gesellschaftsbereiche. Die Frage ist, wie wir sie in ihren vielfältigen Aspekten an das Territorium anpassen und ausrichten, um sie bestmöglich zu nutzen. Das hat einerseits mit der grundsätzlichen Aufstellung Südtirols in Punkto Zukunftstechnologie, andererseits mit mittelfristig gezielten Cluster-Bildungen sowie mit „zugeschnittenen“ Attraktions- und Anwendungsstrategien zu tun. Dabei halten sich Software- und Hardware-Innovationen in der aktuellen Technik-Evolution die Waage. Beide sind gleichermaßen wichtig für eine ausgewogene Entwicklung.
Nicht eine, sondern viele Zukunftstechnologien unterschiedlicher Geschwindigkeit und Anwendungsbreite
Eines gilt es vorab aber zu klären: Worin besteht Zukunftstechnologie heute eigentlich? Und was gilt es hinsichtlich ihrer weiteren Entwicklung zu berücksichtigen?
Zukunftstechnologie ist ein Sammelbegriff für eine nicht einheitliche zivilisatorische Entwicklung. Sie schließt eine breite Vielfalt von Stoßrichtungen unterschiedlicher Geschwindigkeit, Anwendungsbreite und Reife ein. Zusammen wirken sich diese auf unsere Lebensführung ebenso aus wie auf unsere Lebensplanung. Der Begriff Zukunftstechnologie umfasst heute die Trends zu
intelligenten Häusern, intelligenten Städten und intelligenten Peripherien;
digitaler Sanität, einschließlich digitaler Alterungsbetreuung, Ferndiagnostik und Selbstoptimierung, etwa mittels Handy-Anwendungen;
Präzisions- und Gendermedizin;
neue Arbeits- und Ausbildungsmodelle zum Beispiel mittels virtueller Realitäten.
Zur Zukunftstechnologie unserer Zeit gehört darüber hinaus der Trend zur Verräumlichung des Internets: von Internet-Seiten zu Internet-Räumen (Holographie), was Dienstleistungen und künftig wohl auch Tourismus auf digitalem Niveau ermöglicht.
Zudem werden sich Konzept und Praxis von Mobilität stark verändern. Denn „jedes Fahrzeug wird eine rollende Internet-Adresse“22 (Wolfgang Müller-Pietralla), das mittels Internet der Dinge (IoT) mit allen Geräten und Prozessen rundherum ständig kommuniziert, um Informationen in Echtzeit auszutauschen. Ein künftiges Auto hält damit die Menschen während der Fahrt ebenso über die Umgebung auf dem Laufenden, wie es den Straßenverkehr analysiert und Entscheidungen über Wegverlauf, Geschwindigkeit, Tankverhalten, Pausen und Verbrauch in Realzeit trifft. Dieses Auto ist dann nicht mehr notwendigerweise Privat-, sondern eher Gemeinschaftsgefährt. Diese voraussichtlich schon bald universal anzutreffende „angewandte Kybernetik“ wird intelligente – und dabei in vernetzten Verbünden ständig weiter lernende – Automatisierung allgegenwärtig machen. Das Ergebnis sind effizientere Prozesse. Sie können Nachhaltigkeit und Resilienz sowohl des Systems wie des Einzelnen fördern.23
Die damit beschriebene – bisher beispiellose – synchrone Vielfalt technosozialen Veränderungsgeschehens, in das wir zum Teil bereits eingebettet sind, ist der Grund dafür, warum Exzellenz-Lehrgänge nun nicht mehr nur zur „Digitalisierung“ oder „Digitalen Entwicklung“, sondern ganz bewusst – weit umfassender – zur „Digitalen Transformation“ heute so wichtig werden wie nie zuvor.24 Private Institute, Forschungseinrichtungen und Fachhochschulen waren dabei bisher oft schneller; Universitäten und öffentliche Institutionen sollten nachziehen. Warum?
Vieldeutige („tiefenambivalente“) Perspektiven: Die Zweischneidigkeit der neuen Techno-Kybernetik
Laut Forschern wie Markku Wilenius befinden wir heute am Beginn des 5. Kondratieff-Zyklus: dem Prozess des vernetzten Intelligentwerdens fortgeschrittener Technologien.25 Dieser Prozess wird ab Ende der 2030er und in den 2040er Jahren im 6. Kondratieff-Zyklus in die Anwendung dann hyper-intelligenter Technologien in Bio-Technologien und technologische Lebenssysteme münden – das heißt in die Kontrolle über und die Umgestaltung der bio-physiologischen Grundlagen von Mensch und Welt.26
Das erfolgt auf der Grundlage der Wiederkehr der Kybernetik als methodischer Plattform für Innovation, die verschiedenste Bereiche im Grundansatz zusammenführt.27 Galt Kybernetik ab dem 19. Jahrhundert nicht nur als wissenschaftliche Methode, sondern auch als Grundlage der Kunst ganzheitlichen Gestaltens und Regierens, so erneuert sie sich heute nach einer zyklischen Abwesenheit von der Debattenbühne rapide und wird zum Kern der technologischen Vernetzungsrevolution. Kybernetik ist die Gesamtsteuerung von Systemen mittels universaler technologischer Vernetzung. Diese Gesamtsteuerung entwickelt sich durch interaktive Systemkomponenten wie dem Internet der Dinge (IoT) zunehmend auch ohne Zutun von Menschen: nämlich als selbstlernende und „selbsthervorbringende“ („autopoietische“) Selbstorganisation eines zusammenhängenden „Technologieteppichs“. Was hier an immer mehr Selbstorganisation „lernender“ und interaktiver Technologie geschieht, gilt es möglichst nahe am Menschen zu halten und ständig auf seine Gesellschaftsverträglichkeit zu überprüfen. Deshalb hat kürzlich etwa die Elite-Universität Australian National University (ANU) als eine der ersten wieder eine Schule für Kybernetik begründet.28
Auch in Südtirol könnte es an der Zeit sein, die Vieldeutigkeit der zunehmenden technologischen Selbststeuerungslogik von hoch komplexen Systemen, die wir Kybernetik neuester Stufe nennen, in ihren bevorstehenden Wirkungen auf





























