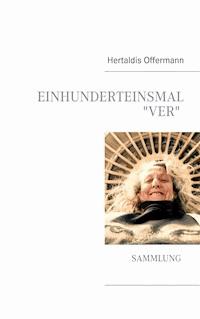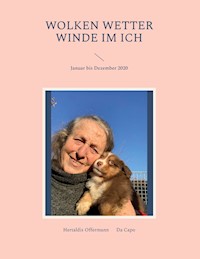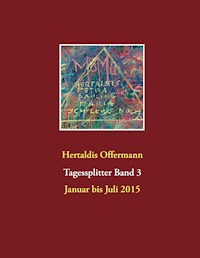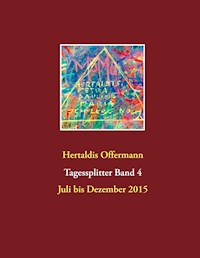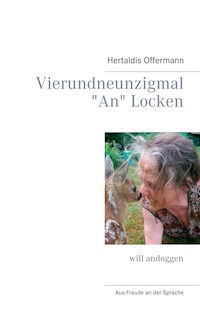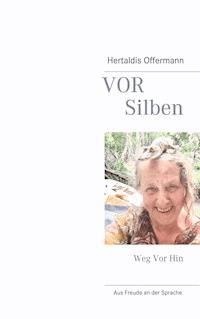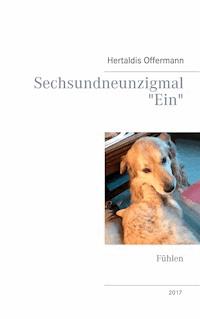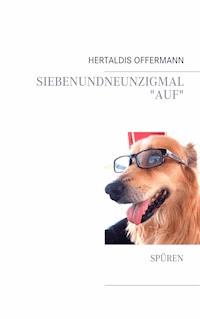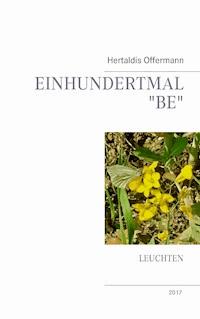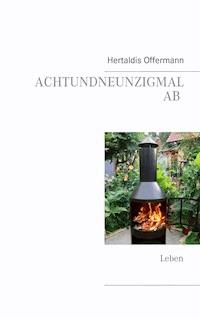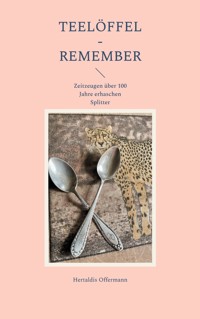
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Teelöffel - Remember ist eine einzigartige Autobiografie, erzählt aus der Perspektive zweier alter Teelöffel. Hertaldis Offermann lässt uns durch diesen ungewöhnlichen Erzähler an einem Jahrhundert deutscher Geschichte teilhaben, von der Vorkriegszeit über die DDR-Ära bis in die Gegenwart. Im Mittelpunkt stehen ihre bewegende Lebensgeschichte und die jahrzehntelange Partnerschaft mit Irene. Das Buch ist eine tiefe Reflexion über Liebe, Verlust und die Kraft des Weiterlebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog und Epilog zugleich
Kapitel 1: „Ich habe es wohl vernommen.“
Kapitel 2: „Nussbaumblätter und Handtuchwandaufhängehaken“
Kapitel 3: „Bubi und der Bockwurstwurf“
Kapitel 4: „Drei Kreuze“
Kapitel 5: „Haldis und Herta“
Kapitel 6: „Mutter“
Kapitel 7: „Selbstvertrauen“
Kapitel 8: „Vater“
Kapitel 9: „Hochzeit und eine dreifarbige Katze“
Kapitel 10: „Kinder, Kinder, Besen, Bürsten und Pinsel“
Kapitel 11: „Umzug nach Berlin“
Kapitel 12: „Ackern und Bildung“
Teelöffel 13: „SELBSTÄNDIGKEITS-TRAININGS-ZENTRUM“
Teelöffel 14: „Josef Stauder“
Kapitel 15: „Leben ist nicht direkt planbar“
Kapitel 16: „Die Bürgschaft“
Kapitel 17: „Schnuppern an der Welt“
Kapitel 18: „Das Glück der Erde ...“
Kapitel 19: „Wo das ICH sich tummeln kann“
Kapitel 20: „PS: Coronaauswirkung“
NACH DEM 31.10.2023
REMEMBER 1
REMEMBER 2
REMEMBER 3
REMEMBER 4
REMEMBER 5
REMEMBER 6
REMEMBER 7
REMEMBER 8
REMEMBER 9
REMEMBER 10
REMEMBER 11
REMEMBER 12
REMEMBER 13
REMEMBER 14
REMEMBER 15
REMEMBER 16
REMEMBER 17
REMEMBER 18
REMEMBER 19 ABGESANG
REMEMBER 20
REMEMBER 21
REMEMBER 22
REMEMBER 23
REMEMBER 24
REMEMBER 25
REMEMBER 26
REMEMBER 27
REMEMBER 28
REMEMBER 29
REMEMBER 30
Prolog und Epilog zugleich
Zeitzeugen über 100 Jahre erhaschen Splitter beobachten ein spät in diese Geschichte geborenes Kind in der schulischen Entwicklung bis zur Ausreise aus der Zone und nach der Maueröffnung in der Entfaltung ihres Potentials in Freiheit
ich danke meinen Teelöffeln für diese Zeilen
Hertaldis Offermann
Kapitel 1„Ich habe es wohl vernommen.“
Auf der Suche nach einem Stichwort fielen mir zwei Teelöffel mit einem Monogramm beim Abwaschen des Frühstücksgeschirrs ins Auge. Das war es! Ich begann zu zittern und vor Aufregung zündete ich mir fast die Nase an, denn die Zigarette ruhte noch auf dem Tisch, samt meiner Hand zwischen Zeige- und Mittelfinger.
Ein Paar aus gleichem Material Silber oder versilbert – nicht wichtig – aus meiner frühen Kindheit als eben vorhanden erkannt.
Es waren Zeugen von einem entscheidenden Lebensmoment meiner Eltern – für das „Ja, ich will“, von Familien in Auftrag gegeben. Sogar der Juwelier fiel mir in diesem Moment ein, den mein Vater mir bei einer Einkehr in die Gaststätte zur Post nach dem Sonntagsgottesdienst gezeigt hatte.
Die Familien waren im 19. Jahrhundert geboren. Inzwischen schreiben wir das 21. Jahrhundert.
Was hatten diese zwei Teelöffel gesehen, gehört, erlebt in den Händen ihrer Nutzer oder in Schubladen auf den Gebrauch wartend.
„We are spoons!“Ja, wir sind Teelöffel von Johannes Offermann und Herta Franke. Das „JO“ und „HF“ in den Griffhals geschrieben.
JO wurde 1901 in Cottbus geboren, einer Tuchmacherstadt. Sein Vater war ein eigenwilliger Mann. Er hatte sich seine zukünftige Ehefrau auf den Treppen der St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin ausgeschaut. Er soll sie gegrüßt haben, wartete auf einen Gegengruß und es blieb still.
Er rief etwas empört, dass er „guten Tag“ gesagt hätte, Darauf kam dann – wie überliefert durch Erzählungen – „ich habe es wohl vernommen!“
So begann die Liaison zwischen dem Rheinländer Richard Offermann aus Monschau und der Pommernfrau Henriette aus Danzig.
Uns Löffel gab es damals noch nicht, doch haben wir die Geschichte oft am Familientisch im Cottbusser Mehrfamilienhaus gehört, wenn sie den Nachkommen erzählt wurde. Wir wissen ja nur, was wir gehört haben und waren nicht immer Zeuge. Jedenfalls wissen wir, dass der eigenwillige Richard Offermann als Meister in einer Tuchfabrik in der genannten Tuchmacherstadt Cottbus gearbeitet haben soll und irgendwann im 19. Jahrhundert als Wollagent nach Russland gegangen war.
Bei dieser Aktion muss er viel Geld verdient haben, denn um die Jahrhundertwende 19.Jh zum 20.Jh baute er ein 16 Parteienmietshaus an der Stadtgrenze in der Nähe zum Cottbusser Bahnhof, der ein bedeutender Knotenpunkt der Eisenbahnlinien nach Polen – also in den Osten – war und deshalb für Handelswege der industrialisierenden Wirtschaft bedeutsam werden sollte. Seine Weitsicht hatte wohl den Standort ausgewählt. Er war später Schauspieler am Cottbusser Theater – von uns abgelauscht – soll er den Gessler in Schillers Schauspiel „Wilhelm Tell“ gespielt haben.
Auch das von ihm erbaute Haus ist im gleichen Jugendstiltouch gebaut, wie seine Schauspielerarbeitsstätte.
Genaue Zeitreihenfolgen können wir nie ermitteln. Auch wenn unsere Neugier geweckt war, zu fragen war verwehrt. Jedenfalls irgendwann in dieser Zeit kam es zur Heirat zwischen dem fröhlichen Monschaurheinländer und der dickköpfigen Danzigerin.
Sie waren die Eltern des Johannes Offermann, der am 20.7.1901 in Cottbus geboren wurde und zu seiner Hochzeit eben uns als Hochzeitsgeschenk im Besteckset erhalten hatte. Es hatten sich trauen lassen: die Kinder vom Wollagent Franz Richard Offermann geb. 6.1.1860 und Wilhelmine Henriette Schulz geb. 23.3.1858. Beide getraut am 25. April 1894 in Berlin – eben dort, wo er seine Zukünftige angesprochen hatte.
Richard Offermann aus Monschau
Kapitel 2„Nussbaumblätter und Handtuchwandaufhängehaken“
Mehr können wir von der Wilhelmine Henriette nicht berichten. Nur dass sie die Tochter eines Aufsehers aus Danzig war. So kamen die entfernten Wurzelgegenden wieder in Cottbus zusammen.
Im 19. Jahrhundert war es in bürgerlichen Kreisen eben erst mit der Sicherheit, eine Familie selbst ernähren zu können, angesagt, zu heiraten.
Am 8.5.1929 war die Hochzeit des Johannes Offermann und der Herta Franke in der Kirche, nachdem sie sich am 23. Februar 1929 im Standesamt gegenüber dem schon erwähnten Jugendstiltheater das Ja-Wort gegeben hatten.
Im Vorfeld hatte auch die Familie Franke ein Teelöffelset mit dem Monogramm HF zur Hochzeit in Auftrag gegeben. Nun waren wir auf der Welt.
Herta war am 28.2.1904 geboren, deren Wurzeln in der
Mitte der Ehemannelternentfernung – nämlich dem Spreewald – lagen, denn ihre Eltern lebten seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts auch schon in Cottbus. Sie war die älteste Tochter des Herrmann Franke und der Marie.
Nun waren wir Teelöffel vereint und wir plaudern hier einige Geschichten aus, die wir erlauscht haben.
Wir sind keine Chronisten, die sich selbst auf Spurensuche begeben können. Wir sind ja nur Gebrauchsgegenstände und werden nur willkürlich benutzt, zu bestimmten Anlässen.
Eine Lebensgeschichte von zwei Teelöffeln!
Wir können nicht zählen und wissen nicht, wie viele Geschwister wir hatten. Wir Beide sind bis in das Jahr 2022 übrig, hatten zwar nicht viele Besitzer, haben aber sehr viel miterlebt.
Alle aus der bisher beschriebenen Geschichte sind nicht mehr auf der Erde. „JO“ fiel meiner Herrin zuerst ins Auge, gab das Stichwort und deshalb darf ich erzählen.
Aber der Leser darf immer beide denken: JO & HF.
Unsere Geburtsstunde war also die Hochzeit und unser Geburtshaus somit in der Lutherstraße 12 in Cottbus. Im Haus wohnten auch die älteren Brüder des Johannes Willibald, der Lehrer geworden war und Leo, der den Laden im Erdgeschoss bewirtschaftete. Ein Kolonialwarenhandel. Das Wort war damals noch üblich, denn Gewürze und auch andere Dinge kamen ja aus den kolonialisierten Ländern. Johannes musste Kaufmann lernen. Als Reisender, der Waren in der Umgebung anpries war er auch oft unterwegs im Spreewald.
Eine Sekretärin konnte mal ein eigenes Stenogramm nicht entziffern und er half. Dabei muss es wohl gefunkt haben und er verliebte sich in ein Fräulein, deren Wurzeln eben im Spreewald lagen. Dieses Fräulein war die älteste Tochter vom Herrmann Franke, in Schmellwitz, evangelisch 1904 getauft. Unsere heutige Besitzerin erzählte mal, dass sie immer an der Kirche vorbei gegangen war, wenn sie ihre Großeltern besuchte und dabei eine, durch eine Nussbaum gesäumte Allee bis zum Nordgraben am Wald, durchquerte. Sie hatte auch von ihrer Mutter Herta gelernt, dass Nussbaumblätter gut gegen Motten in den Schränken wirken. Zwei Schwestern Käthe und Lucie gehörten noch zu Herta.
Zurück in die Lutherstraße.
Dort war eben ab 1929 unser Zuhause.
In der ersten Etage über dem Laden war die Besteckschublade in der Küche, doch wir wurden im Wohnzimmer für Familienfeiern aufbewahrt. Waren die Feste vorbei, landeten wir aber auch in der Küche. Wir erinnern uns an einen Ofen mit Kochringen auf der Oberseite, einen Gazeschrank für fliegenempfindliche Lebensmittel, Handtuchwandaufhängehaken, eine Fensterbank, unter der ein Schrank in die Wand eingebaut war, an die Stühle an drei Seiten für den Tisch und natürlich auch an einen damals üblichen Küchenschrank – mit der Schublade für das tägliche Besteck.
Kapitel 3„Bubi und der Bockwurstwurf“
Ab jetzt erzähle ich, der JO.
Oft beobachtete ich, wie meine – ich will sie ab jetzt „Herrin“ nennen – oft sehnsüchtig aus dem Fenster auf die Straße den dort spielenden Kindern zusah. Gegenüber gab es ein langes Gebäude mit großen aber hoch gelegenen Fenstern. Durch sie konnte man vom Erdboden nur durch Hochklettern auf einen schmalen Steinsims an der Mauer sehen, was drinnen los war. Doch aus der Küche im ersten Stock sah man schräg nach unten hinein und konnte Kindern beim Turnen und Spielen zusehen; es war eine Turnhalle.
An den Wänden draußen spielten Kinder auch „Buchte“, heute weiß kaum noch Jemand, was das war. Der Ball wurde an die Wand gespielt und mit ein oder zwei Händen zurückgespielt bis er herunter fiel. Dann war das nächste Kind an der Reihe.
Neben der Küche war das Bad mit einem Badeofen, der mit Kohle oder Holz gefeuert wurde, um warmes Wasser zu bekommen.
Meine Herrin wurde erst im Jahr 1944 geboren und deshalb verheimlicht dieser Zeitsprung die Zeit von 1929 bis nach dem Krieg. All die Informationen aus dieser Zeit habe ich nur durch belauschte Erzählungen erfahren. Deshalb nur die Fakten, die mir ganz genau in Erinnerung sind. Also: die erste Tochter wurde 1931 geboren, der Sohn 1938.
Johannes O soll schon 1932 stolzer Fahrer eines Autos gewesen sein, das ihm von seiner ihn als Reisender beschäftigenden Firma für den Außenverkauf zur Verfügung gestellt worden war. Meine Herrin hat noch Angebotskataloge der Schokoladenfabrik „Burgbraun“ in ihrer Kindheit, angeblich staunend, durchblättert. Bis heute ist sie nach Schokolade jeder Art wild. Beim Schreiben ihrer Geschichte liegen nicht nur wir zwei Teelöffel neben ihr, auch Schokolade ist immer griffbereit.
Ihre große Schwester lernte schon vor der Geburt unserer Herrin Klavier spielen, wie wir gehört haben, war bei der Evakuierung nach Glauchau im Krieg sogar die Klavierlehrerin mit, damit die Ausbildung nicht unterbrochen werden musste.
Der sechs Jahre ältere Bruder hatte den Spitznamen „Bubi“ und war der Hahn im Korbe. Bei den Bombenangriffen soll sich Herta, die Mutter unserer Herrin über den Kinderwagen gebeugt haben, um das Baby zu schützen. Diesen Säugling zu ernähren war das Schwerste. So berichteten alle unserer Herrin, dass sie durch geschenkten Malzkaffee am Leben erhalten werden konnte. Sicher liegt auch da die Ursache, dass sie auch heute noch oft klagt, dass ihr Lebensmittelverwertungsgrad sehr hoch ist und sie immer ihren Appetit zügeln muss.
Jetzt wieder mal eine Ich-Erinnerung meiner Herrin, dass sie in einem Kinderstuhl zwischen Küchenschrank und Wand gesessen hätte, die Arme ausgestreckt und nach Kürbissuppe langend.
Kürbis wurde in der ersten Nachkriegszeit in allen Varianten verarbeitet. „Kürbis – igitt“ hören wir sogar heute noch. Sie soll eines Tages ihrem Bruder gegenübergesessen haben und bei einem Streit warf der eine Bockwurst an ihren neuen Trainingsanzug, der das erste nicht gebrauchte Kleidungsstück war. Bis zu seinem Tode hat sie das nicht vergessen und kaum verziehen.
Zurück zur großen Schwester. Das Haus war durch Bomben zur Hälfte zerstört. Im Obergeschoss wohnt inzwischen auch die Schwester Lucie von unserer Herrin Mama mit ihrer Familie. Deren Wohnung hing in der Luft (3.Stock). Die Familie im Luftschutzkeller blieb verschont. Der Einschlag war in einem Seitenflügel des 16 - Parteienhauses. Das Klavier im 1. Stock im Wohnzimmer war hin. In dieser Wohnung war auch unsere Herrin geboren – noch vor dem Bombeneinschlag an der Brauhausbergstraße.
Das Erste, was die Eltern wieder in Ordnung bringen ließen, war das Klavier. Die 14-Jährige war auf dem ernsthaften Ausbildungsweg zur Pianistin.
Die Mutter meiner Herrin hatte nach dem Krieg mit einem selbst gebundenen Suppengrün in dem unter Wohnung gelegenen Laden die erste Geldeinnahme.
Der Vater unserer Herrin war während dieses Krieges in Narvik als „Marineverwaltungsinspektor in der Reserve“ und landete in Belgischer Kriegsgefangenschaft.
Die oft erzählte Geschichte, dass er auf einem Pferdekarren mit seinem Freund – einem Architekten- auf dem Rückweg in die Heimat von russischer Patrouille nach Papieren gefragt wurde und der Freund einfach irgendwelche Papiere vorgezeigt hatte, mit dem Wort „Dokumentu“. Das war ihr Glück, dass sie nicht nach Sibirien deportiert worden waren.
Wir Teelöffel waren von den Nachbarfledderern der zerstörten Häuser verschont geblieben. Nur Teppiche entdeckte die Herrin-Mutter mal bei einem Kunden und resolut soll diese herzenswarme gütige Frau ihn zurückgefordert haben.
Kapitel 4„Drei Kreuze“
Meine Herrin hatte kaum Spielzeug und so schaufelte sie sich eine Spitztüte aus dem Zuckersack voll und ging damit in eine Drogerie, um sich dafür Luftballons einzutauschen. Da die „Kleine“ in der Umgebung durch den Laden bekannt war, gab man ihr Fingergummis, die sie aufblasen konnte.
Viele Kunden waren aus Schlesien in diese Gegend verschlagen worden und sie erzählte mal, dass sie heute noch hört, wie manche Alten sagten:
„Marjellchen, ärg‘re dich nich‘, der Papa meint das nicht so böse!“
Früh musste sie im Laden mit anpacken.
Sie war mit 6 Jahren eingeschult worden, in die zur Turnhalle gehörende Schule, doch weil sie so dünne Stöckelbeine hatte – ihr Vater soll sie damit immer geärgert haben – wie: „setz dich, sonst brechen deine Stöckelbeine“– und unterernährt war, wurde sie wieder ausgeschult. Das muss für sie sehr schlimm gewesen sein.
Neugierig und quicklig wie sie wohl war, wollte sie immer beschäftigt sein. Also half sie im Laden mit, lernte Fahrrad fahren. Ihr Bruder hatte ihr aus Einzelteilen ein Fahrrad zusammengebaut, mit einem gefundenen Rennlenker, nachdem sie mit Mutters Fahrrad, das viel zu groß war in der Brauhausbergstraße stehend fahrend immer gegen die Zäune gekracht war.
Sie wurde schlau und stand sehr früh auf, um vor der „Arbeit“ wie sie es nannte, noch unten spielen zu können, denn wenn alle anderen auf waren, gab es immer viel zu tun.
Sie erinnert sich an ein besonderes Erlebnis, da war ihre Mutter zu einem Katholikentag gefahren und nach dem Kindergottesdienst ging sie auf den Rummel.
Vater und Bruder waren in Riesensorge um die zu behütende Kleine. Sie hatten schon alle näheren vertrauten Kunden abgeklappert und als unsere Herrin am Nachmittag zu Hause eintrudelte, musste sie in ihr Gitterbett ohne Mittagessen. Eine kurze Zeit später war ein feines Mittagsmahl zubereitet und die Freude, dass nix passiert war – riesengroß.
Ungefähr in diesem Alter soll sie auch mal einen geschienten Arm gehabt haben, der an einer Strippe über ihrem Bett hing. Angeblich hatte sie spielend ein Buchstabenrätselspiel in den Sand gemalt und da soll ein Hund aus einem Tor gerannt sein, ihr in den Oberarm gebissen und ihren schönen roten Mantel schmutzig gemacht haben. Dann ist der Hund in das Tor zurück und sie fluchtartig weinend nach Hause.
Ach ja und diese Kinderjahre von 6-7 waren sehr aufregend.
Die große Schwester war inzwischen in Berlin am Stern‘schen Konservatorium als angehende Pianistin mit ihrem zukünftigen Mann – auch ein Musikstudent – zusammengetroffen. Beide sind aus der sowjetischbesetzten Zone geflüchtet, weil sie von DDR-Schergen mit einem Westschmöker bei der Fahrt von Cottbus nach Berlin in der S-Bahn erwischt worden waren.
Der Bruder brachte mal einen kleinen Hund nach Hause, der Sauerkraut fraß und alle Bücher anknabberte. Davon gab es viele im Haus. Meine Herrin konnte inzwischen gut Fahrrad fahren und fuhr mit ihrem Vater früh morgens vor dem Öffnen des Ladens zum Gemüsegroßhandel und transportierte so gut sie konnte, kleine Kisten auf dem Gepäckträger.
Oft musste sie das Rad an die Hauswand lehnen, damit sie absteigen konnte, die Hausbeleuchtung abends abschalten, auf dem Dachboden die Fenster schließen bei Regen, die Straße Samstags fegen oder dann auch etwas später nach Ladenschluss, mit Kunden runter, um Vergessenes zu verkaufen.
Brüderchen hatte sich auf die Musikfachschule in Potsdam verdrückt. Also war meine Herrin mit dem herzkranken Vater und der von aufopferungsvoller Arbeit gezeichneten Mama allein.
Als 6-Jährige stand sie an einem aus Kisten bestehenden Stand vor dem Laden und bot zum Beispiel Pflaumen an, welche die Hausfrauen doch zu Kuchen verbacken könnten, denn die gab es ohne Lebensmittelkarten.
In ihrem 7. Lebensjahr wurde ihre Mutter krebskrank. Zu der Zeit war sogar von einem guten bekannten Arzt nur eine Brustamputation angesagt. Der Krebs wurde nicht besiegt, denn genau weitere 7 Jahre später starb sie und genau an dem 14. Geburtstag unserer Herrin wurde ihre Mutter begraben und sie stand tränenlos am Grab.
Zwischen ihrem 7. und 9. Lebensjahr war sie oft auf die Ball- oder Fangen- spielenden Kinder rund um das Haus neidisch, denn das Nachbarhaus war auch weggebombt und so war die Frontseite des Zweiflügelhauses ideal zum Verstecken spielen. Auch die Fahrradtouren zur Bank zum Herrn Fetting, um das eingenommene Tagesgeld auf das Ladenkonto einzuzahlen, sind ihr in Erinnerung und – dass sie drei Kreuze als Unterschrift machen durfte, denn sie konnte ja noch nicht schreiben.