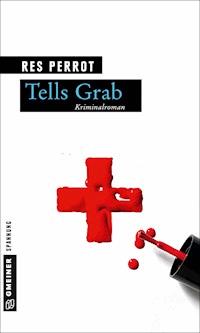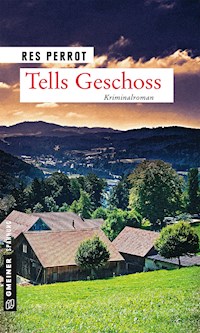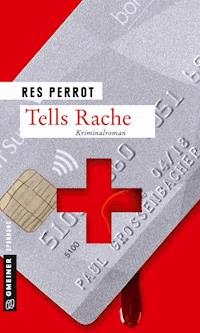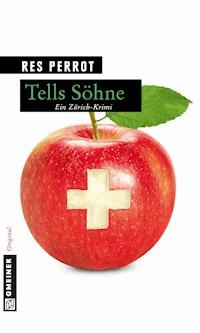
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Wachtmeister Grossenbacher
- Sprache: Deutsch
Auf dem Grundstück von Jonas Wachter, dem Direktor der Sozialversicherungsanstalt Zürich, wird ein Gesslerhut errichtet. Wachtmeister Paul Grossenbacher fühlt sich sofort an Friedrich Schillers Wilhelm Tell erinnert und ermittelt im Kreis von Patrioten. Kurz darauf wird der Direktor getötet aufgefunden und Grossenbacher fliegt eine Bombe buchstäblich um die Ohren. Derart herausgefordert, stößt er bei seinen Ermittlungen auf eine Macht, die lange im Untergrund leben musste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Res Perrot
Tells Söhne
Ein recht extremer Fallfür Wachtmeister Grossenbacher
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Sven Lang
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © egorxfi - Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4504-0
Gedicht
Fährst im wilden Sturm daher,
Bist du selbst uns Hort und Wehr,
Du, allmächtig Waltender, Rettender!
In Gewitternacht und Grauen
Lasst uns kindlich ihm vertrauen!
Ja, die fromme Seele ahnt,
Ja, die fromme Seele ahnt,
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.
Schweizerpsalm, 4. Strophe
Prolog
Die Schweizerfahne baumelt wie ein fauler Sack am Mast. Eine kaum sichtbare Bewegung. Der Fahnenmast steckt erdbebensicher verankert am Rande des Parkplatzes in einer granitgefassten und mit großen runden Steinen gefüllten Blumenrabatte. Alles ist herausgeputzt. Himmel, Häuser, Wiesen und Straßen glänzen als wär’s das Swissminiature in Melide. Nur in der Blumenrabatte fehlen die Blumen.
Jetzt hängt das rote Tuch tot am Seil. Das feine Vibrieren des gespannten Drahtseils verschmilzt mit dem Flirren der sommerlich erhitzten Luft. Es ist heiß. Beinahe drückend, obwohl es noch nicht einmal Mittag ist. Der durchsichtige, bläuliche Himmel ist verlassen. Weder Wolken noch Vögel ziehen vorbei. Eine bewegungslose Stille. Gläsernes Flimmern spiegelt über dem Asphalt. Der Siedepunkt des Tages scheint bereits erreicht oder gar überschritten.
Wie er die Situation auf dem Parkplatz vor dem Löwen so durch die Frontscheibe betrachtet, kommt ihm ein Bild in den Sinn. Er hat es vor etwa zwei Jahren selbst in das große schwarze Silva-Buch SAHARA eingeklebt. Eine Luftspiegelung. Fotografierte Hitze auf ein Stück Papier gedruckt. Es ist kurz nach elf Uhr. Genau sieben Minuten nach. Er hat noch genug Zeit.
Die gnadenlose Junisonne steht senkrecht über dem Platz und brennt die Schatten weg. Er bleibt einen Moment länger als nötig in seinem sportlichen Wagen sitzen, weil er den durchdringenden Duft von aufgeheiztem Kunstleder liebt. Ebenso eine positive Erinnerung. Er bekommt einfach nicht genug vom Geruch im Wageninnern, assoziiert damit ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer. Ein männlicher Duft, der ihn irgendwie auch an seine Jugend erinnert, an Sommer, Hitze, und die Rückbank des VW Käfers. Der Vater sitzt am Steuer und die Passstraße führt ins Tessin.
Er liebt aber auch seinen Wagen. Er ist sein ganzer Stolz. Ein Datsun Violet / 160J SSS Coupé in Gelb. Der neuste Stand der Technik, zweitürig mit Schrägheck, Hardtop und unglaublichen 89 PS. Eine Rakete, hatte ihm der Verkäufer versprochen. Ein Auto. Ein richtiger Wagen, nicht wie die Reisschüsseln der Konkurrenz und trotzdem japanisch, sprich ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Er hatte sich überlegt, ob er den Motor mit Doppelwebervergasern ausrüsten sollte, um zusätzliche Leistung aus der Maschine herauszuholen. Andererseits fühlt er sich mit 34 doch etwas zu alt dafür.
Er ist nicht sicher, was ihn heute hier im Emmental erwartet. Entspannt und gleichwohl auf der Hut lehnt er sich in den aufgeheizten Fahrersitz und starrt durch die Frontscheibe. Mit zwei Fingern wischt er sich den Schweiß unter den Nasenreitern seiner Brille weg. Dann schaltet er das Autoradio an, das er vor einer guten Woche hat einbauen lassen. Stereo, mit zusätzlichem Einschubfach für 8-Spur-Audiokassetten von Blaupunkt. Der reinste Luxus. Er bekommt gerade noch das Ende der Elfuhrnachrichten mit. Es folgt eine Sondersendung mit Hintergrundberichten zum Landesverräter Jean-Louis Jeanmaire. Das Kassationsgericht bestätigte heute Morgen, wie man in den Nachrichten hören konnte, das Urteil, welches das Divisionsgericht 2 vor gut zwei Jahren wegen Landesverrats gegen Jean-Louis Jeanmaire verhängt hatte. 18 Jahre Zuchthaus. Zudem wird Brigadier Jeanmaire degradiert und aus der Armee entlassen.
Der Radiosprecher fasst noch einmal die Ereignisse, sofern sie nicht der Geheimhaltung unterliegen, zusammen: 1961 lernte Jean-Louis Jeanmaire den sowjetischen Militärattaché in Bern, der gleichzeitig auch Mitglied des militärischen Nachrichtendienstes GRU war, kennen. Brigadier Jeanmaire gab ihm, wie auch später dessen Nachfolgern, vertrauliche Auskünfte über die Schweizer Armee weiter. Unter anderem Informationen zur Mobilmachung. Mitte der 70er-Jahre warnte ein ausländischer Nachrichtendienst die Schweizer Behörden vor einem Leck. Das führte im August 1976 zur Verhaftung von Jeanmaire. Der Druck der CIA und der US-Regierung sowie das politische Klima des Kalten Krieges erzeugten nach Brigadier Jeanmaires Verhaftung eine Eigendynamik, die später auf die Medien und damit auf eine breite Öffentlichkeit übergriff. An Stammtischen vernahm man Stimmen die sogar die Folter bei Verhören und die Wiedereinführung der Todesstrafe forderten. Telefonabhörberichte, Überwachungsrapporte, geheimdienstliche Aktennotizen und Verhörprotokolle, die während des Prozesses vor dem Divisionsgericht 2 verlesen wurden, gaben einen tiefen Einblick in das Wirken der dunklen Mächte, die sich so vor der Öffentlichkeit fürchteten.
Die Sondersendung endet mit der Einspielung eines Ausschnitts der Rede, die der EJPD-Vorsteher, Bundesrat Kurt Furgler, vor der vereinigten Bundesversammlung im Oktober 1976 zum Fall Jeanmaire gehalten hatte: ›… wir sind aber kein Polizeistaat und wollen es auch nicht werden. Die Vorstellung beispielsweise, jeder Geheimnisträger sei ständig zu überwachen, ist unserer auf Vertrauen basierenden Gesellschaftsordnung fremd und unwürdig. Wir haben im Bereich des Staatsschutzes die Aufgabe durch sorgfältiges Abwägen aller Werte eine Synthese zwischen den Interessen der staatlichen Ordnung und der Freiheit des Einzelnen zu finden …‹
Endlich bewegt sich die Fahne wieder. Aber nur zögernd. Das geschieht ihm recht, diesem Verräter, denkt er und macht das Radio aus. Das Treffen ist für heute, Donnerstag, den 22. Juni 1978, 12.00 Uhr, oder zwölfhundert, wie es in ihrer Sprache heißt, im Gasthof Löwen in Krauchthal vereinbart. Schon zwei Mal haben sie sich im Vorfeld an ebenso abgelegenen Orten zu konspirativen Gesprächen verabredet. Das Projekt. Es konnte vieles bedeuten, doch genaue Angaben gibt es nicht. Noch nicht. Alles befindet sich derzeit im Aufbau, das hat man ihm jedenfalls gesagt. Aber heute soll es so weit sein. Ein besonderer Tag. Bei einem Mittagessen wird die besprochene Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet. So etwas wie eine Gründungsversammlung. Die mündliche Einladung für die Verabredung hat ihm vor einigen Tagen ein Dienstkollege aus dem WK überbracht, der irgendetwas beim EMD arbeitet. Der Bote reiste extra von Bern nach Zürich, um ihm die Information zu überbringen. Das war vorgestern. Um an dem Treffen teilnehmen zu können, musste er extra freinehmen. Der Bote hat ihn eindringlich darauf aufmerksam gemacht, dass er zu niemandem, weder zu seinem Chef noch zu seiner Frau, etwas sagen dürfe. Am Anfang kam es ihm schon recht geheimniskrämerisch vor, aber inzwischen hat er sich mit dem Gedanken angefreundet und sieht ein, dass nicht alle Welt wissen muss, was er vorhat und wohin er geht.
Und jetzt sitzt er da, am Eingang des Emmentals, und beobachtet die rote Fahne mit dem weißen Kreuz, wie sie sich im kaum spürbaren Luftzug windet. Trotzdem wird ihm immer warm ums Herz, wenn er das Stück Stoff betrachtet. Stolz erfüllt ihn so, dass er sich im Sitz aufrichtet und streckt. Stramm, die Brust raus.
Der Parkplatz im Hof des großen Landgasthauses ist beinahe leer. Seit er hier mit seinem Wagen steht, ist kein weiteres Fahrzeug angekommen oder weggefahren. Weitere vier Wagen brüten verlassen in der Sonne. Zwei Berner Nummern, eine Freiburger und eine Basler. Er hat genau darauf geachtet, als er auf den Abstellplatz zwischen den Nebengebäuden des Hofes gerollt war. Etwas auffällig, so scheint ihm, der Anteil ortsfremder Fahrzeugschilder hier auf dem Land. Ob die wohl auch eingeladen sind? Die Minuten verstreichen wie Honig. Endlich ist es so weit. Es ist Zeit. Er steigt aus, verriegelt sorgfältig die Wagentür und hastet über den Platz zum Hintereingang des Gasthauses. Aus dem Augenwinkel beobachtet er, wie die Strafanstalt Thorberg, die etwas weiter auf dem Hügel thront, hinter dem mächtigen Wirtshausdach verschwindet.
Es ist kühl und finster im alten stattlichen Steinhaus mit dem typischen, tief heruntergezogenen Walmdach. Seine Augen müssen sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Darum bleibt er für einen Augenblick hinter der ins Schloss fallenden Holztür stehen. Dabei klirrt das Türglas gefährlich. Alles ist exakt so, wie es ihm beschrieben wurde. Ein langer Korridor, über dessen Steinfliesen ein ausgetretener Läufer liegt. Verschiedene Türen links und rechts. Am anderen Ende eine Holztruhe, darauf eine trübe Glasvase mit einem Strauß verdorrter Feldblumen. Das Wasser im Gefäß verziert seit Jahren mit Kalkringen der unterschiedlichsten Breite die Vase. Über der verkümmerten Dekoration ein kleines Fenster zur Hauptstraße hinaus. Fünf Schritte den Hausflur hinunter und rechts in die Bauernstube. Die Tür ist genauso angeschrieben. Er ist nicht der erste Gast. Ein Mann sitzt in der Stube vor einer Vitrine – mit den staubsicher hinter Glas geschützten Pokalen und Fahnen des Schützenvereins Krauchthal – an einem Tisch und liest Zeitung. Vor ihm auf der rot-weiß karierten Tischdecke stehen ein ausgetrunkenes Glas und ein Fläschchen Pepita mit Grapefruit-Aroma.
Als er jetzt die Stube betritt, spürt er sofort den Stolz und den Wehrwillen der Nation. Eine verbindende Kraft, die sich seit dem letzten Krieg in ihren Köpfen und Herzen eingenistet hat. Eine Haltung, die aus Männern Eidgenossen macht. Jeder konnte es täglich in den Zeitungen lesen, er ist noch nicht vorbei, der Kalte Krieg. Die Angst vor dem Russen steckt uns genauso in den Knochen, wie damals jene vor dem Adolf. Darum ist er überzeugt, dass dieser eiserne Wille zur Freiheit und Unabhängigkeit durchaus seine Berechtigung und Gültigkeit hat. Vielleicht ist er heute, in diesen unsicheren Zeiten, sogar noch wichtiger.
Alles stimmt mit den Angaben überein, die ihm der Verbindungsmann übermittelt hat. Die Stube, ein Mann, der zeitungslesend am Tisch sitzt und als Zeichen, dass so weit alles in Ordnung ist, steht das Glas rechts der Flasche. Er hatte Order, falls das Glas links davon stehen würde, das Lokal grußlos wieder zu verlassen und sich unverzüglich auf den Heimweg zu begeben. Doch es scheint alles gut zu sein.
Eine patriotische Stimmung überkommt ihn, wie er in dieser vertrauten schweizerischen Umgebung mit würdig erhobenem Haupt den Unbekannten mit einem kaum sichtbaren Kopfnicken begrüßt. Der Bote hat ihn angewiesen, sich auf gar keinen Fall mit seinem Namen vorzustellen. Darum zieht er es vor, besser gar nichts zu sagen und sich auf einen freien Stuhl am hinteren Fenstertisch zu setzen und abzuwarten. Der in seine Lektüre vertiefte Mann blickt kurz auf, faltet andächtig seine Zeitung zusammen, erhebt sich, schiebt den Stuhl ordentlich unter den Tisch, tippt kurz mit zwei Fingern an seine Stirn und verlässt mit dem Amtsanzeiger Burgdorf unter dem Arm das Säli. Genau so wie es abgemacht war.
1. Kapitel
Wachtmeister Paul Grossenbacher von der Kriminalpolizei des Kantons Zürich sitzt faul in seinem Büro und das bereits seit Tagen. Er weiß, dass er sich in der Vergangenheit mehr wie ein arrogantes Arschloch als wie ein weniger arrogantes Arschloch aufgeführt hat. Genau so weiß er auch, dass er dafür gebüßt hat, dass seine Frau seinetwegen auszog und er daraufhin einiges an therapeutischen Behandlungsversuchen über sich ergehen lassen musste. Ob es für etwas gut war, kann er nicht sagen, jedenfalls ist Anna wieder zu ihm zurückgekehrt, was irgendwie für ihn spricht.
Er schwitzt. Auch das schon seit Tagen. Es ist nicht so, dass er sich in letzter Zeit besonders anstrengt, aber der Sommer ist in Zürich eingetroffen und hinterlässt eindeutige Spuren. Dunkle Ränder unter den Hemdsärmeln und auch an anderen Stellen. Grossenbacher befürchtet, dass er in der Sauna, die sich sein Büro nennt, einiges an Gewicht verlieren wird. Zur geistigen Stimulation spielt er eine Partie Solitär auf seinem PC in der Hoffnung, dass an diesem Mittwochmorgen wenigstens hierbei etwas Spannung aufkommt, denn im Kanton Zürich geht es in Sachen Verbrechen nicht so heiß zu wie beispielsweise in Rio de Janeiro, obwohl draußen etwa die gleiche Hitze drückt.
Aber auch beim Spiel ist er unkonzentriert. Zum Rhythmus von Mausklicks und Tastengeklapper führt er unverständliche Selbstgespräche. Nach dem nächsten misslungenen Durchgang lässt er seine hundert Kilo Wärmespeichermasse in den Stuhl zurückfallen, um sich ausgiebig die Kopfhaut zu kratzen. Sobald sich die weiße Schuppenwolke über den mit Akten überstellten Schreibtisch gesetzt hat und den Blick auf die Uhr am oberen Monitorrand wieder freigibt, ist es 9.39 Uhr. Grossenbacher fragt sich, warum die Stunden so lang sind, wie sie sind? Warum Zeit nicht etwas Flexibles ist? Könnte man nicht Uhren herstellen – vor allem für die Beamten –, die mithilfe von ovalen Zahnrädern während der Bürozeit schneller drehen würden, um dann, in der Freizeit, am Feierabend der länglichen Ausdehnung der Zahnkränze folgend, langsamer laufen würden. Grossenbacher ist begeistert. Tolle Idee! Zufrieden lehnt er sich im Stuhl weiter zurück, dabei löst sich die angestaute Blähung. Erleichtert stellt er sich vor, wie er die neue Zeit patentieren lassen und sich mit seiner Erfindung eine goldene Nase verdienen würde, bis Dienst-Chef Christian Lüthi in seine Träumerei platzt.
Die Millionen lösen sich im Nu in Luft auf. Unaufgefordert hat Lüthi an den Türrahmen geklopft und damit das leise beschwörende Murmeln, das aus dem Büro dringt, unterbrochen. Ebenso unaufgefordert tritt Lüthi über die Schwelle und überfällt den Wachtmeister mit einem Redeschwall. »Puh, hier stinkt’s! Willst du nicht einmal lüften?« Lüthi schmatzt mit seinem Kaugummi. »Paul, hör mal, du bist doch unser Mann mit dem mbA. Was bekanntlich so viel heißt wie der Mann ›mit besonderen Aufgaben‹, oder?«
Unsympathische Heiterkeit am frühen Morgen. Grossenbacher erträgt es kaum, doch Lüthi wartet keine Antwort ab, lacht nicht einmal über seinen dürftigen Scherz, sondern fährt gleich mit seinem Geplapper fort: »Genau darum geht’s. Ich hätte eine besondere Aufgabe für dich.«
Grossenbacher stöhnt.
Lüthi setzt sich unaufgefordert auf die Tischkante und lässt Grossenbacher kaum Zeit, um das begonnene Spiel vom Monitor wegzuklicken.
»Vorhin, vor etwa zehn Minuten, also etwa um Viertel vor elf ist eine etwas absurde Meldung vom Posten Horgen eingegangen. Im Garten vor einem Haus in Langnau, hier die Adresse«, Lüthi schiebt Grossenbacher ein A4-Blatt herüber, »steckt mitten in der Rasenfläche eine gut vier Meter hohe Holzstange. Und das Beste daran ist, oben auf dem Spitz sitzt ein grüner Tirolerhut mit Gamsbart. Die Kapo Horgen hat jemanden losgeschickt, um ein paar Fotos zu machen. Sie haben versprochen, uns die Bilder zu schicken, sobald die Streife zurück ist – komisch nicht?«
»Finde ich auch. Wirklich komisch, dass die in Horgen wegen einer Anzeige so ein Aufheben machen.«
»Nein, Paul. Wo denkst du hin? Nicht das ist komisch, ich meine natürlich den Hut auf der Stange.«
»Aha, wenn du Schweizer Geschichte komisch findest, na ja – kann ich sogar verstehen. Aber warum kommen die mit diesem Furz zu uns?« Grossenbacher hat einen Energieanfall und wuchtet sich aus seinem Bürostuhl, trottet zum Fenster, entriegelt dieses so schwungvoll, dass er beinahe den Griff aus dem Rahmen reißt. Das fette Frühsommergrün der Bäume aus der Parkanlage der ehemaligen Militärkaserne gegenüber springt regelrecht ins Zimmer. Die goldgelbe Sonnenscheibe klebt an einem überblauen Himmel und wird von einer ohrenbetäubenden Vogelkakofonie ausgepfiffen. Ein prächtiger Junitag mit allem, was dazu gehört, außer vielleicht den Schweißrändern und dem Besuch von DC Lüthi.
»Es ist nicht das erste Mal«, versucht Lüthi gegen das Vogelgezwitscher anzureden, »dass von dem Haus in Langnau am Albis ähnlich sonderbare Vorkommnisse gemeldet werden. Das sagte mir jedenfalls der Posten-Chef von Horgen am Telefon. Locher heißt er, glaube ich. Die Bewohner des Hauses haben erst kürzlich schon andere merkwürdige Erscheinungen gemeldet.«
»Erscheinungen?«, fragt Grossenbacher in möglichst uninteressiertem Ton.
»Ja, so sagte er, Locher, meine ich, aus Horgen. Warum, stimmt etwas nicht? Hast du etwas dagegen?«
»Ja! – Was geht uns das an? Bis jetzt ist ja nichts passiert. Was will der Horgener von uns? Kann er nicht selber eine Bohnenstange aus dem Boden reißen?«, brummt der Wachtmeister durch das offene Fenster hinaus.
»Nun, es ist so«, Lüthi spricht immer noch mit dem breiten Rücken des Wachtmeisters, »dass sich die Situation insofern etwas zugespitzt hat, dass sie heute Morgen auch erstmals eine Drohung erhalten haben …«
»Eine Drohung? – Wer, der Posten Horgen?«, unterbricht ihn Grossenbacher frech.
»Nein, die Wachters. Ich meine, die Frau, die da in dem Haus wohnt. Stell dir vor, Paul, es war wie im Film. Ein Stein, an den jemand einen Zettel gebunden hat, wurde durch die Fensterscheibe des Wohnzimmers geworfen. Auf dem Papier steht, eh, warte«, Lüthi sucht den entsprechenden Abschnitt auf dem Fax, das unbeachtet auf Grossenbachers Pult liegt.
»Ah, hier ist es: ›Den nehm ich jetzt heraus aus eurer Mitte‹ – klingt doch irgendwie eigenartig, oder nicht?« Dienst-Chef Lüthi schaut Grossenbacher erwartungsvoll an, doch dieser zeigt keinerlei Reaktion. Der DC räuspert sich etwas verunsichert, spuckt seinen ausgeleierten Nicorette-Kaugummi in den Abfalleimer unter dem Pult. »Die Kollegen in Horgen sind nun selber etwas irritiert. Sie wissen nicht, was sie von dieser Botschaft halten sollen, ob es etwas Ernstes ist oder nicht, und haben darum um unsere Hilfe gebeten. Wir hätten doch Spezialisten für so etwas, meinte der Posten-Chef. – Da helfen wir doch gerne, oder etwa nicht? Und da du bei uns der Mann für die besonderen Aufgaben bist, übergebe ich dir diese Geschichte zur Bearbeitung. Alles klar? Hast du noch Fragen? – Wenn nicht, dann nichts wie los!«
Grossenbacher wendet sich vom Fenster ab und will lautstark reklamieren, er befinde sich total am Anschlag. Die Arbeit türmt sich auf seinem Schreibtisch jetzt schon höher als die Säulen der Erde im südenglischen Kingsbridge. Doch er kommt zu spät. Lüthi ist schon zur Tür hinaus und außer Hörweite.
»Ein Hut auf einer Stange, ein blöder Lausbubenstreich«, brummt Grossenbacher. Dabei kommt ihm das schmale, dünne, gelbe Heftchen vom Schiller unglücklich in Erinnerung. »Dieser verdammte Scheißhut auf dieser ebenso verdammten Stange!«, poltert Grossenbacher plötzlich los. Mürrisch wälzt er sich vom Fenster zurück auf seinen Bürosessel. Er hasst diese Geschichte, und er hasst Tell aus genau zwei Gründen: Erstens, weil er in seiner abgebrochenen Gymnasiumskarriere dieses blöde gelbe Heftchen hatte lesen müssen und er schon damals ein grundlegendes Problem mit hochstilisierten Helden hatte. Wie hat er damals gelitten, denkt er voller Selbstmitleid. Wenn er sich richtig erinnert, war sogar dieses Heft schuld an seinem frühzeitigen Abgang vom Gymi. Weil er damals, statt das Ding zu lesen, Seite für Seite auf die Klopapierrolle im Lehrer-WC geklebt hatte. Denn als Pazifist, Love and Peace, war er damals überzeugt, dass allein schon das Lesen dieses Heftchens einen obrigkeitsgläubigen Bünzli aus ihm machen würde – und jetzt soll er sich wieder mit diesem Mist herumschlagen? Literatur ist doch etwas für Gymnasiallehrer und Idioten! Als hätte er nichts Vernünftigeres zu tun.
»Himmelherrgott noch mal! Warum muss DC Lüthi mit diesem Mist nur zu mir kommen?« Grossenbacher hasst bereits den neuen Auftrag, ohne dass ihm der zweite Grund einfällt, warum ihm Tell so auf die Nerven geht.
Leicht verzweifelt sucht er nach einer Möglichkeit, wie er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Als Erstes legt er seine Füße aufs Pult, rutscht auf der Stuhlkante nach vorn, sodass die hundert Kilogramm schwitzende Körpermasse bequem liegen. Dabei überlegt er sich, dass er ohne Weiteres an der Uni Vorlesungen über die Trägheit von Wärmespeichern halten könne, denn wenn jemand etwas davon versteht, dann sicher er. Vorsichtig legt er den Kopf in den Nacken, schiebt seine Hand unter den Gürtel und rückt seine eingeklemmten Dinger in Position. Seit den vergeblichen Fortpflanzungsversuchen – er hatte sich ja unter medizinischer Aufsicht angestrengt –, weiß er, dass sie zu nichts anderem taugen, als im Weg zu sein. Grossenbacher weiß aber nicht, warum er wieder zweifelt und mit seinem Schicksal hadert. Jetzt, wo alles wieder besser läuft. Seine Situation innerhalb des Polizeiapparates hat sich seit der Aufklärung der Familientragödien, zu deren Untersuchung eine interkantonale Ermittlungsgruppe eingesetzt worden war, grundlegend und positiv verändert. Sozusagen im Alleingang und mit einer halsbrecherischen Aktion hat er die Geschichte aufgeklärt. Auch seine neuen Chefs haben dazu beigetragen, dass sich seine Position bei der Kripo wieder beruhigt und gefestigt hat, obwohl er sich nach der Solonummer einen Rüffel eingehandelt hatte. Unverantwortliches Verhalten. Einsatz ohne vorherige Rücksprache. Eigenmächtiges Handeln. Kampfeinsatz ohne Dienstwaffe. Trotz allem war die Aktion ein Erfolg. Er fühlt sich beinahe wieder wohl in seiner Polizistenhaut und sein Übergewicht sorgt dafür, dass er, trotz Lob und Ehre, weiterhin schön am Boden bleibt.
»Also, was kann ich tun?« Grossenbacher spricht mit seinem Computermonitor, der still undefinierbare Muster zeichnet. Nach langer, intensiver Analyse der Situation kommt er schließlich auf drei mögliche Ansätze, die er für weitere Überlegungen in Betracht ziehen kann: »Erstens: Ich kann zum Telefon greifen und mit dem Posten Horgen Kontakt aufnehmen.« Vorsichtig wägt er noch einmal Pro und Kontra ab und kommt zum Schluss, dass das nur in überdurchschnittlich viel Arbeit enden wird. »Hm, zweitens: Ich greife nicht zum Telefon, um mit dem Posten Horgen Kontakt aufzunehmen, und warte, bis sich die Sache von allein gelegt hat. Eine Lösung, die auch das Problem mit der Überbelastung lösen würde oder drittens«, dieser Ansatz gefällt ihm trotz seines Hasses am Besten: »Ich kann in eine Buchhandlung gehen, und den beschissenen Tell, das kleine gelbe Büchlein von Schiller, kaufen. Okay, und was mache ich dann damit? – Hm, ich könnte mich irgendwo am See in den Schatten setzen und etwas darin lesen?«
Der Monitor gibt ihm keine Antwort, doch scheint ihm der dritte Ansatz der richtige Weg, obwohl Lesen – streng genommen – Arbeit ist. Grossenbacher kippt im Stuhl nach vorn, hievt sich mit größter Anstrengung aus dem Polster, schlüpft in seine grünen Gummistiefel und verlässt im Stechschritt das Büro.
2. Kapitel
Wachtmeister Paul Grossenbacher steuert auf direktem Weg, ohne unterwegs einen Bier-Stopp einzulegen, die Orell-Füssli Buchhandlung im Kramhof an, um sich das verhasste Reclam-Büchlein Wilhelm Tell zu besorgen. Er weiß immer noch nicht genau, warum er es haben muss. Kein ersichtlicher Grund, eher ein innerer Drang, etwas Unbewusstes zwingt ihn zum Kauf. Unsicher, was er damit anfangen soll, stopft er sich am Wurststand an der Ecke St. Annahof eine Schweinsbratwurst in den Mund und das Heft in die Tasche, bevor er die Bahnhofstrasse entlang Richtung See schlendert. Am Paradeplatz springt er in den Zweier und fährt schwarz hinauf zum Bürkliplatz. Beim Schiffssteg ersteht er eine Fahrkarte und wartet geduldig, umringt von Horden rucksackbepackter Kinder auf Schulreise, dass das Schiff für die kleine Rundfahrt um 13 Uhr anlegt.
Pünktlich löst die Mannschaft der MS Uetliberg die Leinen, und das Schiff wendet rückwärts ins Seebecken. Schwankend nimmt es langsam Fahrt auf. Wachtmeister Paul Grossenbacher vertieft sich noch vor der ersten Anlegestelle in Wollishofen ins sein Reclam-Heft.
Es lächelt der See, er ladet zum Bade
Das liebliche Bild wird gestört. Konrad Baumgarten ist auf der Flucht aus Unterwalden, weil er den Burgvogt Wolfenschießen, der seine Frau schänden wollte, erschlagen hat. Doch der Fährmann weigert sich Baumgarten überzusetzen, weil ein Föhnsturm den See aufpeitscht. Wilhelm Tell tritt auf und nimmt mutig die Sache in die Hand:
Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt,
Vertrau auf Gott und rette den Bedrängten.
Grossenbacher hat sich in den hinteren Teil des Schiffes mit dem Rücken zur Fahrtrichtung in den Schatten des Oberdecks gesetzt.
Die andern Völker tragen fremdes Joch,
Sie haben sich dem Sieger unterworfen.
[…]
Doch wir, der alten Schweizer echter Stamm,
Wir haben stets die Freiheit uns bewahrt.
Möwen umkreisen laut kreischend die durch den Fahrtwind flatternde Schweizerfahne am Heck des Kursschiffes.
Dem Kaiser selbst versagten wir den Gehorsam,
Da er das Recht zu Gunst der Pfaffen bog.
Denn als die Leute von dem Gotteshaus
Einsiedeln uns die Alp in Anspruch nahmen,
Die wir beweidet seit der Väter Zeit,
Der Abt herfürzog einen alten Brief,
Der ihm die herrenlose Wüste schenkte –
Denn unser Dasein hatte man verhehlt –
Da sprachen wir: »Erschlichen ist der Brief,
Kein Kaiser kann was unser ist verschenken.
Und wird uns Recht versagt vom Reich, wir können
In unsern Bergen auch des Reichs entbehren.«
– So sprachen unsre Väter!
Grossenbacher hat sich in das gelbe Heft hineingelesen und dabei seine Umgebung vergessen. Er blättert Seite um Seite, bis der Stauffacher auftritt:
Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht:
Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden,
Wenn unerträglich wird die Last – greift er
Hinauf getrosten Mutes in den Himmel,
Und holt herunter seine ew’gen Rechte,
Die droben hangen, unveräußerlich
Und unzerbrechlich wie die Sterne selbst –
Der alte Urstand der Natur kehrt wieder,
Wo Mensch dem Menschen gegenübersteht –
Zum letzten Mittel, wenn kein andres mehr
Verfangen will, ist ihm das Schwert gegeben –
Der Güter höchstes dürfen wir verteid’gen
Gegen Gewalt – Wir stehn vor unser Land,
Wir stehn vor unsre Weiber, unsre Kinder!
Auch nach Rüschlikon hat Grossenbacher immer noch keinen Blick für die Villen am See oder die Aussicht übers Wasser. Segelboote schaukeln im flauen Wind. Konzentriert liest er weiter und lässt sich selbst von den herumtollenden Kindern nicht ablenken, wobei der Altlandammann von Schwyz zur Ruhe mahnt:
Eidgenossen!
Sind alle sanften Mittel auch versucht?
Vielleicht weiß es der König nicht, es ist
Wohl gar sein Wille nicht, was wir erdulden.
Auch dieses Letzte sollten wir versuchen,
Erst unsre Klage bringen vor sein Ohr,
Eh wir zum Schwerte greifen. Schrecklich immer
Auch in gerechter Sache ist Gewalt,
Gott hilft nur dann, wenn Menschen nicht mehr helfen.
Wo sind wir? Paul Grossenbacher blickt kurz von seiner Lektüre auf und versucht, sich am Ufer zu orientieren. Doch kommt ihm keines der Gebäude bekannt vor, sodass er orientierungslos aufgibt und seine Nase noch tiefer in das Büchlein steckt.
Was sein muss, das geschehe, doch nicht drüber.
Die Vögte wollen wir mit ihren Knechten
Verjagen und die festen Schlösser brechen,
Doch wenn es sein mag, ohne Blut. Es sehe
Der Kaiser, dass wir notgedrungen nur
Der Ehrfurcht fromme Pflichten abgeworfen.
Während das Schiff vom Steg in Thalwil ablegt und Kurs über den See Richtung Erlenbach aufnimmt, brummt Grossenbacher die Schwurformel von Pfarrer Rösslmann vor sich hin:
Bei diesem Licht, das uns zuerst begrüßt
Von allen Völkern, die tief unter uns
Schweratmend wohnen in dem Qualm der Städte,
Lasst uns den Eid des neuen Bundes schwören.
– Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern,
In keiner Not uns trennen und Gefahr.
– Wir wollen frei sein, wie die Väter waren,
Eher den Tod, als in der Knechtschaft leben.
– Wir wollen trauen auf den höchsten Gott
Und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.
Halbzeit. Langsam wird die Zeit knapp, darum nimmt’s Grossenbacher nicht mehr so genau und beginnt querzulesen und hofft, die wichtigen Stellen trotzdem zu erwischen. Dabei stolpert er über Tells Sohn Walter, der gerade mit Pfeil und Bogen übt:
Früh übt sich, was ein Meister werden will.
Auch bei der nächsten berühmten Aussage hat Wachtmeister Grossenbacher Glück und erwischt die richtige Stelle, an der Wilhelm Tell selbst mit einer Axt hantiert:
Die Axt im Haus erspart den Zimmermann.
Kurz vor Erlenbach, man kann bereits die Uhrzeit vom spitzen Kirchturm lesen, hält Hedwig, Tells Frau, ihrem Mann vor, dass er zu viel wage, sei es auf der Jagd oder auch bei Sturm auf dem See. Worauf Tell antwortet:
Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten.
Hedwig ahnt, dass etwas nicht stimmt und will Tell davon abhalten, hinunter nach Altdorf zu gehen. Auf einer Wiese thront der Gesslerhut auf der Stange.
»Ah …«, denkt Grossenbacher, »da haben wir’s!«
Die Wachen ärgern sich, weil das Volk den belebten Platz meidet, seitdem der Popanz auf der Stange hängt. Wilhelm Tell will mit seinem Bub Walter achtlos vorbeigehen, obwohl ihn der Knabe auf den Hut aufmerksam macht. Die Wachen halten ihn auf. Leute eilen hinzu und so kommt es bald zum Aufruhr. Gessler stößt mit seinem Gefolge dazu. Tell versucht, und dabei wird er Grossenbacher langsam sogar sympathisch, sich herauszureden. Doch der Landvogt schlägt alle Ausreden aus und zwingt Tell zur Strafe, mit seiner Armbrust einen Apfel vom Kopf seines Sohnes zu schießen. Alles Flehen hilft nicht. Während Tell die Armbrust spannt und zum Apfelschuss ansetzt, und das Schiff das Anlegemanöver in Erlenbach macht, mischt sich gegen Gesslers Gebot Rudenz ein:
Ich will reden,
Ich darf’s! Des Königs Ehre ist mir heilig,
Doch solches Regiment muss Hass erwerben.
Das ist des Königs Wille nicht – Ich darf’s
Behaupten – Solche Grausamkeit verdient
Mein Volk nicht, dazu habt Ihr keine Vollmacht.
Wilhelm Tell hält einen zweiten Pfeil bereit, während das Kursschiff wieder ablegt und schnell Fahrt aufnimmt. Grossenbacher hat keine Zeit für die Goldküste. Die prächtigen Villen mit dem alten wuchtigen Baumbestand bleiben unbeachtet. Auch das Anwesen von Tina Turner kann ihn nicht ablenken, obwohl alle steuerbord an der Reling hängen, um eventuell einen Blick auf die berühmte Sängerin ergattern zu können. Ein scharfes Brennen im Magen erinnert ihn an das Hier und Jetzt und an die verspeiste Wurst. Der Landvogt will wissen, was das mit dem zweiten Pfeil auf sich habe, und erst nachdem er ihm das Leben zugesichert hat, gesteht Tell:
So will ich Euch die Wahrheit gründlich sagen.
Mit diesem zweiten Pfeil durchschoss ich – Euch,
Wenn ich mein liebes Kind getroffen hätte,
Und Eurer – wahrlich! hätt ich nicht gefehlt.
Gessler lässt Tell in Fesseln legen und über den See nach Küssnacht am Rigi bringen. Auch der kleine Rundkurs der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft hat inzwischen Küsnacht am Zürichsee erreicht. Ein heftiger Föhnsturm kam auf und der Landvogt und seine Knechte bekamen es mit der Angst. Sie wussten sich nicht anders zu helfen, als Tell loszubinden und ans Steuer zu lassen. An einer vorstehenden Felsplatte jedoch fasst dieser seine Armbrust, springt hinüber und stößt dabei das Schiff in den wütenden See zurück. Etwa auf der Höhe von Zollikon legt sich Wilhelm Tell auf die Lauer.
Durch diese hohle Gasse muss er kommen.
Sie legen bereits wieder in Zollikon ab, als sich dem Landvogt eine arme Frau mit ihren Kindern in den Weg stellt. Auch Grossenbacher stellt sich plötzlich eine Frau in den Weg. Es ist seine eigene, Anna. Verdammt noch mal, haben sie für den Mittag nicht abgemacht, in einem Brillengeschäft einen Sehtest machen zu lassen? Er hat oft das Gefühl, nicht mehr alles richtig zu sehen. Er klaubt sein Handy hervor: ›Anruf in Abwesenheit‹. Anna hat ihn gesucht. Scheiße, verdammte! Dass ihm das immer wieder passieren muss. Eilig drückt er ihre Nummer, doch sie nimmt nicht ab. Er versucht es erneut und quetscht dabei beinahe die kleinen Tasten ins Gehäuse hinein. Nichts. Die andere Frau klagt dem Vogt ihr Elend, ihr Mann schmachte wegen eines geringen Vergehens im Gefängnis:
Nein, nein, ich habe nichts mehr zu verlieren.
– Du kommst nicht von der Stelle Vogt, bis du
Mir Recht gesprochen – Falte deine Stirne,
Rolle die Augen wie du willst – Wir sind
So grenzenlos unglücklich, dass wir nichts
Nach deinem Zorn mehr fragen –
Der kleine Rundkurs ist bereits wieder auf der Höhe der Stadtgrenze und steuert auf das Zürichhorn zu, als der Landvogt Gessler wütend schreit:
Ein allzu milder Herrscher bin ich noch
Gegen dies Volk – die Zungen sind noch frei,
Es ist noch nicht ganz wie es soll gebändigt –
Doch es soll anders werden, ich gelob es,
Ich will ihn brechen diesen starren Sinn,
Den kecken Geist der Freiheit will ich beugen.
Ein neu Gesetz will ich in diesen Landen
Verkündigen – Ich will –
(Ein Pfeil durchbohrt ihn, er fährt mit der Hand ans Herz und will sinken)
[…]
Das ist Tells Geschoss.
14.12 Uhr, Zürichhorn. Grossenbacher hat unerträglichen Durst. Kurz entschlossen klappt er den Tell zu, stopft ihn achtlos zurück in seine Jackentasche und steuert dem Ausgang zu. Über den wackeligen Steg verlässt er die Rundfahrt, denn es lächelt das Restaurant am Ufer, es lädt zum Einkehren.
3. Kapitel
Wachtmeister Grossenbacher versucht, sich an das Gespräch mit DC Lüthi zu erinnern. Doch stattdessen kommt ihm Anna in den Sinn. Er sollte sie anrufen, um zu sagen, dass er abgehalten wurde und darum den Termin nicht einhalten konnte, und dann kam noch der Akku seines Telefons dazu, der auf null Prozent geschrumpft war; oder er entschuldigt sich einfach nur bei ihr. Er bestellt beim vorbeieilenden Kellner zur besseren Entscheidungsfindung eine zweite Stange.
Im Garten vor dem Haus des Ehepaares Wachter, Wildenbühlstrasse 40 in Langnau am Albis, thront ein Gesslerhut, ein Popanz auf der Stange. Dazu diese äußerst dramatische Drohung:
DEN NEHM ICH JETZT HERAUS AUS EURER MITTE!
Langsam wird Grossenbacher klar, warum er das gelbe Heftchen lesen musste. Er blättert in den Seiten und sucht die Stelle. Wenn er die Geschichte noch richtig im Kopf hat, so drohte Gessler mit diesen Worten, nachdem Tell gestanden hat, was er mit dem zweiten Pfeil wollte, ihn, den Tell außer Landes zu bringen:
Ich kenn euch alle – ich durchschau euch ganz –
Den nehm ich jetzt heraus aus eurer Mitte,
Doch alle seid ihr teilhaft seiner Schuld,
Wer klug ist, lerne schweigen und gehorchen.
Da stimmt doch etwas nicht, oder hatte er etwas falsch verstanden?
DEN NEHM ICH JETZT HERAUS AUS EURER MITTE!
Könnte diese Botschaft eine angedrohte Entführung sein, rätselt Grossenbacher, während er das zweite Glas ansetzt. Oder hat derjenige, welcher den Zettel geschrieben hat, einfach den erstbesten Satz aus Tell zitiert? Oder – trifft Wachter eine Schuld? Aber wenn ja, an was oder bei was? Oder der Provokateur ist ein Wirrkopf, ein Tell-Freak mit einem Beachtungsdefizit, der einiges durcheinanderbringt. Das Profil scheint Grossenbacher passend zu der übertriebenen Art, wie die Botschaft übermittelt worden war, und zu der lächerlichen Bohnenstange auf dem Rasen in Wachters Garten. Da muss einer eine ziemliche Ecke weghaben, um seinem Opfer ein solches Mahnmal vors Haus zu stellen. Beim Zahlen überlegt der Wachtmeister, wie und warum er den Begriff Opfer gewählt hat, da es doch weit und breit kein Verbrechen gibt. Abgesehen vielleicht von ›unerlaubtem Betreten fremden Eigentums‹ oder wie die Juristen das auch immer nennen.
Er überquert die Bellerivestrasse bei der Parkplatzausfahrt und trottet die Fröhlichstrasse entlang, um an der gleichnamigen Haltestelle den Zweier in Richtung Stauffacher zu erwischen, als das verhasste Handy in seiner Jackentasche stört.
»Ja?«
»Paul, wo steckst du? Ich hoffe, du bist auf dem Weg nach Langnau?«
Grossenbacher erkennt zwischen den Schmatzgeräuschen die Stimme von Lüthi und antwortet mit einem knappen: »Genau!« Was ja auch stimmt, denn er hat sich fest vorgenommen, wenn er wieder zurück im Büro ist, mit dem Dienstwagen nach Langnau hinauszufahren, um den Popanz zu besichtigen.
»Wo bist du jetzt?« Lüthi gibt nicht so schnell auf und kaut energisch auf seinem Nikotinkaugummi, als würde das seine Autorität unterstreichen.
»Im Seefeld, wenn’s recht ist. Was gibt’s?«
»Genau das frage ich mich auch! Was ist los? Ich habe dir doch heute Morgen ausdrücklich den Auftrag erteilt, bei den Wachters in Langnau vorbeizuschauen. Aber nein, der Herr ist sich zu schade, er vergnügt sich lieber im Seefeld – oder seh ich das falsch?« Lüthi wirkt leicht angesäuert: »Paul, die halbe Belegschaft des Postens Horgen wartet seit heute Morgen auf dich! Hast du mich verstanden?«
»Was hast du gesagt?«
»Paul, pass auf, was du sagst!«
»Ich mach ja nichts!«
»Genau, das ist das Problem!«
»Jetzt hör mal, Christian, ich hab doch gesagt, ich bin unterwegs«, versucht sich Grossenbacher zu rechtfertigen.
»Schön, wenn du dich endlich bewegst.«
»Zudem musste ich mich noch vorbereiten, recherchieren, wie man so schön sagt. Und, von wegen Bewegung, mein Gehirn ist doch kein Muskel!«
In der Leitung bleibt es still.
Endlich lenkt Grossenbacher ein: »Diese Bohnenstange mit dem albernen Hut obendrauf kann ja kaum der Grund für deine Aufregung sein?«
»Nein, das nicht allein.« Lüthi kaut schwer. »Frau Wachter hat im Milchkasten einen weiteren Brief gefunden.«
»Was du nicht sagst. Nach dem Lausbubenstreich schreibt der Unruhestifter jetzt also auch noch Liebesbriefchen! Ist ja klar, dass da die Kripo einschreiten muss, um diesen verzwickten Fall zu klären.« Grossenbacher macht sich lustig über Lüthis ernsten Ton. Doch dieser lässt sich nicht beirren und liest den Inhalt des Briefes vor: »Also, Paul, hör zu. In dem Brief steht Folgendes:
›Eu’r Walten hat ein Ende. Der Tyrann
Des Landes ist gefallen. Wir erdulden
Keine Gewalt mehr. Wir sind freie Menschen.‹
Klingt irgendwie sonderbar, meinst du nicht?«
»Ich bin unterwegs!« Wachtmeister Grossenbacher klemmt das Gespräch ab. Der Zweier ist schon fast am Bellevue und sein Magen meldet sich mit einem üblen Drücken und Kneifen zurück, bevor er gefährlich laute Gurgelgeräusche macht.
Was soll das? Der Text, den Lüthi vorgelesen hat, hat Grossenbacher doch etwas verunsichert. Sind das echte Hinweise, Warnungen, oder gar Zeichen? Was will der Unruhestifter mit diesen Andeutungen erreichen? Ist das ernst gemeint oder will er dieser Frau Wachter nur Angst einjagen? Grossenbacher weiß es nicht und wenn er es sich genau überlegt, so ist es ihm auch egal. Er gehört zum Kader der Kriminalpolizei und bis jetzt kann er nicht viel Kriminelles an der Geschichte entdecken. Trotzdem ist er auf einmal beunruhigt. Er steht auf. Schwankend angelt er sich durch die Sitzreihen nach hinten zum Ausgang. Etwas macht ihn nervös. Ungeduldig klammert er sich an die, von vielen Händen blank polierte Haltestange der Tür. Angeekelt zieht er schnell seine Finger zurück, denn etwas Klebriges hat sich zwischen Ring- und Mittelfinger gequetscht. Gedankenlos streift er das schleimige Etwas wieder an der Stange ab. Eine innere Stimme mahnt ihn, vorsichtig zu sein, sich zu beeilen. Wenigstens diesmal. Grossenbacher drückt im Sekundentakt auf den roten Halteknopf, als könne er so die Fahrt des Trams beschleunigen. Auf einmal ist er überzeugt, dass alles einen Zusammenhang hat, dass die Botschaften zusammen ein einziges Bild ergeben und eine eindeutige und klare Warnung darstellen. Da ist jemand, der sich für den neuen Tell hält oder sich wenigstens sehr eng mit der Kultfigur identifiziert. Aber was Grossenbacher weitaus mehr beunruhigt, ist, dass er absolut keine Idee hat, vor was oder wem die Zitate und Zeichen warnen sollen.
Um Zeit gutzumachen, befestigt Grossenbacher – obwohl er ganz genau weiß, dass es während der Fahrt verboten ist –, das Blaulicht auf dem Autodach und gibt kräftig Gas. Doch Grossenbacher ist nur ein mäßiger Fahrer und kommt daher kaum schneller vorwärts. Kurz überlegt er sich – er braust schon durch das Industriequartier von Leimbach –, ob er nicht auch die Sirene einschalten soll. Der Fahrtwind wirbelt durch seine unfrisierten Haare und kühlt angenehm den Nacken. Adliswil fliegt vorbei und mit knapp 110 überquert er die Gemeindegrenze von Langnau am Albis.
»Beim Bahnhof die Neue Dorfstrasse hoch«, hatte ihm Lüthi gesagt, »dann die nächst größere links und die zweite wieder links.« Beim Abbiegen von der Sihltalstrasse hat er das Gefühl, als würde der Wagen extrem unter- oder übersteuern. Grossenbacher hat keine Ahnung, jedenfalls schlingert der Wagen gefährlich nahe an der schwarz-gelb gestreiften Säule auf der Verkehrsinsel vorbei. Mit quietschenden Reifen biegt er in die Wildenbühlstrasse ein und kann nur knapp vor der herumstehenden Menschenansammlung das Steuer herumreißen. Grinsend imitiert Grossenbacher mit dem Zeigefinger Vettels Siegesgeste. Erst dann macht er das Blaulicht aus und klettert aus dem Wagen, wobei er sich in einer Hundeleine verheddert. Gereizt schimpft er los: »Ach, passen Sie doch auf. Merken Sie eigentlich nicht, dass Sie hier im Weg stehen und die Polizei bei der Arbeit behindern.« Dazu drückt er dem älteren Hundebesitzer seinen Polizeiausweis auf die randlosen Brillengläser.
Der Hundehalter, ein kleiner Mann mit Glatze, schaut ihn ganz erstaunt an, ganz so, als ob er noch nie einen Polizisten in Zivil gesehen hätte.
»Komm, Hedi, machen wir, dass wir nach Hause kommen.« Doch der Hund knurrt und bleibt stur, wo er ist. »So, komm jetzt!« Der Mann zupft an der Leine.
Mit einem noch breiteren Grinsen, das seine Coolness unterstreichen soll, stolziert Grossenbacher wie ein Gockel an den staunenden Nachbarn vorbei und lässt sich von einem uniformierten Polizisten, dem er ebenfalls seinen Ausweis unter die Nase hält, das rot-weiße Absperrband hochhalten, sodass er bequem quer über den Rasen zum Haus hinübergehen kann. Unangemeldet schnürt sich blitzartig sein Magen zusammen. Grossenbacher stöhnt laut auf, krümmt sich vor Schmerzen und geht in die Knie.
»Hallo!« Keuchend und mit schrägem, vom Schmerz verzerrtem Gesicht begrüßt Grossenbacher die anwesenden Polizisten. Wie damals beim Föhnsturm im Urnerboden, der ungebremst durch das enge Tal fegte und hohe Wellen gegen die Tellsplatte peitschte, schwappen die Magensäfte in Grossenbachers Bauch gegen die Magenwände. Im gleichen Augenblick, wie er sich vor Gesslers Hut krümmt, fällt ihm der zweite Grund für seine Tell-Aversion ein.
Es war während seiner Schulzeit, noch vor dem Gymnasium. Er kannte die Geschichte vom Nationalhelden nahezu auswendig, denn sein Großvater hatte sie ihm als kleiner Junge alle Jahre während der Sommerferien mindestens einmal erzählt. Aber das war nicht der Grund, warum er sie hasste, sondern es war wie immer, oder meistens, wegen eines Lehrers. Grossenbacher erinnert sich wieder genau. Jeden Mittag auf dem Schulweg saß der Oberstufenlehrer Utzinger auf seiner Vespa beim Zebrasteifen, der über die stark befahrene Hauptstraße führte, und beobachtete den Verkehr, gab den Verkehrskadetten, welche die Kleinen über die Straße lotsten, Anweisungen oder führte sich auf wie ein Pfau hoch zu Ross. Jeder Schüler, der an ihm vorbeikam, musste ihn grüßen.
»Guten Tag, Herr Utzinger!«, »Einen guten Appetit, Herr Utzinger!« oder »Auf Wiedersehen, Herr Utzinger!«, wenn man am Nachmittag nicht zur Schule musste.
Aber wehe, wenn man nicht grüßte, so zog er einem auf der Stelle die Ohren lang oder man wurde am Nachmittag ins Lehrerzimmer beordert, wo großzügig Kopfnüsse und Ohrfeigen verteilt wurden. Und einmal, als der Lehrer wegen einer Konferenz nicht an seinem Platz sitzen konnte, nahm die Grüßerei eine noch absurdere Form an. Utzinger hatte wohl einmal zu oft den Tell gelesen, denn wie zur Erinnerung hatte Utzinger seine Vespa neben den Zebrastreifen abgestellt und einen der Neuntklässler, der als Verkehrskadett normalerweise die Kleinen über die Straße winkte, beauftragt, darauf zu achten, dass die Schulkinder immer grüßten.
Grossenbacher erinnert sich, dass er als Knirps an einem solchen Tag einen Umweg von einer Viertelstunde oder länger in Kauf nahm, um die Vespa nicht grüßen zu müssen. Er hätte es nie fertiggebracht, Utzingers Roller respektvoll zu würdigen. Wie auch? Warum auch? Es war doch nur ein blöder Töff.
»Was ist mit Ihnen? Sie sehen ja ganz blass und bleich aus?«
Ein zweiter Polizist meint: »Was suchen Sie hier? Haben Sie nicht gesehen, dass der Zugang zu diesem Haus abgesperrt ist?«
»Nein, nein«, stöhnt Grossenbacher abwinkend. Jetzt spürt er sein Herz, es rast wie blöd. Kalter Schweiß steht auf seiner Stirn, den er mit dem Handrücken wegwischt. »Eh …, Sie sehen das etwas falsch.« Ächzend versucht er sich wieder aufzurichten. »Entschuldigen Sie, irgendetwas mit meinem Magen … ’tschuldigung, eh, ich bin Paul Grossenbacher von der Kripo – und mit wem habe ich die Ehre?«
»Ach, endlich! Wir haben schon den ganzen Vormittag auf Sie gewartet.« Einer der Männer macht einen Schritt auf ihn zu und streckt ihm zur Begrüßung die Hand entgegen: »Freut mich, mein Name ist John Locher, ich bin der Posten-Chef von Horgen.«
Grossenbacher erholt sich langsam vom Anfall und richtet sich mühsam auf: »Grossenbacher, freut mich.« Stöhnt er mehr, als dass er spricht, und schüttelt Locher die Hand. Ohne Locher richtig in die Augen zu sehen, denkt er: Welch ein Aufwand für einen Hut auf einer Stange. Drei Polizisten, Absperrband, der ganze Zirkus. Laut sagt er: »Wir hatten noch nie etwas miteinander zu tun, oder?«
»Nein, nicht dass ich wüsste!«
»Eh, ich meine, wir hatten noch nie etwas miteinander zu tun?«
»Bis heute nicht. Darf ich die anderen beiden vorstellen? Hier, Korporal Suter und die Gefreite Fehr ebenfalls vom Posten Horgen. Und da hinten, die Frau in Zivil, ist die Hausbesitzerin, Frau Daniela Wachter.«
Suter, ein hochgeschossener, 30-jähriger Mann mit eng zusammenstehenden dunklen Augen im hageren Gesicht. Seine Physiognomie erinnert Gossenbacher an einen Habicht. Grossenbacher hat auch ihn nie gesehen. Ganz anders der Eindruck, den er von der Gefreiten Fehr hat. Fast eben so groß wie Suter, aber athletisch. Ein etwas kleiner Kopf auf den breiten Schultern einer Schwimmerin. Hinter dem undefinierbaren runden Haarschnitt, der vor langer Zeit vielleicht so etwas wie ein rötlich-blonder Pony gewesen war, blitzen intelligente scharf beobachtende Augen aus einem hübschen Gesicht. Die ganze Erscheinung, leicht verruchte Schönheit gepaart mit Muskelpaketen gleicht einer Mischung aus Kate Moss und Arnold Schwarzenegger. Beinahe ein richtiger Kerl, wenn Brüste und Sommersprossen nicht gewesen wären. Die Hausbesitzerin beachtet er vorerst nicht.
»Gut. Ich bin so schnell ich konnte, hier hergefahren. Unser DC hat mich vor einer guten halben Stunde aufgeboten, da war ich noch im Seefeld beschäftigt.«
»Aber«, Locher versucht klarzustellen, »wir haben schon um viertel vor elf um Unterstützung aus Zürich angefragt. Da hat man uns gesagt, dass sie umgehend jemanden herschicken würden. Sind Sie das?«
»Wie’s scheint. Aber wenn ich nicht mehr gebraucht werde, so kann ich ja wieder weiter!« Grossenbacher wendet sich tatsächlich von Locher ab und macht ein paar Schritte auf die Bohnenstange zu, die genau mitten in die Rasenfläche eingeschlagen worden war. Dabei murmelt er: »Die Axt im Haus erspart den Zimmermann.«
»Wie, was sagen Sie?« Feldweibel John Locher folgt ihm auf den gepflegten englischen Rasen und versucht, aus dem Kriminalbeamten, den man ihm geschickt hat, schlau zu werden.
»Schiller!«
»Wer?«
»Schiller!«
»Was meinen Sie mit Schiller? Wer ist das? Wie kommen Sie auf so etwas?
»Da, Gesslers Hut auf der Stange, eben wie bei Friedrich Sch… – übrigens, ich bin Paul …«
»John. Paul, freut mich.«
»John wie Hans, oder?«
»Ich bin in Amerika geboren.«
»Schön! Wo war ich? – ah ja, ist dir übrigens aufgefallen, dass die Botschaften oder Drohungen, wie immer du willst, Zitate sind?«
»Wie meinst du?«
»Genau so, wie ich’s sage. Zitate eben. Auch von diesem Schiller.« Grossenbacher genießt das länger werdende Gesicht des Posten-Chefs und beschließt, die Katze nicht gleich aus dem Sack und den verdutzten Locher noch etwas zappeln zu lassen. Hatte ihn doch Locher beim DC mit seinen ungeduldigen Anrufen angeschwärzt. »Ja, kennst du denn Schiller nicht? Ist doch Allgemeinbildung, Schillers Wilhelm Tell. Liest doch heute jedes Kind in der Schule. Gut, vielleicht nicht in Amerika.«
»Du willst doch nicht allen Ernstes behaupten, dass das hier etwas mit diesem Schiller zu tun hat, oder etwa schon?«
»Genau!«
»Wenn das so ist, so müssen wir mit ihm reden. Woher kennst du ihn?«