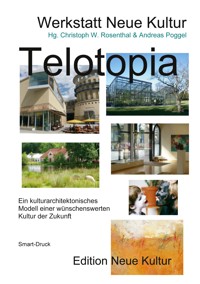
Telotopia E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Telotopia ist ein kulturarchitektonisches Modell einer sozial stabilen & gerechten, ökologisch nachhaltigen, kulturreichen und wünschenswerten Kultur der Zukunft. Dieser Entwurf basiert auf Einsichten in die humanevolutionäre und kulturgeschichtliche Entwicklung, auf Beispielen historisch-ethnologischer Kulturen wie auf humanwissenschaftlichen Erkenntnissen wie u.a. der Psychologie und Pädagogik. Dabei geht es nicht um eine bloße utopische Fantasie. Die Verwirklichung einer Kultur in der Art von Telotopia erscheint real möglich, im Grunde sogar relativ leicht, sofern sie ein entsprechendes Interesse findet. Darüber hinaus soll dieses kulturarchitektonische Modell den neuen Wissenschaftszweig der >Telotopistik< begründen. Es geht um die Einsicht, dass eine gesellschaftliche Entwicklung nur dann ein gewolltes und funktionsfähiges Ergebnis finden kann, wenn sie nicht vager und ungeklärter ist als ein Bauplan für ein gängiges Einfamilien-Haus. Auch in der gesellschaftlichen Anlage gibt es viele Strukturen, die heute geplant werden müssen, aber auch wünschenswert geplant werden können. Das vorliegende Modell soll anregen, ein kulturarchitektonisches Verständnis dieser Strukturen für eine wünschenswerte Kultur der Zukunft zu entwickeln. Die >Werkstatt Neue Kultur< dient in Diskussion und Praxis der Entwicklung einer neuen Kultur. Ihr Mitarbeiter Christoph W. Rosenthal, unter dessen Federführung dieses Werk entstand, ist freier Historiologe und Kulturologe. Er veröffentlichte einige Bücher zu Humanevolution, Geschichte, Kulturologie, Sprache usw.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Werkstatt Neue Kultur
Projekt- und Bildungs-Werkstatt für eine neue Kultur
Die festen Mitarbeiter:
Andreas Poggel: Mediation & Gewaltfreie Kommunikation Christoph W. Rosenthal: Projekte – Forschung – Kunst
www.werkstatt-neue-kultur.net
Aufriss
Eine wünschenswerte Kultur der Zukunft.
Der grandiose Vorteil, den wir heute bei allen Schwierigkeiten haben, besteht darin, dass wir uns nicht mehr mit historisch entstandenen Verhältnissen und Vorstellungen wie der Welt als Scheibe abfinden müssen. Mit dem Überblick über die Geschichte und die Humanevolution bis weit über die Primaten hinaus ist es inzwischen möglich, die entstandenen Irrtümer und Irrwege zu verstehen, und wir verfügen sowohl in menschlich-sozialer als auch in technisch-ökonomischer Hinsicht inzwischen über genügend Potential für eine wünschenswerte Kultur der Zukunft.
So manche haben damit schon privat und in kleineren Kreisen begonnen. Auch wir experimentieren auch persönlich seit längerer Zeit damit und können inzwischen auf einige Erfahrungen und Einsichten aufbauen. Es ist gut, wenn bestehende Freiräume und Möglichkeiten für Entwicklungen einer wünschenswerten Kultur der Zukunft genutzt werden.
Doch damit dies jedoch nicht bloß auf eine Ausbildung eigener Privilegien hinausläuft, worin schließlich ein Grund der historischen Problematik liegt, ist es von Bedeutung, eine Idee zu entwickeln, was eigentlich eine wünschenswerte Kultur im gesellschaftlichen Gesamtbestand ausmachen würde.
Jenseits des Privaten braucht es auf jeden Fall eine kulturarchitektonische Auseinandersetzung, wohin die gesellschaftliche Entwicklung eigentlich führen soll. Die bloße Idee, dass es >toll< werden soll, reicht nicht einmal für den Bau eines hier gängigen Einfamilien-Hauses.
Eine solch kopflose „Praxis“ reichte schon in der humanevolutionären Entwicklung nicht mehr. Darin unterschied sich der Mensch vom Tier.
Die humanevolutionäre Entwicklung wurde allein durch eine allgemein als wünschenswert betrachtete Kulturkonzeption möglich, und die historischen Probleme haben einen wesentlichen Grund darin, dass sich die „Praxis“ verselbständigte.
Doch angesichts der Komplexität des menschlichen Gehirns schafft nur eine Kultur, die auf gemeinschaftlicher Kommunikation basiert, eine soziale Stabilität auf wünschenswertem Niveau über Jahrzehntausende. Exakt in dieser Entwicklung lag das Erfolgsgeheimnis der humanevolutionären Entwicklung mit ihrem Resultat in unserer Art Homo sapiens. Alles andere „nach den Schimpansen“ verfiel dem Scheitern.
Es braucht für eine wünschenswerte Kultur der Zukunft einen kulturarchitektonischen Bauplan, in dem die statischen Anforderungen der menschlichen Anlage an Verhalten und Bedürfnissen im Gesamtgefüge in einer kommunizierbaren Form verarbeitet sind. Es müssen – und dürfen auch gar - nicht sämtliche Einzelheiten geklärt werden. Entscheidend ist die sachliche wie auch die soziale Klärung der kulturarchitektonischen Grundzüge und Verfassung.
Telotopia ist als Einstieg in die Entwicklung einer entsprechenden kulturellen Architektur an Konzeptionen und Praxis gedacht. Es gibt bereits einiges Potential an Wünschenswertem, wie vielleicht die beigefügten Fotos illustrieren können.
Die entstandene gesellschaftliche und menschliche Konfusität muss nicht sein. Der Bau einer Neuen Kultur ist möglich!
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Zu den Grundlagen von Telotopia
1.1 Kultur, Utopie und Telotopistik
1.2 Die Utopie darf nicht vorweg entschieden werden
1.3 Zu den allgemeinen Grundlagen der Telotopistik in Humanevolution, Geschichte und Ethnologie
1.4 Zu der Konzeption von Telotopia
1.5 Zu dem Charakter dieses Werks
1.6 Zum Aufbau dieses Werks
1.7 Das Grundgesetz der Verfassung von Telotopia
Telboro - Ein Modell einer Boro
2.1 Zur Bevölkerungsgröße und Altersstruktur von Telboro
2.2 Zur Versorgung einer Boro
2.3 Die Boro-Konzeption
2.3.1 Zu dem Wort
Boro
2.4 Die Anlage von Telboro
2.4.1 Das Zentrum von Telboro
2.4.2 Das Stadtgebiet von Telboro
2.4.3 Das ländliche Gebiet von Telboro
Zur biographischen Struktur in Telotopia
3.1 Zur Bedeutung kindgerechter Verhältnisse
3.1.1 Das Sozialisations-Modell von Erik H. Erikson
3.1.2 Die kulturelle Architektur der Lebensalter
3.1.3 Zu dem Charakter der biographischen Architektur
3.2 Die Kindheit
3.3 Pubertät und Jugend
3.4 Die Erwachsenen-Zeit
3.5 Das Alter
Die Gesamtanlage von Telotopia
4.1 Die Boros u. ihre weltweite Netzwerk-Organisation
4.2 Die gewohnheitsrechtliche Verankerung der Organisation von Telotopia
4.3 Zu den Institutionen
4.3.1 Der nähere organisatorische Aufbau einer Boro
4.3.2 Die Fach-Institute
4.3.3 Die politische Ebene: Verwaltung und Entscheidungs-Strukturen
4.3.4 Produktion, Arbeit und Ökonomie
4.3.5 Zu dem Verkehrswesen von Telotopia
4.3.6 Die juristische Konzeption Telotopias
4.4 Die übergeordnete Organisation
4.4.1 Die regionale Anlage der Boro
4.4.2 Die technischen und die urbanen Funktionszentren
4.4.3 Die Gesamtorganisation von Telotopia auf der Weltebene
Lexikon
Literatur
Architektonische Planung (Auszug)
Vorwort
Mit Telotopia möchten wir von der >Werkstatt Neue Kultur< anhand eines kulturarchitektonischen Beispiels veranschaulichen, was >Neue Kultur< für uns im gesamtgesellschaftlichen Ergebnis in etwa meint.
Es geht bei >Telotopia< und >Neuer Kultur< um eine menschheitsgeschichtliche Perspektive. >Kultur< war die neuartige menschliche Dimension der humanevolutionären Entwicklung in Persönlichkeit, Sozial- und Beziehungs-Leben samt aller Kreativität und Lebens-Qualität. Sie entstand durch die Ablösung von der genetischen Verhaltenssteuerung aufgrund von Sprache, Kommunikation und Selbst-Steuerung.
Mit >Neuer Kultur< geht es um die Verarbeitung der historischen Entwicklung sowohl von Fortschritt als auch den verschiedenen Folgen des Verlusts an Kultur, wie er sich an Sexismus, Rassismus, Gewalt, Macht, sozialen Hierarchien, Ausbeutung und Barbareien bis hin zu Sklaverei, Diktatur, Faschismus und Krieg zeigt. Alle diese Problematiken sind mitnichten ein Relikt der Evolution oder der Natur des Menschen – ganz im Gegenteil -, sondern die unabdingbare Folge einer unzureichenden oder unfähigen Installation der menschlichen Software namens >Kultur<, insbesondere bei der Betriebssystem-Ebene von Verhaltenssteuerung, Bewusstseins-Entwicklung und Kommunikation.
Im Grundlegenden ist das Problem des Verlusts an Kultur in den Jahrhunderte langen gigantischen Naturkatastrophen am Ende der Eiszeit aufgekommen. Dies hat viele Folgewirkungen – letztlich bis heute – nach sich gezogen. Doch gibt es inzwischen an sich genügend Nahrung, Produkte, Dienstleistungsangebote und Produktionsmöglichkeiten. Wie schon in den 1830ern festgestellt wurde, resultiert das ökonomische Problem aus dem Überangebot. Woran es in Wirklichkeit
mangelt, ist, was von der kulturalen Anlage unserer Art Homo sapiens >Kultur< im Eigentlichen meint: ein fähiges Beziehungs- und Sozial-Leben sowie den zureichenden persönlichen Erwerb der Befähigung dazu, wie nicht zuletzt zu einer wirklichen und menschlich zureichenden Kommunikation.
Die >Werkstatt Neue Kultur< möchte für die Entwicklung einer neuen Kultur Beiträge schaffen. Mit >Telotopia< geht es um einen kulturarchitektonischen Entwurf, wie eine wünschenswerte Kultur der Zukunft aussehen könnte. Die Fragestellung ist in diesem Zusammenhang erst einmal nicht, wie dieser Entwurf angesichts der politischökonomischen Gegebenheiten umgesetzt werden könnte. Zunächst muss es um Klärungen gehen, was man über die verschiedenen Einzelmomente hinaus realistisch als >wünschenswert< versteht. Es bedarf zunächst einem allgemeiner geklärten Bauplan einer Neuen Kultur.
Das vorliegende Modell kann für die unterschiedlichsten Projekte von effektiver Relevanz sein. Es kann auf eine neue Weise zeigen, dass die unterschiedlichsten Projekte eine Bedeutung für die Entwicklung einer >wünschenswerten Kultur der Zukunft< haben und auch welche. Es kann zur Vernetzung der unterschiedlichsten Ansätze beitragen, auch wenn man im Konkreten völlig unterschiedliche Wege verfolgt. Wie ein architektonischer Bauplan eines Großprojektes kann eine entwickeltere kulturelle Architektur aufzeigen, wo die unterschiedlichsten Standorte und Wege einstmals zusammenlaufen. Von dort her wird das Anliegen etlicher Projekte und Personen weit verständlicher.
Ganz in diesem Sinn möchte die >Werkstatt Neue Kultur< diese Auseinandersetzung durch Austausch, Netzwerken, Vorträge, Veranstaltungen usw. weiter fördern und entwickeln. Es gibt dazu noch weitere Projekt-Ideen.
Das vorliegende Werk ist nur als ein Anfang zu sehen. Leider können wir im Moment noch keine bessere Ausstattung dieses Buchs anbieten. Wir verfügen wohl über weit mehr und besseres Bildmaterial, aber nicht über die Rechte, es hier zu verwenden.
Doch im Moment geht es erstmal darum, mit solchen Auseinandersetzungen zu beginnen. Für diesen Zweck möchten wir unterschiedliche Fassungen anbieten, jeweils in zwei Formaten, Längen und Druckqualitäten. Bei der vorliegenden Version handelt es sich um die ungekürzte Ausgabe. Noch einmal deutlich billiger wird diese Fassung durch den Smart-Druck. Allerdings ist die Druckqualität auch nicht so gut.
Bei entsprechender Resonanz sind ergänzende Veröffentlichungen denkbar und auch Absicht. Vorstellbar wäre vor allem ein Buch über Projekte und Personen, die bereits im Sinne von Telotopia arbeiten. Kontaktiert – kontaktieren Sie uns und schickt / schicken Sie uns Fotos und inhaltliche Materialien.
Die vorliegende Abfassung geht auf die Kappe von C. Rosenthal.
Für die Werkstatt Neue Kultur
Christoph W. Rosenthal & Andreas Poggel
Persönliche Bemerkungen
Christoph Rosenthal
Als Initiator und Anleiter der Gespräche um Telotopia in der >Werkstatt Neue Kultur< sowie als Verfasser bzw. Endredakteur dieses Buchs möchte ich hier kurz voranstellen, wie ich zu diesem Projekt gekommen bin. Denn dies hat inzwischen schon eine längere Geschichte.
Meine explizite Auseinandersetzung mit dem Thema Utopie begann in dem Kontext, dass wir Ende März 1980 in Göttingen eine 8er WG (Wohngemeinschaft) gründeten. Darüber bekam ich recht schnell Zugang zu den verschiedensten Alternativ-Projekten wie etwa zu einem Verlag, zu Zeitungen und einer Reihe an Kontakten. Wenn auch vieles damals noch nicht ausgegoren war, stellten sich mir dabei doch Perspektiven dar, die ich lohnend fand. Da ich dafür realistische Möglichkeiten sah, entschied ich mich im Sommer 1981 zu einem entsprechenden freien Leben.
Allerdings hielt dieser damalige Trend in dieser Form nicht zu lange an, und so war auch ich nach der Zeit des Studiums mit vielfältigen Anforderungen wie nicht zuletzt in Bezug auf die ökonomische Perspektive konfrontiert. Wenngleich die Auseinandersetzung mit der Utopie für mich inhaltlich wie auch praktisch von Bedeutung blieb – etwa dass ich mir in den 1990ern für etwa 4 Jahre die Zeit für Kurse und Experimente in Kunst und Theater nahm -, kam ich doch erst Ende der 90er dazu, mich damit zu beschäftigen, wie für mich gesellschaftlich meine Utopie aussehen könnte. Bis dahin war für mich u.a. das Buch >Ökotopia< eine Anregung gewesen. Bei der Arbeit an einem eigenen Entwurf stellte ich jedoch fest, dass die Auseinandersetzung um >Utopie< für mich inzwischen zwei verschiedene Dimensionen enthielt. In beiden Hinsichten fand ich das Buch >Ökotopia< nicht mehr befriedigend.
Die eine Dimension stand mit meinem persönlichen Lebensweg in Verbindung. Dies bezog sich vor allem auf die Bereiche Beziehung, Kunst/Kulturelles und Wohn- oder Lebensgemeinschaft. Da ich diesen Lebensweg jedoch schon 1980 aufgenommen hatte, stellte sich diese Dimension von Utopie nach fast 20 Jahren (und heute nach über 40 Jahren) doch recht anders dar als am Anfang. Es war nicht mehr der Blick aus der Ferne, der sich beliebig mit Fantasien ausschmücken ließ, sondern längst ersichtlich, wie sehr alles an den jeweiligen Personen und Gegebenheiten hing. Da es nicht meine Utopie war, sie auf Kosten Anderer zu verwirklichen, vor allem nicht in Hinsicht auf eine Beziehung, gerät man doch bei allem Vorhaben recht schnell in die Grenzen (etwa an Zeit und Geld), wie sie hier allgemeiner bekannt sind. Meine Erfahrungen fließen wohl in die vorliegende Konzeption ein. Doch um diese Dimension soll es hier nicht gehen.
So wurde ich auf die andere Dimension des Themas aufmerksam. Ich bemerkte bei der Skript-Arbeit, dass das, was mich in Bezug auf >Utopie< interessierte, der Entwurf eines real möglichen Modells einer wünschenswerten Kultur der Zukunft war: die Entwicklung einer kulturellen Architektur, die sich analog zu der Architektur von Bauwerken mit der gesellschaftlichen Anlage befasst.
In dieser Form entstand im Frühjahr 1998 der erste Entwurf. Er enthielt schon die Kern-Elemente des jetzigen Entwurfs, war aber noch deutlich anfänglicher. Demgegenüber erreichte ich mit dem zweiten Entwurf vom Winter 2009/2010 schon ein anderes Niveau. Er hieß auch schon Telotopia und enthielt die wesentlichen Grundzüge der jetzigen Fassung. Doch wollte ich vor einer Veröffentlichung meine Arbeiten zu Humanevolution und zu Geschichte – die hierfür eine gewisse Grundlage stellen (↔ S. →) – erst noch weiter qualifizieren, was sich noch länger als erwartet hinziehen sollte. Wie noch in der Einleitung etwas ausführlicher aufgenommen werden soll, bin ich von den Ergebnissen meiner Forschungen her der Auffassung, dass die Entwicklung einer wünschenswerten Kultur mit einer dauerhaften sozialen Stabilität in Frieden, Selbstbestimmung und voller Lebens-Qualität immer noch eine echte menschliche Möglichkeit ist, ja in gewisser Weise überhaupt erst heute: erstmalig mit einer dauerhaften Zukunfts-Perspektive.
- CR -
1 Einleitung
Zu den Grundlagen von Telotopia
1.1 Kultur, Utopie und Telotopistik
Das Thema Utopie war angesichts der kulturalen Anlage des Menschen von je her von grundlegender Bedeutung und als Bestandteil der Mythologie immer schon ein zentrales und entscheidendes soziales Element von Kultur. Freilich wurde es historisch von Anfang an in der neuen politischen Ideologie und der späteren ökonomischen Werbung vereinnahmt und verdreht. In gewisser Weise ist das heutige Ausmaß an utopischen Bildern in der ökonomischen und politischen Werbe-Propaganda zu einem grundlegenden Problem geworden, das die unbefriedigten Bedürfnisse für sich instrumentalisiert und über die tatsächlichen Problematiken hinwegtäuscht.
Doch zunächst bleibt festzustellen, dass sich schon die humanevolutionäre Ausprägung unserer Art Homo sapiens ausschließlich durch eine vorausgehende Utopie menschlich zugewandter und fähiger Sozialverhältnisse erklärt. Anders wäre man über die sozialen Probleme der genetisch ererbten Verhaltensformen nicht hinausgekommen, mit denen die evolutionär vorausgehenden Hominiden trotz ihrer großen technischen Intelligenz und ihrer weiten Verbreitung über die Welt komplett dem Aussterben verfielen. Es brauchte eine motivierende Zielvorstellung eines produktiven Beziehungs- und Sozial-Lebens, die genügend Zuspruch fand. Erst mit einer >Utopie<, die genügend Verstehen für ein erstrebenswertes Leben und Verhalten bot, wurde es im humanevolutionären Prozess möglich, über die ererbten Sozialverhältnisse und Verhaltensformen hinauszukommen, die evolutionär im Ruin endeten.
Diese Utopie entstand aus der ursprünglichen Mythologie. Es waren die Geschichten für die Kleinkinder, aus denen die soziale Utopie folgte. Wenn diese Geschichten, ganz wie es die Kleinkinder hören wollten, von der >Ur-Mutter Mond< erzählten, die extra für sie diese Welt zwecks Glücks und Liebe geschaffen habe, so boten diese Geschichten den Erwachsenen auch selbst die Idee, dass Besseres möglich ist, als sich wie die Hominiden mit ständigen Konkurrenzkämpfen gegenseitig das Leben schwer zu machen und letztlich auch zu ruinieren.
Anders als die sonstigen biologischen Prozesse der Evolution erklärt sich die Humanevolution nicht von den Naturprozessen her. Es ging in ihr ja um die Ablösung von den biologischen Mechanismen der genetischen Verhaltenssteuerung. Der evolutionäre Erwerb der Befähigung zur Selbststeuerung war ausschließlich aufgrund einer gemeinschaftlich bestimmten Kultur und Zielsetzung möglich. Den ersten Anhalt dafür boten die mythologischen Geschichten, die die Kleinkinder aufgrund der sprachlichen Weiterentwicklung zu hören wünschten. Ihre Motive von Zuwendung, Solidarität und einem >guten Leben< stellten die Grundlagen der ursprünglichen Utopie.
Hierbei kann man das Verhältnis von Utopie und Telotopistik ganz in der Art eines architektonischen Vorhabens sehen. Dieses Vorhaben beginnt mit der Utopie. Die Utopie löst das Vorhaben aus. Sie tritt bei komplexeren Vorhaben als erster Ausdruck eines wirklichen Vorhabens heraus und begründet den Klärungsprozess bzgl. seiner Fantasien usw. Es ist in sozialen Kontexten gut und auch wichtig, zunächst einmal diese rein subjektive Dimension seiner Wünsche, Bedürfnisse und Fantasien zu erschließen, ohne immer sofort an die Machbarkeit zu
denken, die freilich auch nicht aus dem Blick geraten sollte. Je besser man seine Wünsche und Bedürfnisse in Bezug auf die Ziele verstanden hat, desto näher kann man ihnen in den Ergebnissen kommen, selbst wenn man nicht alles (sofort) verwirklichen kann.
Genauso spielt eine Architektur zunächst mit Fantasien. Ist hierbei ein bestimmtes Leitmotiv oder Modell deutlich geworden, kommt es in der Architektur zu dem zweiten Schritt, diese Ideen zu einem realen Bauplan auszuarbeiten. Ganz in dieser Art kann hier die Telotopistik als kulturelle Architektur begriffen werden. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass sie sich auf eine oder wie hier auf die gesellschaftliche Anlage im Weltverhältnis bezieht.
Allerdings haben wir es bei der gesellschaftlichen Anlage heute noch mit einer eigenen Dimension zu tun. Die Frage, wie solch ein kulturarchitektonisches Gesamtmodell einer wünschenswerten Kultur der Zukunft in politisch-ökonomischer Hinsichtverwirklicht werden könnte, muss als eine gänzlich eigene Auseinandersetzung gesehen werden. Sie ist auf jeden Fall ausdrücklich nicht Bestandteil dieses Buches.
Ob die Auseinandersetzung mit der politisch-ökonomischen Verwirklichung perspektivisch als Bestandteil einer Telotopistik eingeordnet oder besser als eigene Dimension unter einem eigenen Begriff oder auch als Teil der Politologie aufgenommen wird, wäre noch zu sehen. Dies könnte auch von der Art der Entwürfe abhängen.
Doch bei dem, worum es bei Telotopia und einer entsprechenden Telotopistik als Wissenschaft der kulturellen Gesellschaftsarchitektur gehen soll, wäre es für eine Auseinandersetzung um die politisch-ökonomische Verwirklichung noch zu früh. Die Konzeption von Telotopia ist nicht darauf angelegt, ein Modell zu stellen, das mit hehren Vorstellungen von >oben< der Bevölkerung übergestülpt werden soll, wie dies seit den vermeintlichen „Hochkulturen“ mit entsprechenden Fehlentwicklungen bis heute der Fall war.
Die Zielvorstellung von Telotopia, eine menschlich-demokratische Kultur zu bauen, hat die Voraussetzung, zuerst einmal - genau wie bei einem Hausbau – ein reales Modell dieser Ziele zu entwickeln, um entsprechende Auseinandersetzungen über diese Ziele zu ermöglichen. Die bloße Absicht, dass es >toll< werden soll, reicht nicht einmal für den Bau eines hier gängigen Ein-Familien-Hauses, und wenn man einen solchen Bau damit beginnt, ohne jeden Plan Material dafür im Baumarkt zu besorgen, ist das tatsächliche Ergebnis schon klar. Im besten Fall kommt eine Hütte dabei heraus, doch leicht auch nichts als Chaos. Mit solchen Herangehensweisen an die gesellschaftliche Gestaltung wäre man besser in der Altsteinzeit verblieben. Auch da reichte dies wohl nicht mehr für ein fähiges Sozialleben, führte aber wenigstens nicht ins sozioökonomische Chaos.
1.2 Die Utopie darf nicht vorweg entschieden werden
Der Auffassung, dass die Utopie nicht vorweg entschieden werden kann und darf, kann hier nur uneingeschränkt zugestimmt werden. Denn alle Personen aller Generationen haben das Recht, ihre Verhältnisse und ihre Art zu leben in gemeinschaftlicher Kommunikation selbst zu bestimmen. Dies ist sogar bei unserer Anlage als Homo sapiens eine unabdingbare Notwendigkeit, will man seine Verhältnisse nicht aus dem Griff verlieren. Der Mensch ist seit seiner humanevolutionären Ablösung von der genetischen Verhaltenssteuerung auf eine fähige Selbststeuerung in gemeinschaftlicher Kommunikation angelegt. Wo dies nicht erreicht wird, sondern dies auch noch autoritär (mit entsprechenden Ideologien aller Art) ausgeschaltet wird, schafft dies bald gesellschaftlich noch verheerendere Folgen als hohe Trunkenheit am Steuer, wie es das 3. Reich in jeder Hinsicht noch einmal drastisch vorgeführt hat.
Doch bestand in der Tat das Problem, dass die meisten utopischen Entwürfe der Vergangenheit auf eine mit Gewalt verbundene autoritäre Steuerung oder Verwirklichung ausgerichtet waren, wie von daher auch Revolutionen schnell in Diktaturen umschlugen.
Dieser Einspruch gegen solche utopischen Entwürfe ist wohl so weit richtig. Nur gibt es dabei zweierlei zu bedenken. Das Erste ist, dass auch die bestehenden Verhältnisse auf einem am Ende der Eiszeit (vor ca. 12.000 Jahren im Nahen Osten) vorgegebenen Fundament von Sitten, Gesetzen, Besitz, Sprache usw. aufbauen, was bis heute bestimmend wirkt. Ganz ohne Zweifel hat die historische Entwicklung von Fortschritt in diesem Fundament ihre Ursache – aber ebenso auch die Entwicklung von Macht und Gewalt bis hin zum Faschismus und den Weltkriegen usw. (Das hat aber auch nicht das Geringste mit der Evolution zu tun, wie man früher angesichts gänzlich anderer Daten annahm).
Wohl bot die neue autoritär-mythologische begründete Sozialorganisation (zuerst namens >Stamm<) in den Chaosproblemen der gigantischen Naturkatastrophen am Ende der Eiszeit zunächst eine Sicherung an Versorgung und im Sozialleben. Es bedeutete im ersten Schritt im sozialen Engagement einer Elite eine Lösung der entstandenen Probleme. Von einem >Eingriff in die Selbststeuerung< konnte in dieser Situation keine Rede sein, war hier diese Steuerung durch die Naturkatastrophen aus dem Griff geraten. Doch so sehr dieses neue autoritär-mythologische Fundament im ersten Moment ersatzweise das Überleben und eine neue soziale Stabilität zu organisieren verstand, schlug es mit der Zeit angesichts der menschlichen Anlage notwendigerweise um. Insbesondere die Formen der Jugend-Initiation, die ursprünglich der Entwicklung der persönlichen Selbständigkeit dienten (der Ausbildung des Ichs in der Ablösung von Es und Über-Ich), wurden hier so verdreht, dass hier erst recht die Über-Ich-Strukturen in einem Anpassungsverhalten verankert wurden (Milgram: Gehorsamsbereitschaft).
Bei solchen Verhältnissen bedeutet der Verzicht auf kulturarchitektonische Entwürfe weder Freiheit noch Demokratie, sondern zumindest de facto ein Votum für die bestehenden Macht-Verhältnisse, die immer mit einem Eingriff in die Selbstbestimmung der Persönlichkeit verbunden sind, wenn nicht Ärgeres.
Es geht bei den kulturarchitektonischen Entwürfen der Telotopistik gerade nicht wie bislang um Entscheidungen zu Verhältnissen, die in die Selbstbestimmung der zukünftigen Generationen eingreifen – wie dies allein schon mit dem übermäßigen Verbrauch an Ressourcen und dem Anhäufen von Müll der Fall ist.
Vielmehr geht es ganz im Gegenteil um die Auseinandersetzung, was es an Verhältnissen braucht, um möglichst dauerhaft das Selbstbestimmungsrecht aller Menschen zu gewährleisten – wenn auch unter Berücksichtigung der Realität, die man hier gerne außer Acht lässt. Es geht also um Entwürfe, die eine wirkliche, volle und dauerhafte Verwirklichung der Menschenrechte und von Demokratie ermöglichen könnten. Denn nach den Einsichten in die humanevolutionäre Entwicklung können allein Verhältnisse, die der menschlichen Natur entsprechen (> Anthropologie) und auf der Basis gemeinschaftlicher Kommunikation gesteuert werden, auf die Dauer dem sozialen Ruin entgehen. Diktatorische Formen sind dazu angesichts der überaus komplexen neurologischen Anlage des Menschen einfach nicht qualifiziert.
Der Verzicht auf eine kulturarchitektonische Auseinandersetzung und Planung zeitigt noch gravierendere Folgen als ein Verzicht auf einen Bauplan bei dem Bau eines gängigen Ein-Familien-Hauses, was demgegenüber doch sehr simpel ist. Die Schuldenberge der öffentlichen Haushalte sind ebenso zwangsläufig, wie wenn man ohne eine reale Vorstellung mit dem Bau eines heutigen Hauses beginnt.
Es geht nicht um ein Zurück zur Natur, sondern vielmehr um das Zurück zu Kultur. Denn es kam am Ende der Eiszeit mit Folgen bis heute zu substanziellen Verlusten an Kultur, worin sich bei uns Homo sapiens die Probleme von Macht und Gewalt begründen.
Will man diese gesellschaftlich und ökologisch ruinösen Entwicklungen lösen, braucht es eine kulturelle Architektur. Dies ist einerseits aus den positiven Einsichten in die menschliche Anlage (Anthropologie mit Psychologie, Neurologie usw.) und andererseits negativ (in dem, was zu vermeiden ist) aus den Einsichten in die Ursachen und Hintergründe der historischen Problematiken zu entwickeln. M.E. gibt es genügend Anhalte, die für eine wünschenswerte Kultur der Zukunft fruchtbar gemacht werden können.
1.3 Zu den allgemeinen Grundlagen der Telotopistik in Humanevolution, Geschichte und Ethnologie
Der Ansatz meiner Forschung verknüpfte sich sozusagen von je her mit folgendem Fragenkomplex:
Von woher erklären sich die historischen Probleme bis hin zu Faschismus und den Kriegen?
Von welchen Gegebenheiten ist in Bezug auf den Menschen auszugehen?
Wie sähen wünschenswerte Verhältnisse für mich persönlich wie im gesellschaftlichen Gesamtkontext aus und wie ließe sich dies jeweils verwirklichen?
Insgesamt haben mich schon seit meiner Kindheit Berichte über andere Länder und Kulturen, Kunst- und Geschichts-Museen sowie Kulturelles, Biographien und Psychologie interessiert. Denn es war von etlichen Eindrücken (eines mangelnden sozialen Verhältnisses zu uns Kindern) wie auch von partiellen positiven Erfahrungen her schon sehr früh meine Sicht, dass ein besseres und interessanteres Sozialleben als das bestehende möglich und auch nötig ist. Von meiner Herkunft her fand ich die ersten guten Anhalte zunächst im christlichen Kontext, und von daher begann ich zwecks einer Gemeinde-Arbeit mit dem Studium der Theologie. Doch sowohl von den praktischen Erfahrungen als auch von den Auseinandersetzungen her verlagerte sich dies bei mir in den Forschungen in die Bereiche Geschichte, Ethnologie und Anthropologie + Humanwissenschaften.
„Die vergleichende Perspektive [der Kulturanthropologie] bringt auch eine Berücksichtigung der zeitlichen Dimension mit sich. Das heißt, sie besteht darauf, dass wir, um die industrialisierten, staatlich organisierten Gesellschaften der Gegenwart zu verstehen, mit dem vertraut sein müssen, was ihnen vorhergegangen ist; wir müssen also die staatenlosen, nichtindustriellen Gesellschaften kennen, aus denen sich die modernen Gesellschaften entwickelt haben.
Uns steht eine einigermaßen vollständige Dokumentation der Gattung Mensch zur Verfügung, die zeitlich fast fünf Millionen Jahre zurückreicht. Die ersten Bodenbau treibenden Gesellschaften traten erst vor ungefähr 10.000 Jahren [eher vor 11.500 Jahren] auf, die ersten staatlich organisierten Gesellschaften erschienen erst vor etwa 6000 Jahren; und die Industriegesellschaft hat erst vor 200 Jahren begonnen, sich im großen Maßstab durchzusetzen. Sicherlich können wir nicht hoffen, uns selbst zu verstehen, wenn wir die Berichte über die früheren Lebensformen ignorieren. [...] Man kann z.B. die Ausübung von Herrschaft in modernen politischen Institutionen nicht völlig verstehen ohne einige Vertrautheit mit Gesellschaften, in denen es keine politische Herrschaft gibt und formale Institutionen der Rechtspflege fehlen. […]
Zweitens ist die Anthropologie holistisch in dem Sinn, dass sie den Versuch macht, die Menschen nicht nur als kulturelle Wesen, sondern auch als biologische Wesen1 zu verstehen. Sie befasst sich mit den physischen oder biologischen Charakteristika der Gattung ebenso gut wie mit den sozialen und kulturellen. Die physische Evolution der Gattung Homo und die kulturelle Evolution der Menschheit werden nicht als zusammenhangslos nebeneinander laufend betrachtet. Beide sind nötig für ein richtiges Verständnis davon, was für eine Art von Geschöpfe wir sind.“
Frank Robert Vivelo: Handbuch der Kulturanthropologie,
S. 39, 41
Ganz entsprechend basieren die Grundlagen der vorliegenden Konzeption auf Erkenntnissen aus diesen Bereichen, wie ich sie inzwischen in etlichen Büchern dargestellt habe.
Insgesamt ist zu sagen, dass sich die uns bekannten menschlichen Problematiken in Gesellschaft, Kultur und Verhalten nach den heutigen Einsichten eindeutig aus der historischen Entwicklung und nicht von der Humanevolution und der eiszeitlichen Kultur des Homo sapiens her erklären, wie man früher meinte.
Nach neueren Einsichten erklärt sich die Humanevolution durch die Entwicklung von Kommunikation und Kultur als dem Sachverhalt fähiger Sozial- und Beziehungs-Verhältnisse, vgl. z.B.:
„In jüngster Zeit hat eine Serie neurobiologischer Beobachtungen ein neues Bild entstehen lassen. Es beschreibt den Menschen als ein Wesen, dessen zentrale Motivationen auf Zuwendung und gelingende menschlichen Beziehungen gerichtet sind. […] Wir sind – aus neurobiologischer Sicht – auf soziale Resonanz und Kooperation angelegte Wesen. Kern aller menschlichen Motivation ist es, zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu finden und zu geben.“ 2
Dies aber kann noch nicht mit der Evolution von Technologie und technischer Intelligenz vor ca. 2,5 Mio. Jahren verbunden werden. Hierbei handelt es sich vielmehr um die evolutionäre Stufe der Hominiden, die noch auf der genetischen Verhaltensanlage der Tiere basierte. Auf dieser Stufe ist es mit der Zeit zu Verschärfungen im Sozialleben gekommen.
Die Evolution von Technologie und technischer Intelligenz vermochte wohl die fundamentalen evolutionären Probleme in dem geologischen Umbruch vom Pliozän auf das Pleistozän vor 2,5 Mio. Jahren bewältigen. In diesem Umbruch gingen die Regenwälder in Afrika überaus beträchtlich zurück, dass hier Zweige der Menschenaffen ganz anders der Sonne und dem sehr andersartigen Leben in der Savanne ausgesetzt waren.
Die Entwicklung der Zweibeinigkeit,3 die Umwandlung vom Fell zur Haut (mit Schweißdrüsen zur Kühlung) sowie eine neue Handfertigkeit und die Entwicklung von Werkzeugen stehen in diesem Zusammenhang. Unter solchen Notstandsproblemen war diese evolutionäre Entwicklung zu und unter den Hominiden auch höchst leistungsfähig. Doch ohne diese äußere Beanspruchung führten die freien Energien nach dem evolutionären Umbruch angesichts der bestehenden genetischen Verhaltensanlage zu einer Steigerung der Konkurrenzkämpfe um Macht und Geschlechtspartner/innen – letztlich bis zu einem gegenseitigen Selbstruin, das im Aussterben endete.
Aus diesen evolutionär dringend gewordenen Problemen im Sozialleben kam es vor ca. 0,5 Mio. Jahren zu der Entstehung der erst eigentlichen Humanevolution. Sie verknüpft sich mit der Ablösung von der genetischen Verhaltenssteuerung zur Befähigung zur Selbststeuerung. Darin liegt – allein - der kategoriale Unterschied zwischen Mensch und Tier wie auch der biologische Inhalt der Entwicklung von >Kultur<. Mit dieser Befähigung entging die humanevolutionäre Entwicklung kurz vor der Entstehung unserer Art Homo sapiens vor vielleicht 150.000 Jahren in letzter Minute dem kompletten Aussterben der hominiden Stufe. Die Entwicklung von durch gemeinschaftliche Kommunikation fähig gesteuerte Sozial- und Beziehungs-Verhältnisse erwies sich als die einzige evolutionäre Alternative zu den ruinös gewordenen Konkurrenzkämpfen um Macht, Ränge und Geschlechtspartner. Umgekehrt entstand hiermit die evolutionär neuartige Dimension von Lebens-Qualität incl. Personalität und Liebes-Beziehungen. Auf dieser Basis wurde die Evolution der Primaten und des Menschen schließlich doch noch zum Erfolg – und dann: in was für einem Ausmaß!
Leider brachen in diese Situation eines im Allgemeinen fähigen Soziallebens in kultureller Lebens-Qualität über Jahrzehntausende (Reisen, Abenteuer und Kunst, wie von den Höhlen her bekannt, usw.) die gigantischen Naturkatastrophen und –Umbrüche am Ende der Eiszeit vor ca. 13.000 Jahren ein.
Wohl gelang es dem Menschen anders als vielen höheren Tier-Arten zu überleben, doch verbreitet auch nicht viel mehr. Entsprechend kam es hier zu einem Verlust in der Entwicklung von Kultur, Persönlichkeit, Sprache, Sprachbeherrschung und der Fähigkeit zu Kommunikation, die die entscheidenden Grundlagen der menschlichen Existenz sind. Dies wirkte sich recht bald in der Verselbständigung seiner Sozialverhältnisse sowie in externen und internen Kämpfen, autoritären Entwicklungen und Barbareien aus.
Zwar kam es in den Bemühungen, die entstandenen Notstände zu beheben, auch zu Fortschritten, die insgesamt die historische Entwicklung auslösten. Das hierbei bedeutendste Moment lag in der Gründung einer institutionellen Organisation, die eine Reihe der ursprünglichen freien Kleinverbände aus ein bis zwei Dutzend Erwachsenen plus Kinder vereinigte. Diese erste Form von >Staat< ist historisch als >Stamm< bekannt. Damit ließ sich (längst vor einer Aufnahme von Nahrungsproduktion) in neuartiger Form die Beschaffung und Verteilung von Ressourcen organisieren und ein Kampf um Ressourcen vermeiden, worin zunächst die entscheidende Lösung der entstandenen Probleme lag, vor allem unter den wüstenartigen Verhältnissen im Nahen Osten.
Doch wie diese größeren organisatorischen Strukturen die entscheidende Grundlage für den historischen Fortschritt stellten, so trugen sie doch von Anfang an das Problem in sich, dass sie nicht mehr auf einer gemeinschaftlichen Kommunikation aufbauten, worin die entscheidende Entwicklung der Humanevolution gelegen hatte. Ganz offenbar wurde die neue Organisation von einer Elite zur Lösung der durch die Naturumbrüche aufgeworfenen Probleme geschaffen. Schon diese erste frühmesolithische Organisationsstruktur namens >Stamm< zeigt mit ihrer Konzeption der >Stamm-Ahnen< (wie >Adam & Eva<), dass sie auf autoritärer und „mythologischer“, d.h. in Wirklichkeit ideologischer Basis errichtet werden musste, da die Kommunikation in den Wirren am Ende der Eiszeit vor allem im Nahen Osten nicht mehr zureichend funktionierte.
Das Engagement einer Elite war unter diesen Notstandsproblemen zweifellos unvermeidlich und auch erstmal hilfreich. Nur wurde mit dem Aufbau dieser neuen Organisation eine in Ideologie und Sprache begründete autoritäre Struktur mit dauerhaften Konsequenzen bis
heute institutionalisiert. Wenn sich am Anfang diese >Stammes-Führer< noch als Repräsentanten des Stamms der Basis verpflichtet fühlten, so begann sich dies bereits vor 12.000 Jahren zu verselbständigen (wie etwa bei dem Bau der großen Megalith-Anlage von Göbekli Tepe). Die Konzeption des >Adels< erklärt sich daraus, dass dieser die leibliche Nachkommenschaft der eigentlich mythologischen Stamm-Ahnen (später auch >Götter<) wäre, wie es in etlichen Traditionen überliefert ist. 4 Von dort her geraten die Sozialverhältnisse nun gerade aufgrund dieser Organisation mit der Zeit in zunehmende Elendsprobleme und Disflikte.
Es sind nicht die Ansätze der Nahrungsproduktion an sich, sondern vielmehr diese organisatorischen Hintergründe der Nahrungsproduktion, dass recht bald festzustellen ist:
„Seltener macht man sich klar, wie viel Unglück der Mensch mit der Landwirtschaft über sich selber gebracht hat: die Fron, die Armut, die großen Kriege - und sogar den Hunger.“ 5
Im Ursprünglichen hat es bis auf besondere Ausnahmen keine Ernährungsprobleme gegeben. Das Sozialleben erbrachte mit dem Gehirnwachstum in der Evolution der Primaten eine hohe Intelligenz, mit der man gegenüber der Umwelt eine hohe Souveränität erreichte. Doch schon auf der Stufe der einfachen Affen (Anthropoiden) brauchte es dieser hohen Intelligenz, um seine Sozialverhältnisse aufrechterhalten zu können.
„Labortests zeigten deutlich, dass niedere Affen und Menschaffen außergewöhnlich intelligent sind. Feldstudien ergaben allerdings, dass zumindest beim Gewinnen des täglichen Lebensunterhaltes diese Intelligenz kaum beansprucht wird. […] Mit anderen Worten, für einen nichtmenschlichen Primaten in freier Wildbahn ist der Lernprozess über das Vorkommen und vielleicht auch die Reifezeit von Nahrungsressourcen ein intellektuelles Kinderspiel verglichen mit der Vorhersage - und Beeinflussung - von Verhaltensweisen anderer Individuen der Gruppe.“ 6
Dass nicht die materielle Versorgung, sondern in Wirklichkeit die Steuerung seines Sozialverhaltens das entscheidende Probleme ist, galt infolge der humanevolutionären Entwicklung erst recht:
„Überhaupt ist es typisch für [für die ursprüngliche menschliche Lebensform der] Sammlerinnen- und Jägergesellschaften, die unter Bedingungen wie die der afrikanischen leben, dass sie ein ausgesprochen unbekümmertes, heiteres Naturell besitzen, sich gerne amüsieren und viel lachen.
Die Voraussetzungen dazu sind ihnen auch wahrlich gegeben. Man hat errechnet, dass Buschmänner oder Hadza zum Beispiel einen Arbeitsaufwand von weniger als zwei Stunden pro Tag aufbringen müssen, um ihren Lebensunterhalt sicherzustellen. Es bleibt ihnen also reichlich Muße, die ihre Phantasie beflügelt und die sie denn auch mit viel Spiel, Tanz, Gesang, Unterhaltung und Geschichtenerzählen ausfüllen. Man darf annehmen, dass dies früher […] nicht viel anders war.“ 7
Tatsächlich mangelt es schon lange nicht mehr an Angeboten von Nahrung, Produktion, Technologien und Dienstleistung. Bereits seit den 1830er Jahren wurde – wohl ursprünglich von dem Franzosen Charles Fourier - erkannt, dass in Wirklichkeit das Gegenteil das Problem ist: nämlich das Überangebot, das aufgrund der politischökonomischen Zusammenhänge bislang regelmäßig in Kriege und einen allgemeinen gegenseitigen Selbstruin führte. Wenn nun diese Kriege zu Elend und Versorgungsproblemen führen, ist das nicht erstaunlich, aber weder ein Problem der Natur noch der Evolution, wie man früher meinte. Die ganzen sozialen und ökologischen Probleme begründen sich aus dem am Ende der Eiszeit entstandenen Mangel an Kultur und den daraus resultierenden Machtverhältnissen samt einer diese stützende Ideologie.
Diese historiologischen Ergebnisse spielen für die Konzeption von Telotopia eine grundlegende Rolle. Hierbei gibt es im Besonderen zwei Gesichtspunkte.
Einerseits belegen sich bedeutsame Fortschritte, die das völlig neuartige Potential der historischen Entwicklung geschaffen haben. Als die entscheidende Grundlage dabei stellt sich die Entwicklung einer neuartigen organisatorischen Struktur dar.
Wohl lag die Ursache für diese neuartige Organisation zuerst (Frühes Mesolithikum) in Form der Stämme und dann (Mittleres Mesolithikum) des übergreifenden Stämme-Rechts-Bundes von Göbekli Tepe in der Bewältigung von Notstandsproblemen: nämlich zur Lösung der Ressourcen-Probleme und zur Vermeidung von Kämpfen um Ressourcen und Gebiete. Doch zeigte sich vor allem zunächst mit Göbekli Tepe, dass sich durch die systematisierte Organisation der Ressourcen ein völlig neuartiges kulturelles Potential ergab, wie es schon in dem Bau der gewaltigen Megalith-Anlage von Göbekli Tepe (größer als Stonehenge) ab ca. 9.500 v. Chr. zum Ausdruck kommt. Auch die damalige Befahrung von Zypern dürfte mit der neuen Organisation in Verbindung stehen. Die Züchtung von Getreide und die Entwicklung einer systematischen Nahrungsproduktion und der ganzen Grundlagen der zivilisatorischen Kultur dürften ebenso wie unsere historischen Sprachformen von der Organisation von Göbekli Tepe ausgegangen sein.
Andererseits gelang es diesen Ansätzen nicht, sämtliche am Ende der Eiszeit entstandenen Probleme und Verluste an Kultur zu beheben. Von daher verknüpft sich die historische Entwicklung nicht nur mit Fortschritt, sondern auch mit Eskalationen.
In Hinsicht auf die Eskalation zeigen sich zwei Problem-Komplexe, die sich im Weiteren historisch wechselseitig verstärkten. Der eine Komplex verknüpft sich mit einem substanziellen Verlust an Kultur, an kindgerechten Verhältnissen und daraus folgend mit einem Verlust der Fähigkeit zu Selbststeuerung und Kommunikation; der andere Komplex mit der Anlage seiner Sozialorganisation. Es kommt zu Problemen der Verselbständigung seiner Sozialverhältnisse und einer kulturellen Verwahrlosung mit Asozialität, Ego, „Macht“, Gewalt und sozialen Problemen.
Bei allem sozialen Engagement der Elite hebt die soziale Organisation sehr bald ab, woraus die Macht-Problematik entstand, die sich dann pandemisch über die Welt verbreitete (wohl insbesondere von Göbekli Tepe aus). In dieser Problematik liegt die Ursache, warum es in der zivilisatorischen Entwicklung regelmäßig zu kulturellen Zusammenbrüchen kommt.
Diese Problematik liegt nicht in der Sozialorganisation an sich. Vielmehr ist die systematisierte Organisation zunächst als die Lösung der am Ende entstandenen Probleme an unzureichenden Ressourcen und Konflikten um Gebiete wie als Grundlage des historischen Fortschritts zu sehen.
Das Problem verknüpft sich vielmehr mit der Form dieser Organisation. Diese neu geschaffene Sozialorganisation entstand in den damaligen Naturkatastrophen von vorneherein als elitärer Ersatz zu der in den Naturkatastrophen am Ende der Eiszeit verloren gegangen Selbststeuerung auf der Basis gemeinschaftlicher Kommunikation.
Es ist jedoch von den heutigen Einsichten her festzustellen, dass eine höhere Organisation nur dann sozialen und kulturellen Fortschritt schafft, wenn das allgemeine soziale Fundament auf dem Prinzip der Selbstorganisation in gemeinschaftlicher Kommunikation basiert. Dies ist in der vorliegenden Konzeption die Funktion der >Boros< (s.u.). Je höher ein Bau wird, desto entscheidender wird die Anlage des Fundaments. Sonst ist der Einsturz vorprogrammiert. Dies gilt auch für die Sozialverhältnisse samt Ökonomie und Politik.
„Und ich stimme hier, wie gesagt, Marcuse vollkommen zu, dass progressive gesellschaftliche Änderungen nur gestaltet und durchgehalten werden können von Menschen, die sich auch psychisch ändern und mit dieser inneren Umerziehung [bzw. Entwicklung] bereits lange zuvor begonnen haben.“ 8
1 Das Kursive ist hier meine Übersetzung anstatt >Tiere<. Das wohl im englischen Original gebrauchte animal bedeutet ursprünglich >Lebewesen<, vgl. lat. anima.
2 Der Neurobiologe Joachim Bauer





























