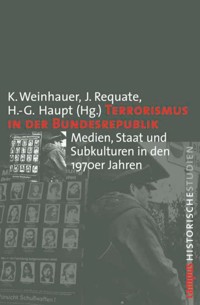
Terrorismus in der Bundesrepublik E-Book
38,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Campus Historische Studien
- Sprache: Deutsch
Die Kontroverse um die RAF-Ausstellung in Berlin 2005 zeigt, dass die Wunden, die der Terrorismus der 1970er Jahre in unserer Gesellschaft hinterlassen hat, bis heute nicht verheilt sind. Noch ist es zu früh, um schon von einer Historisierung zu sprechen. Die meisten Auseinandersetzungen mit dem Thema sind individueller und biographischer Art. In diesem Band wird der bundesdeutsche Linksterrorismus erstmals aus sozialund kulturhistorischer Perspektive analysiert. Untersucht werden die Subkulturen und Milieus, aus denen der Terrorismus entstanden ist, die staatlichen und institutionellen Reaktionen sowie die öffentliche Beschäftigung mit dem Phänomen. Deutlich wird dabei die zentrale Rolle der Medien, wenn es um die gesellschaftliche Bewertung des Terrorismus und seiner Akteure geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 35
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
LESEPROBE
Haupt, Heinz-Gerhard; Requate, Jörg; Weinhauer, Klaus
Terrorismus in der Bundesrepublik
Medien, Staat und Subkulturen in den 1970er Jahren
LESEPROBE
www.campus.de
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Copyright © 2006. Campus Verlag GmbH
Besuchen Sie uns im Internet: www.campus.de
E-Book ISBN: 978-3-593-40242-0
|8|
|9|Einleitung:
Die Herausforderung des »Linksterrorismus«1
Klaus Weinhauer / Jörg Requate
Seit einigen Jahren erlebt die Beschäftigung mit dem bundesdeutschen Linksterrorismus der 1970er Jahre eine Konjunktur mit sehr unterschiedlichen Aspekten.2 Zum einen scheint die Selbstauflösung der Rote Armee Fraktion (RAF) den Weg für eine Ästhetisierung des Phänomens geöffnet zu haben. Die Verballhornung »Prada-Meinhof«, Filme wie »Baader« von Christopher Roth oder »Starbuck« von Gerd Conradt oder – von ganz anderer Warte – das Buch Hans und Grete von Astrid Proll versuchen auf unterschiedliche Weise, die Protagonisten zu Teilen der Popkultur werden zu lassen.3 Die Berliner RAF-Ausstellung des Jahres 2005 zielte nicht zuletzt darauf ab, den Terrorismus der siebziger Jahre auch als Medienphänomen ernst zu nehmen. Zum anderen beginnt sich der hermetische Gesamtkomplex des Linksterrorismus biographisch aufzulösen. Ehemalige Aktivistinnen und Aktivisten haben in autobiographischen Zeugnissen ihre Sicht der Dinge dargelegt.4|10|Auch werden Namen wie »Ulrike Meinhof« und »Andreas Baader« sowie die Aktivitäten der im Mai 1970 gegründeten Rote Armee Fraktion oder Baader-Meinhof-Gruppe medial breit gefächert präsentiert. Und schließlich wurde in den letzten Jahren auch über die militante Vergangenheit führender Politiker oder die Taten ehemaliger Aktivisten gestritten. Im Zuge dessen lässt sich eine Interessenverlagerung von den spektakulären Ermordungen und Entführungen des Jahres 19775 hin zur Gründungsphase des Linksterrorismus in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren verfolgen.6 Dies hängt auch damit zusammen, dass im Kontext der rot-grünen Regierung eher auf politischer als auf wissenschaftlicher Ebene die tatsächlichen oder vermeintlichen Folgen von »68« thematisiert wurden. Konzentriert man sich auf die wissenschaftliche Forschung zum bundesdeutschen Linksterrorismus, fällt aus historischer Perspektive zunächst auf, dass die Auseinandersetzung bislang ganz von juristischen, politik- oder sozialwissenschaftlichen Studien dominiert wird,7 während spezifisch geschichtswissenschaftliche Analysen erst in den Anfängen stecken.8
Insgesamt kristallisieren sich dabei zwei unterschiedliche Zugänge heraus, die allerdings fast keine Berührungen miteinander haben. Auf der einen Seite gibt es einen relativ geschlossenen Korpus sozialwissenschaftlicher Analysen aus den späten 1970er und 1980er Jahren. Ein großer Teil davon ist im |11|Auftrag des Bundesinnenministeriums entstanden und dokumentiert damit das Bemühen des Staates, die Hintergründe jener Bedrohungen aufzuklären, denen sich dieser seit den frühen 1970er Jahren ausgesetzt sah. Diese sozialwissenschaftlichen sowie kriminologischen Arbeiten, an denen insbesondere Fritz Sack, Heinz Steinert und Sebastian Scheerer federführend beteiligt waren, können gleichwohl kaum als »Auftragsarbeiten« in einem klassischen Sinne gelten. Anstatt, wie es sich das Innenministerium vielleicht gewünscht hatte, konkrete Ergebnisse zur Bekämpfung des Terrorismus zu liefern, analysierten die Wissenschaftler das Phänomen umfassend als ein gesellschaftliches.
Viele dieser Studien orientierten sich – oft auch unausgesprochen – an Norbert Elias. Orientiert an seinem Zivilisationsmodell interpretierte Elias bereits um 1980 den bundesdeutschen Terrorismus als eine besondere Variante des »sozialen Generationenkonflikts«.9 Die Ursachen für die terroristische Ausprägung dieses sozialen Generationenkonflikts sieht Elias besonders in der NS-Vergangenheit, im deutschen Staatsbildungsprozess sowie in den damit verbundenen autoritären Verhaltensmustern nebst schwach ausgeprägten Selbstkontrollmechanismen bei der Gewaltanwendung. In den Konflikten mit ihren Vätern – nicht unbedingt mit den persönlichen, sondern den sozialen – stellten sich Teile der bundesdeutschen jungbürgerlichen Nachkriegsgeneration aus einer Außenseiterposition heraus und oft vermittelt über marxistische Ideen »fest und unzweideutig auf die Seite der Unterdrückten«.10 Dabei wurde Faschismus zum »symbolischen Gegenbild«11 der eigenen Ziele. Während die weniger gewaltlose Oppositionspolitik in England, Frankreich oder Holland auf der »ungebrochenen Festigkeit des Nationalgefühls« fußte,12 litten Deutschland und Italien an einer chronischen »Unsicherheit ihres Selbstwertes als Nation«.13 Einzigartig für die deutsche Geschichte blieb jedoch, auch im Vergleich zu Italien, das »hohe Ausmaß des geplanten Mordens« während der NS-Herrschaft. Wobei später auch für einige bundesdeutsche Terroristen das Gefühl dafür schwand, so Elias, dass es sich bei ihren Opfern um Menschen handelte und nicht nur um »Symbole im Rahmen einer Theorie«.14
Zwar mögen die sozialstrukturellen Analysen der 1980er Jahre heute etwas spröde wirken, jedoch ging es den Autoren darum, etwas über den Zustand |12|der bundesdeutschen Gesellschaft auszusagen15





























