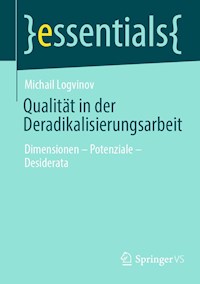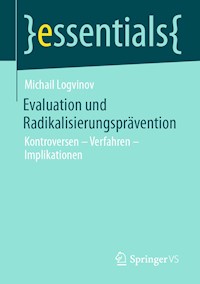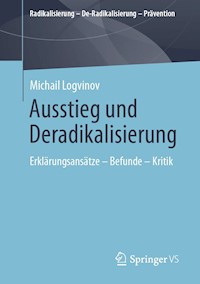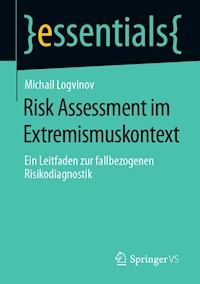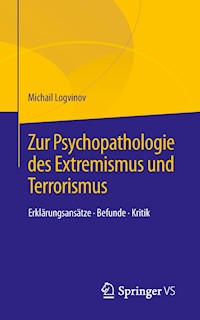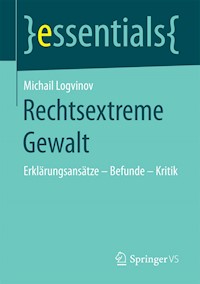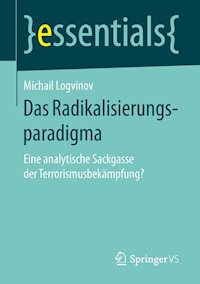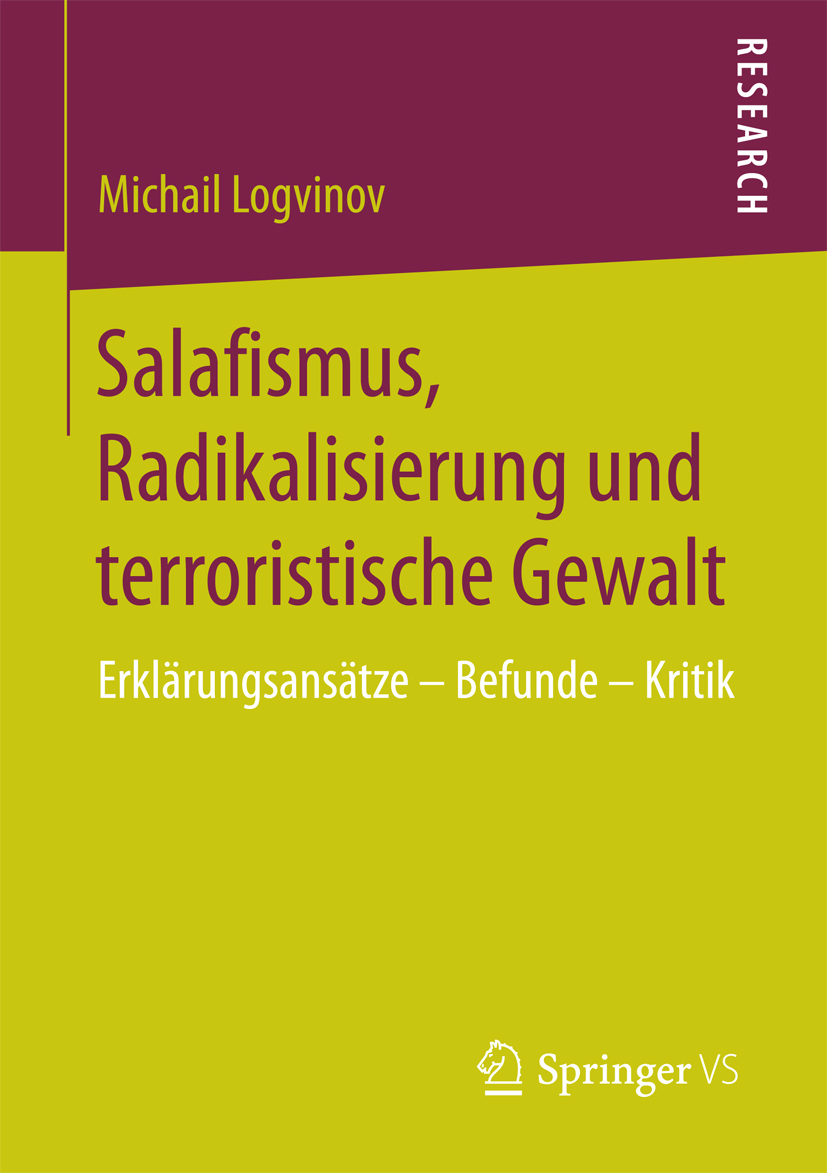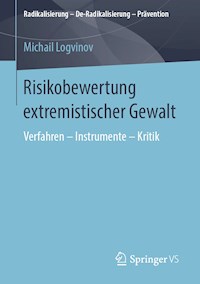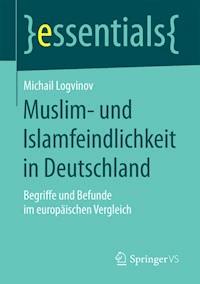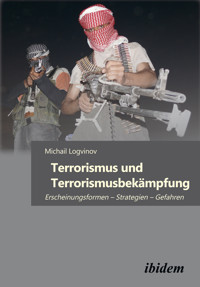
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Art und Weise, wie dem Terrorismus entgegengetreten wird, resultiert aus - vermeintlichen oder tatsächlichen - Erkenntnissen der staatlichen Sicherheitsbehörden. Dass deren Vorgehen keineswegs immer als optimal zu betrachten ist, zeigt sich beispielsweise am Fall NSU, der mit einem Mal offenbarte, dass die größte Schwäche der deutschen Extremismusexpertise darin bestand, das Konzept einer führerlos organisierten Terrorzelle nicht berücksichtigt zu haben. Die weltweite Expansion des Dschihadismus und die erschreckende Tatsache, dass Al-Qaida von einer noch brutaleren Sammlungsbewegung mit dem Namen Islamischer Staat überholt wurde, zeugen ebenfalls nicht unbedingt vom Erfolg des bisherigen Krieges gegen den Terrorismus. Das Ziel des vorliegenden Bandes besteht darin, einen informativen Überblick über Ziele, Strategien und Gefahren des Terrorismus einerseits sowie über mögliche und wirkungsvolle Bekämpfungsmaßnahmen andererseits zu geben. Michail Logvinov zeigt die Varianten des Terrorismus auf und definiert seine Erscheinungsformen nach verschiedenen Kriterien. Der Autor informiert detailliert über die Motivation von Selbstmordattentätern, Islamisten, Rechts- und Linksterroristen. Überdies stellt er Ziele und Strategien der Terrorismusbekämpfung vor und weist auf mögliche Zweck-Mittel-Konflikte der Bekämpfungsmaßnahmen hin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung
Vermeintliche oder tatsächliche (Er-)Kenntnisse über das jeweilige Terrorismusphänomen, seine Erscheinungs- und Organisationsformen, ZieleundStrategien, die in einer Konstruktion der Analyseeinheit"Terrorismus"münden,wirken sich auf die Wahrnehmung seiner Gefahrenund zugleich aufBekämpfungsmaßnahmen aus.Womöglich vorliegendeFehlinterpretationenbzw.-kategorisierungenwerden ob derzirkulären Verstärkungsprozesse zwischen den sicherheitsbehördlichen, politischen, medialen und wissenschaftlichen Diskursen nur selten korrigiert. So kommt es, dass eineim gegebenen historischen KontextkonstruierteKategorieunseren Blick auf das jeweilige Phänomenzwarschärft,währendseine Vielfältigkeit bzw. historische Wandelbarkeitjedoch weniger Beachtung findet.Denndie wahrnehmungsdominantenAttributeschränkenzugleichdas Blickfeld ein. Auf diese Weise kann die Aussage des SachverständigenGünter Schichtin der Abschlusssitzung des Ausschusses des Deutschen Bundestages zum Fall NSU im Mai 2013 verstanden werden."Wissen macht lernbehindert", meinte er. Gemeint war wohl, perspektivische Verengungen trübten den Blick. Denn sobald sich einealles dominierendeSichtweise – gleich ob bei der Faktenerhebung oder bei der Interpretation – herausbildet, werden die Randzonen um den etablierten Fokus immer unschärfer(Backes/Logvinov 2014: 202)."Standardmäßige Täuschung"nannte das Ofira Seliktar (Horst 2014: 1999).
Das etablierte Rechtsterrorismusverständnis führte bspw. dazu, dass deutsche Nachrichtendienste und Polizeibehörden zwar zu Recht auf das Fehlen der rechtsterroristischen Strukturen hinwiesen, das Vorhandensein einer militanten Zelle jedoch für unmöglich hielten(Logvinov 2013).Dabei waren die meisten Urheber rechter Anschläge in Europa nach 2000 in Zellen bzw. Pseudo-Zellen organisiert (Berecz/Domina 2012). Auch die deutsche Szene interessierte sich fürdie neuen Organisationsformenund besaß nachweislich Publikationen, die den führerlosen Widerstand glorifizierten(Backes et al. 2014).
Der Trugschluss, Schiiten und Sunniten seien so verfeindet, dass eine Kooperation zwischen dem Iran und Al-Qaida unmöglich sei, erwies sich ebenfalls als korrekturbedürftig. Diedschihadistisch-takfiristische Organisation Boko Haram wurde lange Zeit und wird in manchen Medien nach wie vor als Sekte bezeichnet, weil ihre Gewaltstrategievom herkömmlichenVerständnis des islamistischen Terrorismus abweicht. Dabei ist offensichtlich, dass der Sektenbegriff weder der Organisation noch ihren Zielsetzungen gerecht wird. Lange Zeit herrschte in der Terrorismusforschung die Erkenntnis vor, dass terroristische Organisationen keine Geländegewinne anstrebten. DerdschihadistischeTrend hin zur Etablierungvon(Schatten-)Emiratenund Diskussionen über ein islamisches Kalifatwurdenzwar registriert, aber anscheinend nicht ernst genug genommen. Als der Islamische Staat Anfang Juni 2014Mossul einnahm, war die Welt- wie Fachöffentlichkeit entsetztund auf diese Entwicklungkaumvorbereitet. Dabeiriefdie Al-Qaida im IrakbereitsEnde 2006in Mossul das"Islamische Emirat Irak"aus.Trotz der zum damaligen Zeitpunkt nicht ausreichenden Kapazitäten vollzog das irakische Kalifat ab 2008 einen Strategiewechsel mit dem Ziel,"sich dauerhaft auf einem klar umrissenen Territorium einzurichten, was damals ebenso ehrgeizig wie utopisch zu sein schien"(Hanne/Neuville 2015: 37). Utopisch schien das neue Ziel vor allem ob des Widerspruchs zur"dschihadistischen Politik"von Al-Qaida. Dennoch war esder Al-Qaida-Vize Aiman az-Zawahiri, der für die Schaffung eines Islamischen Staatesplädierte. In einem Brief vom Juli 2005 rief er den Anführer der Organisation im Irak Zarqawi dazu auf,"kurz vor oder sofort nach dem Abzug der Amerikaner eine ‚islamische Autorität'oder ein ‚islamisches Emirat'in den sunnitisch-arabischen Gebieten des Landes zu gründen und zu einem Kalifat auszubauen"(Steinberg 2015: 60).Erscheint vor diesem Hintergrundtatsächlichunplausibel, dass der ISseine Hochburgeinnehmen würde,sobald die Zeit reif dafür ist? Kurz:Etablierte Kategorien und Wahrnehmungsschemata (Vor-Urteile) beeinflussen unsere Erkenntnisprozesse.
Die Antwort darauf, was das Terrorismusphänomen ausmacht, ist daher eng mit der Fragestellung verflochten, warum"Terrorismus"als Kategorie und Analyseeinheit zahlreiche Definitionssperren aufweist. Umgekehrt gilt: Die Kategorisierung des Terrorismus geht mit dem oft als selbstverständlich aufgefassten Anspruch einher, Aussagen über die Phänomenologie des Terrorismus treffen zu können. Dabei gerät schnell aus dem Blick, dass die extrawissenschaftlichen Werte die wissenschaftlichen Diskurse konturieren. Die Terrorismusdefinition erweist sich somit oft als Bestandteil eines"Alltagsmythos", der laut Barthes ein vermeintliches Ähnlichkeitsverhältnis eines konstruierten Objektes mit dem zu untersuchenden Phänomen in Form einer So-Sein-Relation herstellt. Hierbei wird unterschlagen,"dass eine Aussage und das in ihr enthaltene Objekt etwas sozial Gemachtes sind, und er unterschlägt auch die unterschwellige Zielsetzung gerade dieser sozialen Konstruktion von Wirklichkeit"(Hess 1988: 58).
Vor allem im Fall des islamistischen Terrorismus ist nach dem 11. September 2001 ein Kampf der Emotionen und daraus resultierend ein politischer wie kultureller"Kampf der Konstruktionen"entbrannt: Es stehen sich nicht nur der Okzident und der Orient ratlos und zuweilen feindlich gegenüber, selbst die westlich geprägten Kulturen nehmen ähnliche Gefährdungen auf unterschiedliche Art und Weise wahr (Moisi 2009). Das kann als Beleg dafür gelten, dass die angeblich"objektiven"Phänomene wie derTerrorismusauchsoziale Konstruktebzw. Ergebnisse sozialer(Definitions-)Prozessesind.Aus diesem Grund kommt den Sozialwissenschaften diedringendeAufgabe zu, sich phänomenologisch und ideologiekritisch mit den Erscheinungsformen des Terrorismusund daraus resultierend mit möglichen sowie plausiblen Terrorismusbekämpfungsmaßenzu befassen. Das ist das Ziel dieses Buches.
2.Terrorismus – Annäherung an ein komplexes Phänomen
2.1. Terrorismus als politischer Kampfbegriff
Diescheinbare AllgegenwärtigkeitterroristischerGewalt zeitigt nicht nur politische Brisanz und daraus resultierend die Notwendigkeit eines durchdachten Reaktionskonzeptes seitens betroffener Staaten, sondern vor allem die Unerlässlichkeit, den emotional und politisch aufgeladenen Begriff des Terrorismus abseits der vom Alltagsmythos suggerierten So-Sein-Relation zu kategorisieren. Vor allem gilt es, das Ineinandergreifen verschiedener Diskurse und die Vielfältigkeit wissenschaftlicher Ansätze aufzuzeigen.
In der Politikwissenschaft herrscht ein Konsens darüber, dass eine Annäherung an den Terrorismusbegriff anhand der Dimensionen"Zielsetzung","ModusOperandi", des zugrunde liegenden"politischen Kalküls"und der"Opferstruktur"möglich ist. Eine differenziertere, über die elementaren Merkmale hinausgehendeBegriffsbestimmungscheint jedoch die Wissenschaft mit deutlichen Definitionsproblemen zu konfrontieren.NachfünfzigJahren haben es die Terrorismusforschung und das Völkerrecht trotz Ächtung der terroristischen Tathandlungen nicht vermocht, definitorische Klarheit zu schaffen (Daase 2002a: 367). Man kann behaupten, dass das Terrorismuskonzept, ähnlich dem übergeordneten Begriff des politischen Extremismus, weder allseitige Zustimmung findet[1]"noch gibt es volle Übereinstimmung darüber, wie dessen Definitionsbereich zu erfassen sei"(Backes/Jesse 1985: 17).
Die nur zum Teil gewährleistete Erkenntnissicherheit über das Terrorismusphänomen liegt nicht nur in seiner Natur begründet. Denn die Terrorismusforschung ist selbst Teil einer Debatte, die politische und erkenntnistheoretische Diskurse[2]vermengt.[3]Die beschriebene"Struktur der Forschung"erschwert die definitorische Eingrenzung und argumentative Auseinandersetzung mit dem Phänomen. Bei politischen und öffentlichen Diskussionen rund um das Terrorismusthema handelt es sich oft nicht um seine Kategorisierung[4]und anschließende Operationalisierung, sondern vor allem um Argumentationshoheit, politische Überzeugungen und den"Kampf um Begriffe".[5]Polemische Demagogie in politischen Debatten macht es nicht nur möglich, dass"der Terrorist des Einen"gleichzeitig"Freiheitskämpfer des Anderen"ist. Politischer"Missbrauch"und inflationärer Gebrauch des Terrorismusbegriffes entzieht diesem oftseineSubstanz. Der Terrorismusbegriff mutiert zuweilen zu einem Stereotyp, das oft herangezogen wird, um den Feind zu stigmatisieren. Dies hat zur Folge, dass ein und dieselbe Person bzw. Organisation bei unverändertem Verhalten ihrerseits das"Terrorismusstigma"ablegen und einen Schritt hin zur Durchsetzung politischer Ziele näher kommen kann (Münkler 2002: 174). Der Terrorismusbegriff stellt im öffentlichen Diskurs einen pejorativen Begriff, eine moralische Verurteilung dar. Indem man eine Handlung als terroristisch bezeichnet, hebt man ihre Illegalität und Illegitimität hervor.
Der aufgeweichte (Kampf-)Begriff bietet sich kraft seiner Ungenauigkeit sowohl den substaatlichen Akteuren an, die Regierungen des Terror(ismu)s bezichtigen, um den subversiven bewaffneten Kampf gegen die Staatsgewalt zu legitimieren, als auch den Regierungen, die ihrerseitsdanach streben, die mehr oder weniger militante Opposition zu kriminalisieren und durch Hinweise auf illegale, terroristische Methoden zu delegitimieren (Daase 2002a: 367). Scheerer (2002: 13) beobachtete in der Diskussion um Terrorismus nach dem 11. September die"ewige Wiederkehr"zweier Erklärungsmuster, die die rationale Auseinandersetzung mit dem Phänomen beeinträchtigten: zum einen"Pathologisierung"–"die altbekannte Erklärung revoltierender politischer Gewaltkriminalität aus einer mit etwas sozialpathologischem Kulturpessimismus garnierten Pathologie der Täter"– und zum anderen"Mythologisierung"in Form der"Negation jeglicher rationaler Erklärbarkeit und die Deutung des Phänomens als Manifestation eines motiv- und ursachenlosen Bösen".
In den internationalen Beziehungen stand der Terrorismusbegriff oft im Dienst der politischen Interessen. So wurde in den 1980er Jahren Terrorismus als"ein kalkuliert eingesetztes Mittel zur Destabilisierung des Westens im Rahmen einer umfassenden weltweiten Verschwörung"aufgefasst (Hoffmann 2006: 45). Die ideologische Begründung der amerikanischen (Über-)Reaktionen nach den AnschlägeninNew York und Washington im Jahre 2001 legt Zeugnis davon ab, dass das Verschwörungsdenken im globalen Krieg gegen den Terror ebenfalls ein ernst zu nehmender Faktor bleibt (Daase 2001).
Die Entwicklungsgeschichte des Terrorismuskonzeptes zeigt deutlich seinen Bedeutungswandel auf. Wurde in den 1930er Jahren die Bezeichnung"Terrorismus"häufiger für"die Praktiken der Massenunterdrückung"und"Missbrauch von Macht durch die Regierungen"verwendet, gewann der Begriff nach dem Zweiten Weltkrieg"seine revolutionären Anklänge zurück, mit denen er heutzutage meist assoziiert wird"(Hoffmann 2006: 43). In den 1960er Jahren setzte der Prozess der Übertragung seines Geltungsbereichs auf nationalistische und ethnisch-separatistische Gruppen sowie auf ideologisch motivierte Organisationen ein. Mit dieser Entwicklung ging die Internationalisierung des Terrorismus und seine Medialisierung einher (Daase 2002a: 370).
In den 1990er Jahren wurde der Terrorismusbegriff durch das Aufkommen des Neologismus"Drogenterrorismus"zusätzlich verwischt. Die Verbindung des ausufernden internationalen Drogenhandels mit der angeblich"von Moskau gesteuerten terroristischen Verschwörung"führte dazu, dass westliche Regierungen die bedrohlichen Allianzen der profitorientierten Wirtschaftskriminalität mit Terror- und Guerillagruppen als"Instrument gewisser Regierungen zum Erreichen ihrer politischen Ziele"bzw. als"jüngste Erscheinungsform der kommunistischen Verschwörung zur Zerstörung der westlichen Gesellschaft"missinterpretierten (Hoffmann 2006: 46). Laut Daase (2001: 71) ist die"Verschwörungstheorie des Terrorismus"[6], deren Höhepunkt im Kalten Krieg zu verorten ist, nicht oft genug zu akzentuieren, um die Gefahren und die epistemischen Nachteile der Ansätze aufzuzeigen, den Terrorismus nur als lokal isoliertes oder als vorwiegend international vernetztes Phänomen aufzufassen:"Auch in diese Frage sind wieder politische Interessen verwoben, die sich deswegen so verheerend auswirken, weil unabhängige empirische Informationen, mit denen man die jeweiligen Theorien testen könnte, äußerst rar sind."
Walter Laqueur hat eine umfassende und verbindliche Terrorismusdefinition angezweifelt und als"aussichtsloses Unterfangen"qualifiziert, denn die"Schwierigkeiten der Formulierung einer umfassenden Definition schienen unüberwindbar zu sein – und waren es dann auch. Denn die Natur des Terrorismus verändert sich je nach Ort und Zeit"(Laqueur 2004: 208). Zwar bleibt die Feststellung eher eine Minderheitenmeinung, denn die Suche nach einer konsensfähigen Definition geht weiter. Seine lakonische Prophezeiung, eine allgemeine Definition des Terrorismus existiere nicht und sei in der nahen Zukunft auch nicht zu finden,hat sich jedoch bewahrheitet. Es bleibt allerdings fraglich, ob die Behauptung, Terrorismus könne ohne eine Definition nicht untersucht werden, so offensichtlich absurd sei. Sie ist allerdings nicht unbequem:"Solange eine [akzeptierte und verbindliche] Definition fehlt, kann man kasuistisch vorgehen und mal dies, mal jenes Terrorismus nennen, ohne zu unangenehmer Konsequenz genötigt zu sein"(Scheerer 2002: 19).
Eine Analyse der politisch motivierten Gewalt kann ohne eine Arbeitsdefinition des zu untersuchenden Phänomens kaum überzeugen, wasauchLaqueurveranlasste, ein minimalistisches Terrorismuskonzept zu entwickeln. Seine Definition[7]lässt wie andere pragmatische Begriffsbestimmungen allerdings so"viel Raum, dass es jedem selbst überlassen bleibt, was als Terrorismus bezeichnet werden soll; damit ist der Beliebigkeit ebenso Tür und Tor geöffnet wie dem politischen Missbrauch des Terrorismusbegriffs"(Daase 2001: 58). Um kumulative Theoriebildung sowie theoriegeleitete Datenerhebung auf Grundlage eines von Definitionssperren befreiten Terrorismusbegriffs zu ermöglichen, gilt es, das komplexe Phänomen jenseits der"semantischen Positionskämpfe"zu kategorisieren. Nur so ist seine Brauchbarkeit zu gewährleisten, und zwar dann, wenn es festzulegen gelingt,"welche Ökonomien und Strategien der Gewalt damit bezeichnet werden und worin deren spezifische Unterschiede zu anderen politisch-militärischen Strategien liegen"(Münkler 2002: 176).
Die sicherheitspolitische Zäsur des 11. September 2001 trug maßgeblich zu neuen Akzenten in der Terrorismusforschung bei. Die Anschläge seien laut Schneckener (2006: 12) ein Superlativ ohne Präzedenz, wofür in erster Linie vier Aspekte verantwortlich seien: Diedestruktive Dimension(Todeszahl und ökonomischer Schaden), diemediale Dimension(erstmals in der Geschichte konnte die Weltöffentlichkeit Live-Bilder einer solchen Katastrophe sehen), dieoperative Dimension(Koordinationsfähigkeit der Attentäter) und dieweltpolitische Dimension(zum ersten Mal wurde das Territorium der Weltmacht angegriffen). Die Gegenreaktion der USA wie die Erklärung des Präsidenten Bush, die USA seien in einem Krieg gegen den Terror, der bei Al-Qaidabeginne, aber dort nicht ende, ließ erahnen,"dass hier ein potenziell endloser Kampf gegen alles und alle gemeint war, die in irgendeiner Weise Amerikaner in Angst versetzen oder bedrohen […]. Der'Krieg gegen den Terror'war […] zugleich ein'Kreuzzug', wie Präsident Bush ihn in einer unglücklichen Wortwahl nannte […]. In diesem Sinne steht er für die Neudefinition, die der Ausdruck'Terrorismus'zu Beginn des 21. Jahrhunderts erfuhr und die dafür sorgte, dass der Begriff […] sowohl die dunklen Kräfte umfasst, welche die'Zivilisation'bedrohen, als auch die Ängste, die daraus entstehen"(Hoffman 2006: 48). Freilich kann man darüber diskutieren, ob ein Krieg gegen eine"abstrakte Größe"bzw.Modus Operandi geführt werden kann.[8]Unbestreitbar bleibt jedoch, dass im Zeitalter des globalen Krieges gegen den Terrorismus der Wissenschaft die besondere Aufgabe zukommt, die definitorische Klarheit zu gewährleisten.
2.2. Sozialwissenschaftliche Ansätze zum Terrorismus
Es sind nicht nur exogene Faktoren, die für die Definitionssperren in der Terrorismusforschung verantwortlich sind. Zur machtpolitischen Dimension und Instrumentalisierbarkeit des Terrorismus kommt eine methodische Pluralität in den Sozialwissenschaften hinzu, die durch die Hervorhebung einzelner Aspekte des zu untersuchenden Phänomens eine multikausale, holistische Interpretation erschwert. Es haben sich in den Sozialwissenschaften teils selbstständige, teils miteinander verwobene Forschungsansätze herausgebildet.
Der Ansatzvon Laqueur (2001, 2004) rückt die historischen Entwicklungsstränge in den Vordergrund der Terrorismusforschung und weist nach, dass die"aktuelle Phänomenologie des Terrorismus nicht in ungebrochener Kontinuität zu den historischen Wurzeln [steht], aber andererseits ohne sie nicht erklärbar [ist]"(Neidhardt 2004: 264). Der historische Ansatz stößt spätestens dann an seine Grenzen, wenn es um die Erklärung des modernen islamistischen Terrorismus geht, der nicht selten in psychopathologischen Kategorien ausgelegt wird. Verweise auf die"entscheidende Bedeutung paranoider Elemente", den"wachsenden Fanatismus"und"zunehmende Bedeutung des Wahnsinns"offenbarenseineErklärungsdefizite.
Psychologische bzw. anthropologische Ansätzerichten ihr Augenmerk auf individuelle sowie gruppendynamische Motive der politischen Gewalt und gehen der Frage nach, welche gesellschaftlichen Erfahrungen auf persönlicher wie Gruppenebene diese begünstigen (Jaschke 2007: 122). Post (1990: 26) weist auf die Notwendigkeit hin, die psychologischen Faktoren der Gewaltanwendung zu eruieren, um die terroristische Gewalt im Sinne der"Suche nach Identität"zu interpretieren. Der Terrorist agiere seiner Hypothese zufolge nicht nur gegen den äußeren Feind,sonderner versuche auch, den inneren Feind zu beeinflussen:"Die Gruppenkohäsion, die entsteht, wird durch die externe Gefahr gesteigert, was die innere Brüchigkeit der Einheit gegenüber dem äußeren Feind reduziert"(zit. nach Daase 2001: 68). Da terroristische Vereinigungenzur Etablierungeines eigenen Weltbildes tendieren und die für die Gemeinschaft relevanten Informationen selektiv verarbeiten, neigen sie zu einem mit der Radikalisierung einhergehenden Realitätsverlust.[9]Daher gilt es, die Gruppendynamiken terroristischer Bewegungen unter die Lupe zu nehmen. Gruppenbezogene Erklärungsmuster liegen dem organisationssoziologischen Ansatz von Crenshaw (1992) zugrunde, der erklären soll, warum die Umwelt nur in der Entstehungsphase terroristischer Organisationen einebesondereRolle spielt, während für ihre Weiterentwicklung und Radikalisierung eher Gruppendynamiken sowie persönliche Motive ausschlaggebend sind. Das analytische Modell setzt voraus, dass Terrorismus eine kollektive Rationalität besitzt. Die Gruppe weise demnach als zentraler Akteur kollektive Präferenzen und Werte auf. Der Terrorismus wird hier nicht instrumentell, sondern als Ergebnis der internen Dynamiken ausgelegt. Den organisationsbezogenen Theorien liegt unter anderem der Rational-Choice-Ansatz zugrunde, der es ermöglicht, die auf den ersten Blick irrationalen persönlichen Motive in der gruppendynamischen"Semiosphäre"zu plausibilisieren. Dennoch kann der Rational-choice-Ansatz sowie die psychologischen bzw. anthropologischen Ansätze die Entstehung und den Wandel der Präferenzen nicht vollständig erklären.[10]
Das von Sofsky (1994) favorisierte und für die Terrorismusforschung vielversprechende"mikrosoziologische Studium kollektiver Gewalt"mit den Variablen der"Figuration, der Organisation, der Situation, der Eigendynamik sozialer Prozesse"wird in seiner Analyse"Zeiten des Schreckens. Amok, Terror und Krieg"(2002)größtenteilsentsoziologisiert und somit auf die anthropologische Beschreibung reduziert, so dass der Kontext sozialer Gewalt als nicht