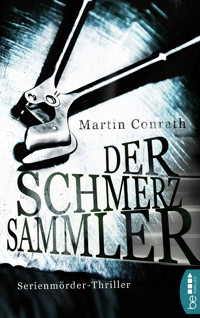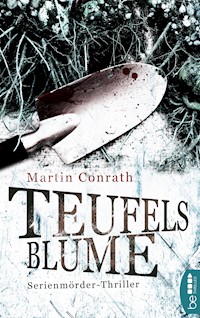
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Profilerin Fran Miller
- Sprache: Deutsch
Diese Blumen bringen den Tod!
In Düsseldorf wird eine Frauenleiche gefunden. Sie lag schon länger in der Erde, wurde dann exhumiert und mit großer Mühe adrett hergerichtet. In ihren gekreuzten Händen liegt eine Fledermauslilie, die im Volksmund auch »Teufelsblume« heißt. Fran Miller, Profilerin beim LKA und Sektenspezialistin, wird auf den Fall angesetzt. Bald findet man weitere Leichen, alle in ähnlichem Zustand, alle mit seltenen Blumen geschmückt. Wer ist der todbringende Gärtner? Und was hat es mit den Opfern auf sich? Eine nervenaufreibende Jagd beginnt ...
Fran Miller ermittelt auch in diesen Serienmörder-Thrillern: "Der Schmerzsammler" und "Ich werde töten".
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Zitat
Prolog
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Sonntag
Montag
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Noch 72 Stunden
Noch 63 Stunden
Noch 51 Stunden
Noch 40 Stunden
Noch 32 Stunden
Noch 28 Stunden
Noch 27 Stunden
Noch 26 Stunden
Noch 25 Stunden
Noch 24 Stunden
Epilog
Dank
Weitere Titel des Autors
Profilerin Fran Miller ermittelt:
Band 1: Der Schmerzsammler
Band 3: Ich werde töten
Über dieses Buch
Diese Blumen bringen den Tod!
In Düsseldorf wird eine Frauenleiche gefunden. Sie lag schon länger in der Erde, wurde dann exhumiert und mit großer Mühe adrett hergerichtet. In ihren gekreuzten Händen liegt eine Fledermauslilie, die im Volksmund auch "Teufelsblume" heißt. Fran Miller, Profilerin beim LKA und Sektenspezialistin, wird auf den Fall angesetzt. Bald findet man weitere Leichen, alle in ähnlichem Zustand, alle mit seltenen Blumen geschmückt. Wer ist der todbringende Gärtner? Und was hat es mit den Opfern auf sich? Eine nervenaufreibende Jagd beginnt …
Über den Autor
Martin Conrath schreibt Kriminalromane, von denen einer auch als »Tatort« verfilmt wurde. Außerdem ist er Teil des Autorenduos Sabine Martin, das erfolgreich historische Romane veröffentlicht. Martin Conrath lebt und schreibt in Düsseldorf.
Martin Conrath
Teufelsblume
Serienmörder-Thriller
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Für diese Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Heike Rosbach, Nürnberg
Lektorat: Daniela Jarzynka
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München unter Verwendung eines Motives © shutterstock: Sever180
eBook-Erstellung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-6980-9
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Es geht nirgends merkwürdiger zu als auf der Welt.
Kurt Tucholski
Prolog
»Lieber Gott, ich bin die Katrin. Vielleicht erinnerst du dich ja an mich, ich bete jeden Tag und bin ganz artig.
Heute war meine Mama da. Sie hat traurig geguckt. Ich sehe ja auch komisch aus, ohne Haare. Ich habe ihr gesagt, sie soll das nächste Mal früher kommen, nach dem Frühstück. Dann kommt nämlich der Clown, und der hat auch eine Glatze. Der Clown ist sehr lustig. Wir alle lachen viel. Auch die Sina, obwohl die nur ganz leise gelacht hat, weil sie doch so schwach ist. Für Sina habe ich heute ganz doll gebetet. Aber ich weiß nicht, ob du mich gehört hast. Du bist doch so weit oben im Himmel, oder?
Schwester Lydia ist neu hier. Sie ist nett! Sie hat immer Zeit für mich. Wir spielen mit ihr Mensch ärgere Dich nicht und Rummikub und Monopoly. Das Mittagessen war auch lecker. Hähnchen und Pommes und Erbsen. Es ist schön hier. Ich brauche nur auf den Knopf zu drücken, dann kommt jemand und fragt, was ich brauche.
Meine Schwester und mein Bruder waren auch hier. Sie sind aber nicht lange geblieben. Meine Schwester hat geweint.
Nachts ist es gruselig. Lieber Gott, ich weiß, dass ich nicht lügen soll. Ich sage immer die Wahrheit, auch wenn die Erwachsenen mir nicht glauben: Wenn das Licht aus ist, dann kommen die kleinen bunten Tiere. Sie sind ganz rund und haben ein weiches Fell. Sie sitzen einfach nur da und schauen mich und die anderen Kinder mit ihren großen runden Augen an. Vorgestern, da ist eins auf das Bett von Andy gekrabbelt und hat sich auf seinen Kopf gesetzt. Der hat das gar nicht gemerkt. Am nächsten Morgen war der Andy tot. Ist er jetzt bei dir? Geht es ihm gut? Kannst du ihm sagen, dass ich ihn vermisse?
Gestern wollte eins von den Tieren in mein Bett. Ich habe ganz laut geschrien, Lydia kam, und da ist es ganz schnell weggerollt und hat sich so gut versteckt, dass keiner es gefunden hat. Jetzt sitzt wieder eins da und schaut mich an. Die ganze Zeit. Ich kann nicht schreien. Ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Muss ich jetzt sterben? Komme ich jetzt zu dir und Andy? Und zu den anderen Kindern? Ich weiß, dass es nicht schlimm ist zu sterben, das hat Mama gesagt. Aber ich habe trotzdem furchtbare Angst und muss die ganze Zeit weinen …«
Montag
Frau Dr. Sola lächelte auf eine Art, die Fran nicht wütend machte. »Wie oft denken Sie daran, dass der Tod Sie erlösen kann?«, fragte sie.
»Nie.«
»Wir hatten eine Vereinbarung.«
»Manchmal«, gab Fran zu, obwohl das Wort ihr die Kehle verklebte.
»Was heißt manchmal?«
Manchmal hieß eigentlich oft: Immer dann, wenn die Verzweiflung Fran zu zerstören drohte. Immer dann, wenn Fran an den letzten Frühling denken musste. Immer dann, wenn Fran einen Trost brauchte, um von ihrer Trauer nicht zerrissen zu werden. »Das wissen Sie doch ganz genau, Frau Dr. Sola.«
»Das ist richtig. Aber das nützt Ihnen nichts. Wissen nützt Ihnen nichts. Es ist wichtig, dass Sie es aussprechen können.«
Fran öffnete den Mund, doch die Worte kamen nicht, sie klammerten sich in ihrem Bauch fest. Sie schloss den Mund wieder.
»Es macht Sie sprachlos, nach wie vor …«
Fran nahm das Glas, das vor ihr stand, und leerte es. Das Wasser schmeckte schal, immerhin war es kühl, drängte ein wenig die Hitze zurück, die Frans Kehle hochstieg.
Frau Dr. Sola konnte in ihr lesen wie in einem offenen Buch. Das war Fran immer wieder unheimlich, aber es war unumgänglich, damit die Therapie wirkte.
Fran betrachtete das Bild an der gegenüberliegenden Wand. Sie kannte inzwischen jedes Detail: ein Haus auf einem Hügel, umgeben von Lavendelfeldern. Südfrankreich. An siebenundzwanzig Stellen bröckelte der Putz von der Fassade, dessen Farbe in der Sonne schmerzhaft weiß strahlte. Die Lavendelfelder wurden durch sechs Wege horizontal und durch elf Wege vertikal geteilt. Auf dem vierten horizontalen stand eine alte Frau und winkte dem Betrachter zu. Sie trug einen schwarzen Rock und eine türkisfarbene Bluse. Ihr Haar war von einem weißen Tuch verdeckt, das sie wie einen Turban um den Kopf geschlungen hatte.
Die ersten Sitzungen waren grotesk gewesen. Fran hatte nicht reden können. Nicht über das, was ihr zu schaffen machte. Sie schüttelte innerlich den Kopf. Selbst jetzt noch, sogar in Gedanken verwendete sie Worte, die zu beschwichtigen suchten: »Zu schaffen machen.« Was für eine Verharmlosung! Stechmücken machten einem zu schaffen, störrische Arbeitskollegen, neurotische Nachbarn oder Straßenlärm. Was sie erlebt hatte, machte ihr nicht zu schaffen, es machte sie kaputt.
»Frau Miller?«
»Ja«, erwiderte Fran und stellte das Glas wieder zurück.
»›Ja‹ für sprachlos oder ›ja‹ für ›Ich habe Sie gehört‹?«
»Sprachlos.« Fran überlegte einen Moment. »Eigentlich ist das falsch. Wortlos trifft es besser. Mir fehlen die Worte, die Begriffe. Ich fühle nur. Nichts als Entsetzen. Und Scham.«
»Sie geben sich die Schuld«, sagte Frau Dr. Sola in einem Ton, der halb fragend, halb feststellend war.
War das die richtige Formulierung? Das treffende Wort? Sich die Schuld geben? War es nicht so, dass sie die Schuld einfach hatte, dass die Schuld über sie gekommen war wie eine Naturkatastrophe? Dass sie sich nicht hatte wehren können? Nein, sie hatte sich nie die Schuld gegeben, andere hatten ihr die Schuld gegeben, aber das änderte nichts daran, dass sie Schuld auf sich geladen hatte, die Schuld angenommen hatte wie einen streunenden verlausten Hund, der sich als reißende Bestie entpuppte.
»Ich habe die Schuld einfach. Sie ist in meine Seele eingebrannt wie ein Brandzeichen in die Haut einer Kuh. Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen.«
»Das ist ein sehr interessanter Aspekt, Frau Miller. Hat diese Sicht der Dinge Auswirkungen auf Ihr Leben?«
Mein Leben? Fran war sich nicht sicher, ob das noch ihr Leben war. Sie hatte Psychologie studiert, dann war sie zur Polizei gegangen, hatte die Ochsentour absolviert, und nach nur sieben Jahren war sie zur Kriminalhauptkommissarin befördert worden. Kurz darauf hatte das Landeskriminalamt sie abgeworben. Seitdem war sie Mitglied der Arbeitsgruppe Operative Fallanalyse und Spezialistin für Sekten. Nach dem Tag X, dem Tag, der ihr bisheriges Leben zerstört hatte, war sie als Referentin und Seminarleiterin immer öfter eingeladen worden. Zuerst hatte sie entsetzt abgelehnt, aber dann hatte sie begriffen, dass darin eine Chance lag, ihr Trauma in den Griff zu kriegen und gleichzeitig andere zu warnen, sich nicht so zu verhalten, wie sie es getan hatte: einem Mörder auf den Leim zu gehen, einen Alleingang zu wagen, der sie direkt in die Hölle geführt hatte. In einem Bunker auf einen Stuhl gefesselt hatte sie zusehen müssen, wie ihre Schwester gefoltert wurde, und sie hatte nicht verhindern können, dass der Mann, in den sie sich verliebt hatte, in einem Explosionsinferno ums Leben gekommen war. Sie hatte entschieden, ihre Schwester zu retten.
»Die Schuld ist über mich gekommen!«, sagte Fran und dachte: Ja, diese Sicht der Dinge beeinflusst mein Leben, und wie! Nur weil ich es so sehe, wie ich es sehe, lebe ich überhaupt noch. Nur weil mir klar wurde, dass ich die Schuld nicht gesucht habe, sondern die Schuld eines anderen auf mich übergegangen ist, weiß ich, dass ich kein schlechter Mensch bin, dass es nicht Egoismus war, der mich damals gelenkt hat.
»Diese Sicht ist meine Lebensversicherung, Frau Dr. Sola«, flüsterte Fran.
»Eine gute Lebensversicherung, Frau Miller.« Frau Dr. Sola schaute zur Uhr. »Die Zeit ist mal wieder um. Ich denke, Sie sind auf einem guten Weg.«
»Sie halten mich nicht mehr für selbstmordgefährdet?«
Frau Dr. Sola seufzte. »Ich habe Sie nie als selbstmordgefährdet eingestuft. Wenn es so gewesen wäre, hätte ich Sie einliefern lassen. Das ändert nichts daran, dass Sie Ihr Trauma noch nicht überwunden haben. Aber daran arbeiten wir, solange es notwendig ist. Sie sind auf einem guten Weg, wie gesagt. Ich habe erneut eine Verlängerung der Therapie beantragt, und glauben Sie mir, sie wird genehmigt werden.«
Das war eine gute Nachricht. Fran hätte die Therapie nicht bezahlen können. Die ersten sechs Monate hatte sie wöchentlich zwei Termine gehabt, danach einen pro Woche.
Fran und Frau Dr. Sola standen gleichzeitig auf. Sie schüttelten sich die Hände. Fran genoss den Blick in die Augen von Frau Dr. Sola. Sie leuchteten smaragdgrün, und obwohl diese Farbe eher kalt war, strahlten ihre Augen Wärme aus.
»Wir sehen uns dann etwas früher diesmal, am Mittwoch um achtzehn Uhr«, sagte Frau Dr. Sola und geleitete Fran nach draußen.
Aus dem Wartezimmer kam ein Mädchen auf sie zugestürmt. »Mama! Endlich! Ich habe Hunger!«
Frau Dr. Sola verzog das Gesicht, dann lächelte sie. »Meine Tochter Emily.«
Emily blieb vor Fran stehen und streckte die Rechte aus. »Guten Tag.«
Wie Anne, dachte Fran. Sie sieht genauso aus wie meine Schwester, als sie acht oder neun war. Ein Rauschgoldengelchen mit einer Ausstrahlung, die es schwermachte, ihr böse zu sein. Fran nahm die kleine zarte Hand.
»Hallo Emily, ich bin Fran.«
Sie drückte Frans Hand erstaunlich fest. Ein selbstbewusstes Mädchen. Gut.
»Kommst du aus Amerika?«, fragte Emily.
»Mein Vater kommt aus Amerika. Meine Mutter ist von hier. Eigentlich heiße ich Franziska, aber das finde ich blöd.«
»Stimmt. Franziska klingt doof. Wie findest du Emily?«
Frau Dr. Sola holte tief Luft.
»Sehr schön«, sagte Fran schnell.
»Na prima«, sagte Frau Dr. Sola. »Dann wäre das ja geklärt. Jetzt müssen wir los, sonst bekommst du nie was zu essen.«
»Na dann. Auf Wiedersehen, Emily.« Fran winkte noch einmal, dann zog sie die Tür der Praxis hinter sich zu und trat auf die Straße.
Dichte Wolken hingen über der Stadt, es war kaum zehn Grad warm, obwohl es schon Mitte Mai war. Der Frühling sollte eigentlich mit Wärme und Sonne die unterkühlte Stadt auftauen, aber er schien nachholen zu wollen, was der Winter versäumt hatte.
Fran fröstelte und zog den Reißverschluss ihrer schwarzen Lederjacke bis zum Hals zu. Einen Moment lang dachte sie, man habe ihr Fahrrad gestohlen, doch dann fiel ihr ein, dass sie mit ihrem neuen Auto hier war.
Sie spähte die Straße hinunter. Blau-metallisch schimmerte die Karosserie zwischen den anderen Wagen hervor, der Heckspoiler machte klar, dass es sich nicht um eine Familienkutsche handelte, sondern um einen Sportwagen, dafür gebaut, schnell zu fahren.
Sie hatte lange gesucht, einige Händler fast um den Verstand gebracht. Im Internet war sie auf den Fanclub dieses Fahrzeugs gestoßen. Sie wollte schon wegklicken, doch als sie noch einmal hinschaute, stellte sie fest, dass sie genau dieses Auto gesucht hatte. Dem Club würde sie niemals beitreten, aber man hatte ihr dort bereitwillig Auskunft gegeben, welches Modell für sie am geeignetsten war. Zwei Wochen später stand ihr gebrauchter Impreza vor der Tür, das Modell gab es nicht mehr, und die Nachfolger sahen aus wie alle anderen Spießerkisten auch. Mit sechzigtausend Kilometern auf dem Tacho war der Wagen so gut wie neu.
Sie drückte auf die Fernbedienung, hörte das Klacken der Verriegelung; drei Mal leuchteten die Blinklichter auf, der Diener begrüßte seine Herrin, es sah aus wie das Blinzeln gelber Augen, Augen, die auch zu einem Wesen aus der Unterwelt gepasst hätten.
Dienstag
»Los, gib mir das Feuerzeug«, sagte Kevin. Er war gerade vierzehn Jahre alt geworden, sah aber aus wie sechzehn. Sein Freund, dem seine Eltern den vollkommen bekloppten Namen Alfred gegeben hatten, war tatsächlich sechzehn, aber einen Kopf kleiner.
Alfred schüttelte den Kopf. Er griff in die Tüte und zog einen Feuerwerksknaller hervor, einen Donnerschlag. »Den lass ich hochgehen, und zwar in Rekordzeit, dann kannst du dir einen aussuchen. Hast du die Stoppuhr bereit?«
Widerwillig nickte Kevin. Sie hatten vorher ausprobiert, wie lange die Zündschnur brannte. Zu ihrem Entzücken war es nie dieselbe Zeit. Die kürzeste waren viereinhalb Sekunden gewesen, die längste sechs. Eine halbe Ewigkeit.
Alfred zündete den Böller an und betrachtete die zischende Zündschnur. Die Sekunden tickten. Eine, zwei, drei. Jetzt wäre es gut gewesen, das Ding wegzuwerfen.
Wie jedes Jahr hatten sie an Silvester ihr ganzes Taschengeld in Feuerwerk umgesetzt, damit der Vorrat mindestens bis in den Frühling reichte. Als Übungsgelände hatten sie ein Waldstück ausgesucht, das nicht von Forstarbeitern heimgesucht wurde. Niemand schlug Holz, niemand räumte tote umgestürzte Bäume beiseite, niemand ging hier spazieren. Perfekt! Sie hatten am nächsten Tag frei und würden die ganze Nacht hier verbringen. Sie hatten sich mit Schlafsäcken, Energieriegeln und Bier ausgerüstet und ihren Eltern erzählt, sie würden bei einem Freund übernachten.
Langsam wurde es Zeit. Alfred wollte wirklich aufs Ganze gehen. Kein Wunder. Sie hatten darum gewettet, wer der Mutigste war, wer den Böller am längsten in der Hand hielt. Der Einsatz: jeweils ihr halbes Monatstaschengeld, vierzig Euro von Alfred und dreißig von Kevin. Man konnte sagen, was man wollte, aber Alfred war echt fair. Er hatte zehn Euro mehr in den Pott eingezahlt. Kevin machte einen Schritt rückwärts, er hatte keinen Bock darauf, irgendwelche heißen Teile ins Gesicht zu bekommen. Fünf Sekunden. Noch ein Schritt rückwärts. Sechs Sekunden. So lange hatte noch keine Zündschnur gebrannt. Sieben. Alfred schien den Böller in seiner Hand gar nicht mehr zu sehen. Er hatte irgendwie abgeschaltet.
»Scheiße!«, schrie Kevin, tat einen Satz nach vorn, schlug Alfred den Böller aus der Hand, schloss die Augen und riss ihn zu Boden. Sie rollten sich ab, und im selben Augenblick flogen ihnen die glühenden Fetzen des Böllers um die Ohren. Der Lärm der Explosion machte Kevin für einen Moment taub. Dann hörte er Alfreds Schreien. Verdammte Scheiße, dachte Kevin, hat’s ihn doch erwischt? Als er die Augen öffnete, begriff er, warum Alfred schrie, und stimmte in das Gebrüll mit ein.
*
Schon die ersten Töne von »Like a Satellite« rissen Fran aus dem Schlaf. Entgegen der Empfehlung von Frau Dr. Sola und obwohl er unentwirrbar mit den schwärzesten Stunden ihres Lebens verbunden war, hatte sie sich nicht dazu durchringen können, den Klingelton ihres Handys zu wechseln. Sie liebte dieses Lied, obwohl es Teenie-Kram war.
Fran schaute zuerst auf die Uhr. Giftiggrüne Ziffern leuchteten ihr entgegen: vier Uhr und siebenundzwanzig Minuten. Dann identifizierte sie die Nummer auf dem Display ihres Telefons. Es war Sascha Herz, leitender Hauptkommissar des Kriminalkommissariats 11 in Düsseldorf, das sich unter anderem mit Mord und Totschlag befasste. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Und das heute. Um zwei musste sie in Wiesbaden sein. Jörn Vogler, der Chef des Bundeskriminalamtes, hatte sie eingeladen, einen Vortrag über ihre Arbeit zu halten: Operative Fallanalyse, salopp auch Profiling genannt, und ihr Spezialgebiet Sekten und Okkultes.
»Guten Morgen, Sascha.«
»Du klingst, als hättest du noch gar nicht geschlafen.«
Fran mochte Saschas warme Stimme und seine ruhige Art, die Dinge anzugehen. Sie hatte ihn im letzten Jahr während der Mordermittlung kennengelernt, die ihr Leben von Grund auf verändert hatte.
»Ich war früh im Bett, und mehr als sechs Stunden brauche ich nicht. Wie schlimm ist es?«
»Ziemlich. Nicht viel übrig. Ein Skelett. Zieh dich warm an. Kannst du kommen?«
»Eilig?«
»Schnelldusche geht. Taxi steht vor der Tür. Bis gleich.«
Fran trennte die Verbindung, knipste die Nachttischlampe an, schaute sich kurz um, aber seit sie ins Bett gegangen war, hatte sich nichts verändert.
In fünf Minuten hatte sie sich geduscht und angezogen. Vor der Tür stand ein Streifenwagen, sie konnte die Beamten nicht erkennen, ihre Gesichter verschwanden im Schatten einer Baumkrone, hinter der eine Straßenlaterne stand. Sie stieg hinten ein, gurtete sich an und fragte, wo es hingehe.
»Ratingen.«
Die Stimme trieb Fran augenblicklich den Schweiß auf die Stirn. Was zum Teufel hatte ihr Vater hier verloren? Der »große« James Miller, der sich nach wie vor als Herr der alleinigen Wahrheit betrachtete. Der seine Tochter als ehrgeizigen Emporkömmling betrachtete. Der sie nicht einmal im Krankenhaus besucht hatte, als sie dort mit dem Tod gerungen hatte. Den sie seit fast einem Jahr nicht gesehen hatte und den zu treffen, geschweige denn ein Wort mit ihm zu wechseln sie nicht erpicht gewesen war. Daran hatten auch ihre Besuche bei Mum nichts geändert. Genauso wenig die Therapie. Machte er jetzt Doppelschichten?
Ihr wurde die Kehle eng, Trauer und Wut stiegen ihr in den Kopf, ausgelöst durch die Ohnmacht ihrem Vater gegenüber.
»Aha.« Mehr brachte sie nicht heraus. Sie warf einen Blick in den Rückspiegel: Ihr Vater saß am Steuer, den düsteren Blick starr geradeaus gerichtet.
Sein Kollege ergriff das Wort. »Das KK11 hat Sie angefordert, Frau Miller, KHK Sascha Herz, um genau zu sein. Weil es wohl Unklarheit darüber gibt, wie die Tat einzuordnen ist.«
Fran räusperte sich. »Details? Männlich? Weiblich? Identifiziert? Lagebild?«
»Geschlecht unbekannt«, sagte der Kollege. »Identität unbekannt. Unklare Lage. Zwei Jungs haben die Leiche gefunden. Die wollten da übernachten. Die haben ihr ganz privates Halloween erlebt. Die Kollegen aus Mettmann haben den ersten Sicherungsangriff durchgeführt und dann uns angerufen. Die Gerichtsmedizin ist unterwegs.«
»Danke«, sagte Fran und lehnte sich zurück. Wenn Düsseldorf eingeschaltet wurde und die Abteilung Operative Fallanalyse, hieß das eindeutig, dass es um etwas Größeres ging. Hoffentlich kein Kind oder, noch schlimmer, ein Säugling.
»Wie alt?« Fran hörte ihre Stimme zittern.
»Erwachsen. Mehr weiß ich nicht.«
Wenigstens das blieb ihr erspart. Schon zu ihrer Zeit auf Streife hatte sie sich immer darum gedrückt, wenn es um Gewalt gegen Kinder gegangen war. Und je weniger sie wusste, desto besser. Eigentlich hatte sie schon zu viel gefragt. Zu viel Wissen machte sie voreingenommen, verstellte ihr den Blick.
Der Kollege versank in Schweigen, auch ihr Vater gab keinen Laut von sich. Er fuhr los, das Blaulicht zuckte durch die Nacht. Das Martinshorn würde er nur einschalten, wenn jemand vor sich hin träumte und das Blaulicht nicht sah.
Die Stadt schien zu gähnen, wachte langsam auf. Auf den Straßen waren die ersten Frühaufsteher unterwegs, das große Rennen würde erst ab acht Uhr losgehen, sich bis elf hinziehen. Dann war an manchen Stellen kein Durchkommen mehr.
Von ihrem Vater schien Hitze auszugehen. Sie drückte sich in den Sitz, versuchte so weit wie möglich von ihm abzurücken. Aber es wurde nicht besser. Sein ausrasierter Nacken starrte sie an, das volle graue Haar war exakt in der Mitte des Schädels gescheitelt, kein einziges Härchen tanzte aus der Reihe. So hatte es sich James Miller auch für seine Familie vorgestellt. Jedes Mitglied hatte seine Rolle, und wehe, jemand lehnte sich gegen den göttlichen Plan des James Miller auf.
Fran hatte es geschafft, sich freigemacht, sie lebte ihr eigenes Leben. »Lüg dich nur selber an!«, rief eine Stimme in ihr. »Dein eigenes Leben? Dass ich nicht lache! Du fängst an zu zittern, wenn du die Stimme deines Vaters hörst. Wie erbärmlich ist das denn?«
Fran vertrieb die schlechten Gedanken, konzentrierte sich auf das, was vor ihr lag. Eine Leiche. Ein Skelett. Ein komplexer Tatort. Fragen. Entscheidungen. Sie drehte den Kopf zur Seite, die Stadt flog an ihr vorüber. Sie fuhren nach Norden, am Flughafen vorbei, ein Stück Autobahn, dann Landstraße, schließlich ein Waldweg. Scheinwerfer blendeten, der Wagen hielt an. Frans Vater schwieg, machte keine Anstalten, auszusteigen. Fran murmelte »Danke«, stieß die Tür auf, stieg aus und achtete darauf, sie leise und sanft zu schließen. Kaum stand sie an der Absperrung, rammte ihr Vater den Rückwärtsgang rein und preschte davon. Fran blickte dem Streifenwagen hinterher, seufzte und wandte sich einem Kollegen in Uniform zu, der offensichtlich den Zugang zum Fundort bewachte.
»Fran Miller …«
Mit einer zackigen Bewegung hob der Mann das Flatterband und zeigte den Weg entlang. »Kollege Herz erwartet Sie. Da vorne rechts.«
Sein Atem kondensierte. Fran genoss die kalte Luft, die zumindest von außen die Gluthitze in ihrem Körper etwas linderte.
Sascha kam auf sie zu, lächelte; er legte ihr eine Hand sanft auf die Schulter. »Wie geht es dir?«, fragte er.
Fran wusste, dass er die Frage ernst meinte. Sascha meinte alles ernst, was er sagte, und trotzdem war er ein fröhlicher Mensch, trotz des Berufes, den er ausübte. Oder war er fröhlich, weil er alles ernst meinte, was er sagte?
»Nicht so schlecht«, antwortete Fran. Seine Hand auf ihrer Schulter war angenehm. Die Zuwendung eines Freundes. Ohne Hintergedanken. Unkompliziert. »Frau Dr. Sola ist wirklich gut.«
Es war ein offenes Geheimnis, dass Fran in psychotherapeutischer Behandlung war.
»Aber es dauert halt.« Fran blickte Sascha in die Augen, er verstand.
»Gut.« Er nahm die Hand weg und deutete auf die Scheinwerfer und die Sichtblenden. Die Leute vom Erkennungsdienst bewegten sich in aller Ruhe. In dem kalten grellen Scheinwerferlicht sahen sie aus wie Gespenster, weiße Schutzanzüge, Gesichtsmasken. Das Licht hob die Umrisse der Menschen hervor, stanzte sie aus der Dunkelheit, sie leuchteten, als hätten sie eine sichtbare Aura.
»Und?«, fragte Fran
»Die Leiche ist in einem besonderen Zustand.« Sascha rieb sich die Nasenwurzel. »Am besten, du schaust es dir selber an. Alles andere erzähle ich dir danach.«
Fran legte den Anzug an, dann musste sie warten. Die Spurensicherung hatte noch keinen Pfad abgesteckt und noch keine Trittplatten ausgelegt, die dazu dienten, dass sich die Kollegen am Tatort bewegen konnten, ohne ihn zu verunreinigen oder Spuren zu zerstören.
Fran schaute sich um. Sie war noch nie hier gewesen. Ein naturbelassenes Waldstück, eine Straße, ein Feldweg. Einsam. Dichtes Gebüsch. Bestens geeignet, um eine Leiche abzulegen, die nicht gefunden werden sollte. Die Luft roch frisch, kein durchdringender Verwesungsgeruch.
»Warum hast du mich gerufen?«, fragte Fran in die kalte Luft, die langsam in ihre Glieder kroch.
Bevor Sascha antworten konnte, winkte der verantwortliche Einsatzleiter der Spurensicherung und zeigte auf einen Weg, der nun mit Flatterband markiert war und ins Unterholz führte. Noch war es dunkel, obwohl sich die Dämmerung schon ahnen ließ. Ohne Scheinwerfer und Markierung hätte Fran nach ein paar Metern die Orientierung verloren. Der Wald war dicht wie ein Dschungel.
»Na dann los«, sagte Sascha und ging vor. Er hatte ebenfalls einen Schutzanzug angelegt, der auch ihm die Persönlichkeit nahm; er sah jetzt genauso aus wie alle anderen, genauso wie Fran. Nur Konturen waren noch auszumachen, größere, kleinere, dickere, dünnere. Wie eine Prozession Untoter liefen sie den markierten Weg entlang, drückten Äste zur Seite und mussten einen riesigen Baumstumpf umgehen, der wie ein Fels aus dem Boden ragte. Es lag noch ein Geruch in der Luft. Schießpulver. War geschossen worden?
Noch einmal mussten sie stehen bleiben, der Fotograf war auf einen Baum geklettert, um ein Bild von oben zu schießen. Es blitzte mehrmals, dann war der Weg frei. Um die Leiche waren keine Sichtblenden aufgestellt, der Wald war so dicht, dass er den Tatort vor Gaffern und den Teleobjektiven etwaiger Pressefotografen abschirmte, die sich eine Leiche schneller zu Gemüte führten als die Fleischfliegen – wenn man sie ließ. Wobei Fleischfliegen wesentlich leichter zu verscheuchen waren als Journalisten. In diesem Fall aber hatten die echten Fleischfliegen das Nachsehen. Von der Leiche war tatsächlich nur noch das Skelett übrig.
Ein braun verfärbter Schädel grinste ihr entgegen, schien sich noch im Tod über sie lustig zu machen. Jetzt stieg ihr leichter Verwesungsgeruch in die Nase. So leicht und flüchtig wie eine salzige Brise an der Nordsee, die einem bei geschlossenen Augen sagt, wo man ist, was man zu erwarten hat. Die Nordsee wäre ihr eindeutig lieber gewesen.
Ein paar Gewebefetzen klebten noch hie und da am Knochen. Was es im Einzelnen war, konnte Fran nicht sagen, da musste das Labor ran. In diesem Zustand konnte es Haut sein, oder Muskeln oder Sehnen, eben alles, was an einem Schädel zu finden ist. Keine Haare. Aber etwas konnte Fran am Schädel erkennen, das nicht zum Fundort passte: Dreck. Erde. Schmutz. Hell und krümelig, durchsetzt mit dunklen Partikeln. Der Boden hier war schwarz, die Leiche war also eindeutig von einem anderen Ort hergebracht und hier abgelegt worden.
Die Armknochen lagen gekreuzt über dem eingefallenen Brustkorb. Am Handskelett fehlten ein paar Knochen, der Mittelfinger war nicht vollständig, die Handwurzel der rechten Hand war durcheinandergeraten, weil kein Gewebe mehr vorhanden war, das die Knöchelchen an der richtigen Stelle hielt. Unter den Knochen machte sie eine unverrottbare Plane aus. Das erklärte, wie die losen Knochen hierher gebracht worden waren. Nach dem Transport waren sie neu sortiert worden.
Fran beugte sich vor. Wer immer die Leiche hergerichtet hatte, war, was Anatomie anging, kein Laie. Die meisten Knochen waren an der richtigen Stelle platziert. Das war besonders bei der Wirbelsäule nicht so einfach. Die Knochen der einen Hand waren korrekt aneinandergelegt, die der anderen nicht. Jeder Student, der sich mit Anatomie auseinandersetzen musste, lernte den Merkspruch, der die Position der Handwurzelknochen beschrieb: »Es fährt ein Kahn im Mondenschein dreieckig um das Erbsenbein, vieleckig groß, vieleckig klein, der Kopf, der muss beim Haken sein.« Aber das Kahnbein war um hundertachtzig Grad verdreht, das Vieleckbein war in der Mitte zwischen Kopfbein und Hakenbein platziert. Vollkommen falsch. So konnte ein Handgelenk nicht funktionieren.
Fran rief sich zur Ordnung. Sie wertete, was sie sah. Genauso gut konnte es möglich sein, dass die Anordnung bewusst gewählt worden war. So wie alles an dieser Leiche augenscheinlich planvoll hergerichtet war.
Zwischen den Knochen der beiden Hände war eine Pflanze drapiert. Eine ganz besondere Pflanze! Deswegen hatte Sascha sie verständigt. Schwarz glänzend streckten sich Fran die langen schwarzen Fäden der Blüte einer Fledermauslilie entgegen. Und die Fledermauslilie hieß im Volksmund Teufelsblume.
*
Ich schlage das Tagebuch meiner Mutter auf. Es fällt mir nicht leicht, darin zu lesen, aber es muss sein. Ich muss mich den Schatten aussetzen, die aus der Vergangenheit immer wieder über mich fallen. Manchmal finde ich auch tröstende Worte, finde Antworten auf schwierige Fragen.
Ich nehme das ledergebundene Buch in die Hand. Es trägt die Nummer zwölf und umfasst das Jahr 1972. Wie weich die Oberfläche ist! Samtig wie Babyhaut. Mutter hat mir die Tagebücher gegeben, hat gesagt: »Bei dir, Hannah, sind sie sicher, und du darfst sie lesen, ich habe keine Geheimnisse vor meiner Tochter.« Ich blättere die Stelle auf, an der ich gestern aufgehört habe. Sommer 1972. Ich lese die ersten Worte, und schon höre ich die Stimme meiner Mutter, obwohl sie oben im Bett liegt und schläft. Sie schreibt so lebendig, als würde sie mir es erzählen, es ist, als wäre ich dabei. »An erster Stelle muss die Familie stehen. Ich kann nicht verstehen, wie man das anders sehen kann. Es ist doch ein Schwur, den ich geleistet habe vor Gott und den Menschen! ›Bis dass der Tod uns scheidet.‹ Treu zueinander stehen in guten wie in schlechten Tagen. Dazu stehe ich, und dazu werde ich immer stehen.
Rüdiger ist ein guter Mann, da können die Leute sagen, was sie wollen. Er kümmert sich um alles. Er verdient gutes Geld, und sein Beruf ist nicht einfach. Ständig ist er auf Achse, aber am Wochenende ist er immer zu Hause. Dadurch verdient er etwas weniger als andere. Wir verbringen eine gute Zeit miteinander, und ich erfülle gerne meine ehelichen Pflichten. Es ist ja nie lange, und er gibt sich Mühe, mir nicht wehzutun.
Rüdiger hat recht behalten, dass wir den Kommunisten zeigen werden, wer wir sind. Vom Platz gefegt haben wir sie und sind Fußballeuropameister geworden, so wie sich das gehört. Schon vom ersten Spiel an hat Rüdiger gesagt: ›Diesmal geben wir es ihnen! Egal wer im Endspiel gegen uns antreten muss, er hat schon verloren.‹
Wenn nur das mit Torsten endlich aufhören würde. Gestern hat er schon wieder einen Vogel mitgebracht. Gefunden hätte er ihn, das hat er behauptet, aber ich kann ihm nicht glauben. Das arme Tier hatte beide Flügel gebrochen, ein Bein war ihm ausgerissen worden.
Ständig schleppt er irgendwelche Tiere an, und wenn ich sie ihm wegnehme, gerät er außer sich und besteht darauf, sie zu begraben. Hinten im Garten ist schon ein ganzer Friedhof. Er ist doch erst fünf Jahre alt! Wie kann so etwas sein? Hoffentlich merken sie im Kindergarten nichts davon. Sonst sagen sie alle, der Torsten, der ist verrückt. Wie verrückt muss dann erst die Mutter sein?
Bis jetzt hat sich niemand beschwert, Gott sei Dank! Rüdiger sagt, wir sollen den Jungen nach dem Sommer in die Schule schicken. Ich finde, es ist zu früh. Aber wenn er darauf besteht, werde ich es natürlich machen. Vielleicht ist es ja auch gut für Torsten; die anderen Kinder, die Disziplin, Lehrer, die nichts durchgehen lassen. Mein Sohn ist ein intelligentes Kind. Wir haben ihn testen lassen, er hat einen IQ von einhundertachtundzwanzig. Damit kann er studieren und Professor werden, und genau so soll es auch sein. Rüdiger hat recht, wenn er sagt, dass unsere Kinder es besser haben sollen als wir. Wir haben uns noch nicht entschieden, was Torsten studieren soll. Vielleicht Medizin? Oder Jura? Nein, ich möchte, dass er in die Wirtschaft geht. Da ist das meiste Geld zu verdienen. Er soll ins Bankgeschäft.
Morgen kommt Rüdiger von einer Tour zurück. Am Montag hat er Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer. Wenn er besteht, kann er als Disponent arbeiten und muss nicht mehr mit dem LKW unterwegs sein. Ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll.«
Ich klappe das Tagebuch wieder zu. Genug für heute. Ich habe noch viel zu tun, muss mich um Katrin kümmern, muss waschen, muss einkaufen und Essen kochen für Torsten.
*
»Das sieht nicht gut aus, oder was meinst du?«, sagte Sascha, der plötzlich hinter Fran stand.
Fran zuckte zusammen. »Du bist leise wie eine Katze, Sascha. Du hast mich erschreckt.«
Er trat neben sie. »Entschuldige, aber du warst so vertieft, dass du mich nicht gehört hast.«
»Schon gut, ich habe es überlebt.«
»Was meinst du? Hat der Teufel seine Hand im Spiel?«
Fran lächelte. »Hat er sie nicht immer im Spiel, wenn jemand ermordet wird?« Sie hustete. »Obwohl wir noch gar nicht wissen, wie das Opfer ums Leben kam.«
»Es muss eine Zeit lang in der Erde gelegen haben.«
»Zweifellos. Vielleicht ein Teufel mit Spaten, der auf die Idee gekommen ist, sich ein paar gebrauchte Seelen zu besorgen«, sagte Fran.
»Gebrauchte Seelen?« Sascha verzog das Gesicht.
»Stell dir vor, du stirbst«, sagte Fran.
»Ich versuche es, aber ich muss gestehen, das ist nicht ganz einfach.«
»Du bist ein guter Mensch, zumindest, soweit ich dich kenne.«
Sascha verneigte sich leicht. »Danke für die Blumen.«
»Bedank dich nicht zu früh, das dicke Ende kommt noch. Du stirbst also, klopfst an die Himmelspforte, wirst eingelassen, deine Weste ist weiß. Aber dann passiert es. Nach kurzer Zeit geht dir das Gejaule der Engel auf den Keks, die von morgens bis abends nichts Besseres zu tun haben, als langweilige Lieder zur Ehre ihres Chefs zu singen. Also machst du einen Termin mit Gott und erklärst ihm, dass du es im Himmel nicht mehr aushältst, dass du lieber woanders hinwillst. In die ewigen Jagdgründe zum Beispiel. Oder zu den zweiundsiebzig Jungfrauen. Das passt für einen Bullen einfach besser. Gott zuckt mit den Schultern und meint, er wolle niemanden gegen seinen Willen festhalten und ob du es dir nicht noch mal überlegen willst. Prima, denkst du. Gott ist ja doch ganz okay. Du sagst, du möchtest lieber gehen. Er grinst dich an, es macht plopp – und deine Seele ist weder im Himmel noch in der Hölle, sondern in einem Nichts. Du fühlst nichts, bist nur einfach bei Bewusstsein. Ziemlich unangenehm.«
»Und jetzt kommt der Teufel ins Spiel, der mit irgendeinem satanischen Spruch meine – gebrauchte, weil aus dem Paradies kommende – Seele in die Hölle holt.«
Fran klatschte in die Hände. »Exakt. Aus dieser Zwischenwelt bedient sich der Teufel, wenn er nichts Besseres findet.«
»Aber was hat Gott davon? Und warum komme ich zuerst in den Himmel, wenn er eigentlich wissen müsste, dass ich gar nicht dahinwill? Er ist doch unfehlbar und allwissend.«
»Ich muss euch leider enttäuschen.«
Fran und Sascha fuhren herum.
Ein Gespenst stand vor ihnen. Weiß vom Kopf bis zu den Unterschenkeln, nur die Füße waren in blauen Kunststoff gehüllt. »Gott ist fehlbar, und Polizisten kommen grundsätzlich nicht in den Himmel! Harald Machinsky, angenehm.« Die Stimme klang gedämpft, der Mundschutz filterte die hohen Frequenzen heraus.
»Unser neuer Leichenschnippler«, sagte Sascha. »Das ist …«
Harald Machinsky unterbrach Sascha. »Fran Miller, ich weiß.«
»Woher kennen Sie mich?« Fran konnte sich nicht daran gewöhnen, so etwas wie ein B-Promi geworden zu sein.
»Das ging doch durch die Presse, vorwärts und rückwärts. Frage mich, warum Sie noch niemandem die Geschichte verkauft haben.«
Fran lachte. »Weil niemand sie haben wollte.«
»Echt jetzt? Das ist doch der Stoff, aus dem die Boulevardblätter gemacht sind. Schlagzeile: ›Sekten-Jägerin in den Fängen des Teufels‹.«
Sascha hustete. »Was können Sie über die Leiche sagen?«
Harald Machinsky seufzte. »Also die Leiche ist kürzlich ausgegraben und eindeutig auf der Plane transportiert worden. Die Bodenanhaftungen sind nicht vertrocknet. Anhand der Kopfform und des Beckens bin ich mir sicher, dass es eine Frau ist. Der Verwesungszustand ist sehr weit fortgeschritten, wie Sie sehen, so gut wie skelettiert. Keine Haare, das ist schon seltsam, kein nennenswertes Gewebe. Liegezeit? Keine Angaben. Todeszeitpunkt? Keine Angaben. Todesursache? Keine Angaben. Das wird ein Dauerbrenner. Wenn wir Glück haben, finden wir was über den Zahnstatus. Alter: so zwischen sechzehn und fünfzig. Sehr wahrscheinlich eine Weiße. Alles andere kriegen wir im Labor raus.«
»Danke.« Sascha Herz wandte sich Fran zu. »Was meinst du?«
Fran verstand nicht. »Wozu?«
»Die Blume.«
»Nichts.«
»Wie, nichts?«, fragte Sascha.
»Das ist alles viel zu wenig, um daraus irgendwelche vernünftigen Schlüsse ziehen zu können. Nur weil diese Pflanze im Volksmund Teufelsblume heißt, bedeutet das nicht, dass irgendeine Sekte, und schon gar nicht eine satanistische, etwas damit zu tun hat. Ehrlich gesagt verringert das sogar die Wahrscheinlichkeit, denn ich kenne keine Sekte, die sich mit dieser exotischen Schönheit schmückt. Für euch ist es aber ein guter Ansatz. Findet raus, wer diese Pflanze im Gewächshaus hegt und pflegt. Dann seid ihr einen gewaltigen Schritt weiter. Sie wächst nicht einfach so im Garten.« Fran wunderte sich, dass sie Sascha erklären musste, wie er seinen Job zu erledigen hatte.
»Ich bin ehrlich gesagt etwas überrascht, Fran.« Er zog sie beiseite. »Eine ausgegrabene Leiche, die rituell zurechtgemacht ist mit einem aussagekräftigen Requisit – und du hältst es nicht für schwarze Magie?«
»Rituell ist deine Interpretation.« Fran hob einen Zeigefinger. »Weißt du, das ist mir zu dick. Das ist, als würde jemand mit Neonbuchstaben auf die Straße sprühen: ›Sekte bei der Arbeit‹. Wir wissen noch nicht einmal, ob es sich um ein Kapitalverbrechen handelt.«
Sascha rieb sich die Nasenwurzel. »Okay. Kein Thema. Ich stelle meine Frage anders. Was siehst du? Welches Szenario kannst du dir vorstellen? Wie kommt die Leiche hierher? Warum?«
»Viele Fragen auf einmal. Die Anordnung der Handwurzelknochen ist dir aufgefallen?«
Sascha schüttelte den Kopf. »Was ist damit? Stimmt was nicht? Machinsky ist nichts aufgefallen. Oder er hat es nicht für bedeutsam erachtet.«
»Wenn jemand versucht hat, die Handwurzel korrekt zu restaurieren, war er ein Laie. Das bezweifle ich, weil die Handwurzelknochen der einen Hand richtig angeordnet sind. Der Täter weiß also, wie es geht. Es war Absicht, aber ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Auf jeden Fall wurde das Skelett zusammengepuzzelt. Es muss beim Transport durcheinandergeraten sein. Der Fundort spricht dafür, dass man die Leiche nicht sofort finden sollte und dass der Täter kein großes Risiko eingehen wollte, entdeckt zu werden. Es dauert schließlich eine Weile, über zweihundert Knochen fein säuberlich zu einem ordentlichen Skelett anzuordnen, egal ob Laie oder Spezialist.«
Sascha nickte. Fran wusste, dass er diese Schlüsse auch schon gezogen hatte. Sie wusste auch, dass Sascha normalerweise gewissenhaft bei der Sache war und lieber hundert Spuren nachging, die nicht erfolgversprechend aussahen, um nur ja nicht die eine zu übersehen, die den Durchbruch in Form des Schuldbeweises bringen konnte oder den Verdächtigen entlastete. Das machte ihn in den Augen seiner Vorgesetzten zu einem unbequemen Mann, der viel Geld verbrauchte. Aber noch genoss Sascha Vorschusslorbeeren, denn sein ehemaliger Chef und Mentor, Benjamin Haller, genannt Senior, hatte ihn wärmstens empfohlen. Und so wie Fran Senior kannte, hatte er bei der Beförderung die Hand im Spiel gehabt.
»Also könnte jeder mit einem Anatomiebuch ein Skelett zusammenbasteln?«
»Siehst du?«, sagte Fran. »Es hat nichts zu bedeuten. Es muss kein Arzt gewesen sein, der hier das Opfer seines Kunstfehlers entsorgt hat.«
»Und die Blume?«
»Die Teufelsblume eröffnet viele Interpretationsmöglichkeiten. Wenn es um eine Sekte geht, dann eine, die ich nicht kenne, mit neuen Ritualen, äußerst morbiden, ohne Zweifel. Wenn es ein Menschenopfer war, was ich sehr bezweifle, dann muss die Leiche irgendwo gelagert oder vergraben worden sein. Dafür kommen nur abgelegene Orte in Frage, die nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind oder so versteckt, dass sie selten frequentiert werden.«
»Vielleicht eine Kleingartenkolonie?«, fragte Sascha.
»Schrebergärten? Nein. Da kennt jeder jeden, da kannst du nicht mal eben eine Leiche verbuddeln. Natürlich müsst ihr das checken, aber ich glaube nicht, dass ihr was finden werdet …«, Fran hielt kurz inne. »Habt ihr die Friedhöfe schon abgeklappert?«
»Meine Leute sind dabei.« Sascha schien fast beleidigt. »Sofort abtelefoniert, halb Düsseldorf aus dem Bett geklingelt. Bis jetzt noch nichts. Die Friedhöfe sind groß, es wird noch etwas dauern.«
»Ist der Täter ein Einzelgänger? Ist er ein Mehrfachtäter?« Sie ließ den Zeigefinger sinken. »Wo hat er die Leiche her? Oder die Leichen? Hat er sie gestohlen? Schwierig. Das würde auffallen.« Sie lächelte Sascha an. »Wenn ich dich richtig einschätze, hast du alle Fälle von Grabschändung der letzten zehn Jahre abgefragt?«
Sascha nickte. »Sackgasse.«
»Also tötet er, lagert die Leichen, lässt sie skelettieren, wahrscheinlich in der Erde, der Geruch wäre jemandem aufgefallen, auch auf zwei Kilometer gegen den Wind. Er gräbt sie wieder aus. Einige Zeit später.« Sie warf einen Blick in Richtung des Skeletts. »Wie lange lässt er sie liegen? Wo? Vielleicht doch zuerst im Freien, damit sie skelettieren? Dann muss er weit draußen auf dem Land wohnen. Vielleicht betreibt er seine ganz private Bodyfarm.«
Fran hatte während ihres Studienaufenthaltes in den Staaten die Gelegenheit gehabt, die Bodyfarm zu besuchen. Dort lagen Dutzende frische und alte Leichen in der freien Natur, um die Verwesungsvorgänge studieren zu können.
»Seine Skelette sind auf jeden Fall ein wenig derangiert, die Knochen zum Teil ein einziges Durcheinander, weil nicht mehr viel da ist, das sie zusammenhält. Auf jeden Fall mag er seine Leiche. Er misshandelt sie nicht, er schmückt sie. Wiedergutmachung? Eine Gabe, um in einer Welt, die auf Äußerlichkeiten steht, einen besseren Start zu haben?«
»Ein besserer Start? Das verstehe ich nicht, Fran.« Er zeigte auf die Teufelsblume. »Das ist nicht wirklich attraktiv.«
»Nicht für dich. Aber für ihn?«
»Na gut. Unser Täter tötet, gräbt ein. Was er vorher noch mit dem Opfer gemacht hat, wissen wir nicht. Nach einer relativ langen Zeit gräbt er sie aus und übergibt die Leiche wieder der Welt, so dass sie gefunden wird. Eine Botschaft?«
»Wer hat das Skelett gefunden?« Fran hob die Augenbrauen.
»Zwei Jungs …«
»Ich weiß. Das war eine rhetorische Frage. Zufallsfund. Das Skelett hätte hier Jahre liegen können. Es sollte nicht gefunden werden, wahrscheinlich war es dem Täter egal. Sonst hätte er sein Opfer besser versteckt.«
Viele offene Fragen. Fran musste zugeben, dass sie der Fall interessierte. Aber sie wollte endlich ihre Studie fertigstellen, die sie vor drei Jahren begonnen hatte, als sie in die Abteilung Operative Fallanalyse des LKA gewechselt war. Und ihre Chefin, Sabine Fellmis, würde nicht erfreut sein, wenn sie sich an einen Fall dranhängte, der zu wenig Fakten hergab.
»Sascha.« Fran holte tief Luft. »Wir wissen zu wenig. Vielleicht ist die Leiche erst vier Wochen alt, ist an der Luft verwest, dann wurden die Reste eingegraben und wieder ausgegraben. Das hier ist nicht mal Kaffeesatzleserei. Wenn du mehr weißt, dann ruf mich an, ja? So hat es keinen Sinn.«
»Aber ich dachte …«
Erst musste Sascha die Fakten ausermitteln, und wenn sich dann keine klaren Hinweise ergeben hatten, kam sie wieder ins Spiel – oder wenn die Leiche mit der Teufelsblume der Anfang einer Serie war. Fran beschlich das Gefühl, dass Sascha Zeit und Geld sparen wollte, indem er sie als eine Art Wünschelrute benutzte.
»Falsch gedacht. Gib mir Ergebnisse, gib mir Fakten. Das hier kann alles sein und nichts. Ich wiederhole mich, und du weißt, dass ich das nicht gern mache.«
Sascha schaute ihr in die Augen. »Hast du Angst?«
Was sollte das denn jetzt? Fran holte einmal Luft, um ihren aufwallenden Zorn zu vertreiben. Sie hatte mit Frau Dr. Sola vereinbart, ihre Gefühle zu kontrollieren, vor allem ihre Wut, nicht um sie zu verdrängen, sondern um sich an geeigneter Stelle damit auseinanderzusetzen und nicht die Falschen als Blitzableiter zu missbrauchen. Sascha wäre jetzt der Falsche gewesen. Sie war dünnhäutig, weil sie ihren Vater getroffen hatte. Sie lächelte. »Ja. Ich habe Angst, mich in einen Fall zu stürzen, der kein Fall für mich ist.«
Sascha nickte. »Verstehe. Und ich möchte so schnell wie möglich dem Täter auf die Spur kommen. Das hier ist doch kein Einzelfall. Da steckt mehr dahinter. Du hast doch selber gesagt, es könnte ein Mehrfachtäter sein.«
Sascha klang, als wollte er ihr einen Staubsauger verkaufen. Sie musste wider Willen grinsen. Normalerweise waren es OFA-Leute wie sie, die aus dem kleinsten Indiz an einer Leiche gleich eine Mordserie machen wollten, diesmal war es der leitende Hauptkommissar.
»Es könnte immer ein Mehrfachtäter sein. Das musst du mir schon begründen«, sagte Fran.
»Wer so eine …«, er suchte nach dem passenden Wort, »… wer sich so mit Leichen beschäftigt, macht das doch nicht im Affekt. Da muss vorher schon was passiert sein, und danach wird er nicht plötzlich wieder ganz normal durch die Welt laufen. Da steckt sorgfältige Planung dahinter. Organisation.«
»Nicht schlecht«, sagte Fran anerkennend. »Das ist durchaus ein Argument. Aber genauso gut kann es sein, dass das hier ein Einzelfall bleibt, dass der Täter Angst vor der eigenen Tat bekommen hat und es nie wieder tun wird. Oder dass er vor vielen Jahren getötet hat, er wurde nicht entdeckt, sein Gewissen lässt ihn nicht in Ruhe und mit der«, sie malte Anführungszeichen in die Luft, »Veröffentlichung seines Opfers ruft er nach Hilfe, drückt er seinen Wunsch aus, aufgespürt und zur Rechenschaft gezogen zu werden.« Fran legte Sascha eine Hand auf den Unterarm. »Wenn eine zweite Leiche auftaucht, die so oder so ähnlich zurechtgemacht ist, und sich herausstellt, dass die Opfer eines nichtnatürlichen Todes gestorben sind, oder wenn der Staatsanwalt mich anfordert und meine Chefin grünes Licht gibt, dann stehe ich mit meinem kompletten Team auf der Matte.« Sie zeigte auf das Skelett und die Teufelsblume. »Damit kein Missverständnis entsteht: Natürlich will ich wissen, wer das war und wie er tickt. Das ist mein Beruf.«
Sascha seufzte. »Okay. Ich hatte die leise Hoffnung, dass du etwas aus dem Ärmel zaubern könntest.«
»Manchmal stirbt die Hoffnung zuerst«, sagte Fran. Für sie gab es hier nichts mehr zu tun. Sie suchte sich einen Kollegen aus, den sie noch von ihrer Zeit im Streifendienst kannte. Erfreut öffnete er ihr die Tür des Streifenwagens und fuhr sie in aller Ruhe und gemütlich plaudernd nach Hause.
Die ganze Fahrt über ging ihr ein Gedanke nicht aus dem Kopf: Was, wenn du dich irrst? Wenn Sascha recht hat und wir nur einen Kopf der Hydra sehen? Wenn die Teufelsblume wirklich der Schrei des Täters nach Entdeckung ist und er so lange weitermacht, bis er erhört wird?
*
Ich sitze im Garten. Es ist kühl, ich habe mir eine Decke über die Beine gelegt. Heute ist ein Tag, an dem die Erinnerungen kommen. An das, was Torsten mir erzählt hat, immer wieder und immer wieder. Es ist, als wäre ich dabei gewesen. Ich schließe die Augen und höre Torstens Stimme.
»Ich komme ja wohl nicht drum herum, alles zu erzählen, richtig? Dachte ich mir. Ist ja auch egal. Ich heiße immer noch Torsten Gabald, wohne in Düsseldorf, genügt das? Okay. Wie Sie wollen. Wo soll ich anfangen? Vielleicht bei Papa? Obwohl ich das gar nicht gerne machen würde. Ich fange lieber an, vom Urlaub zu erzählen. Wir sind nämlich jedes Jahr an die Nordsee gefahren. Auf eine Insel. Ameland heißt sie.
Da bin ich schon im Bauch meiner Mama mitgefahren, das Rauschen der Nordsee habe ich sozusagen mit der Muttermilch eingesogen. Seitdem muss ich mindestens einmal im Jahr dorthin. Es ist ein Drang, wenn ich es nicht tue, fühlt es sich an, als hätte ich etwas Wichtiges verpasst, und eine innere Unruhe überfällt mich. Der weiße Strand, das Kreischen der Möwen, die würzige Luft, die Chocomel, dieser dicke Kakao, den ich literweise in mich reinschütten kann, ohne dass mir schlecht wird.
Zuerst haben wir bei einer holländischen Familie mit Namen van der Stock zur Miete gewohnt. Ein Zimmer für Mama und Papa, eins für mich, und später schlief Hannah in meinem Zimmer.
Das war eine schöne Zeit, vor allem weil Papa und Mama uns ganz oft in Ruhe ließen. Sie gingen aus, redeten die ganze Nacht mit unseren Vermietern, rauchten und tranken und nervten uns nicht mit irgendwelchen doofen Spielen, bei denen man was lernen musste. Dann schliefen sie bis mittags. Als Hannah groß genug war, sie ist ja zehn Jahre jünger als ich, habe ich sie angezogen, Frühstück gemacht, und dann sind wir an den Strand, manchmal schon ganz früh. Besonders toll war es, wenn Wilhelma van der Stock mitgegangen ist. Die war so alt wie ich. Dann haben wir zusammen am Strand gesessen, die Möwen gefüttert und aufgepasst, dass Hannah nicht ins offene Wasser tapste, sondern immer schön in einem Priel blieb. Das ging natürlich nur bei Ebbe; wenn Flut war, musste sie am Strand bleiben. Ich habe sie immer im Auge gehabt, deshalb ist auch nie etwas passiert.
Auf jeden Fall durfte sie hier so viel Sand ›umhertragen‹, wie sie wollte. Zu Hause ging das nicht. Da gab es auf dem Spielplatz einen ganz kleinen Sandkasten, und da durfte man keinen Sand herausnehmen.
Als ich vierzehn wurde, kaufte Papa ein Zelt. Von da an zelteten wir immer. Ich weiß nicht, warum, aber aus irgendeinem Grund wollten die van der Stocks uns nicht mehr haben. Und Wilhelma durfte auch nicht mehr mit mir an den Strand.
Mama und Papa haben nie darüber geredet, was da passiert war, nur einmal habe ich mitbekommen, dass Mama Papa eine runtergehauen und geschimpft hat, wenn das noch mal vorkäme, würde sie sich scheiden lassen. Was sie aber nicht getan hat, denn sie ist bald darauf gestorben.
Ich war sehr traurig, Hannah auch, nur Papa weinte überhaupt nicht. Und ganz schnell haben wir eine neue Mama gehabt, die war viel jünger als Papa und hatte nie Lust, mit uns zu spielen.
Hannah hat immer gefragt: ›Wo ist meine Mama?‹ Papa hat ihr einen Klaps auf den Hintern gegeben und gesagt, sie solle keine dummen Fragen stellen, Mama sei nicht mehr da.
Hannah ist zu mir gekommen, hat furchtbar geweint, ich konnte das gar nicht aushalten. Deshalb habe ich Hannah gesagt: ›Du kannst mit ihr reden. Sie ist in dir drin.‹ Sie hat mich mit ihren großen runden Augen angeschaut und gefragt: ›Wo?‹ Ich habe ihr auf den Kopf getippt und gesagt: ›Da drin, sollen wir es versuchen?‹ Sie hat geschnieft und sich mit dem Ärmel den Rotz abgewischt und hat aufgehört zu heulen. ›Ich frage Mama jetzt was, und sie wird dir eine Antwort geben, wenn du nur gut zuhörst und ganz stark an sie denkst. Mach die Augen zu.‹
Hannah schloss die Augen, ich stellte eine Frage, suchte eine ganz einfache aus. ›Hallo Mama. Hast du mich lieb?‹
Einen Moment arbeitete es in Hannahs Gesicht, als müsste sie ein ganz großes Geschäft erledigen, dann entspannten sich ihre Züge. Sie begann zu lächeln, dann strahlte sie über das ganze Gesicht und öffnete die Augen. ›Sie hat Ja gesagt.‹
Ab da haben wir immer mit Mama geredet, und mit der Zeit konnte ich Mama auch hören.
Papa hat uns auch nach Mutters Tod in Ruhe gelassen, ich konnte Hannah alles zeigen: wie man ein Feuerchen macht, ohne dass es Rauch gibt; wie man unter der Bettdecke liest, ohne dass Licht nach außen dringt; wie man genau die richtige Menge Geld aus dem Geldbeutel von der neuen Mama klaut, damit es nicht auffällt. Damit haben wir uns dann Lakritzstangen gekauft und sind ins Kino gegangen, nachmittags.
Eigentlich war das ganz gut mit der neuen Mama. Fast wie im Urlaub. Ich bin morgens aufgestanden, habe Frühstück gemacht, Hannah geweckt, sie fertig gemacht und in den Kindergarten gebracht. Aber Hannah hat schnell gelernt, sich selbst anzuziehen.
Und dann kam eines Tages unser neues Geschwisterchen. Von da an mussten wir immer ganz leise sein, und alles drehte sich nur noch um sie. Katrin hieß sie, ein blöder Name, aber die Erwachsenen machen immer alles, wie sie es wollen, egal, ob es Sinn macht oder nicht.
Ich habe versucht, Katrin zu hassen, aber es ging nicht. Wenn sie mich angelacht hat, musste ich auch lachen. Wenn sie geschrien hat, musste ich sie trösten.
MamaZwei war ganz überrascht, dass ich mein Schwesterchen mochte. Sie hatte wohl nicht damit gerechnet. Aber es war ihr recht. Hannah liebte ihre Schwester sowieso. Schon vom ersten Tag an. Wir durften mit ihr spielen und sie sogar wickeln. Zuerst war das ziemlich eklig, aber dann hat es mir auch Spaß gemacht. Hannah hatte ich nie gewickelt.
Papa fing mit der Zeit an, uns mächtig auf die Nerven zu gehen, und es wurde immer schlimmer. Ständig hatte er irgendetwas zu meckern. Wenn ich eine Zwei geschrieben habe, habe ich eine verpasst bekommen, weil ich doch eine Eins hätte schreiben können. Ich sei ein fauler Sack, hat er dann gebrüllt, und aus mir würde nichts werden, und er würde sich jeden Tag krummlegen, damit es mir eines Tages besser gehen sollte.
Jetzt rede ich doch von Papa, obwohl ich das gar nicht wollte. Aber ganz schlimm wurde es ja erst, als das große Unglück über uns hereinbrach.«
*
Der Kollege setzte sie an ihrer Wohnung ab, sie bedankte sich und bat ihn, noch einen Moment zu warten, so lange, bis sie im Haus war. Er sah sie irritiert an, nickte aber und öffnete den Sicherheitsgurt, damit er schnell aus dem Wagen springen konnte. Guter Mann. Immer zuerst den Partner sichern.
Sie zog den Schlüssel aus der Tasche, steckte ihn ins Schloss, zögerte einen Augenblick, atmete. Sie schloss auf, winkte ihrem Kollegen zu, der sich angurtete und losfuhr.
Fran drückte die Haustür ins Schloss, blieb im Dunkeln stehen. Kein Atmen zu hören. Kein Scharren von Schuhen, deren Besitzer ungeduldig auf sie gewartet hatte. Eine Tür ging, das Flurlicht flammte auf, Fran musste blinzeln, die Helligkeit blendete sie. Mit einem Satz sprang sie hinter einen Mauervorsprung, der den Eingang zum Keller markierte, und ging in Kampfstellung. Schritte klackten die geflieste Treppe hinunter. Noch bevor Fran das Gesicht sah, wusste sie, dass ihre Angst wieder einmal unbegründet gewesen war. Es war eine Frau, und vor Frauen brauchte sie keine Angst zu haben. Es war die Nachbarin aus dem ersten Stock. Fran wartete, bis sie das Haus verlassen hatte, dann eilte sie die Treppe hinauf, nahm immer zwei Stufen auf einmal. Ihre Wohnungstür schien unversehrt, zumindest war sie nicht verschmutzt oder mit irgendetwas Ekligem beklebt. In Windeseile entriegelte sie die drei Sicherheitsschlösser, bevor sie das normale Türschloss aufschließen konnte. Sie schlüpfte in ihre Wohnung, lauschte. Nichts. Reihum kontrollierte sie die Zimmer. Nichts. Entwarnung.
Frau Dr. Sola hatte ihr erklärt, was sie in der Theorie schon lange wusste: »Ihr Verstand sagt Ihnen, dass keine Gefahr drohen kann, dass der eine schreckliche Mann hinter dicken Mauern eingesperrt und der andere tot ist. Ihr Gefühl sagt Ihnen, dass die Gefahr allgegenwärtig ist. Dass keine Mauer hoch genug ist, ihn zurückzuhalten, und dass die Monster jederzeit von den Toten auferstehen können. Lassen Sie Ihr Gefühl nicht überhandnehmen, aber lassen Sie ihm genug Freiraum.«
Fran bereitete sich ein frisches Müsli, schaltete das Radio ein, hörte ein wenig Musik und die Nachrichten. Müdigkeit kroch ihr in die Glieder. Sie hatte noch genug Zeit, sich kurz hinzulegen. Den Wecker stellte sie auf zwölf Uhr, dann musste sie sich nicht hetzen.
Um zehn nach zwölf saß sie in ihrem neuen Spielzeug, lenkte es auf die A46, dann auf die A3. Die Tachonadel näherte sich der Zweihundertzwanzig, die Überholspur war frei. Fran drückte noch ein wenig aufs Gas, und selbst bei dieser Geschwindigkeit hatte der Motor Kraft genug, so zu beschleunigen, dass sie in den Hartschalensitz gedrückt wurde. Bei zweihundertfünfundfünfzig nahm sie den Fuß vom Gas. Von Weitem sah sie einen LKW, der von einem langsamen PKW überholt wurde. Sie wollte auf keinen Fall drängeln, also bremste sie bis auf einhundertzwanzig ab. So machte es ihr sogar noch mehr Spaß. Sie konnte immer wieder beschleunigen und das Gefühl genießen, in den Sitz gedrückt zu werden.
Mehr als neunzig Minuten würde sie nicht brauchen, würde also noch viel Zeit haben, ihren Vortrag noch mal durchzugehen und an den Details zu feilen. Sie sollte ausgesuchte Kollegen auf den neuesten Stand der Sektenaktivitäten in Deutschland bringen und ihnen erzählen, was in diesem Bereich die Operative Fallanalyse leisten konnte, vor allem im Beweisverfahren vor Gericht. Vogler hatte sie gebeten, die Studie vorzustellen, auch wenn sie noch nicht ganz fertig war. Wenigstens das waren Neuigkeiten für die Kollegen vom BKA. Denn ein wenig fühlte sie sich, als sollte sie Eulen nach Athen tragen: Das BKA in Wiesbaden hatte eine hervorragende Abteilung Operative Fallanalyse, rekrutiert vor allem aus Münchner Profilern, die Vorreiter in Sachen OFA Deutschland gewesen waren. Sie fragte sich, wie viele Morde der NSU-Serie man hätte verhindern können, hätte man auf die Kollegen aus München früher gehört. Und sie fragte sich, warum man sie wirklich eingeladen hatte. Für das BKA war ihre Arbeit nicht sonderlich relevant, auch nicht die Studie. Die Ergebnisse ließen sich in wenigen Worten zusammenfassen: »Satanisten sind nicht gewalttätiger als die Durchschnittsbevölkerung.«
Wieder kam ein Stück freie Strecke ohne Tempolimit. Fran trat das Gaspedal bis zum Anschlag durch, der Impreza machte einen Satz und schoss davon. Fast so gut wie ein heißer Base-Jump – eine Sekunde unaufmerksam, und man war tot.
Kein Stau hatte sie aufgehalten, also war sie pünktlich zu ihrem Vortrag eingetroffen. Fran ließ ihren Blick über das Auditorium gleiten. Siebenundzwanzig Männer, sechs Frauen. In der ersten Reihe saß Jörn Vogler. Zwar hatte er sie eingeladen, aber dass er sich ihren Vortrag anhören würde, damit hatte sie nicht gerechnet. War das ein Kompliment oder eine Warnung? Voglers Arm war lang genug, um sie mit einem Fingerschnipsen aus ihrem Job zu werfen.
»Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrter Herr Vogler!« Sie nickte ihm zu, aber seine Miene blieb verschlossen. »Ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben, Ihnen aus meinem Arbeitsbereich einige Aspekte näherzubringen. Dass ich hier, sozusagen in der guten Stube der deutschen OFA, sprechen darf, betrachte ich als eine Ehre. Ich hoffe, ich kann ihr gerecht werden.« Keine Reaktion. Also fuhr Fran fort: »Bevor ich ins Thema einsteige, möchte ich Ihnen ein paar Dinge über meinen Werdegang erzählen, die Sie in der Veranstaltungsbroschüre nicht gelesen haben. Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben.«
Und damit die Distanz ein wenig geringer wird. Es war gut, etwas über sich selbst zu erzählen, zu signalisieren, dass sie eine von ihnen war. Sie machte eine kurze Pause, ließ den Blick schweifen. Immer noch keine Reaktionen, aber alle waren auf sie fokussiert. Gut.
»Genauso wichtig wie das Studium der Psychologie waren für mich die Jahre auf Streife, mit einem altgedienten, erfahrenen Kollegen. Dort habe ich die Fallstricke, die Versuchungen und die Anforderungen an den Polizeiberuf kennengelernt. Ich habe eine Kameradschaft erlebt, die es so wohl nur noch bei Bergleuten gibt, mit allen Vor- und Nachteilen.« Sie genoss die fragenden Blicke. »Ebenso wie unter Tage das Leben des Bergmanns von der Zuverlässigkeit des Kumpels an seiner Seite abhängt, so hängen über Tage das Leben und die seelische Gesundheit der Polizisten ebenfalls von den Kollegen an ihrer Seite ab. Der soziale Druck innerhalb einer Wache ist, sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne, enorm hoch.« Kurze Pause. »Aber wem erzähle ich das? Es ist also menschlich, mal auszurasten, einen Fehler zu machen oder dem Alkohol mehr zuzusprechen, als es guttäte.« Jetzt kam die erste kleine Bombe. »Insofern wundert es mich nicht, dass Polizistinnen und Polizisten sich falsch verhalten; es wundert mich, dass sie sich nicht viel öfter falsch verhalten.«
Verhaltener Applaus lief durch die Reihen, einige nickten bestätigend, Vogler aber hielt seine Arme über der Brust verschränkt und starrte sie misstrauisch an.
»Dann bin ich in den Kriminaldienst gewechselt und habe eine vollkommen andere Welt vorgefunden. Hatte ich vorher acht Stunden Dienst auf Streife und anschließend noch zwei Stunden Berichteschreiben, bestand meine Aufgabe nun vorwiegend in Aktenarbeit. Aber das, was ich lernen wollte, konnte ich dort nicht lernen: das Ganze eines Verbrechens erfassen! Die meisten Fälle hatten wir in ein oder zwei Tagen aufgeklärt, Intimizide, Beziehungstaten, klare Sachverhalte. Doch dann gab es Fälle, die von der Norm abwichen, die keinem bekannten Muster folgen wollten, die sich selbstständig machten, die sich mit unseren Perspektiven, mit unserer Erfahrung, mit unserem Wissen nicht fassen ließen. Noch immer schlummern viele dieser Fälle in den Archiven der deutschen Polizei. Glücklicherweise fragte mich das LKA genau zu diesem Zeitpunkt, ob ich das Team der Düsseldorfer OFA verstärken wollte. Natürlich wollte ich! Es folgten Lehrgänge im Ausland, unter anderem in den USA und in Großbritannien und natürlich in Bayern.« Sie musste einen Moment warten, bis das Gelächter abgeebbt war, sogar Vogler verzog den Mund zu einem schiefen Grinsen. Sie setzte neu an. »Vor allem bei unseren Münchner Kollegen habe ich viel gelernt. Umso größer war die Erschütterung, als ich erkennen musste«, Voglers Miene versteinerte; er wusste, was jetzt kam, »dass im Fall der NSU-Morde alle Hinweise der OFA in den Wind geschlagen worden waren.«