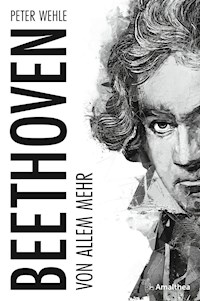Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mord in der Lungauer Almidylle: Das passt Wotan Perkowitz gar nicht, immerhin sitzt er in der Almhütte seiner Tante, um endlich Ruhe für seine Abschlussarbeit zu haben. Doch anstatt sich seinen Studien zu widmen, kramt Wotan nun lieber in der Vergangenheit der Gegend herum. Dabei stößt er auf die Hinrichtung einer Hexe, die denselben Namen wie die Ermordete trug. Und bekommt es direkt mit dem Teufel zu tun. Mit trockenem Charme und Schlagfertigkeit begegnet der Städter Wotan Perkowitz den eigenwilligen Dorfbewohnern - ein Krimi voller Spannung und Humor, gewürzt mit einer ordentlichen Prise Dämonie!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Wehle
Teufelskoller
Ein dämonischer Kriminalroman
Peter Wehle
Teufelskoller
Salzburg, Anno Domini 1677, dem 25. August
Jaja, was fragten die hohen Herren ihn das schon wieder? Das hatte er doch mehrfach erzählt, dem Herrn Landrichter in Großarl ebenso wie den Herren hier. Ja, er war mit dem berühmten Zauberer-Jackl zusammen gewesen. Jaja, da staunt ihr, meine Herren, ich, der Bettelbub Dionysus Feldner, ich war Kumpan des berühmten Zauberer-Jackl! Wie meint ihr? Nein, nicht nur acht Tage, ich war viel länger in seinem Gefolge, viel länger. Jaja, Wochen … wie viele? Je nun, mit dem Zählen hab ich’s nicht so genau. Drei? Ja, drei Wochen! So lange hat der Jackl nur mich bei sich gehabt, jawohl! Wie? Ja, auch andere Buben seien beim Jackl gewesen. Aber er, Dionysus Feldner, sei sein Lieblingsbub gewesen. Was er gelernt habe? Ja, alles, wirklich alles, er sei ein sehr gelehriger Schüler gewesen. Bitte, der hohe Herr solle nicht so böse sein wegen seiner Gelehrigkeit – das sei doch etwas Gutes, oder nicht? Nein, die Worte unseres Herrn könne er nicht lesen. Aber er merke sich fast alles, was die Pfaffen … die Herren Pfarrer so erzählen. Was er beim berühmten Zauberer-Jackl so gelernt habe? Ja, eben alles, alles Wichtige, wie: sich verschwinden lassen, Tiere krank machen, Wetterzauber, Liebeszauber, Menschen krumm machen, sich verwandeln können. Alles eben! Warum er denn mit dem Zauberer-Jackl überhaupt mitgegangen sei? Ja, der Zauberer-Jackl sei doch berühmt im ganzen Land, allerlei wilde Geschichten erzähle man sich von diesem tollkühnen Kerl, und außerdem habe er ihn, den zwölfjährigen Dionysus Feldner, von sich aus angesprochen – nie mehr Hunger leiden müsse er, wenn er mit ihm zöge.
Als Dionysus Feldner vom Verhör zurück in seine Zelle gebracht wurde, hatte er das vage Gefühl, dass die freundliche Strenge der Herren an seinem Schicksal nichts ändern würde. Sein Erdendasein würde bald zu Ende gehen.
Er sollte recht behalten.
Dienstag, 8. Juli 2008, Mittag
»Wie heißen Sie? Wotan Perkowitz? Wotan? Perkowitz? Nicht in echt? Doch echt? Perkowitz mit tz am Ende? Also, so wie ‚Witz‘?«
Es war jedes Mal dasselbe – als ob man allein schon an der Nummerntafel seines Wagens seinen Namen erkennen könnte. Immer traf es ihn – Wotan Perkowitz! Jedes Mal hielten Polizisten bei einer beliebigen Verkehrskontrolle ihn, Wotan Perkowitz, an. Und jedes Mal dasselbe Gelächter! Er war sich sicher, dass er schon als Säugling im Auto kontrolliert worden war. Lediglich die ersten zwei Monate seines Lebens, die Wochen vor seiner Taufe, waren glücklich gewesen. Aber dann hatte sein Vater, Ministerialrat Doktor Rudolf Perkowitz, beschlossen, seine Verehrung der Werke Richard Wagners in einem grausamen Akt lebenslanger Verstümmelung gipfeln zu lassen … und hatte »Wotan« als Namen seines Erstgeborenen trotz der Proteste der Mutter, des Priesters – eigentlich aller – durchgesetzt.
Und damit hatte sein Elend begonnen … seines, Wotans Elend, Wotan Perkowitz’ Elend!
Bevor er endgültig in Tränen ausbrach und damit seine Schnellstraßen-Fahrtauglichkeit massiv beeinträchtigt hätte, half sein üblicher Rettungsanker, sein analytischer, manchmal ein wenig zwangsneurotischer Verstand.
»Wotans Elend«, da war der Genetiv noch klar. Aber bei »Wotan Perkowitz’ Elend«, müsste man da nicht »Wotans Perkowitz’ Elend«, also einen doppelten Genitiv bilden? Nein, Unsinn, es muss »Wotan Perkowitz’ Elend« heißen. Aber warum eigentlich? Weil es ja nur das Elend einer Person wäre, daher wäre auch nur ein Genitiv nötig, dozierte er zu sich selbst genau in dem Tonfall, der seine Schwestern und seinen Vater so reizte. »Unser kleiner Professor«, sagten sie dann mit dieser unnachahmlichen Mischung aus tiefer Ironie, seichter Wissenschaftlichkeit und gut verborgener Unsicherheit. Also gut, »Wotan Perkowitz’ Elend« musste es heißen. Wobei, die Idee mit dem doppelten Genitiv – »Wotans Perkowitz’ Elend« – gefiel ihm eigentlich ganz gut, denn immerhin war sein Elend ja auch mindestens groß genug für zwei Personen. Sei nicht blöd!, schalt er sich. Im Übrigen, stimmt die Schreibweise des Genitivs bei »Perkowitz« – mit Apostroph – überhaupt?
Eines hatten all die sinnlosen, aber im Grunde amüsanten genitiven Überlegungen an sich … sie hatten ihm die Zeit vertrieben, er war an »seinem Ende« der Bundesstraße angelangt.
Wie hatte Tante Agathe es ihm beschrieben: »In Tamsweg biegst du bei der Tafel ‚Lackn-See‘ ab, da geht’s dann sehr steil hinauf, beim See ist das Ausflugslokal Hiafalm, und unmittelbar davor fährst du auf die Forststraße. Ignorier die Fahrverbotsschilder, für dich gilt die nächsten Monate ‚Nur für Anrainer‘.«
Das Ignorieren gefiel ihm, aber der Gedanke, dass er drei Monate Anrainer auf einer Alm im salzburgischen Lungau sein sollte, behagte ihm gar nicht.
Dienstag, 8. Juli 2008, Nachmittag
Bereits nach einigen Metern Forstweg-Geholper begriff Wotan widerwillig, dass sein Vater recht gehabt hatte, als er ihm anstatt des italienisch-schicken »Katzenschleppers« – ein Fahrzeug, das vor allem der Anbahnung zwischenmenschlicher Beziehungen diente – den robusten Gebrauchten gekauft hatte. »Echte deutsche Qualität« – das waren die Schlüsselworte gewesen, mit denen bei Perkowitz senior der Kaufreflex ausgelöst worden war. Die Tatsache, dass die »echte deutsche Qualität« ein tschechisches Logo trug, hätte den Kauf beinahe verhindert, doch – welch Glück! – konnte noch klargestellt werden, dass der Großteil des Autos aus deutschen Qualitätsteilen bestand … und somit hoppelte Wotan mit seiner »Schenhajt«, wie er das eher klobige Vehikel liebevoll-böhmakelnd getauft hatte, eben Anfang Juli auf die Alm seiner Tante.
Gut, es roch gut. Gut, es war wirklich schöner Wald um ihn. Gut, zahlreiche Touristen aus aller Welt kamen nach Österreich, um genau diese Landschaft mit unzähligen »Ahs« und »Ohs« zu prägen.
Trotzdem fühlte er sich elend!
Warum er? Das war eigentlich eine rhetorische Frage, denn er wusste ja, warum er den Sommer über auf diese Alm sollte. Aber dieses Wissen machte die Tatsache an sich nicht wirklich erträglicher.
»Ich will gar nicht Psychologie studieren!«, schrie er unversehens sein Lenkrad an. Vor Schreck fielen zwei Vögel, die neben dem Auto hergeflogen waren, beinahe steingleich zu Boden. Wotan schloss das Wagenfenster und murmelte eine Entschuldigung – eine dreifache, um genau zu sein. Er entschuldigte sich bei den beiden Vöglein, bei seinem Lenkrad und bei sich, denn irrtümlich hatte er mit seiner Überemotion beinahe seinem Vater recht gegeben. Dieser war es ja, der immer behauptete, die Studienwahl seines Sohnes sei ein Wahnsinn und diene nur dazu, ihn, Ministerialrat Doktor Rudolf Perkowitz, an den Rand des geistigen und finanziellen Ruins zu treiben. »Du bist der erste Perkowitz seit Generationen, der nicht Jus studiert. Wenn du wenigstens Medizin gewählt hättest, zur Not noch Architektur … aber Psychologie?!« Wotan hatte noch das Schluss-»ie« in den Ohren, bei dem die Stimme seines Vaters beinahe gekippt war. Dieses »ie« hatte über all die Jahre jegliche Zweifel in ihm beseitigt – er wollte Psychologie studieren, absolvieren und auch als Beruf ausüben! Zweifel waren unangebracht, Psychologie war schön, jawohl! Und eigentlich war Psychologie ja wirklich interessant … trotz dieser Ausbildungsstufen-bedingten Arbeiten, die man verfassen musste. Das Bakkalaureat war eben der erste Titel am Weg zum Doktorat, der mittels einer schriftlichen Bakkalaureatsarbeit erlangt wurde. Und wenn man daheim in Wien keine Ruhe fand, um diese Arbeit endlich zu vollenden, so mussten eben drei Monate »Almhaft« die notwendige Distanz zu den diversen Störfaktoren bringen.
Störfaktoren – wenn das Amelie gehört hätte … Ameliiie! Wie anders klang doch ein langes »ie«, wenn es am Schluss von »Amelie« stand und von seiner inneren Stimme gehaucht wurde, wie anders als jenes am Ende von »Psychologie«, von seinem Vater hysterisch gekeucht. Ach, Amelie …
Die Sanftheit, die seinen Körper trotz der Schlaglöcher durchflutet hatte, mutierte in Sekunden zur grausamen Härte Lungauer Granits, als ihm klar wurde, dass er nicht einmal hier, im entferntesten Alpental, vor Amelie Ruhe finden würde. Da gab es nur ein Gegenmittel – an die anderen Wiener Störfaktoren zu denken und zu genießen, dass sie ihn hierher nicht verfolgen könnten.
Störfaktoren … sein Vater würde sich über diese rüde Bezeichnung maßlos ärgern. Und seine drei Schwestern Brunhilde, Isolde und Aglaia würden mit einer Mischung aus blankem Zynismus – Brunhilde –, einem völlig desinteressierten »Hast du was gesagt?« – Isolde –, und einem »Sei nicht so gemein!« – Aglaia –, reagieren.
Man hatte es nicht leicht, wenn man drei Schwestern den »großen Bruder« geben musste. Gut, Brunhilde war nur eineinhalb Jahre jünger, der hatte er keinen Moment je vormachen können, so etwas wie ein Beschützer oder liebevoller Ratgeber zu sein. Schon in der Sandkiste hatte sie die Kinder verhauen, die ihm das Spielzeug wegnahmen. Sie war eben immer schon eine richtige Brunhilde gewesen. Ätsch, dachte Wotan in einer befreienden Anwandlung intensiver Bosheit, du bist auch ein Perkowitz’sches Wagneropfer! Gut, Bruni hatte ja noch die Chance, ihren Familiennamen mittels einer Heirat zu ändern … aber auch Brunhilde Sedlacek klang nicht viel besser – vorausgesetzt natürlich, der derzeitige Anbeter würde eines Tages um ihre breite und für eine junge Dame etwas zu muskulöse Hand anhalten. Das wäre eigentlich gar nicht so schlimm, denn der Heinzi – Magister iuris Heinz Sedlacek – war kein so übler Kerl, immerhin konnte er Perkowitz senior erstaunlich rasch zu einem Menschen formen, wenn dieser wieder einmal explodiert war. »Und zur Bruni würde er auch gut passen«, murmelte Wotan vor sich hin. Ja, weil … weil … also gut – eigentlich war auch die Bruni gar nicht so übel, wie er immer allen erzählen musste, um das zwischen ihnen seit zwei Jahrzehnten – also faktisch von ihrer Geburt an – aufgebaute Rollenklischee zu pflegen.
Rollenklischee? Mein Gott, du denkst ja schon wie ein Psychologe!, freute sich Wotan … für einen Moment. Denn schon im nächsten musste er sich eingestehen, dass gerade so zeitgeistige Ausdrücke wie »Rollenklischee« wahrlich noch keinen Bakkalaureus der Psychologie aus ihm machten.
Noch musst du nicht an die Psychologie denken … lass das noch ruhen … konzentrier dich lieber auf die Forststraße und denk zur Not an … an … Isolde!
Eigentlich logisch, dass ich denke, dass ich an Isolde denken könnte, um nicht an Ame... nein! Dieser Name war für drei Monate aus seinem Hirn, seinem Herzen, seinem Magen, seinem … und überhaupt zu verbannen!
Isolde, logisch!
Denn Isolde war nicht nur das dritte Opfer der Wagnervergötterung seines Vaters, sondern auch seine zweite Schwester. Mit ihr hatte ihn seit ihrer Kindheit … nichts … ja, nichts verbunden. Sie hatten nie viel gestritten, nie viel gespielt, nie viel gelacht – sie waren immer wie ein altes Ehepaar gewesen, neben-, fast nie miteinander.
Erstaunlich, aber nicht schlimm!, tröstete sich Wotan und fuhr beinahe in einen Traktor, der mitten auf der Forststraße stand, um schwere Holzstämme ins Tal zu transportieren. »Sagen Sie, Sie … Sie … Sie Sie, Sie – müssen Sie unbedingt hinter der unübersichtlichen Kurve halten, sodass jeder, der hier fährt, zwangsläufig in Sie hineinfahren muss!« Gott sei Dank hatte sich Wotan im letzten Moment zu seiner »Beschimpfungsformel« gerettet – »Sie Sie, Sie« (mit der Betonung auf dem zweiten »Sie«) musste immer dann als Platzhalter dienen, wenn das väterliche Element in ihm, sein Zorn, das mütterliche, seine Wohlerzogenheit, zu verdrängen drohte.
Der Mann, dem die emotionelle Aufwallung gegolten hatte, kam langsam aus seiner Hocke hoch, nahm seelenruhig den gelben Schutzhelm vom Kopf und musterte Wotan lange und sorgfältig.
Ein Stummer, durchzuckte es Wotan, ich habe beinahe einen Unfall mit einem Stummen gebaut. Na, das wär aber lustig geworden bei der Polizei, da hätte wenigstens nicht Aussage gegen Aussage stehen können, ätzte er zu sich selbst, gleichzeitig überrascht von der Bosheit seiner Gedanken.
Doch … »Junger Herr, zum einen wären Sie erfreulicherweise nicht in mich, sondern in meinen Traktor hineingefahren. Ihre Aufregung ist also unbegründet. Zum anderen hätte das meine Agi, so heißt der Traktor, gut überlebt, Ihr fahrbarer Untersatz hingegen eher nicht. So gesehen ist Ihre Aufregung begründet, Ihr scharfer Tonfall verständlich. Da es sozusagen eins zu eins im Match Sie gegen Sie steht, und im Übrigen nichts passiert ist, würde ich vorschlagen, dass ich meine Agi ein wenig zur Seite fahre, Sie vorsichtig an uns vorbeimanövrieren und Ihrem weiteren Lebensweg folgen. Einverstanden?«
Wotan war zu perplex, um eine geeignete, geistreiche Antwort zu geben. Hatte er einen Universitätsprofessor der Vergleichenden Sprachwissenschaft vor sich, der sich in den Sommerferien als Holzfäller verdingte? Oder war er auf den Priester der kleinen Gemeinde am Fuße des Berges gestoßen, der seine Formulierungen wie seine Äxte für das Kirchen-Heiz-Holz schliff? Egal, er war perplex. Also stieg er wie empfohlen in seine Schenhajt und arbeitete sich Millimeter um Millimeter an Agi und dem sprachgewandten Waldmann vorbei.
Woran hatte er gerade …? Ah ja, Bruni, Isi – und daher fehlte natürlich noch Laili, also Aglaia, seine jüngste Schwester, das von allen geliebte und verhätschelte Nesthäkchen. Vierzehn Jahre jünger als er hatte sie vor kurzem die dritte Volksschulklasse beendet – sie, die als Einzige von ihnen nicht den Makel Wagner’scher Vornamen-Germanisierung trug. Und das war eindeutig der wichtigsten Person des »Irrenhauses Perkowitz«, wie Bruni sich manchmal am Telefon meldete, zu verdanken. Ihre Mutter war es gewesen, die vor der Taufe ihrer Jüngsten ihrem Mann unmissverständlich klargemacht hatte, dass dieser »... kleine Wecken nicht Sieglinde heißen wird. Sieglinde heißt bei uns eine Erdäpfelsorte, aber nicht meine jüngste Tochter! Die heißt Aglaia, die Prächtige – und wenn dir das nicht passt, kannst du von mir aus woanders viele kleine Siegfrieds und Alberichs und Woglindes und Wellgundes zeugen, aber nicht bei mir!«
Der Vater war damals so fassungslos gewesen, dass er die ganze Taufe über wie apathisch gewirkt hatte. Dass seine Frau des Altgriechischen und damit der Bedeutung des Namens »Aglaia« mächtig war, hätte er wissen können, denn immerhin hatte sie Griechisch und Latein studiert, bevor sie die akademische Laufbahn aufgeben musste, um den Wünschen ihres damaligen Verlobten und späteren Ehemannes zu entsprechen. Dass seine Frau pointiert und messerscharf formulieren konnte, hätte er auch viele Jahre nach ihrer Hochzeit wissen können, wenn er ihr öfter zugehört hätte.
Aber er hatte nicht!
»Ach ja«, seufzte Wotan, »meine Mama, wie würde ich die jemandem erklären?« Weiter kam er nicht mehr in seinen familiären Gedanken, denn er war am geografischen Ziel der nächsten drei Monate angelangt, er stand am Ende der Forststraße, mitten auf der Hiafalm.
Dienstag, 8. Juli 2008, Abend
Endlich, dachte er sich, endlich kann ich tief durchatmen. Tiiief atmen, tiief atm... und schon begann er zu husten.
Entsetzlich, kann ich nicht einmal mehr normal atmen? Habe ich alle primitiven Vitalfunktionen so weit verlernt, dass ich mich sogar beim Einatmen verkutze?
Wotan überlegte fieberhaft, ob er nicht rasch vor sich selber eine Ausrede finden könnte, warum er sich verschluckt hatte. Natürlich, es könnte die Menge an Sauerstoff sein, die er hier einatmete – so eine Bergluft war für einen Durch-und-Durch-Städter wie ihn doch sicher ungewohnt. Oder war es vielleicht die Seehöhe? 1600 Meter waren für ihn, der in Wien auf – ja, auf wie viel Metern Seehöhe eigentlich? – lebte, möglicherweise nicht auf Anhieb leicht zu ertragen.
»Denk dran«, sagte er zu sich, »sofort nachzuschauen, auf wie viel Metern relativer Seehöhe Wien liegt.« Vielleicht war das im Internet zu finden. Um das wiederum tun zu können, müsste er vorher die Koffer auspacken, in denen all seine Sachen, darunter sein Computer, der Wiederverwendung harrten.
»Nur nichts überstürzen!«, zögerte Wotan diesen mühsamen Akt der Körperertüchtigung hinaus – immerhin würde er diesmal selber die Koffer vom Auto bis in den ersten Stock des Almhauses schleppen müssen, eine Tätigkeit, die sonst immer Bruni für ihn übernahm. Wenn die Beschreibung seiner Tante stimmte, war die Hütte ein ziemlich luxuriöser Schuppen, mit Solarstrom, Warmwasser und »... sogar einem Innenklo« – für ein »Almgut«, wie sein Vater die Liegenschaft seiner Schwägerin hochtrabend-ironisch nannte, war das wohl schon eine noble Ausstattung. Er fand zu seinem Erstaunen sofort den Schlüssel, sperrte die Tür auf … und staunte wirklich. Vor ihm erstreckte sich ein wunderschöner großer Wohn-Ess-Küchen-Raum, der durchgehend aus hellem Holz bestand. Vorsichtig setzte er seinen Fuss auf den Holzboden – kein Knarren, stattdessen überwältigte ihn eine Duftflut, die ihm einen Moment lang wie die alpine Abwandlung eines orientalischen Drogenrausches erschien … zumindest stellte Wotan sich eben so einen orientalischen Drogenrausch vor. Der Holzduft zog sich entlang der Treppe in den ersten Stock – ebenfalls wunderschön, gemütlich und mit einem kleinen und offensichtlich neuen Anbau, in dem das versprochene Bad und das »Innenklo« sehr geschickt untergebracht waren. Und dann die Krönung … ein herrlicher Balkon, der auf ein Hochplateau hinausging, das erst am Horizont mit der nächsten Bergkette zu verschmelzen schien. Auf der gegenüberliegenden Seite stand das Bett unter einem Fenster, das gerade ein wenig Ausblick bot – das Haus war so in einen Hang gebaut, dass die hinteren Fenster im Erdgeschoss auf eine grimmige Felswand blickten, hier im ersten Stock aber bereits einige Meter Abstand zwischen Fenster und leicht geneigter Bergwiese waren.
Natürlich hatte er inzwischen vergessen, dass er sich eigentlich schwer verkutzt hatte. Er atmete daher wieder ruhig und gleichmäßig und ließ die herrliche Abendluft und den strahlenden Sonnenuntergang auf sich wirken, den er hier auf diesem geräumigen, aus massiven Bohlen gebauten Balkon inmitten eines der schönsten österreichischen Waldgebiete genoss.
Und da waren sie wieder, die Familiengedanken!
»Wotan!«, hatte seine Mutter zum Abschied gesagt. »Wotan, bemüh dich, endlich wieder etwas Rhythmus in dein Leben zu bringen. Und verkühl dich nicht.«
Sein Vater hatte wie immer gemeint, er müsse den Pater familias hervorstreichen. Und ihm zum x-ten Mal klargemacht, dass er, sein einziger Sohn, sehr, sehr dankbar sein müsse, dass Tante Agathe ihnen, im Besonderen ihm, Wotan, ihr steirisches Almgut zur Verfügung stellte, damit er, des Vaters einziger Sohn, endlich jene Ruhe des Geistes fände, die es doch ermöglichen sollte, seine Bakkalaureatsarbeit in Psychologie fertigzustellen. »Ja, Papa«, hatte er gesagt. Wie üblich.
»Almgut« … er hatte sich noch über die Bezeichnung lustig gemacht und gedacht: Alm vielleicht, aber gut? Doch diesmal hatte sein Vater recht behalten, das hier war ein Almgut, und die Alm war wirklich gut!
Wotan seufzte tief auf seinem neuen Refugiumsbalkon. Sein Vater! Natürlich, er meinte es immer nur gut mit ihm. Aber das war ja das Problem! Als ob die Namensgebung nicht genug Bürde für sein Leben gewesen wäre, hatte ihn sein Vater noch dazu in ein streng geführtes, von Wotan nicht wirklich geschätztes Jesuitenkollegium geschickt. Denn die Basis eines jeden Menschen seien einzig und allein Altgriechisch und Latein! Wotan Perkowitz, discipulus Dei … das haut den stärksten Wen-auch-immer um!
Wotan seufzte wieder. Und nieste. Daraus schloss er, dass ihm langsam kalt wurde. Zumindest würde das seine Mutter so sehen.
Seine Mutter. In zynischen Momenten wunderte er sich, dass ihr noch keine Flügel gewachsen waren. Wie konnte Gott sie nur übersehen? Sie, die die Kraft aus der Religion – natürlich aus der einzig wahren – zog. Die Kraft, zwei Katzen, drei Töchter, einen Sohn und – und das war die »eigentlichste« Prüfung – diesen ihren Mann zu ertragen, ja sogar zu lieben.
Er fröstelte wirklich. Also ging er hinein. Er freute sich, dass er zu dieser einfachen Schlussfolgerung – wenn es kalt wird, geht man hinein – selbst und allein in der Lage gewesen war. Vielleicht war er doch nicht so weltfremd, wie das seine Freunde kritisierten. Oder lebensunfähig, wie es seine Feinde – oder waren es doch nur Gegner? – sarkastisch bemerkten.
Feind oder Freund? Jetzt seufzte Wotan am allertiefsten. Denn wieder war er bei Amelie angelangt. Was bedeutete sie für sein Seelenleben? Hatte sich der Himmel oder die Hölle aufgetan, wenn sie ihn im Hörsaal 31 wieder einmal ignorierte? Er wusste es nicht. Also seufzte er. »Seufzo, ergo sum.« Im selben Moment, in dem er den Satz weinerlich vor sich hinblödelte, musste er schon wieder an seinen Vater denken. Er hätte so einen Ausspruch niemals ungeahndet gelassen. »Sag es richtig, oder gar nicht!«, hätte er wie immer jegliche sprachliche Kreativität im Keim erstickt. Wotan seufzte – und mit Schrecken stellte er fest, dass dieses Seufzen einem Weinen zu gleichen begann. Also riss er sich am Riemen – hoffentlich reißt er nicht, dachte er in einem Anflug von Galgenhumor – und begann den Kofferraum zu entladen.
Er wurde von einem schrillen Klingeln unterbrochen. Im ersten Moment erinnerte ihn das Geräusch an Laili, wenn sie etwas wollte, es aber nicht bekam. Im zweiten Moment hatte er erst die Kraft, nervös zusammenzuzucken, und endlich im dritten Moment wurde ihm klar, dass er sich doch nicht ganz fern jeglicher Zivilisation befand: Aber wo war sein Handy? Das Klingeln als Orientierungshilfe nützend, fand Wotan die »elektronische Hundeleine« schließlich im roten Rucksack. Tante Agathe wollte sich nur erkundigen, ob er alles gefunden habe, und ob alles auch funktionieren würde. Ja, Tante Agathe, danke vielmals, Tante Agathe. Nein, in der Küche sei er noch nicht gewesen. Ja, Tante Agathe, danke dir, Tante Agathe. Als er das Gespräch beendet hatte, wählte er die elterliche Telefonnummer. »Ja, Laili, gibst du mir den Papa oder die Mama? Nein, mich hat hier noch kein Yeti getötet. Nein Laili, ich bin ja nicht im Himalaya, sondern nur im Lungau. Was heißt hier schade! Also, gib mir jetzt endlich … ah, Papa, endlich! Ja, ich habe bereits mit der Tante Agathe telefoniert. Natürlich war ich höflich. Ja, danke, ja … Mama! Ja, alles in Ordnung. Nein, ich werde nicht verhungern, keine Sorge. Und erfrieren auch nicht. Vor welchen Tieren soll ich mich hüten? Aha, daher hat die Laili also diesen Yeti-Blödsinn! Nein, ich meine natürlich nicht, dass sie den direkt von dir hätte. Ich wollte nur sagen, dass das offenbar unausgesprochen in der Luft gehängt ist, und die Laili hat das halt wieder einmal als Erste blöd formuliert. Ja Mama, ich weiß, ich soll nicht über meine Schwestern schlecht reden. Also red ich lieber gar nicht über sie. Ja, das wird mir hier ja nicht sehr schwer fallen. Gut, ja, danke. Bussi!«
Als Wotan aufgelegt hatte, hob sich sogleich seine Laune. Es gäbe etwas zu essen in diesem Haus, hatte Tante Agathe gesagt. Also machte er sich auf die Suche nach Tiefkühltruhe und Mikrowellenherd. Und er fand sogar Rindsrouladen mit Spiralnudeln – ein Luxus! Und seine liebe Tante hatte ihm noch dazu Bier eingekühlt! Wotan beschloss, dass »mit soeben« ein neuer Lebensabschnitt begonnen hatte. Er würde allen beweisen, dass er sehr wohl in der Lage war, rasch und gut seine Bakkalaureatsarbeit fertigzuschreiben. Jawohl, er war auf dem Weg, endlich richtig erwachsen zu werden … oder zumindest damit anzufangen.
Es musste an der Waldluft liegen, dass er plötzlich so entschlossen war, entschlossener zu werden. Ab nun würde er definitive Entscheidungen treffen und nicht alles nur dahindümpeln lassen. Wobei … so ein Beschluss brauchte natürlich einen festlichen Rahmen, um in Kraft gesetzt zu werden. Also begann Wotan, den Küchentrakt nach möglichst edlem Geschirr zu durchsuchen, um das Nachtmahl gebührend zu zelebrieren. Nach fünfminütigem Wühlen in Tante Agathes Tellerstößen stellte er leicht frustriert fest, dass es nur ein dekorloses, robustes Einheitsgeschirr gab. Von so einem Detail ließ sich »der neue Wotan Perkowitz«, der er ab nun sein wollte, jedoch nicht entmutigen.
Rindsrouladenbissen um Rindsrouladenbissen spürte er, wie er an Kraft gewann, um in den nächsten drei Monaten seine etwas verworrene Situation durch Fleiß und Entschlussfreudigkeit zu bereinigen.
Ja, das würde ihm gelingen!
Aber nicht mehr heute – das opulente Mahl, der Alkohol und die mitternächtliche Uhrzeit zwangen Wotan zur Erkenntnis, dass auch morgen noch Zeit genug sein würde, um auszupacken und einzuräumen, und so suchte er nur mühsam Pyjama und Zahnbürste und wankte in Richtung Badezimmer. Nach einem sehr kurz geratenen Aufenthalt in eben diesem wollte Wotan noch im Bett darüber nachdenken, wie er denn … aber dazu kam er nicht mehr.
Salzburg, Anno Domini 1675, dem 13. Juni
Sie überfiel sie jäh und trotz allem unerwartet. Die Angst war plötzlich anwesend, fast so, als ob sie als Mitgefangene neben ihr angekettet wäre. In einem hysterischen Aufflackern von Ironie lachte sie kurz und hasserfüllt vor sich hin – wo sollte denn diese Angst sein? Zelle winzig … Angst immer größer … daher kein Platz für die Angst … also doch keine Angst – dieser Gedankengang hätte den Hexenkommissaren beim Verhör gefallen, dachte sie bitter. Doch die scheinbar logische Überlegung nützte ihr auch diesmal nicht … und damit brach die Angst endgültig über sie herein.
Einen Moment glaubte, nein, hoffte sie, an dieser Angst zu sterben. Ihr wurde so übel, dass sie die Kälte, den Hunger, den Durst, ja nicht einmal mehr die Schmerzen der Folterverletzungen spürte … doch ebbte dieser Zustand leider ebenso rasch ab, wie er gekommen war.
Die Angst blieb.
Sie wollte sich so fürchten, dass ihr Herz aussetzen würde, dass Gott, an den sie immer noch glaubte, obwohl ihr all die Schmerzen auch in seinem Namen zugefügt worden waren, sie endlich zu sich nehmen müsste. Doch sie vermochte es nicht, sich – endlich – zu Tode zu fürchten. Sie weinte bitterlich. Jetzt nützte ihr die Angst nicht mehr, jetzt quälte sie sie nur noch.
Das Schlimmste war, dass diese Bestien in ihren Richterröcken sie nun endgültig dort hatten, wo sie deren Meinung nach hingehörte. An das Ende allen menschlichen Seins, das bei ihr so minder war, dass es nur mehr durch die Hinrichtung, die reinigende Wirkung der Leichnamsverbrennung und die Gnade Gottes erträglich gemacht werden konnte.
... an dieses verfluchte Ende des Seins, das ihr von Anfang an beschieden gewesen war. Tochter eines Abdeckers, eines Schinders … der letzte Dreck für die ehrbaren Bürger! Fast so missachtet wie die Folter- und Henkersknechte, die ihr seit vier Monaten das Leben zur Hölle machten, schoss es ihr durch den Kopf – ein Gedanke, über den sie innerlich lächeln musste. Äußerlich konnte sie nicht mehr den Mund verziehen, die gebrochenen Kiefer schmerzten zu sehr.
Ihr Lebensweg hatte beständig bergab geführt. Die glücklichen Zeiten waren rar gewesen. Wie sie ihren Kilian geheiratet hatte – auch ein Ausgestoßener, ein Henkersknecht und Schinder, aber eine stattliche und Respekt gebietende Gestalt. Die Bauern hatten sich vor ihm gefürchtet!, dachte sie in einem Anflug von Glück. Und dann war da ihr Sohn Jakob gewesen, der Zauberer-Jackl, der ihr Begleiter und Komplize geworden war. Auch die Zeit mit ihm war noch erträglich gewesen.
Das Quietschen des Schlüssels und der schweren Eisentür ließen sie aufschrecken. Da wurde die Angst endgültig zur Panik. Sie wusste augenblicklich, dass sie nun alles gestehen würde, was man ihr in den Mund legte – sie war am Ende ihrer Kräfte, sie ertrug die Folter nicht mehr!
Mittwoch, 9. Juli 2008, 15 Uhr
Jäh schreckte Wotan aus seinem Schlaf – er glaubte, einen Schrei gehört zu haben.
In dem Moment entfuhr ihm ein zweiter, als er seinen Kopf in Richtung des Hangfensters zu seiner Rechten drehte. Eine Kuh hatte ihren Kopf zum Fenster hereingesteckt und kaute mit einem Ausdruck blöden Stumpfsinns vor sich hin. Warum, dachte Wotan, warum steckt dieses Vieh seinen Kopf hier herein, wenn es sich so überhaupt nicht für meinen Morgenschlaf interessiert? Egal, es war nicht an der Zeit, tiefschürfende Überlegungen über viehische Verhaltensweisen anzustellen, denn das Tier stank dermaßen aus dem Maul, dass Wotans schlechtes Gewissen, sich gestern Abend nur kurz die Zähne geputzt zu haben, augenblicklich verging. »So wie du stink ich lang nicht!«, fuhr er die Kuh an und setzte sich auf. Seine rasche Bewegung veranlasste das wiederkäuende Vieh dazu, widerwillig den Kopf aus dem Fenster zu ziehen.
»Wem gehört denn dieses Stinkmonster?«, hörte er von der anderen Seite des Hauses unten vor der Türe eine Stimme fragen. Fragen – na ja, eigentlich war es eine ungewöhnlich schnarrende Stimme, die Sprachmelodie kaum auszumachen, ja selbst das Geschlecht des Sprechers war nur schwer zu identifizieren. Er stürmte die Treppe hinunter, um vorm Aufreißen der Tür zu begreifen, dass er unmittelbar aus dem Bett kam. Doch es war zu spät! Unfrisiert, unrasiert, mit schlafverklebten Augen und Mundgeruch, in einem verdrückten Pyjama stand er vor einer … einer … er traute seinen Augen nicht – er war wohl doch noch in der Aufwachphase. So eine Gestalt konnte es im 21. Jahrhundert nicht mehr geben, zumindest nicht in Mitteleuropa.
»Gehört Ihnen das Stinkmonster?« – die Gestalt sprach! Und es war sogar die Stimme von vorhin, unmittelbar nach dem Kuhalarm.
Diese Stimme kam aus einer Hülle, die lediglich die groben Proportionen mit der Species Mensch teilte. Ansonsten bestand die Gestalt aus kuhhäutigen Fellfetzen, die tentakelgleich von einem grau-grünen Etwas abstanden – dieses Etwas erinnerte in Struktur und Geruch an gepressten Kuhmist.
Die Krönung bildete eine schwarze Katze, die oben links auf dem Gebilde thronte und Wotan mit ihren ockerfarbenen Augen fixierte.
»Sind Sie taub?«, kam es aus dem obersten Teil der Naturstatue. »Gehört Ihnen dieses Stinkmonster?« – einer der Tentakel schoss in die Höhe und zeigte auf seine Schenhajt, die ebenfalls noch verschlafen wirkend einige Meter entfernt parkte. Und da begriff Wotan endlich, dass das ein Arm war, dass es sich bei seinem Gegenüber wohl doch um einen Menschen handelte, und dass mit dem »Stinkmonster« weder die Kuh noch sein Gegenüber noch er, sondern sein Auto gemeint war.
»Ja.« Mehr brachte Wotan aufgrund seiner geballten Erkenntnis nicht heraus. »Sie wagen es, mit Ihrer Kohlendioxidschleuder hier herauf auf die … fahren Sie eigentlich einen Diesel?«
»Ja.« Wieder war Wotan zu nicht mehr als zu diesen zwei Buchstaben in der Lage, diesmal aber eher aus dem grenzenlosen Erstaunen heraus, in das ihn diese Sagengestalt versetzt hatte. Aber er genoss in diesem Moment selbst dieses Rumpfwort, da es ihm erlaubte, zumindest minimal Widerstand gegen die Ökotirade zu leisten.
»... dann kommen noch die Rußpartikel dazu, Sie Klimaterrorist, Sie Baumschänder, Sie … Sie typischer Städter!«
Wotan hatte ein Déjà -vu. Er war doch erst kürzlich auf ungewöhnlich hochgestochene Art zurechtgewiesen worden … ah ja, natürlich, der intellektuelle Waldtraktorfahrer gestern bei der Anreise. Boten hier alle Eingeborenen eine Mischung aus leicht seltsamem Verhalten und brillanter Ausdrucksgabe? Hatte es hier durch die abgeschiedene Lage im Lauf der Jahrhunderte vielleicht genetische Veränderungen gegeben? Oder diente die Gegend einfach als Rückzugsort für pensionierte Nobelpreisträger?
»Also, was jetzt? Wieso erlauben Sie sich, mit dem Auto hier heraufzukommen? Die Zufahrt ist nur Eigentümern und Anrainern gestattet – gehören Sie etwa zu diesem erlauchten Kreis?« Die Betonung des Wörtchens »Sie« war wohl als besondere Beleidigung gedacht, die Wotan aber geflissentlich überhörte.
Er holte tief Luft. »Gnädige Frau« – das Wesen vor ihm nahm sofort eine weniger offensive Körperhaltung ein – »gnädige Frau, ja, ich bin so eine Art Besitzer, und nein, ich wollte selbstverständlich nicht die Wälder schänden, schon deshalb nicht, weil zumindest der umliegende Wald meiner Tante Magistra Agathe Gattermüller gehört und, soviel ich weiß, forstwirtschaftlich genützt wird. Gestatten Sie mir, dass ich mich, obwohl ich wahrlich nicht präsentabel aussehe, Ihnen vorstelle. Mein Name ist Wotan Perkowitz. Ich bin der Sohn von Magistra Gattermüllers älterer Schwester …«
»Sie sind der Sohn von der Lisi? Mein Gott, warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt?« Beinahe wäre Wotan ein »Wann denn« entschlüpft, doch konnte er sich gerade noch einbremsen. »Nun, verzeihen Sie mein Versäumnis, Frau …«
»Ich bin die Kollerin … das heißt, vor so einem wohlerzogenen jungen Herrn muss ich mich natürlich korrekt vorstellen … wo bleiben denn nur meine Umgangsformen.«
Ja, wo denn?, dachte Wotan, ohne die Miene zu verziehen.
»Barbara Koller, ich bin Ihre Almnachbarin. Da drüben, die Lacknseealm. Aber die Leut hier kennen meine Alm nur unter dem Namen Hexenalm. Im Übrigen, ziehen Sie sich endlich was an, sonst verkühlen Sie sich noch zu Tod. Außerdem, also bei uns hier trägt man um drei Uhr am Nachmittag keinen Pyjama mehr. Noch dazu jetzt, nach dem Gewitter von vorhin … da sollte man trotz der Kühle hinaus in die Natur gehen, nicht drinnen im Bett liegen.«
Wotan hatte zwar eine Weile gebraucht, um zu begreifen, was ihm Frau Koller mit unnachahmlichem Sarkasmus in der Stimme zu verstehen gab. Als er aber seinen Kopf gedreht und einen Blick auf die verkitschte Kuckucksuhr hinter sich geworfen hatte, durchzuckte ihn eine Scham, die ihn heiß-rot werden ließ.
Es war tatsächlich 15 Uhr am Nachmittag!
Er hatte 15 Stunden durchgeschlafen.
Ob es die wochenlange Bakkalaureat-Fertigschreiben-Auseinandersetzung mit seinen Eltern, die angespannte Neugier der letzten Tage, die gestrige Herfahrt oder die Überdosis Waldluft war, die ihn so ermüdet hatte, konnte er noch später überlegen – jetzt genierte er sich und fror, weshalb er nur mehr rasch ins Badezimmer huschen und in adäquatere Kleidungsstücke schlüpfen wollte. Wobei … Frau Koller hatte recht, es war für einen Julinachmittag erstaunlich frisch. Viel kühler, als es im Hochsommer vor einem Jahr gewesen war – selbst beim morgendlichen Erstürmen der Liegestühle am Strand von Rimini hatte es ihn nicht so gefröstelt. Rimini – doch bevor Wotan wieder in wehmütiges »Amelieren« abgleiten konnte, riss ihn die schnarrende Stimme in die Almenrealität zurück. »Ich darf doch reinkommen?« Wotan zog sich stumm nickend ins Bad zurück. Von unten hörte er leises Miauen und Geschirrgeklapper. »Ihre Tante hat doch immer einen so wunderbaren Assam-Tee hier irgendwo … da ist er ja.« Als er aus dem Badezimmer kam, hörte er den Wasserkessel pfeifen, und beim letzten Hemdknopf duftete der Tee bereits verführerisch.
Mittwoch, 9. Juli 2008, 15.15 Uhr
Verstohlen über den Tassenrand schielend war Wotan nach wie vor von der modischen Erscheinung seines Gastes fasziniert. Sein Eindruck unmittelbar nach dem Aus-dem-Bett-geschmissen-worden-Sein hatte ihn nicht getäuscht – Frau Koller trug eine Art Umhang, der aus grob zusammengenähten Kuhhäuten bestand, an welche ausgestopfte Kuhbeine angefügt waren. »Zucker?« … beim Umdrehen zur Anrichte schwangen die Kuhbeine in einem beinahe sechzig-gradigen Winkel vom Körper weg. Trotz seiner Verblüffung ob dieses wandelnden Mobiles registrierte Wotan, dass sich Frau Koller bestens auf der Alm seiner Tante auszukennen schien – sie griff gezielt nach der Zuckerdose. Daraufhin nahm Wotan all seinen Mut zusammen.
»Entschuldigen Sie meine Neugier, aber … aber …« Was das alles solle, wollte er sie nun doch nicht fragen – er rang mit einer Formulierung.
»Warum ich wie eine Verrückte angezogen bin?« – dankenswerterweise befreite ihn die Nachbarin aus seiner Verlegenheit. »Wissen Sie, das hat etwas mit Selbstmarketing zu tun. Mit Selbstachtung im weitesten Sinn auch. Jetzt schauen Sie doch nicht so entsetzt – es ist folgendes: Wie schon erwähnt, nennen meine Alm alle nur die Hexenalm. Das hat etwas mit der Geschichte zu tun. Vor rund drei Jahrhunderten gab es hier in der Gegend einen grässlichen Hexenprozess. Viele von den ach so ehrbaren Bürgern hatten schlicht und einfach kein Mitleid mit den zahlreichen Bettlern und den herumziehenden Waisenkindern … die Säuberungswelle durch die Behörden kam aus der damaligen Sicht gerade zur rechten Zeit.«
Wotans Bürgerliche-Werte-Welt ließ ihn zusammenzucken. Immer sind die Bettler die Armen!, wollte er schon den Stand der Besitzenden verteidigen. Erfreulicherweise fiel ihm rechtzeitig ein, dass Bettler für gewöhnlich tatsächlich arm waren, sodass er den Einwurf gerade noch hinunterschlucken konnte und sich nicht bis auf die Knochen blamierte.
»Das Ganze lief auf eine Vernichtungsmaschinerie vor allem halbwüchsiger Bettelbuben hinaus. Diese dummen Kinder haben noch dazu herumerzählt, dass ein ‚Zauberer-Jackl‘ ihr Anführer sei … über neunzig Kinder und Jugendliche wurden der Zauberei und ähnlicher Delikte angeklagt und daraufhin hingerichtet. Das erste Opfer dieser perversen Serie aber war die Mutter des angeblichen Zauberers namens Jakob, sie wurde verbrannt. Und jetzt raten Sie, wie diese bedauernswerte Kreatur geheißen hat … na?«
Da Wotan von einer rein rhetorischen Frage ausging, setzte er nur kurz seinen treuesten »Ja, wie denn?«-Blick auf. Prompt funktionierte er.
»Barbara Koller! Ja, genau, so wie ich … genau so hat diese bitterarme Person geheißen. Und jetzt stellen Sie sich vor, was ich mir deshalb schon in der Volksschule habe anhören müssen. Noch dazu bin ich rothaarig! ‚Schiache Hex‘ war noch das Netteste, was man mir schon als Fünfjähriger nachgerufen hat.«
Wotan kam nicht umhin, auf jene Stelle auf ihrem Kopf zu starren, die normale Damen als Frisur titulierten, pflegten beziehungsweise pflegen ließen und auch mit mehr oder weniger Stolz herzeigten. Dieses undefinierbare Gestrüpp waren einmal rote Haare gewesen?
»... ja, und genau damals war’s« – Wotan kehrte von seinen Haarbetrachtungen zur ein wenig ausufernden Barbara Koller zurück – »damals, in der Pubertät, als ich beschlossen habe, mich eben wie eine echte Hexe zu geben. Wenn die Leute eine Hexe wollen, sollen sie eine Hexe kriegen. Also habe ich mein Leben etwas … na ja, sagen wir, unkonventionell gestaltet. Mit schwarzer Katze auf der Schulter. Dem jeweiligen Modediktat habe ich mich nie unterworfen.«
Nein, wahrlich nicht!, dachte Wotan entsetzt.
»Ich trage richtige Naturmaterialien, die vor allem die ursprünglichsten Funktionen von Kleidung erfüllen. Kleidung muss vor Kälte und Nässe schützen, und das tun meine Mädchen noch heute.« Liebevoll strich sie über die Kuhhäute. »Das da, das war die Annamirl, die war wie ich. Die hat sich von niemandem was gefallen lassen … das sieht man sogar jetzt noch.«
Wotan brauchte eine Sekunde, bis er begriff, dass Annamirl jene Kuh gewesen sein musste, von der die vernarbte Haut stammte, die heute Frau Kollers linke Schulter wärmte. Fassungslos griff er nach einem der angenähten Kuhbeine. »Und die?«
Mit einem Lächeln, das sich zwischen blanker Bosheit und kindlicher Freude nicht entschließen konnte, nahm Barbara Koller eines der Anhängsel in die Hand. »Die sind meine Wahrzeichen! Seit Jahrzehnten trag ich solche Dekorationen. Sehen Sie, da sind wir beim Selbstmarketing. ‚Die Kuhhaxen-Hex‘ haben sie mich genannt, wie ich damit angefangen habe. Und so hab ich auch meine Firma genannt: Kuhhaxen-Hex. Und dass dieser modische Behang noch dazu so schön herumwirbelt, hat einen weiteren Vorteil. Diese Bewegung …« – Frau Koller drehte sich erstaunlich behände um die eigene Achse und verteilte das unnachahmliche Aroma toter Tierhaut in der Küche – »die hält mir die bösen Geister vom Leib … was ich als Hex natürlich ganz besonders brauchen kann.«
Bei dieser offensichtlich als Scherz gedachten Koketterie gurgelte ein Lachen aus ihrer Kehle, das Wotan an das Starten eines Zweitaktmotors erinnerte.
»Danke für den Tee – jetzt muss ich aber wieder los. Weil, ich hab noch viel zu tun! Ich muss nämlich wieder einmal meinem Ruf als wandelnder Schrecken des hiesigen Establishments gerecht werden und heute noch zwei Scheinmoralaposteln so richtig schön auf die Zehen treten. Diabolina, komm!«
Flugs wandte sie sich nach einem kurzen Handschütteln ab und verließ schwebend und mit rotierenden Tentakeln das Haus, die schwarze Katze sprang ihr nach.
Wotan war so verblüfft, dass ihm erst, als sie draußen war, einfiel, sich nach ihrer Firma zu erkundigen.
»Na ja, werd ich das halt Tante Agathe fragen«, murmelte er zu sich – um sogleich innerlich zu erblassen. Tante Agathe! Jetzt war er schon fast einen Tag hier und hatte sie noch immer nicht besucht! Rasch räumte er das Geschirr weg, machte nur die notwendigste Ordnung und setzte sich in sein Auto, um diese »bodenlose Unmanierlichkeit«, wie sein Vater sagen würde, wieder gutzumachen.
Mittwoch, 9. Juli 2008, 17 Uhr
Er jagte seine Schenhajt über den Forstweg, in einem Tempo, das die Qualität einer deutsch-tschechischen Kooperation auf das Härteste prüfte. Erstaunlicherweise schien das Auto standzuhalten, doch plötzlich hörte Wotan ein knurrendes Geräusch, das nicht zu all dem Geholperlärm passte.
Getriebe? Auspuff? Irgendwas an den Achsen?
»Bitte, Schenhajt, lass mich jetzt nicht im Stich!«
Panik breitete sich in ihm aus. Kein Auto, kein Tantenbesuch, keine Hiafalm, keine Bakkalaureatsarbeit, keine zufriedenen Eltern, kein Zuhause, keine Chancen, kein Leben – so in etwa rasten Wotans Gedanken in seinem Hirn. Er lauschte angestrengt … da, da war es wieder. Seltsam, eigentlich klang es gar nicht motorisch, sondern eher körperlich. Außerdem kannte Wotan das Geräusch. Er überlegte fieberhaft, welcher seiner bisherigen Pannen dieser Klang vorausgegangen war?
Das Nachdenken verbesserte nicht wirklich seine Stimmung … »außerdem bin ich hungrig!«, maulte er das Armaturenbrett an. Hungrig … hungrig … irgendetwas ließ Wotan nicht mehr von dem Wort loskommen … und da war auch wieder dieses unheimliche Geräusch … und endlich durchflutete ihn die Erkenntnis wie der Regen eine Wüstenlandschaft. »Heureka! Ich bin hungrig! Das Geräusch macht mein Magen!«
Als ob sein Magen telekinetische Fähigkeiten hätte, standen sein Wagen und er plötzlich vor dem »See- und Ausflugslokal Hiafalm am Lacknsee«.
Wenn das Essen so gut wie der Name lang ist, dann sollte meinem Knurrbauch geholfen werden können, dachte Wotan bei sich und lenkte seine Schenhajt auf den leeren Parkplatz.
Ein leerer Parkplatz? Bei einem Ausflugslokal? Im Juli? Wotan blieb im Auto sitzen und überlegte kurz, doch weiterzufahren.
Schließlich entschloss er sich, doch auszusteigen und dem Rätsel aktiv auf den Grund zu gehen.
»Besitzer: Adalbert Furmaier«, stand in großen Buchstaben auf einem hübschen Holzschildchen, das am oberen Rand der Eingangstür angebracht war. Woher kannte er nur diesen Namen?, wunderte sich Wotan, ehe er die Tür zu öffnen versuchte, wobei er die zweite Tafel weiter unten einfach übersah. Er hatte eine schwere Holzpforte erwartet und seinen Druck entsprechend dosiert – und konnte daher nur mit Mühe einen Sturz abfangen, als die Tür – mit ihm – weit in die Schankstube hinein aufschwang.
»Ruhetag! Außerdem haben wir auch sonst nur bis 17 Uhr warme Küche. Beehren Sie uns bitte morgen ab elf Uhr wieder!« – der Gedanke, diese Stimme zu kennen, lenkte Wotan gerade so lange ab, bis ihm klar wurde, dass er das Mysterium des leeren Ausflugslokal-Parkplatzes im Juli gelöst hatte. Ruhetag!
Und außerdem … es war schlicht und einfach schon spät! Durch seine etwas unerwartete »Morgen«-Gestaltung mit Frau Koller hatte er jegliches Zeitgefühl verloren. Ein Blick auf seine Uhr brachte Wotan endgültig wieder in die Realität zurück – es war 18.07 Uhr. Wenigstens war sein Versäumnis, seine Tante Agathe noch nicht besucht zu haben, nicht unverzeihlich – immerhin war er erst seit ziemlich genau 24 Stunden hier.
»Entschuldigen Sie, könnte ich trotzdem eine Kleinigkeit zu essen bekommen? Ich bin nämlich schrecklich hungrig.« Der durch und durch glückliche Klang seiner Stimme – er jubelte innerlich ob der Doch-nicht-so-Unhöflichkeit des Noch-nicht-Tantenbesuches – passte nicht wirklich zum Inhalt des gerade Gesagten. Prompt folgten der »Erst-ab-morgen-11-Uhr«-Stimme die dazugehörigen Augen, die aus der Küche in den Gästeraum blinzelten.
Wotan wusste sofort, woher er sie kannte. Sie gehörten zu demselben Kopf, der gestern in einem gelben Helm gesteckt und ihn kraft seiner intellektuellen Ruhe vollkommen verblüfft hatte.
Und jetzt war Wotans Hunger diesem Kopf ausgeliefert!
»Ach, der junge, ungestüme Herr! Hat Ihnen Ihre Tante doch nicht den Eiskasten vollgefüllt?«
Wotan machte ein dermaßen irritiert-verblödetes Gesicht, dass die Ironie Adalbert Furmaiers sofort in Mitleid umschlug.
»Na, dann kommen S’ halt herein – irgendwas Sättigendes wird sich schon finden lassen.«
Wotan war noch immer so verdattert, dass er hölzern auf Furmaier zutrat, die Hand ausstreckte und »Grüß Gott!« stammelte.
Furmaier wischte sich die Hände an seiner Schürze ab und hielt ihm eine Pranke entgegen, die nicht zu seiner Ausdrucksweise passte. Da erwachte Wotan aus seiner von Hunger und Überraschung verursachten Starre. In dem Moment begriff er auch, wieso ihm der Name bekannt vorgekommen war.
»Danke vielmals … Herr Furmaier?«
»Ja, der bin ich, Herr Perkowitz.«
Wotan fragte sich gar nicht erst, woher sein Gegenüber seinen Namen kannte. Adalbert Furmaier war der langjährige heimliche Verehrer seiner Tante Agathe, von dem offiziell natürlich niemand wissen durfte, der aber inoffiziell als »Herr Magister Gattermüller« oder als das »Tantengspusi«, wie ihn seine Schwester Isi respektlos titulierte, bekannt war.
Eigentlich kein so übler Kerl, dieser Tantengspu... Verzeihung, der Herr Furmaier, dachte Wotan erleichtert, schüttelte die klobig-raue Furmaier-Hand … und wunderte sich schon wieder. Diese rissige Tatze zerdrückte ihm nicht seine Hand – Wotan hasste die »maskulinen Handzerquetscher« –, im Gegenteil, Furmaiers Händedruck war sanft, beinahe entschuldigend.
Als Wotan in die Küche gebeten wurde, fiel ihm als Erstes wieder sein Hunger auf, als Zweites aber die Sauberkeit dieser kulinarischen Schaltzentrale – an eine Küche erinnerte der klinisch saubere Raum in Edelstahl, der vor lauter blinkenden und leuchtenden Lämpchen »Raumschiff Enterprise«-Atmosphäre ausstrahlte, nur peripher.
»Ja, ich bin ein Technikfreak. Und ja, wir brauchen hier viele Maschinen, ganz besonders im Juli zur Ferienzeit«, griff Furmaier den verdutzten Blick Wotans auf.
Bevor er zu einer Rechtfertigung ansetzen konnte, krachte die Lokaltür und erlöste Wotan aus seiner Misere.
»Maroni, ich bitt dich, pass doch auf!«
»Tschuldigung!«
Wotan hatte plötzlich das Bild einer feenhaften Erscheinung vor Augen – das musste wohl am Duft liegen, der in die Küche zog. Ein Hauch von Noblesse, eine Idee von wallenden blonden Haaren und langen blassen Beinen, eine Nuance von weiter Welt …
»Sag einmal, musst du dir dein Parfum literweise draufleeren, das stinkt ja wie im … nein, das sag ich jetzt lieber nicht!« Furmaier schien den Geruch von Pommes frites und Germknödeln zu bevorzugen.
Wotan wappnete sich, um den Anblick des gleich die Küche betretenden, sicher engelsgleichen Wesens ertragen zu können, ohne sofort an Amelie zu denken.
»Oh, du hast Besuch. Sehr erfreut, Zillerberg, Maria-Antonia Zillerberg.«
Wotan schien heute aus dem Zustand der Verwunderung nicht mehr herauszukommen – vor ihm stand eine zweifelsohne reizende junge Dame, aber von blond, langbeinig und unnahbar-verrucht keine Spur, Fräulein Zillerberg war klein, brünett und sehr sympathisch.
Mittwoch, 9. Juli 2008, 18.30 Uhr
»Ich küss die Hand, Fräulein Zillerberg.«
»Salzburg, Graz oder Wien?«
»Wie meinen?«
»Ob Sie aus Salzburg, Graz oder Wien sind?«
»Aus Wien … aber wieso?«
»Glauben Sie wirklich, ein Hiesiger würde ‚Küss die Hand‘ und ‚Fräulein‘ sagen?«
»Maroni, jetzt tust du uns ländlich-sittlich-einfachen Menschen unrecht, und das weißt du auch!«, schaltete sich Furmaier dazwischen. »Zum Beispiel der Herr Doktor Hangerer, oder der Herr Pfarrer, oder aber Vater und Sohn Herrenberg, oder …«
»Jaja, du hast mich überzeugt, ich verdinge mich hier als Ferialkellnerin in einer Gegend erlesenster Umgangsformen.«
»Das Fräulein von Zillerberg geruht manchmal etwas in Zynismus abzurutschen, aber sonst ist sie eine wunderbare Ferienaushilfe, eine herausragende Kunstgeschichtestudentin und eigentlich eine reizende junge Dame der gehobenen Salzburger Gesellschaft. Und Ihr ‚Küss die Hand‘, lieber Herr Perkowitz, hat Ihnen sofort einen Sonderstatus bei unserem Fräulein von Zillerberg beschert.«
Endlich befand sich Wotan auf seinem Terrain! Er war hier unversehens in ein Duell mit feinster Klinge geraten, da zählte jede noch so leichte Betonung einer Silbe, jedes noch so kurze Zögern vor einem Wort. Anders formuliert, Wotan war mitten in der Welt der altösterreichischen Hautevolee gelandet, dem Minenfeld österreichischer Soireen und Bälle.
Aber wieso hier?
Egal … was hatte er herausgehört? Die junge Dame stammte vermutlich aus einer Familie adeligen Ursprungs – allerdings wohl niederer Adel, vielleicht Beamtenadel?
Egal, Wotan freute sich! Endlich zahlte es sich aus, all die Bälle, die väterlichen Rüffel wie die schwesterlichen Verbalspitzen nicht nur verkraftet, sondern auch verarbeitet zu haben.
Was hatte er noch aus dem Wortwechsel eben heraushören können? Fräulein Zillerberg schien sich hier nicht ernsthaft sozial integrieren zu wollen … das Manierenrepertoire ländlicher Jugend war offenbar nicht das ihre.
Da war doch noch was? … ah ja, die eigentliche Information: Die junge Dame war nur als Ferienaushilfe hier, die restlichen zehn Monate verbrachte sie als Studentin der Kunstgeschichte in Salzburg.
Und noch etwas hatte er, quasi en passant, mitgekriegt – Adalbert Furmaier war nicht nur das »Tantengspusi« aus Ermangelung anderer Möglichkeiten für beide, nein, er war, und Wotan begann es sogar für seine Tante zu hoffen, ihr – wie sagte man heute so schön? – »Lebensmensch«, weil er gebildet war, nett, charmant und, zumindest verbal, hochbegabt.
Wotan wollte zahlen, wurde eingeladen, bedankte sich herzlich, verließ die Gaststube … und kehrte sogleich wieder zurück.
»Entschuldigen Sie, lieber Herr Furmaier, wo finde ich denn jetzt um 19 Uhr meine Tante? In ihrer Apotheke wird sie ja wohl kaum mehr sein? Kommt sie jetzt eh … her … zu Ihnen?«
Furmaier reagierte überraschend entsetzt. »Um Gottes Willen, wo denken Sie hin! Es lästern sowieso schon alle, dass wir … na ja, egal … nein, da kann Ihre Tante das nicht auch noch brauchen. Aber, am Rande bemerkt, sie ist noch in ihrer Apotheke. Soviel ich weiß, hat die heute Nachtdienst … und ihre Tante hat sich selbst dazu eingeteilt.«
Wotan konnte kaum glauben, dass offiziell niemand von der »unschicklichen Liaison« wissen durfte. »Ja, dann … danke nochmals« – kopfschüttelnd stürzte er endgültig aus der Tür hinaus und fuhr ins Tal.
Mittwoch, 9. Juli 2008, 19.30 Uhr
»Aber gern, Frau Mayer, ja, ganz sicher wird Ihnen das helfen. Natürlich, wenn Ihnen das der Doktor Hangerer verschrieben hat, dann wird er schon wissen, warum. Kommen Sie, ich helf Ihnen aufstehen. So, ja, schön langsam, nur nichts überstürzen. Ja, da haben Sie recht, das ist das Schöne am Alter, es darf alles ein bisschen langsamer gehen. Aber gern, hoffentlich hat Ihnen unsere neue Kräutertee-Mischung geschmeckt. Nein, nein, nichts zu zahlen, also, die eine Tasse geht aufs Haus. gute Nacht! Auf Wiedersehen.«
Magistra Gattermüller schloss wieder die Tür. Eigentlich bin ich eine Mischung aus Pfarrerin und Ernährungsberaterin … und manchmal ein bisschen Apothekerin, schüttelte sie den Kopf. Warum so viele Leute gerade am Abend und in der Nacht entdeckten, dass sie unbedingt und auf der Stelle das Medikament brauchten, das sie vor Tagen verschrieben bekommen hatten … sie wusste es nicht.
Nein, falsch, sie wusste es sehr wohl!
Es war die Einsamkeit in der Dunkelheit, die manchem seine Schmerzen immer schlimmer erscheinen ließ. Seltsam, selbst in einer ländlichen Kleinstadt gab es erstaunlich viele einsame Menschen. Magistra Gattermüller seufzte. Diesen Gedanken würde sie aber schön für sich behalten, sonst würden sich die städtischen Klatschmäuler ebendieselben gleich wieder über sie zerreißen. »Oh Bertl!«, entfuhr ihr ein Seufzer. Alle, aber wirklich alle, wussten von ihr und ihm, aber niemand wagte, eine direkte Bemerkung zu machen – dafür boomten die Anspielungen.
Wie schwer es doch wäre, so allein durchs Leben zu gehen, wo man doch sonst alles hätte!
Wie schade es doch wäre, dass gerade eine so erfolgreiche Frau wie sie keinen Partner finden könne!
Partner! Tatsächlich sagte heute niemand mehr »Mann«, nein, sie hatte – offiziell – keinen Partner. Blödsinn!
Sie schüttelte sich wie ein nasser Hund, als ob sie dadurch all die Bosheiten, die ihr die ach so lieben Mitmenschen antaten, loswerden könnte. Das funktionierte natürlich nicht, aber ein wenig besser fühlte sie sich nach dieser Bewegung dann doch.
Eigentlich war es eine Riesengemeinheit, dass viele nur auf ihr etwas verworrenes Privatleben anspielten, aber die wenigsten ihre Leistungen zu würdigen gedachten. Kaum einer sprach darüber, dass sie sich gut in der Kunstgeschichte der Lungauer Kirchen auskannte und dass sie eine hervorragende Apothekerin, eine passable Bibelkennerin und eine ausgezeichnete Köchin war. Wobei sie die beiden letzteren Fähigkeiten zu einer weiteren eigenständigen kombinierte – ohne ihre Aufläufe und Bäckereien wären die Bibelrunden in der Pfarre wohl nicht so regelmäßig so gut besucht. Ob der liebe Gott ihr dafür verzeihen würde, dass sie am Sonntag vor drei Wochen die Messe geschwänzt hatte und das auch sicher nicht beichten würde? Sie konnte ja schwerlich als Entschuldigung angeben, dass … besser gesagt, dass der Adalbert aufgrund eines wilden Zufalls gegen jede Sonntag-Vormittag-Gewohnheit auch Zeit gehabt hatte und sie … nein, das konnte sie wirklich nicht! Na ja, wieder ein Punkt im jenseitigen Strafregister, dachte sie resigniert. Wobei, kann man nicht mit vielleicht zehn Gutpunkten einen Strafpunkt löschen? – sie begann mit der »Chefetage«, wie sie die göttliche Instanz für sich nannte, zu verhandeln. Nein, sie sah hier und jetzt nicht ein, dass sie, die sich wirklich für kranke und alte und einsame Menschen auch in ihrer Freizeit einsetzte, da oben nur Strafpunkte haben sollte, das war nicht fair, das war nicht … –
Mitten in die Mischung aus Selbstmitleid, Übermüdung und Urlaubsreife hinein klingelte die Dienstglocke. Oh, schon wieder ein wandelnder Nachtdienstzuschlag, versuchte sich Magistra Gattermüller aufzuheitern. Sie blinzelte in die Juli-Abendsonne hinaus, als sie öffnete.
»Küss die Hand, Tante Agathe.«
Sehen konnte sie nichts, aber die Stimme erkannte sie sofort.
»Wotan! Bist schon da?«
»Nein, Tante Agathe, ich bin noch weit weg, aber mein Geist ist mir schon vorausgeeilt.«
»Du bist immer noch ein dummer Bub! Aber trotzdem … oder vielleicht sogar gerade deshalb: Komm herein! Magst einen Kaffee? Oder was zu essen? «
Wotan war eigentlich noch satt, aber angesichts seines einsamen Almdaseins schoss ihm durch den Kopf, dass ein überfüllter Magen vielleicht gar keine so schlechte Idee wäre.
»Ja bitte, was zu essen. Was hast du denn da?«
Die Tante kramte in einem sehr großen Kühlschrank zwischen hunderten von Medikamenten.
»Vielleicht ein Gemüseauflauf von vorgestern?« An Wotans Gesicht erkannte sie sofort seine Antwort. »Ihr Perkowitzen seid doch alle gleich … nur nix G’sundes! Aber«, wieder tauchte sie in den Tiefen des Kühlschranks unter, »ein Blunzengröstl von gestern, das ist doch was für meinen Lieblingsneffen, oder?«
»Zweimal oh danke! Einmal fürs Gröstl, und einmal, weil ich dein Lieblingsneffe bin.«
In einer einzigen eleganten Bewegung drehte sich Tante Agathe von der Mikrowelle weg und setzte sich an den Tisch im rückwärtigen Bereich der Apotheke.
»Natürlich bist du mein Lieblingsneffe, du bist ja auch mein einziger!«
Wotan überlegte kurz, ob er nun ein wenig beleidigt sein sollte, aber angesichts des Blunzengröstls, der Hiafalm und seiner Bakkalaureatsarbeit verzichtete er darauf.
»Nein, mein Lieber, keine Angst, jetzt kommt nicht das obligate ‚Erzähl von daheim!‘, das hebe ich mir für ein anderes Mal …«
– und Mahl, ergänzte Wotan in Gedanken, als in der Sekunde das Signal der Mikrowelle ertönte –
»... auf. Außerdem bin ich noch neugieriger, wie es dir auf der Hiafalm geht. Hast du leicht hingefunden? Funktioniert alles? Verhungerst du mir? Wie gefällt es dir? Hast du schon irgendwen getroffen? Und übrigens, wieso hast du gewusst, dass du mich heute hier findest?«
Wotan hatte schon bei der dritten Frage auf Nicht-mehr-so-genau-Zuhören geschaltet, eine Fähigkeit, die er vor allem im Umgang mit seinen Schwestern geschult hatte, sodass er erst an der plötzlichen Stille merkte, dass er jetzt antworten sollte.
»Jaja, sehr gut, danke!«
Den Bruchteil einer Sekunde später war ihm klar, dass er und seine reduzierte Aufmerksamkeit entlarvt worden waren.
»Ihr Perkowitz-Männer seid doch alle gleich, reden ja, aber zuhören, selten!«
Er setzte sofort seinen »Mea culpa«-Blick auf … und stellte erleichtert fest, dass er fruchtete.
»Also, noch mal, wieso hast du überhaupt gewusst, dass du mich heute hier finden würdest?«
»Auskunftsbüro See- und Ausflugslokal Hiafalm am Lacknsee … übrigens hervorragend, dein Blunzengröstl, herrlich.«
Eine Kaupause nützend, hakte Tante Agathe sofort wieder nach.
»Und, wie ist es oben auf der Alm? Hast dich schon ein bisschen eingelebt? Hast schon wen getroffen?«
Wotan war klar, dass es keinen Sinn machte, den wenig ruhmreichen Furmaier-mit-Traktor-Einstand zu verschweigen – Tante Agathe würde es eben von Furmaier erfahren. Also erzählte er lieber gleich von beiden »Adalbertiaden«, wie er die Begegnungen scherzend betitelte.
»Und sonst, wie ist es sonst oben?«
Da erst fiel ihm der wahrlich merkwürdige Beginn seines ersten Almtages ein und er erzählte von der Fensterkuh, der verewigten Annamirl und natürlich von Frau Koller.
Seine Tante lachte schallend. »Damit hast du die erste und vielleicht schwerste Alm-Überlebensprüfung bestanden! Na ja, schon eine seltsame Person, aber andererseits auch sehr klug und geschickt. Und wenn man bedenkt, dass der wirklich nie was geschenkt worden ist von ihrem Schicksal … aber das wird dich ja sicher nicht interessieren, du Perkowitz, du.«
Oje!, dachte sich Wotan. Jetzt hat sie diesen Blick drauf, den er zur Genüge von seiner Mutter und seinen Schwestern kannte. Erstaunlich, dass offenbar sogar Blicke genetische Komponenten haben konnten. Diese Mischung aus weiblicher Raffinesse, Kampfeslust und absolutem Siegeswillen über – vermeintliche – männliche Ignoranz, dieser Blick konnte ihm keinen Schrecken mehr einjagen. Belustigt registrierte er, dass seine Tante ebendas in dieser Sekunde begriffen hatte. Und nobel, wie Perkowitz-Männer selbst im Siegesrausch noch waren, stellte Wotan seine Miene auf interessierte Anteilnahme um und sagte mit unnachahmlichem Tonfall: »Aber ja doch!«
Seine Tante war so verblüfft, dass sie den Gesprächsfaden verlor.
»Du wolltest mir etwas über Frau Koller erzählen«, weidete sich Wotan an seinem Triumph.
»Ja, also …« – die »Gattermüller-Gesprächsmühle«, wie sein Vater den Erzählstil der weiblichen Familienmitglieder nannte, kam langsam wieder in ihren Rhythmus – »eigentlich ist die Barbara Koller eine ganz arme Person. Von Geburt an hat die nix zum Lachen gehabt. Das hat schon damit angefangen, dass die Kollerin unehelich zur Welt gekommen ist. Das war damals, 1932, hier am Land eine Katastrophe! Und als ob das noch nicht gereicht hätte, hat ihre Mutter das arme Kind Barbara getauft. Barbara Koller! Kannst du dir einen schlimmeren Namen vorstellen?«
Beinahe hätte Wotan »ja, Wotan Perkowitz!« erwidert, doch schluckte er die Worte gerade noch hinunter, ganz besonders, da er inzwischen wusste, welche Bedeutung »Barbara Koller« hier in der Region hatte. Aber so ganz wollte er sich doch nicht geschlagen geben – zum einen, um die vorangegangene Beleidigung von wegen »Perkowitz-Männer« nicht ganz unwidersprochen im Raum stehen zu lassen, zum anderen, um wieder einmal klarzustellen, dass es keinen schlimmeren Namen als seinen geben konnte.
Also sagte er doch: »Ja, Wotan Perkowitz!«
Er war über das Mienenspiel seiner Tante verblüfft – für ein Lächeln war die Gesichtsmuskelverschiebung zu ironisch, für ein Grinsen zu wehmütig. »Aber geh, du weißt ja gar nicht, was du für ein Glück mit deinem Namen hast! Zumindest hier in der Gegend wärst du mit Barbara Koller weit ärger dran.«
»Zugegeben, Tante Agathe, ich wäre mit ‚Barbara Koller‘ etwas fehl am Platz, aber …« »Wieso?«
»Verzeih, meine liebe Tante, aber falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, ich bin dein Neffe, und Neffen pflegen im deutschsprachigen Raum nicht Barbara zu heißen. Wotan zwar auch nicht, aber …«
»Eins zu null für dich, mein lieber männlicher Neffe … aber auch mit Jakob Koller wärst du in unserer Gegend nicht wirklich passend benamst!«
»Bitte, warum denn nicht?«
»Schläfst du eigentlich leicht schlecht?«
»Was hat denn das damit zu tun?«
»Ja oder nein?«
»Ja, nach zu viel abendlichen Chips. Nein, bei normaler Ernährung.«
»Und was ist mit Horrorgeschichten vor dem Schlafengehen?«
»Die mag ich nicht, aber wann immer ich doch eine zufällig gesehen habe, musste ich eher lachen … das Ganze war meistens so kindisch zusammenerfunden, dass …«
»... und nach einer wahren Horrorgeschichte, wie schläfst du da?«
»Du meinst, nach einem Familiennachmittag mit meinem Vater und meinen drei Schwestern?«
»Wotan, im Ernst, ich meine eine schreckliche, wahre Geschichte, die sich wirklich zugetragen hat!«
Er merkte am Wechsel ihres Tonfalls, dass es ihr ernst war. Daher antwortete er folgsam: »Nein, ich weiß nicht, wie ich nach einer realen Horrorstory schlafe. Also, erzähl schon, spann mich nicht auf die Folter.«
Tante Agathe seufzte ebenso unvermutet wie entsetzt auf. »Hör auf mit solchen Formulierungen!«, antwortete sie überraschend scharf. Als sie sein schlicht verblüfftes Gesicht sah, machte sie sofort eine innerliche Kehrtwendung und klang wieder etwas sanfter: »Folter ist in dem Zusammenhang kein sehr glückliches Wort. Denn vor 333 Jahren begann im Land Salzburg einer der schrecklichsten Hexenprozesse … nein! – der schrecklichste, den es auf österreichischem Boden je gegeben hat! Begonnen hat eigentlich alles mit … mit der elenden Armut, die nach dem Dreißigjährigen Krieg vielleicht noch schlimmer war als davor.«
»Bitte, Tante Agathe, wenn geht, keine Sozialenzyklika aus deinem Mund … mir reicht, wenn mein Vater mir immer mit salbungsvoller Stimme …«
»Wotan«, die Stimme gewann wieder an Härte – Wotan beschloss, ab jetzt ruhig zu sein und vorsichtshalber zuzuhören – »es geht hier … also, es ging um Menschen, die verhungerten, die erfroren, die aus der Gesellschaft ausgestoßen waren … sie waren wirklich der letzte Dreck in der damaligen Hierarchie. Na, was werden sie getan haben?«
Wotan klassifizierte ihre Worte als rein rhetorische Frage – bei der Rage, in die sich seine sonst so ruhige Tante geredet hatte.
»... na, gestohlen haben sie natürlich! Unglücklicherweise ist ein damals 15-jähriger Bub bei so einem Diebstahl erwischt worden … und das noch dazu bei einem Opferstockdiebstahl in einer Kirche. Er wurde natürlich verhört – noch ohne Folter – und gestand, mit einer älteren Frau und deren Sohn Jakob mehrere solcher Diebstähle begangen zu haben. Der Bursch hieß Paul Kaltenpacher … er behauptete, immer nur Schmiere gestanden zu sein, aber um die Obrigkeit etwas milder zu stimmen, gab er natürlich möglichst viel über seine Komplizen preis. Schinterwäberl – unter diesem Namen kannte man die Bettlerin, die mit ihrem Sohn Jakob durch die Lande zog, gestohlen und erpresst hat und trotzdem nur dahinvegetierte.«
»Tante Agathe, bitte, auch kein kommunistisches Gut-Menschen-Manifest!«
»Wotan! … sie waren die Ärmsten der Armen. Denn diese ursprüngliche Kollerin … nein … falsch … also ja, doch … was ich sagen will …« – Wotan hatte den Eindruck, ersticken zu müssen, da seine Tante beim Einatmen fast keine Luft im Raum übrig zu lassen schien – »die Barbara Koller aus dem 17. Jahrhundert stammte vermutlich aus Werfen bei Salzburg, war Abdeckerin gewesen und hatte einen ‚Kollegen‘ namens Tischler geheiratet …« – die Pause im Redeschwall nützte Wotan.
»Bitte, wen oder was deckten Abdeckerinnen ab?«