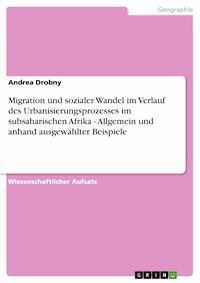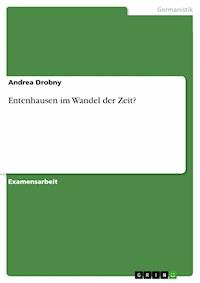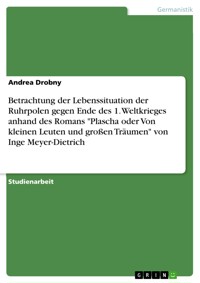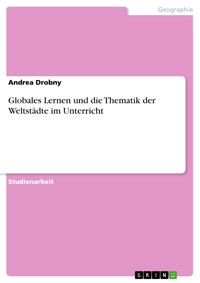15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Geowissenschaften / Geographie - Regionalgeographie, Note: 1,7, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: In der vorliegenden Arbeit geht es um die Textil- und am Rande um die Bekleidungsindustrie im Münsterland. Zu Beginn werden die Begrifflichkeiten Textil- und Bekleidungsindustrie definiert. Im Anschluss daran wird auf die Geschichte der Textil-(Bekleidungs-) industrie eingegangen. Nach diesem textilen historischen Rückblick kommt es zur Benennung der rheinisch-westfälischen Textilzentren. Hierbei stehen besonders die Umsätze der einzelnen textilen Standorte im Zentrum der Betrachtung (Stand: 1996). Wie sich die textile münsterländische Monostruktur zu einem diversifizierten Industriestandort entwickelt hat, verdeutlichen die anschließenden Abschnitte. Der Leserschaft dieser Arbeit wird zunächst die Region Münsterland unter besonderer Berücksichtigung naturräumlicher und geschichtlich-kulturlandschaftlicher Gesichtspunkte vorgestellt. Danach erfolgt ein Überblick bezüglich der Geschichte der münsterländischen und dülmener Textil- und Bekleidungsindustrie, wobei auf die dülmener textilen Familienbetriebe Ketteler/Specht und Bendix genauer eingegangen wird. Zu guter Letzt schließt sich ein Fazit an, welches noch einmal wesentliche Aspekte zusammenfasst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Textil- und Bekleidungsindustrie
2.1 Ein allgemeiner historischer Rückblick
2.2 Die rheinisch-westfälischen Textilzentren
2.3 Das Münsterland – eine textile Monostruktur wird zu einem diversifizierten Industriestandort
2.3.1 Das Münsterland – eine Landschaft in NRW stellt sich unter Berücksichtigung naturräumlicher und geschichtlich-kulturlandschaftlicher Gesichtspunkte vor
2.3.2 Die Geschichte der münsterländischen und dülmener Textil- und Bekleidungsindustrie im Überblick
3 Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1
Abbildung 2
Abbildung 3
Abbildung 4
Abbildung 5 Wasserburg Anholt
1 Einleitung
In der vorliegenden Hausarbeit geht es um die Textil- und am Rande um die Bekleidungsindustrie im Münsterland. Zu Beginn werden die Begrifflichkeiten Textil- und Bekleidungsindustrie definiert. Im Anschluss daran wird auf die Geschichte der Textil- (Bekleidungs-) industrie eingegangen.
Nach diesem textilen historischen Rückblick kommt es zur Benennung der rheinisch-westfälischen Textilzentren. Hierbei stehen besonders die Umsätze der einzelnen textilen Standorte im Zentrum der Betrachtung (Stand: 1996).
Wie sich die textile münsterländische Monostruktur zu einem diversifizierten Industriestandort entwickelt hat, verdeutlichen die anschließenden Abschnitte.
Der Leserschaft dieser Hausarbeit wird zunächst die Region Münsterland unter besonderer Berücksichtigung naturräumlicher und geschichtlich-kulturlandschaftlicher Gesichtspunkte vorgestellt.
Danach erfolgt ein Überblick bezüglich der Geschichte der münsterländischen und dülmener Textil- und Bekleidungsindustrie, wobei auf die dülmener textilen Familienbetriebe Ketteler/Specht und Bendix genauer eingegangen wird.
2 Die Textil- und Bekleidungsindustrie
2.1 Ein allgemeiner historischer Rückblick
Bevor auf die Geschichte der Textil-/ (Bekleidungs-) industrie in dem folgenden Abschnitt eingegangen wird, erfolgt zunächst einmal eine Definition der beiden Begrifflichkeiten Textilindustrie und Bekleidungsindustrie. Hierzu ist zu erwähnen, dass eine Abgrenzung der Bereiche Textil-und Bekleidungsindustrieoft kaum möglich ist, da es sich in vielen Fällen um integrierte Produktionsabläufe handelt, welche im gleichen Betrieb stattfinden können. Die Bekleidungsindustrie sticht nur durch intensivere Näharbeiten sowie durch eine arbeitsintensivere Produktion hervor. Aus funktionaler Sicht betrachtet umspannt die Textilindustrie sowohl die Faserherstellung als auch die Bekleidungsbranche[1]. Allgemein ist festzuhalten, dass die Textilindustrie eine Branche des produzierenden Gewerbes darstellt. In dem textilen Industriezweig werden pflanzliche wie Lein, Jute, Sisal und Baumwolle, aber auch tierische Rohstoffe wie beispielsweise Schafwolle und Seide zu textilen Produkten wie Gewebe, Filz etc. verarbeitet, wobei letztere eine Veredelung zu textilen Gebrauchsgegenständen wie zum Beispiel zu Kleidungsstücken erfahren.
In der Textilindustrie sind unter anderem die folgenden Techniken elementar: 1. Spinnen: Unter dieser Begrifflichkeit wird die Herstellung von Fäden bzw. von Garn aus Wolle/Baumwolle verstanden. Das Spinnen zählt zu den ältesten Technologien der Welt. Die Fäden-/Garnproduktion wurde mit der Zeit verfeinert, was dazu führte, dass immer neue Herstellungsmethoden entstanden. Ein fertig gesponnenes Garn kann auf unterschiedlichste Art weiterverarbeitet werden. Hierbei kommen die Begriffe Zwirnen, Weben, Stricken und Nähen zu tragen. Schon die alten Ägypter stellten per Hand Garn her. Es wird vermutet, dass die Inder um 500 v. Chr. das Spinnrad erfanden. In Deutschland wurde es erstmals 1298 in der Webeordnung der Stadt Speyer erwähnt. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts kam die erste Spinnmaschine auf die Welt, die so genannte Spinning Jenny. Im Jahre 1769 fand die erste Spinnmaschine mit Wasserradantrieb ihren Platz auf dem Markt, die den Namen Waterframe trug. Das Ringspinnen, das bis in die heutige Zeit das wichtigste Spinnverfahren darstellt, wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts ins Leben gerufen. Da die Bedienung der Spinnmaschinen heutzutage immer einfacher wird, sind in Spinnereien häufig unqualifizierte Arbeitskräfte tätig. Daher steht der Ausdruck Spinner für Menschen mit verrückten Ideen.
2. Weben: Hier ist das rechtwinklige Verkreuzen von mindestens zwei Fadensystemen
gemeint.Verlaufen die Fadensysteme in einem Winkel ungleich 90°, also diagonal, spricht man von Flechten. Das Produkt beim Weben ist das Gewebe. Bereits in der Bronzezeit, also im 3. bis in das 1. Jahrtausend v. Chr., existierte die Webkunst. Weiterhin wurden in einigen ägyptischen Grabkammern Überreste von gewebten Gewändern gefunden. Die Assyrer, Babylonier und später auch die Phönizier betrieben mit gewobenen Textilien und Teppiche Handel, wodurch ihr Reichtum eingeleitet wurde. Der Geistliche Edmond Cartwright erbaute 1784 den ersten mechanischen Webstuhl. Der erste elektrisch betriebene Webstuhl kam im Jahre 1879 durch W. von Siemens auf die Welt
3. Flechten: Die Tätigkeit des Flechtens beschränkt sich auf das regelmäßige Ineinanderschlingen mehrerer Stränge aus biegsamen Material, auf das Korb- sowie auf das Haarflechten oder aber auch auf das maschinelle Flechten von mehreren Fäden zu Schnüren. Die Flechtkunst wurde auch schon in der Urzeit angewandt, da bei ihr kein Werkzeug von Nöten ist.
4. Häckeln/Wirken: Hierbei werden mit Faden und Häckelnadel Maschen erzeugt und miteinander verknüpft.
5. Stricken: Mit Hilfe dieser Technik erfolgt die Maschenherstellung durch Fäden bzw. mehreren Nadeln. Seide, Wolle oder Baumwolle dienen als Material. Das Stricken war angeblich in Italien bereits im 13. Jahrhundert bekannt. Wissenschaftler sind sich jedoch noch nicht einig darüber, ob dieses Verfahren in Italien oder erst im 16. Jahrhundert in Spanien erfunden worden ist. Von Italien und Spanien aus gelangte die Strickkunst nach England und Schottland. William Rider wird in Großbritannien um 1564 als erster Strumpfstricker erwähnt. In Deutschland existierten zeitgleich ausschließlich männliche Hosenstricker. Erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts werden Strickereien durch Strickmaschinen hergestellt.
6. Bleichen: Hierbei handelt es sich um ein textilchemisches Verfahren, um die vorhandenen natürlichen Färbungen der Naturfaser zu beseitigen und den Weißgrad zu erhöhen. 7. Färben: Diese Methode ermöglicht, dass textiles Material durch Aufbringen von Farbmitteln in Färbe- oder Druckprozessen koloriert wird. Mit der Industrialisierung Ende des 18. Jahrhunderts erfolgte das Einfärben von Textilien maschinell. Hier darf nicht außer Acht gelassen werden, dass den wässrigen Farbstofflösungen oder Farbstoffdispersionen andere Stoffe wie beispielsweise Salz, Alkalien, Säuren und weitere Hilfsstoffe zugesetzt wurden, die eine starke Umweltbelastung hervorriefen[2].