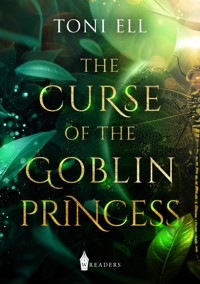
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tamara traut ihren Augen kaum, als sie eines Abends einen Einbrecher mit spitzen Ohren in ihrem Zimmer entdeckt. Frederick – ein Koboldprinz – ist auf der Jagd nach einem Monster. Aber nicht, um es zu töten, sondern um es zu retten. Er nimmt Tamara mit in eine magische Stadt voller Geheimnisse, riesiger Dachse und unterirdischer Kamine. Dort müssen sie das Rätsel um einen vergangenen Krieg und eine verschwundene Prinzessin lösen, sonst droht ein weiterer verheerender Konflikt zwischen den beiden letzten Koboldvölkern. Können Tamara und ihre neuen Freunde den Wettlauf gegen die Zeit gewinnen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Toni Ell veröffentlicht seit 2020 unter dem Namen Leslie Meilinger düstere Fantasyromane im Selfpublishing. Für ihre humorvollen Kobolde hat sie das offene Pseudonym "Toni Ell" gewählt und ein glückliches zu Hause im Wreaders Verlag gefunden. Beim Schreiben sind ihr Witz, Diversität, originelle Charaktere sowie eine komplexe Handlung wichtig. Mehr Informationen über die Illustratorin und Autorin unter www.lesliemeilinger.de
WREADERS EBOOK
Band 255
Dieser Titel ist auch als Taschenbuch erschienen
Vollständige E-Book-Ausgabe
Copyright © 2025 by Wreaders Verlag, Sassenberg
Verlagsleitung: Lena Weinert
Bestellung und Vertrieb: epubli, Neopubli GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: Emily Bähr
Lektorat: Michél Schüler, Lektorat Seitensturm
Satz: Elci J. Sagittarius
Karte & Illustrationen: Toni Ell
www.wreaders.de
Für alle, die manchmal das Gefühl haben,
vom Unglück verfolgt zu werden.
Kapitel 1
Tamara rückte ihre Brille zurecht und begutachtete die Knöpfe des altmodischen Gasherds. Alle aus – genau wie es sein sollte. Bevor ihre Eltern in den Urlaub an der Ostsee gefahren waren, hatten sie ihrer Tochter die üblichen Vorsichtsmaßnahmen eingebläut. Den Herd zweimal überprüfen, bei Gewitter alle Stecker ziehen und die Rollläden regelmäßig hoch- und runterziehen. Auch das Lauschen auf verdächtige Geräusche stand auf der Liste, immerhin hatten Einbrecher in den Ferien Hochsaison. Doch das weitläufig ausgebaute Fachwerkhaus lag still und friedlich da, genau wie an allen Abenden zuvor. Tamara beendete ihren Rundgang mit einem Gähnen, griff nach ihrem Tee und ging durch den offenen Essbereich auf ihr Zimmer zu. Die Tür schwang auf – und sie entdeckte eine zusammengekauerte Gestalt, die auf ihrem Schreibtisch saß.
Sie schnappte nach Luft.
Die Teetasse rutschte ihr aus der Hand und erst als sie in ihre Einzelteile zerplatzte, drang ein gellender Schrei aus Tamaras Kehle. Die Gestalt richtete sich langsam auf und ließ die vage Hoffnung verpuffen, es könnte sich um ein großes, streunendes Tier handeln. Sie spürte ihr Herz hämmern. Ich muss die Polizei rufen, dachte sie und tastete nach ihrem Handy. Aber erst mal hier raus! Sie hastete auf die Eingangstür zu, die sich rechts von ihrem Zimmer befand. Ihr Fuß stieß gegen etwas, sie stolperte – und krachte zu Boden. Schmerzen schossen ihr durch Kniescheiben und Ellenbogen und ein Jaulen erklang. Ihr Hund rappelte sich sofort wieder auf und sprintete los.
»Jimmy!«, rief sie, als der massige Basset mit wehenden Schlappohren in ihrem Zimmer verschwand. Dort stimmte er ein ohrenbetäubendes Gekläffe an. Tamara drehte sich der Magen um.
Sie musste ihn sofort da rausholen! Ohne noch mal darüber nachzudenken, schnappte sie sich eine massive Schlüsselschale aus Kristallglas und eilte zurück in ihr Zimmer. Mit der Faust schlug sie auf den Lichtschalter und starrte den Einbrecher mit aufgerissenen Augen an.
Dieser schenkte ihr keine Aufmerksamkeit. Er stand auf den Zehenspitzen auf ihrem Schreibtisch. Rücken und Arme an die Wand gepresst, den Blick fest auf den wurstförmigen Hund gerichtet, der ihn aus vollem Hals anbellte.
Hätte der Einbrecher ein Brecheisen in der Hand gehabt oder eine Sturmhaube getragen, hätte Tamara vermutlich sofort ihren Hund geschnappt und sich im Bad verbarrikadiert, um die Polizei zu rufen. Stattdessen ließ sie die erhobene Schale etwas sinken und ihr entkam ein verblüfftes: »Was …?«. Er war wohl nicht viel älter als sie, groß und drahtig, mit blasser Haut. Seine Haare hatten einen hellen Rotton und er trug einen Anzug. Einen Anzug mit schwarz-weißen Längsstreifen, der an den Knien aufgerissen war. Wirklich alarmierend erschienen jedoch seine Ohren, die spitz unter seinem Haar hervorstanden, und die Tatsache, dass er mit Pfeil und Bogen bewaffnet war. Das Fenster links über ihrem Schreibtisch stand sperrangelweit offen.
Die Schlüsselschale in ihrer Hand begann heftig zu zittern, als ein Schaudern ihren Körper hinabjagte. Sie stieß die Luft aus und versuchte einen klaren Gedanken zu fassen – vergeblich!
Der Blick des Eindringlings huschte kurz zu ihr, dann wieder zurück zu Jimmy. »Hast du zufällig ein Monster gesehen?«
Tamara stieß die Luft aus. Jimmy hatte unterdessen das Gekläffe eingestellt. Er ging dazu über, den Fremden anzuknurren, wobei er den Boden vollsabberte. Der Unbekannte schaute mit gerunzelter Stirn zwischen dem Hund und Tamara hin und her.
»Wärst du vielleicht so nett, ihn zurückzurufen? Hunde mögen mich nicht besonders.«
Ihr klappte der Mund auf. Der Eindringling wartete beinahe reglos auf ihre Antwort. Nur seine Mundwinkel zuckten kaum merklich, als müsste er allen Ernstes ein Grinsen unterdrücken.
»Was zum Teufel?«, brachte sie endlich hervor und versuchte, mit einem Kopfschütteln ihre Sinne wiederzuerlangen. »Hau sofort ab, sonst rufe ich die Polizei!«
»Ich bin gleich wieder weg, ehrlich. Aber ich sollte vorher wirklich dieses Monster –«
Er brach ab und kniff die Augen zusammen. Jimmys Knurren erstarb. Den Blick hatte er irgendwo in die große Essküche gerichtet. Ein Grollen drang an Tamaras Ohren. Ein Geräusch genau von der Sorte, die einem die Haare im Nacken aufstellte. Klickend näherte sich etwas, das klang wie ein Tausendfüßler auf Krallen. Ein sehr großer, schwerer Tausendfüßler.
Tamara wandte dem Einbrecher ihren Rücken zu, um einen Blick in die Finsternis der Essküche zu werfen. Sie hörte, wie der Fremde von ihrem Schreibtisch kletterte. Kaum hörbar näherte er sich.
»Geh lieber einen Schritt zurück«, flüsterte er hinter ihr. Sie hielt den Atem an. Kalte Angst umklammerte ihr Inneres und hinderte sie daran, sich zu ihm umzudrehen.
»Um auf meine erste Frage zurückzukommen: Hast du es gesehen?«, fragte er leise, trat neben sie und folgte ihrem Blick wachsam, eine Hand am Bogen.
»Was gesehen?«, fragte Tamara mit brechender Stimme.
Er warf ihr einen kurzen Blick zu. Ein beunruhigend gefasstes Lächeln umspielte seinen Mund. »Das Monster.«
Das konnte unmöglich sein Ernst sein. Sie schüttelte den Kopf. Er legte einen Pfeil in den Bogen und beugte sich der Finsternis entgegen. Vorsichtig spähte er am Türrahmen vorbei. Dann trat er einen weiteren Schritt vor und die Scherben der Teetasse knirschten unter seinen Stiefeln. Tamara hielt die Luft an und er erstarrte. Ein tiefes Grollen drang aus der Küche. Sie schlug die Hände vor den Mund, um ein angsterfülltes Quietschen zu dämpfen.
Der Eindringling warf ihr einen Blick über die Schulter zu. »Vielleicht solltest du –«
Etwas schoss aus der Dunkelheit hervor und ein Pfeil sauste durch die Luft. Tamara schrie.
Der Fremde riss seinen Bogen hoch. Er geriet ins Taumeln, stieß mit dem Rücken gegen ihr Bücherregal und das Monster wirbelte herum. Kniehoch, mit zotteligem schwarzem Fell, sah es im ersten Moment wie ein Straßenköter aus, doch als es sich mit einem Satz zu Tamara umdrehte, schrie sie erneut. Sein Maul verlief von einem flachen Ohr zum anderen und es bewegte sich auf vier langen Spinnenbeinen. Geduckt setzte es zum Sprung an. Mehrere schwarze Insektenaugen taxierten sie und sein Grollen dröhnte in ihren Ohren wie eine herannahende Lok.
Panisch machte sie einen Hechtsprung über ihr Bett und griff nach dem Einzigen, was ihr zur Verteidigung sinnvoll erschien – ihre Stehlampe. Als Tamara jedoch den Stiel packte und zu dem Monster herumwirbelte, war es verschwunden. Voller Entsetzen taumelte sie rückwärts.
»Vorsicht!«, rief der Fremde. Der hölzerne Bogen war in der Mitte zersplittert. Er warf ihn achtlos zur Seite und zog ein Messer. In dem Moment kamen zwei klauenbesetzte Spinnenbeine unter dem Bett auf Tamara zugeschossen. Laut schreiend ließ sie den schwarz gerüschten Lampenschirm auf die Klauen niedergehen. Das Monster fauchte und riss sein getroffenes Bein in die Deckung zurück. Dafür schnellte das andere nach vorn und verfehlte Tamaras Fuß nur um Haaresbreite. Die Klaue hinterließ vier tiefe Furchen im Parkett. Blind hieb sie vor sich auf den Boden, während der Fremde das Bett erreichte und es mit einem Ruck zu sich heranzog. Das Monster kam zum Vorschein und schrie mit Tamara um die Wette. Der Rothaarige sprang auf das Bett.
Mit fliegenden Armen stürzte das Wesen auf Tamara zu. Sie riss den Lampenschirm hoch, um es fortzuschleudern. Doch es klammerte sich fest und fauchte und schlug aus nächster Nähe nach ihr.
»Tu was!«, kreischte Tamara, neigte den Schirm nach unten und versuchte das Biest am Boden zu halten.
»Hat es einen blauen Punkt auf der Stirn?«
»Bist du bescheuert? Tu was verdammt!«
»Hat es einen blauen Punkt?«
Wovon redete er, verdammt noch mal? Es war ein Monster, das aus nichts als heimtückischen Augen und schwarzen Zotteln bestand!
»Nein, zur Hölle, hat es nicht!«
Er warf sein Messer und Tamaras Herz blieb stehen, aus Furcht, es würde sich gleich in ihre Stirn bohren. Doch es grub sich stattdessen zielsicher in den Nacken des Monsters, das aufschrie und mit einem dumpfen Geräusch zu Boden stürzte. Tamara ließ die Stehlampe fallen und wich zurück, bis sie mit dem Rücken an die Wand stieß. Nach Atem ringend strich sie sich eine kurze dunkle Haarsträhne aus dem Gesicht und sah dabei zu, wie sich eine schwarze Blutlache zu ihren Füßen verteilte.
Der Fremde seufzte tief und ließ sich im Schneidersitz auf ihrem Bett nieder. Prüfend schaute er sich im Zimmer um, bis sein Blick an Tamara hängen blieb. Diese stand noch immer an die Wand gepresst da und atmete schwer. Ihr Blick huschte zu dem abgeschossenen Pfeil, der in ihrer Fotowand steckte. Genauer gesagt, in ihrem Klassenfoto — mitten im Gesicht ihrer Lehrerin.
»Ich heiße Frederick«, sagte er, beugte sich vor und zog mit einem knackenden Geräusch das Messer aus dem Genick des Monsters.
»Schön für dich«, brachte Tamara hervor. Konzentration, mahnte sie sich. Es muss eine vernünftige Erklärung für das geben, was gerade geschehen ist. Neben der Möglichkeit, dass du gerade deinen Verstand verloren hast.
Der Rothaarige wischte das blutige Messer an seinem Hosenbein ab und verstaute es in einer Lederscheide an seinem Gürtel.
»Was ist hier los?«, platze es aus ihr heraus. Das Zittern ihres Körpers wollte einfach nicht nachlassen.
»Ein Monster der Kategorie B. Ich muss mich wohl entschuldigen, es ist meine Schuld, dass es hier aufgetaucht ist.«
»Ein Monster …«, wiederholte Tamara und sah erneut auf das ausblutende Wesen hinab.
»Der Kategorie B. Genau.«
»Und du bist …?«
»Frederick«, erklärte er mit geduldiger Miene.
»Ja, aber …«
Tamara wusste nicht so recht, wie sie fortfahren sollte, und deutete auf ihr eigenes Ohr. Bei der Gelegenheit rückte sie auch ihre Brille zurecht. Er legte den Kopf leicht schief und sie erkannte, dass seine Augen blau waren.
»Ich bin vom Volk der Sinn. Aber …« Er legte den Kopf schief und grinste leicht. »Das wird dir vermutlich keine Erklärung sein. Ich könnte mich verwandeln und es dir zeigen, aber ich will dir keine Angst machen.«
Er besaß die Frechheit, ihr zuzuzwinkern.
Tamara schnaubte empört. »Du willst mir keine Angst machen? Dann hättest du vielleicht nicht um halb zwölf Uhr nachts in mein Zimmer einbrechen sollen!«
»Hätte dir ein späterer Zeitpunkt besser gepasst?« Er hob fragend die Brauen. »Tut mir echt leid, aber das Monster hatte andere Pläne.«
Sie stieß langsam die Luft zwischen den Zähnen aus. Dieser Kerl hielt sich wohl für besonders lustig. Eine grandiose Fehleinschätzung, fand Tamara. Eigentlich müsste sie jetzt total durchdrehen. Ihn mindestens mit der Stehlampe verprügeln wie das Monster.
»Willst du einen Tee?«, fragte sie stattdessen.
»Gern«, antwortete Frederick und sah nicht im Mindesten überrascht aus.
Ein leises Winseln erinnerte Tamara an Jimmy, der sich in die Ecke zwischen Kleiderschrank und Bücherregal geklemmt hatte. In einem großen Bogen ging sie um Frederick herum und nahm den zitternden Basset auf den Arm. Sie ließ den Einbrecher allein in ihrem Zimmer zurück und schaltete auf dem Weg zu Küchenanrichte alle Licher in dem offenen Raum an. Dann konzentrierte sie sich darauf, einarmig das Teewasser aufzusetzen. Der Hund schmiegte sich angstvoll an sie und sie kraulte ihn hinter den Ohren.
»Du warst ein tapferer Jim Knopf«, flüsterte sie und er winselte leise. Mit zitternden Fingern bereitete sie zwei Tassen mit Pfefferminz-Teebeuteln vor, während sie versuchte, ihre Gedanken zu sortieren.
»Wie heißt du?«, wollte Frederick wissen, der ihr hinterher schlenderte.
Er lehnte sich mit großem Abstand zu ihr und Jimmy an den Kühlschrank am Ende der Anrichte. Im Hellen wirkte ihr unverhoffter Gast trotz der aufrechten Haltung müde. Unter seinen blitzenden Augen lagen dunkle Schatten, seine Kleidung war staubig, aufgerissen und sein rechter Arm blutig.
»Ich heiße Tamara«, antwortete sie, und das Klicken des Wasserkochers erklang. Vorsichtig setzte sie den protestierenden Hund ab und goss das Wasser in die Tassen. Jimmy knurrte zwar kurz in Fredericks Richtung, doch dann verzog er sich mit einem Grunzen auf seinen Platz unter dem Esstisch.
»Also, Frederick«, setzte sie an, bemüht ruhig, und reichte ihm mit größtmöglicher Wachsamkeit seine dampfende Tasse. »Du bist nur hierhergekommen, um dieses Monster zu töten. Du kamst nicht, um meine Familie zu bestehlen, mich zu kidnappen oder sonst irgendwas?«
Er schmunzelte. »Korrekt.«
»Das heißt, du gehst gleich wieder … wohin auch immer und kommst nicht wieder. Und ich kann das einfach vergessen, richtig?«
Nun legte er den Kopf schief und schien darüber nachzudenken. Dann lächelte er bedauernd. »Nein, das wird nicht möglich sein.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich bin mir sicher, du willst nicht, dass deiner Familie etwas passiert.«
Tamara schnappte nach Luft. »Bedrohst du etwa gerade meine Eltern? Gib dir keine Mühe, in den nächsten zwei Wochen bin ich die Einzige in diesem Haus!«
Er hob abwehrend seine freie Hand und behielt den munteren Gesichtsausdruck bei. »Nein, nein. Wegen mir musst du dir keine Sorgen machen, sondern wegen der Monster. Sie könnten wiederkommen.«
»Warum?«, fragte Tamara atemlos.
»Weil sie im Rudel leben. Und nicht selten folgen sie einander.«
»Du verarschst mich doch. Was soll das denn bedeuten? Was sind das überhaupt für Monster?«
»Monster eben. Spitze Zähne, scharfe Krallen und Hunger auf Fleisch. Zugegebenermaßen fressen sie eher selten Menschen, was hauptsächlich daran liegt, dass sie sich normalerweise nicht in eurer Welt aufhalten.«
»Unserer Welt?«, flüsterte sie und jetzt schrumpfte Fredericks Grinsen etwas. Er sah so aus, als ob er Mitleid mit ihr hatte. »Das ist schwer zu glauben, kann ich mir vorstellen.«
Frederick führte die Tasse zum Mund.
»Vorsicht, der ist frisch …«
Er prustete los und verzog das Gesicht. Tamara verdrehte die Augen und er leckte sich über die verbrannte Lippe. »Wie heißt eure Welt?«
»Nischt anders als eure. Welt, eben«, nuschelte Frederick.
»Aber … was bist du, wenn kein Mensch? Was sind diese Sinn?«
Frederick nahm sich erneut viel Zeit, um über ihre Frage nachzudenken, und stellte seine Tasse neben ihre. »Manche Menschen nennen uns Kobolde. Oder Goblins.«
»Was?«, kam es spitz von Tamara. Sie ließ beinahe ihre Tasse fallen. »Sind Kobolde nicht … ich weiß nicht … grün? Und klein?«
Frederick grinste. »Also grün bin ich höchstens, wenn ich in einem Boot sitze, da wird mir sofort schlecht. Aber was den anderen Punkt betrifft …« Tamara starrte ihn wie gebannt an. Sein Lächeln hatte sich verändert. Sie brauchte noch eine Sekunde, um endgültig zu begreifen, was sie sah. Er schrumpfte! Sie holte rasselnd Luft und rutschte mit dem Rücken gegen die Spülmaschine gepresst zu Boden, während Frederick auf geschätzte vierzig Zentimeter schrumpfte. Er hatte die Arme in die Hüften gestemmt und sah sie mit schief gelegtem Kopf an.
»Hast du noch nie gesehen, was?«
Seine Stimme hatte sich nicht verändert, sie war nur leiser geworden. Tamara schüttelte den Kopf. Probehalber nahm sie ihre Brille von der Nase und säuberte sie mechanisch mit dem Saum ihres Iron Maiden T-Shirts. »Das ist unglaublich.«
»Stimmt und nicht immer praktisch«, entgegnete Frederick, der sich nach links lehnte, um an Tamara vorbeizuschauen. Erschrocken machte er einen Satz in die Luft, als Jimmy aufsprang und erstaunlich schnell mit seinen kurzen Beinen auf ihn zulief.
»Halt! Stopp, Jimmy, lass das! Sei ein braver Hund!«
Tamara schaffte es, den Basset aufzuhalten, und Frederick wuchs wieder auf seine ursprüngliche Größe zurück. Er legte die Arme lässig über die Knie und richtete den Blick amüsiert auf den kläffenden Hund.
»Ja, wir haben ein schwieriges Verhältnis zu Hunden.«
»Aha«, gab Tamara zurück und schüttelte ungläubig den Kopf. »Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen muss? Ich will wirklich nicht, dass es hier vor Monstern oder Kobolden wimmelt, wenn meine Eltern nach Hause kommen.«
»Du hast dich erstaunlich gut geschlagen mit dem Monster. Für einen Menschen in seinem ersten Kampf gegen ein Kategorie B –«
»Beantworte meine Frage«, fiel sie ihm ins Wort.
Seine Augenbrauen waren ebenfalls rot. Sie wanderten ein Stück nach oben.
»Also gut.« Sein Grinsen verwandelte sich in ein milderes Lächeln und er setzte sich ihr gegenüber auf den Boden, streckte die langen Beine aus. »Ich werde dich mit zu einem Freund von mir nehmen, der das tote Monster fachgerecht entsorgen und seine Spur verwischen wird. Vielleicht hilft er mir auch bei der Vertuschung meiner Schuld an dieser ganzen Situation, je nachdem, wie seine Laune ist. Ich dürfte dir eigentlich gar nichts über unsere Welt erzählen, geschweige denn dich dort hinbringen, … aber um das wieder geradezurücken, sehe ich keine andere Möglichkeit.«
»Wieso?«, fragte Tamara misstrauisch. Er bot ihr einen Ausflug in die Welt schrumpfender Kobolde und fleischfressender Monster an? Ihr Magen zog sich in unguter Vorahnung zusammen. Es war verboten. Aber da war auch dieser warme Funken Neugier, der zeitgleich erwachte.
»Weil mein Volk sehr große Angst vor Eindringlingen hat. Unsere Welt ist empfindlich. Aber du bist dort nicht in Gefahr, keine Sorge. Ich würde nur ziemlichen Ärger bekommen, wenn herauskommt, dass ich dich eingeladen habe.«
Er zuckte mit den Schultern und sie nickte, als hätte sie verstanden. Was sie nicht tat. Sie starrte den spitzohrigen, grinsenden Kerl an. Dann fiel ihre Entscheidung mit einem kleinen Seufzen.
»Okay«, wisperte sie. »Ich bin nicht scharf darauf, dass noch weitere Monster bei mir vorbeikommen.«
»Prima.« Frederick nickte zufrieden. »Ich hole meinen Bogen und schiebe dein Bett wieder an seine Stelle, dann gehen wir.«
Tamara kam ebenfalls auf die Beine und stemmte die Arme in die Seiten. Dabei versuchte sie das Schlottern ihrer Knie zu verbergen.
Er wandte sich ab und ging leichten Schrittes in ihr Zimmer davon. Dabei machten seine Stiefel, die sich vorn leicht zuspitzten, kaum ein Geräusch. Sein Schuhwerk wollte eher zu den altmodischen Waffen, als zu dem auffälligen Anzug passen und sie fragte sich, in welche Art von Welt er sie führen würde. Nervös griff sie nach ihrer Teetasse und nahm einen Schluck, während sie lauschte, wie das Bett an seinen Platz zurückgeschoben wurde.
Sollte sie nicht mehr Zweifel haben?
Bedingungen stellen? Aber er hatte sie schließlich gerade noch rechtzeitig vor dem Monster gewarnt und versuchte auch jetzt noch, ihr zu helfen. Ob das die ganze Wahrheit war, konnte sie am besten herausfinden, wenn sie ihn erst mal nicht aus den Augen ließ.
»Bist du so weit?«
Frederick schulterte seinen lädierten Bogen, eine Hand an den ledernen Gurt gelegt und sah sie fragend an. Tamara schaute mit verengten Augen zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich werde dir eine Menge Fragen stellen.«
Er nickte verständnisvoll. »Damit komme ich zurecht.«
Sie zögerte und presste ihre schwitzigen Handflächen aneinander. Ihr Herz pochte viel zu schnell.
»Du musst keine Angst vor mir haben«, fügte Frederick hinzu, jetzt mit etwas Ernsthaftigkeit in der Stimme. Sie schauten einander in die Augen und Tamara sah ein, dass er diesbezüglich wohl die Wahrheit sagte. Es sei denn, er wollte sie nicht verletzen, sondern in Wirklichkeit entführen. Und sie war drauf und dran ihm einfach zu folgen … Sie holte tief Luft und verkündete: »Ich gehe nicht ohne Jim Knopf.«
So sehr sie Frederick auch vertrauen wollte, einen Hund als Koboldschreck an der Seite zu haben, schien ihr nützlich.
Außerdem würde sie Jimmy ohnehin nicht allein lassen. Der Rothaarige verzog das Gesicht und warf dem Basset einen vorwurfsvollen Blick zu. Doch er setzte nicht zu einer Diskussion an, zuckte schließlich mit den Schultern und entgegnete: »Von mir aus.«
Tamara atmete tief ein und aus.
»Ist es kalt in deiner Welt? Muss ich irgendetwas mitnehmen?«
»Nein, es ist dort auch August, keine Sorge. Ich begleite dich selbstverständlich wieder nach Hause, wenn das geklärt ist. Du musst nichts mitnehmen.«
Tamara nickte, wandte den Blick zu Jimmy und biss nachdenklich auf ihre Unterlippe. Dann ging sie wortlos an Frederick vorbei in ihr Zimmer, knotete sich die schwarze Jeansjacke um die Hüften, packte ihr Handy ein und nahm Jimmys Leine von einem Haken nahe der Zimmertür. Schließlich kehrte sie in die Küche zurück, leinte den Hund an und atmete tief ein und aus.
»Versuch bitte nicht, mich in irgendwelche krummen Sachen mit reinzuziehen oder mich anzulügen, verstanden? Ich hasse Lügen.«
Frederick sah nicht so aus, als hätten ihre Worte ihn beeindruckt, im Gegenteil. Er verschränkte zufrieden die Arme und entgegnete: »Wer mag schon gern Lügen?«
»Los jetzt. Bevor ich es mir anders überlege.«
Tamara drückte die Klinke herunter.
»Einverstanden.«
»Wie kam das Monster eigentlich in mein Zimmer?«, wollte sie wissen, während sie umständlich die Haustür hinter sich abschloss und mit der anderen Hand die Leine umklammerte. Jimmy zog sie begeistert über die Auffahrt in Richtung Straße.
»Vermutlich kam es durch den Kamin im Wohnzimmer. Und deine Familie kommt sicher erst mal nicht zurück?«
»Ganz sicher. Die sitzen hoffentlich noch zwei Wochen friedlich in ihren Strandkörben … Wohin gehen wir eigentlich genau?«, wollte sie wissen, als Frederick nicht auf die Hauptstraße, sondern auf das Ende des Dorfes zusteuerte. Es lagen nur noch je zwei Häuser mit großen Grundstücken rechts und links neben ihnen. Sie näherten sich dem Licht der letzten Straßenlaterne.
»Wir benutzen ein Portal und reisen in meine Heimatstadt. Dort treffen wir Rufus, der uns helfen wird, das Monster zu entsorgen. Das hoffe ich jedenfalls … Die Stadt heißt Sinnrik.«
Das Dämmerlicht wurde mit jedem Schritt gegenwärtiger. Hier verlief sich der Bordstein in einen Schotterweg, der in Richtung Wald führte. Tamara warf einen Blick zurück und sah noch den Speichergiebel ihres Elternhauses, das wie viele Gebäude in der Gegend ein altes Exemplar aus Fachwerk war. Sie wollte gerade ihr Handy hervorholen, um die Taschenlampe zu betätigen – und im Falle des Falles den Notruf zu wählen –, da griff Frederick in seine Tasche. Er zog einen Gegenstand hervor und warf ihn in ihre Richtung. Zu ihrer eigenen Überraschung fing sie ihn reflexartig auf. Sie wollte sich schon beschweren, dass er zum zweiten Mal etwas nicht ganz Ungefährliches nach ihr warf, ohne sie vorzuwarnen. Doch kaum hatten ihre Finger den Stein umschlossen, begann dieser zu leuchten. Abrupt blieb sie stehen und sah staunend dabei zu, wie sich das braun-rote, warme Licht über den Feldweg und ihre Gesichter ausbreitete. Der Schein reichte gerade weit genug, um die ersten Baumreihen des Waldes erkennen zu können, die wie ein undurchdringlicher Wall wirkten.
»Schön, nicht wahr? Kobolde brauchen die nie. Wir können auch ohne zusätzliches Licht ganz passabel in der Nacht sehen.«
»Trotzdem trägst du zufälligerweise so einen Stein bei dir?«
»Weitsichtigerweise trifft es besser. Immerhin ist es nicht unwahrscheinlich, in der Menschenwelt einem Menschen zu begegnen, oder?«
Sie zog misstrauisch die Augenbrauen über den Rand ihrer Brille, doch er setzte seinen Weg unbeeindruckt fort. Der Basset schien diesen unverhofften Spaziergang ebenfalls nicht weiter zu hinterfragen, er trabte vergnügt voran.
»Wir gehen nur ein kleines Stück in den Wald rein, es ist nicht mehr weit.«
Sie folgte ihm, wenn auch mit großem Abstand und das Handy in der Tasche ihrer Jeans fest im Griff. Irgendwo schrie eine Eule und sie fröstelte unwillkürlich. Mehr aus Anspannung als vor Kälte.
»Ist das Monsterjagen dein Beruf?«, fragte sie, während sie ihm misstrauisch in den Nacken starrte.
»Im Moment, ja.«
»Was soll das heißen? Machst du sonst etwas anderes?«
»Ich arbeite da, wo ich gebraucht werde«, antwortete er ausweichend, jedoch weiterhin mit munterer Stimme.
»Zum Beispiel?«
»Du bist ganz schön neugierig.«
»Ich habe jeden Grund, neugierig zu sein! Immerhin folge ich dir gerade in einen dunklen Wald, und niemand weiß, wo ich bin.«
Es auszusprechen, machte Tamara diese Tatsache nur klarer und sie spürte, dass die Angst in ihr wuchs.
»Also gut. Ich habe schon als Sanitäter und als Schuhmacher gearbeitet.«
»Interessant«, antwortete sie, obwohl sie sich auf diese Aussage keinen Reim machen konnte. Vermutlich log er.
»Wir sind da«, verkündete Frederick unvermittelt und drehte sich mit ausgebreiteten Armen zu ihr um. Sie befanden sich in einem unwegsamen Bereich des Waldes, der sich mit viel Wohlwollen als kleine Lichtung beschreiben ließ. Eigentlich waren hier nur Büsche, etwas Laub und eine große Pfütze. Tamara sah ihn skeptisch an.
»Sind wir?«
»Ja, das hier ist ein Feenkreis. Wir stehen genau in einem und er wird uns als Portal dienen. Menschen können ihn leider nicht sehen.«
Tamara leuchtete trotzdem mit ihrem Stein auf den Boden, doch der sah ganz gewöhnlich aus. Kein Steinkreis, kein ungewöhnliches Pilzvorkommen. Sie runzelte die Stirn.
»Portal«, wiederholte sie langgezogen.
»Genau. So sind auch die Monster hierhergekommen. Sie verstecken sich manchmal in eurer Welt, wenn sie gejagt werden. Bedauerlicherweise … Reich mir eine Hand«, sagte Frederick und kam zwei Schritte auf sie zu. Er wartete, bis sie die Lücke zu ihm schloss. Tamara betrachtete ihn noch einen Moment. Frederick wirkte nicht auf eine klassische Weise bedrohlich, was zum Großteil dem lustigen Anzug und seinem Lächeln geschuldet war. Doch er war bewaffnet, kein Mensch und fast einen Kopf größer als sie. In seinen Augen blitzte ein Verstand, der sie warnte. Nicht nur Intelligenz, sondern auch Schalk.
Sie sammelte Jimmy vom Boden auf, während sie noch einmal tief Luft holte. Zögernd löste sie die Fingerspitzen von ihrem Handy und legte ihre Hand in seine ausgestreckte. »Ich habe Angst«, hörte sie sich sagen.
Eine kleine Falte bildete sich zwischen Fredericks Augenbrauen. Eine Sorgenfalte.
»Wir bekommen das wieder hin. Versprochen.«
Seine Finger schlossen sich um ihre und augenblicklich erfüllte Nebel ihren Kopf. Sie sah nichts, hörte nichts und fühlte einzig und allein seine Hand, die ihre immer fester umschloss.
Kapitel 2
Tamara schnappte nach Luft, blinzelte und entriss Frederick ihre Hand. Dann ging sie in die Knie und würgte los. Sie kämpfte gegen die heftigste Übelkeit an, die sie seit ihrer Lebensmittelvergiftung gehabt hatte.
»Alles gut?«, fragte er und trat neben sie.
Tamara atmete tief ein und aus, konzentrierte sich nur auf ihren kreisenden Magen. Die Luft stieg ihr kühl in die Nase und half, die Übelkeit zu bekämpfen. Langsam öffnete sie die Augen und blinzelte dicht stehenden Baumkronen entgegen. Sie schnaufte und stützte sich auf den Knien ab. Es dauerte, bis sie endlich auf die wackligen Beine kam.
»Du bist echt hart im Nehmen. Sogar die Erfahrensten müssen hin und wieder kotzen und du bist nur hingefallen.«
Tamara fühlte sich wenig ruhmreich, als sie die Brille auf ihrer Nase zurechtrückte und ein Hicksen unterdrücken musste. »Weshalb ist es hier Tag?«, wollte sie wissen und Fredericks selbstsichere Miene geriet ins Wanken.
»Nun, das … ist eine gute Frage. Scheinbar ist mir da ein Fehler mit der genauen Tag-Nacht-Justierung unterlaufen. Ein kleiner Fehler, minimal nur. Es ist vermutlich einige Stunden früher als in deiner Welt.«
Tamara öffnete den Mund, um zu antworten, dann blieb ihr Herz vor Schreck fast stehen. »Wo ist Jimmy?«
Hektisch drehte sie sich im Kreis und schaute sich genauer um. Sie war mit Frederick auf einer winzigen Lichtung gelandet, über der sich die Bäume nach innen wölbten. Als streckten sie sich nach dem Sonnenlicht in der Mitte der Lichtung aus. Sie hörte ein leises Knacken und drehte sich um. Direkt vor ihr sank einer der mächtigen, moosbewachsenen Bäume auf die Größe eines schulterhohen Schösslings zusammen. In Zeitlupe neigte er sich auf die Seite, als wollte er fragend den Kopf schief legen. Sie zwang sich, den Blick von einem zweiten Baum zu lösen, der den freigewordenen Platz nutzte und seine Äste weiter nach oben streckte. Wo war ihr Hund?
»Wir müssen ihn finden!«, verlangte sie von Frederick und ging mit zitternden Beinen auf das Dickicht zu. Moose und Sträucher bedeckten den Boden. Ein gelbgesprenkelter Farn ließ die Blätter hängen und drängte sich an den Boden. Scheinbar versuchte er dem rasant wachsenden Durchmesser eines knorrigen Baumriesen zu entkommen. Der Baum schüttelte seine Äste, wie Jimmy sich nach einem guten Nickerchen. Tamara drehte sich mit wachsender Panik im Kreis und ließ den Blick umherhuschen. Die stetigen Bewegungen der Bäume halfen ihr nicht gerade dabei, die Orientierung zu behalten. Außerdem knarzten die Bäume so laut, dass sie unmöglich das Geräusch kleiner Hundepfoten ausmachen konnte.
»Ich glaube, ich habe ihn hier drüben gesehen«, meinte Frederick. Mit einem Schritt über eine kniehohe Tanne verschwand er im Dickicht auf der gegenüberliegenden Seite.
»Warte!«, schrie Tamara und stolperte ihm hinterher. Ein dicker Ast drohte die Lücke zu verschließen – hielt aber plötzlich inne. Eine Sekunde verstrich, dann spross er in hohem Bogen über sie hinweg.
Krass, dachte Tamara und sah sich nach allen Seiten um. Doch sie war hier nur umgeben von dichtem Grün, Stämmen und vereinzelten Sonnenstrahlen. Ihr Atem ging schnell. Die unverbrauchte Luft eines friedlichen, ungefährdeten Waldes füllte ihre Lungen, konnte sie aber nicht beruhigen. Glücklicherweise blitzte Fredericks schwarz-weißer Anzug immer wieder im Unterholz auf. Er blieb plötzlich stehen und fluchte. Tamara eilte zu ihm. Frederick lehnte sich zurück und versuchte, sein Bein aus einem Dornenbusch zu befreien. Hartnäckig umklammerte das Gewächs den Kobold.
»Komm schon!« Mit einem Ruck befreite er sich, dann schrumpfte er und schaute sich auf Bodenhöhe nach dem Hund um. Tamara musste einen Sprint hinlegen, um dem streitlustigen Dornenbusch zu entgehen und keuchte, als sie neben ihm ankam.
»Jimmy! Wo bist du?«
Frederick wuchs in die Höhe. »Keine Sorge, da ist er doch.«
Er deutete auf das Ende der Leine, das langsam, aber sicher in einem umgestürzten Baumstumpf verschwand. Tamara eilte zu ihm und schnappte sich die Leine, bevor der Hund vollständig außer Reichweite war. »Komm da raus, Jimmy. Los doch.«
Der Basset hatte immer schon gut auf ihre Kommandos gehört und glücklicherweise tat er das auch jetzt. Auch schien ihm nichts zu fehlen. Sicherheitshalber nahm sie ihn auf den Arm, als sie zurück zu Frederick ging.
»Nun dann. Lass uns runter in die Stadt gehen.«
Er setzte sich in Bewegung und sie folgte ihm schweigend. Ihr Herz pochte im Rhythmus eines Presslufthammers.
Kobolde. Feenkreise. Schrumpfende Bäume. Tag-Nacht-Justierung.
Monster.
Im Gehen blieben ihre Blicke immer wieder an den sich gemütlich streckenden und sinkenden Pflanzen hängen. Sie hätte diesem friedlichen Schauspiel ewig zusehen können. Sie streiten sich nicht um die Lichtquellen, dachte Tamara. Sie wechseln sich ab.
Fest presste sie den Basset an ihre Brust, während sie versuchte, mit Frederick Schritt zu halten. Dabei zwitscherten Vögel Lieder, deren Melodien Tamara noch nie gehört hatte. Langsam lichtete sich das Dickicht und je heller es um sie herum wurde, desto ruhiger wurden die Pflanzen. Gemächlich und kaum sichtbar wiegten sie sich in den Strahlen, wie Seegras in milder Brandung.
»Das ist Sinnrik«, erklärte Frederick mit einer Handbewegung auf die unter ihnen liegende Stadt deutend.
Dieser Ort hätte eine deutlich prunkvollere Vorstellung verdient, fand Tamara. Sie blickte hinunter in die gewundene, von Türmen und Kanälen durchsetzte Stadt, die jeden freien Winkel zwischen zwei hoch aufragenden, mit Wald bedeckten Bergen einnahm. Ihr stockte der Atem. Einige der Dächer glitzerten türkis im nachmittäglichen Sonnenlicht und hüllten die Stadt in eine magische Aura. Eine kreisrunde Stadtmauer schloss die kompakten Bauten ein, aus denen überraschend viele Schornsteine aufragten. Rechts von Sinnrik verjüngte sich das Tal um einen kleinen Fluss, auf der linken Seite öffnete es sich zu einer weiten Grasfläche. Von ihrem Berg führte eine steinige, serpentinenreiche Straße hinab.
»Wunderschön«, hauchte Tamara, als aus mehreren Teilen der Stadt ein Glockenspiel anstimmte, das bei ihnen hier oben nur ganz leise ankam.
»Ja, ganz nett. Vielleicht etwas altmodisch«, entgegnete Frederick und zuckte mit den Schultern. Sein Grinsen war einem angestrengten Gesichtsausdruck gewichen und er hatte die Hände tief in den Taschen seiner Anzugjacke vergraben. Jimmy blieb erstaunlich ruhig auf Tamaras Arm. Nur ab und zu warf er einen Blick zurück zum Wald und dessen bewegte Wipfel, die miteinander zu tanzen schienen. Eine Brise jagte aus dem Tal den Berg hinauf und sie fröstelte.
»Gut, dass ich meine Jacke mitgenommen habe. Ganz recht hattest du nicht mit der Behauptung, hier wäre es nicht kälter.«
»Als ich losgegangen bin, war es schön warm«, antwortete er und schenkte ihr ein Lächeln über seine Schulter.
Sie verdrehte die Augen und richtete den Blick wieder auf die Stadt, deren Gebäude durch kleine Brücken und gespannte Wäscheleinen zueinander zu gehören schienen. Wie die verschiedenen Bereiche einer einzigen großen Burg.
»Von wo sind diese Monster eigentlich entkommen? Sperrt ihr sie irgendwo ein?«
»Ja, so in der Art. Das ist kompliziert. Manche Monster kann man als Zugtiere benutzen, wenn sie richtig trainiert sind. Es sind also nicht alle eingesperrt.« Er hielt kurz inne und schob die Hände tief in seine Manteltaschen. »Ich habe versehentlich ein paar Monster freigelassen. Einige konnte ich direkt wieder einfangen, aber vier oder fünf sind mir entwischt … Vielleicht auch mehr. Einem bin ich bis zu diesem Haus gefolgt«
Tamaras Schritte verlangsamten sich und eine kühle Brise fuhr durch ihr kurzes Haar. Das bedeutete wohl, dass Frederick sie nicht nur unerlaubterweise in diese Welt führte. Er hatte diese Situation herbeigeführt. Wenn auch nicht absichtlich. Sie warf ihm einen Seitenblick zu. Wie weit konnte sie ihm glauben?
Als sie den Abstieg geschafft hatten, kamen sie auf einem Pfad im Tal an. Die Stadtmauer lag nur noch wenige Hundert Meter vor ihnen. Fahnen, Türme und Dächer waren nun gut zu erkennen. Darauf tummelten sich hauptsächlich die Abbildungen blauer und purpurfarbener Libellen. Gusseiserne Laternen schmückten die Fassaden und die Dachwipfel waren mit Holzschnitzereien verziert.
»Hm«, machte Frederick, als sie sich einer Brücke ohne Geländer näherten, die sie über einen schmalen Fluss an die Stadtmauer heranführen würde. Er blieb davor stehen und legte den Kopf schief, um Tamara genau zu mustern. Jimmy begann nun doch zu zappeln. Sie setzte ihn in dem hohen Gras ab, das den kurzbeinigen Hund sofort verschluckte. Nur der aufgeregt wedelnde Schwanz war zu sehen, als er schnüffelnd seine Kreise um Tamara zog. Schmetterlinge flatterten von den umliegenden Blumen und ab und an erklang ein Schmatzen. Tamara konnte nur hoffen, dass der Hund klug genug war, um nichts Giftiges zu fressen.
»Was ist?«, wollte sie von Frederick wissen, der nachdenklich an sein Kinn fasste.
»Ich überlege, wie ich dich ungesehen zu Rufus bekomme.«
Sie öffnete empört den Mund. »Das überlegst du dir jetzt? Nachdem wir schon fast da sind?«
»Ja, ich improvisiere.«
»Als du mir sagtest, es sei verboten, einen Menschen hier her zu bringen, dachte ich, du hättest einen Plan.«
Er grinste schief und sie versuchte aus seinem Ausdruck schlau zu werden. Zog dieser Kobold sie einfach besonders gern auf, oder besaß er wirklich kein Gespür für Ernsthaftigkeit? »Meine Pläne gehen leider sehr oft schief. Ich lebe lieber spontan«, antwortete er, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Unfassbar! Tamara öffnete den Mund, um ihn zu fragen, was denn überhaupt passieren würde, wenn sie hier erwischt würde. Doch in dem Moment ertönte lautes Stimmengewirr links von ihnen. Jemand lachte und Schritte waren zu hören. Noch konnte sie durch die Biegung der Mauer niemanden sehen, doch scheinbar näherte sich eine Gruppe Personen aus dieser Richtung. Und auf ihrer Seite der Mauer.
»Wir nehmen einen der Seiteneingänge. Hier entlang.«
Frederick griff nach ihrer Hand und zog sie über die Brücke, dicht an die Mauer heran. Dort schrumpfte er und sie eilte ihm in geduckter Haltung nach, Jimmy dicht auf den Fersen. »Nein, nein. Das Archiv muss endlich aufgeräumt werden, das sind doch keine Zustände! Habe dort fast meinen Lehrling nicht mehr wiedergefunden …«, verkündete jemand aus der sich nähernden Gruppe und erntete weiteres Gelächter. Tamara schalt sich währenddessen einen Dummkopf, Frederick hierhin gefolgt zu sein.
Dieser stoppte so unvermittelt, dass sie fast über ihn drüber stürzte. Er schoss in die Höhe und legte eine Hand an ein Holztor in der Mauer, das Tamara glatt übersehen hätte. Sein Schloss hatte die Form einer geöffneten Rosenblüte und sie hoffte inständig, dass Frederick in seiner Manteltasche gerade nach dem passenden Schlüssel suchte. »Er war hier, ich bin mir ganz sicher …«, murmelte er. Nervös blickte Tamara über die Schulter und sah schon einen lang gezogenen, näherkommen Schatten. Jeden Augenblick würde … Endlich zog Frederick einen winzigen goldenen Schlüssel hervor und grinste triumphierend. Dann rutschte ihm der Schlüssel zu Boden. Tamara stöhnte verzweifelt, schloss die Augen und sah sich bereits verhaftet und geknebelt in einem Kerker. Dann sprang das Schloss auf und sie eilten hindurch. Frederick zog die Tür zu und verharrte reglos. »… hätte ja nichts dagegen, wenn mein Lehrling für ein paar Tage verschwinden würde. Vorgestern hat das Lager schon wieder gebrannt … « Die Schritte und Stimmen auf der anderen Seite verklangen und Tamara wagte einen tiefen Atemzug.
»Weshalb hast du einen Schlüssel für die Stadtmauer?«, flüsterte sie und sah sich flüchtig auf dem verwinkelten Platz um, der mit großen, naturbelassenen Steinen gepflastert war. Keine anderen Kobolde waren zu sehen, nur eng stehende Häuser und ein Brückenaufgang.
»Erkläre ich dir später.«
»Nein, nicht später. Jetzt sofort.« Sie sah ihn herausfordernd an und er presste die Lippen zusammen, dann seufzte er.
»Also gut. Ich arbeite momentan für die Stadtwache und in dieser Funktion gehört auch das Fangen von Monstern zu meiner Arbeit. Ich bin ein wenig glücklos dabei, das gebe ich gern zu. Aber ich habe nichts Unrechtes getan, verstanden? Ich habe diesen Schlüssel nicht gestohlen.«
»Was passiert, wenn mich jemand sieht?«
Frederick zögerte und sah sich um.
»Die meisten menschlichen Besucher wurden einfach wieder zurückgeschickt. Ich würde aber vermutlich ziemliche Schwierigkeiten bekommen.«
»Aber –« Sie setzte zu der Frage an, was denn mit den wenigen Menschen geschehen war, die nicht zurückgeschickt worden waren. Doch wieder ertönten Stimmen und das Rumpeln von Holzrädern auf Kopfsteinpflaster näherte sich irgendwo zwischen den Häusern. Sie sah genauer hin. Überall wölbten sich pilzförmige Laternen mit Schirmen aus Buntglas über Holzbänken, Blumenkästen und Ladenschildern. Die Häuser wiesen Fassaden aus Fachwerk und Stein auf und standen fest aneinandergeschmiegt. Aus einem Gebäude, über dem eine große hölzerne Brezel hing, traten vier Kobolde. »Hier entlang«, zischte Frederick und packte sie am Handgelenk. Im Schatten der efeubewachsenen Mauer geduckt, sprinteten sie die wenigen Schritte in eine verlassene Seitengasse.





























