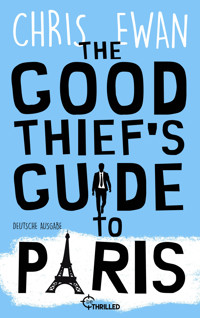
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Charlie Howard
- Sprache: Deutsch
Krimiautor, Dieb, Sündenbock?
Charlie Howard - gefeierter Krimiautor bei Tag, brillanter Meisterdieb bei Nacht - genießt gerade den Trubel um seinen neuesten Bestseller, als er ein ungewöhnliches Angebot erhält: Nach einer Lesung bittet ihn einer der Gäste an dessen Wohnungstür seine Einbruchskünste zu demonstrieren. Ein kurioser Gefallen, denkt Charlie - und lässt sich darauf ein. Erst am nächsten Tag erfährt er: Das Apartment gehört einer Frau, und deren Leiche taucht plötzlich in Charlies Hotelzimmer auf ...
Spannung pur - begleite den charmanten Meisterdieb Charlie Howard bei seinen aufregenden Abenteuern!
Band 1: The Good Thief's Guide to Amsterdam
Band 2: The Good Thief's Guide to Paris
Band 3: The Good Thief's Guide to Vegas
Band 4: The Good Thief's Guide to Venice
»The Good Thief's Guide to Paris« erschien im Deutschen bereits unter dem Titel »Kleine Morde in Paris«.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreissig
Dreiunddreissig
Vierunddreissig
Fünfunddreissig
Sechsunddreissig
Siebenunddreissig
Nützliche Informationen
Grundriss mit Erläuterungen
Französische Begriffe und Redewendungen
Danksagung
Über den Autor
Weitere Titel des Autors
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Charlie Howard – gefeierter Krimiautor bei Tag, brillanter Meisterdieb bei Nacht – genießt gerade den Trubel um seinen neuesten Bestseller, als er ein ungewöhnliches Angebot erhält: Nach einer Lesung bittet ihn einer der Gäste an dessen Wohnungstür seine Einbruchskünste zu demonstrieren. Ein kurioser Gefallen, denkt Charlie – und lässt sich darauf ein. Erst am nächsten Tag erfährt er: Das Apartment gehört einer Frau, und deren Leiche taucht plötzlich in Charlies Hotelzimmer auf …
CHRIS EWAN
The Good Thief’sGuide to Paris
Deutsche Ausgabe
Aus dem britischen Englisch von Stefanie Retterbush
Meiner Familie
EINS
Kaum hatte ich das Haus von außen in Augenschein genommen, drehte ich mich zu Bruno um und erklärte: »Auf den ersten Blick würde ich sagen: ein Kinderspiel.«
Ehrlich, kein Scherz. Ein Kinderspiel. Das habe ich gesagt und anscheinend auch tatsächlich geglaubt. Rückblickend kann ich mich nur kopfschüttelnd fragen, was ich mir dabei wohl gedacht habe. Würde man einen solchen Satz am Anfang eines Krimis schreiben, wäre das praktisch die Garantie dafür, dass man schnurstracks auf eine verflixt komplizierte Geschichte zusteuert. Und doch stand ich – selbst ein Krimiautor – da und sprach nichtsahnend ebendiesen Satz. Hätte nur noch gefehlt, dass ich ein T-Shirt mit der Aufschrift »Katastrophengebiet« trug.
Der arme Bruno. Der hatte natürlich von alledem nicht die geringste Ahnung.
»Wunderbar«, entgegnete er entzückt.
Mahnend hielt ich einen Finger in die Höhe. »Der erste Eindruck kann allerdings täuschen. Und wir wollen doch nichts überstürzen.«
»Und was machen wir jetzt?«
»Wir kundschaften alles aus. Machen uns mit den Gegebenheiten vertraut.«
Bruno nickte, die Konzentration stand ihm buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Freudige Erregung blitzte in seinen Augen auf, die ich nur zu gut von meinen ersten Diebeszügen kannte. Abgesehen davon waren ihm seine kriminellen Energien nicht anzusehen. Eigentlich wirkte er durch und durch wie ein grundanständiger junger Franzose: kurz geschnittene Haare, leichter Dreitagebart, Poloshirt, leicht abgeschabte Turnschuhe.
»Auch von außen kann man schon eine ganze Menge in Erfahrung bringen«, erklärte ich. »Zum Beispiel sehe ich mir die Klingelknöpfe am Eingang an und zähle sie: genau elf.«
»Zwölf.«
»Meinen Sie?«
»Ganz unten ist noch einer, wo das Licht nicht so gut ist.«
»Aha«, brummte ich und fragte mich, wie sehr der Alkohol in meinem Blutkreislauf meine Sehfähigkeit bereits eingeschränkt hatte. »Okay, also zwölf Wohnungen. Und dann zähle ich, mal sehen, zwei beleuchtete Fenster hier an der Vorderseite des Hauses.«
»Stimmt.«
»Normalerweise würde ich sagen, nach hinten raus werden es sicher noch mal so viele sein, also sollten wir davon ausgehen, dass die Bewohner von mindestens vier der Appartements augenblicklich zu Hause sind.«
Bruno runzelte skeptisch die Stirn. »Aber die Leute könnten auch ausgegangen sein und bloß das Licht angelassen haben.«
»Möglich. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und Sie sagten doch, die Wohnung liegt im vierten Stock, nach vorne raus, und dort brennt kein Licht. Zumindest sehe ich keins.«
»Stimmt, da haben Sie recht.«
Ich wies auf das betreffende Fenster. »Und die Gardinen sind nicht zugezogen und die Rollläden nicht geschlossen. Sollte also die Person, die in dieser Wohnung lebt, nicht zufälligerweise bereits um Viertel vor zehn abends zu Bett gegangen sein, ohne das Schlafzimmer gegen das helle Licht der Straßenlaterne abzudunkeln, können wir davon ausgehen, dass niemand zu Hause ist.«
»Wir könnten doch auf Nummer sicher gehen«, meinte Bruno und drehte sich zu mir um.
»Und wie?«
»Einfach klingeln.«
»Stimmt«, gab ich zurück, »aber Sie vergessen den Nachtportier.«
Mit ausgestrecktem Zeigefinger wies ich auf die verglaste zweiflügelige Eingangstür des Hauses und den korpulenten, beinahe kahlköpfigen Herrn, der hinter einer auf Hochglanz polierten Rezeptionstheke thronte und hochkonzentriert auf eine gefaltete Zeitung starrte. In der Hand hielt er einen Kugelschreiber, woraus ich messerscharf schloss, dass er gerade mit einem Kreuzworträtsel kämpfte. Obwohl das auch ziemlich egal war. Mich interessierte allein seine Anwesenheit.
»Denken Sie mal kurz nach«, empfahl ich. »Wenn Sie jetzt auf die Klingel drücken und keiner aufmacht, dann riecht der Portier doch sofort den Braten, wenn Sie anschließend versuchen, einfach nonchalant hineinzuspazieren, um dem Wohnungseigentümer einen kurzen Besuch abzustatten.«
»So weit hatte ich nicht gedacht.«
»Tja, darum bin ich ja auch hier.« Wohlwollend legte ich ihm eine Hand auf die Schulter. »Also, Sie sagten, die Vordertür sei immer abgeschlossen. Da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder das Schloss ist alt – womöglich schon so alt wie das Haus selbst –, dann ist es vielleicht verrostet und lässt sich sogar mit dem Schlüssel nur schwer öffnen. Oder die Stifte sind schon so abgenutzt, dass ich das Ding in nicht mal einer Sekunde geknackt habe. Aber so oder so darf uns der Portier nicht dabei erwischen, vor allem nicht mit Ihnen als blutigem Anfänger.«
Bruno guckte mich mit zusammengekniffenen Augen an, als sei ich eine kleine Gestalt weit weg am fernen Horizont. »Was schlagen Sie also vor?«
»Ein kleines Ablenkungsmanöver, um ihn von der Rezeption wegzulocken. Los, helfen Sie mir mal, ein bisschen Müll zu sammeln.«
Zu meiner Verblüffung war es ein Leichtes, im Nobelviertel Marais genügend Müll auf den Straßen zu finden. So begehrt das Viertel als Wohngegend auch geworden war, so viele teure Boutiquen, exklusive Galerien und angesagte Brasserien in den letzten Jahren dort auch eröffnet worden waren, lagen doch überall unzählige dieser grünen Plastikmüllsäcke herum. Jeder von uns schnappte sich einen Sack aus einem der Torbögen des Säulengangs am Place des Vosges, dann führte ich Bruno zurück zur Rue de Birague.
Mit dem Kinn wies ich in eine dunkle Gasse hinter dem Gebäude, zu dem wir uns Zutritt verschaffen wollten. Dort stand eine große Mülltonne, die aussah, als gehörte sie zu dem kleinen, noch bis spät abends geöffneten Gemüseladen gleich rechts neben unserem Haus.
»Für Sie«, flötete ich charmant, reichte Bruno meinen Müllsack und wischte mir die Hände an der Hose ab. »Folgen Sie mir unauffällig.«
»Aber der Portier – der wird uns doch sehen.«
»Nicht, wenn wir schnell sind. Der liest gerade die Zeitung, schon vergessen?«
Und ehe Bruno weitere Widerworte geben konnte, war ich auch schon über die Straße geflitzt und grinste übers ganze Gesicht wie ein Honigkuchenpferd angesichts der Absurdität meines Vorhabens. Nie im Leben würde ich bei einem meiner eigenen Aufträge etwas derart Hirnrissiges versuchen. Das war eigentlich alles bloß Show, um Bruno das Gefühl zu geben, er bekomme etwas geboten für sein Geld. Ich meine, jeder professionelle Dieb wird Ihnen bestätigen, dass die einfachste Lösung immer die beste ist. Und mit ein paar Tagen Bedenkzeit wären mir sicher ein Dutzend einfachere Methoden eingefallen, um den Portier elegant zu umgehen. Bestimmt hätten wir auf der Rückseite des Hauses einen Hintereingang oder einen Notausgang gefunden, der diese ganze hirnverbrannte Aktion überflüssig gemacht hätte. Vielleicht hätten wir sogar durch den Gemüseladen oder das Zwei-Sterne-Hotel auf der anderen Seite des Hauses hineinkommen können. Dieser Bruno war ja wirklich ein netter Kerl, aber er hatte anscheinend nicht alle Tassen im Schrank, wenn er mir ernsthaft diesen Mülltrick abkaufte.
Rasch schlüpfte ich in die Gasse hinter dem Haus, hob den Deckel von der Mülltonne und sah hinein. Sie war leer, roch aber durchdringend nach faulem Obst. Entschlossen hob ich die Mülltonne hoch und trug sie neben den Seiteneingang des Hauses. An der hübsch lackierten Tür klebte ein Schild mit der Aufschrift Post.
»Ich gehe davon aus, dass sich der Portierschalter gleich hinter dieser Tür befinden müsste«, meinte ich.
Bruno nickte.
»Also, der Plan sieht folgendermaßen aus: Wir stecken die Mülltüten in die Tonne und zünden sie an, dann klopfen wir an die Tür und laufen zurück zur Vorderseite. Während der Portier noch damit beschäftigt ist, das Feuer zu löschen, knacken wir das Schloss und spazieren in aller Seelenruhe zur Vordertür hinein.«
»Meinen Sie nicht, das ist ein bisschen zu plump?«
»Überhaupt nicht«, entgegnete ich und wedelte Brunos durchaus berechtigte Sorge mit einer abschätzigen Handbewegung fort. »Ihm bleibt überhaupt keine Zeit zum Nachdenken. Er muss schnell agieren. Und während er hier hinten agiert, agieren wir vorne. Und wenn wir schließlich alle fertig sind mit agieren, stehen wir beide wie gewünscht oben in der Wohnung.«
Bruno schulterte die Müllsäcke. »Glauben Sie denn, das Zeug brennt ordentlich?«
»Klar«, erwiderte ich, nahm ihm die Tüten aus der Hand und stopfte sie in die Tonne.
»Ich überlege nämlich gerade«, fuhr er fort, »vielleicht könnten wir auch Ihr Buch nehmen?«
Bruno grinste mich an, wobei er eine Reihe makelloser weißer Zähne entblößte, dann bückte er sich, kramte das Buch aus seinem Rucksack und hielt er mir vor die Nase. Ich lächelte tapfer zurück, als sei er ein echter Scherzkeks, auch wenn ich ihm am liebsten einen harten Handkantenschlag gegen die Luftröhre verpasst und ihm dann als Zugabe mit meiner Kniescheibe die Nase zertrümmert hätte. Warum, fragen Sie? Weil es mich über ein Jahr meines Lebens gekostet hatte, dieses Buch zu schreiben, das er so beiläufig zu verbrennen vorschlug. Es war das mit Abstand schwierigste Projekt gewesen, an dem ich je gearbeitet hatte. Jeden einzelnen Satz hatte ich mir im Schweiße meines Angesichts abgerungen, jedes einzelne Wort, und da stand nun der gute alte Bruno, den ich erst seit drei Stunden kannte, und riss dumme Witze darüber, es als Grillanzünder zu verwenden.
»Keine gute Idee«, widersprach ich so ruhig wie möglich.
»Meinen Sie, der Einband brennt vielleicht nicht? Soll ich ihn besser zerreißen?«, fragte er und packte das Buch, als ob er seine Drohung sofort wahr machen wolle.
»Nein«, protestierte ich und hielt sein Handgelenk fest. »Ich finde, wir sollten mal ganz kurz logisch darüber nachdenken, was Sie da gerade vorschlagen. Sie wollten, dass ich Ihnen zeige, wie man in diese Wohnung einsteigt, ohne erwischt zu werden, richtig? Nun, Lektion Nummer eins, mein lieber Bruno: Ich halte es für keine gute Idee, ein Buch zu verbrennen, auf dem mein Name steht; ein Buch, in das ich eine persönliche Widmung für Sie geschrieben habe. Das ist so ziemlich das Dämlichste, was ich je gehört habe. Mal angenommen, wir klopfen an die Tür und der Portier kommt raus, noch ehe das Buch gründlich verbrannt ist? Oder was, wenn das Buch gar nicht richtig Feuer fängt? Ich würde sagen, es sähe doch ziemlich verdächtig aus, wenn jemand genau an dem Abend in eine Wohnung hier im Haus einbricht, an dem der Portier ein verkokeltes Exemplar meiner Memoiren findet, oder nicht?«
Wieder grinste Bruno über das ganze Gesicht. »Schon gut«, beschwichtigte er mich, drückte meinen Arm und strich liebevoll über den Buchtitel. »Das war doch nur Spaß, Charlie.«
»Sehr lustig.«
»Schauen Sie, ich stecke das Buch wieder ein«, beruhigte er mich und verstaute meinen Roman in seinem Rucksack. »Da drin ist es ganz sicher. So, können wir jetzt das Feuer legen?«
Finstere Verwünschungen vor mich hin murmelnd, griff ich in meine Jackentasche und zog ein Päckchen Zigaretten heraus. Ich zündete eine Zigarette an, zog zur Beruhigung einmal kräftig daran und warf Bruno mein Feuerzeug zu. Dann beobachtete ich, wie er sich vorbeugte, halb in der Tonne verschwand und den Müll in Brand steckte. Sekunden später quollen dicke, schwarze Rauchschwaden aus der Tonne.
Ich blies den Rauch aus und kramte währenddessen in meiner Hosentasche herum, bis ich das kleine, biegsame Plastikutensil gefunden hatte, das ich suchte. Für das ungeübte Auge mochte der Gegenstand auf den ersten Blick aussehen wie eines dieser Rührstäbchen, wie man sie am Kaffeeausschank zum Mitnehmen bekam, aber wenn man genauer hinschaute, konnte man am Ende des Stiels eine Reihe winziger Plastikborsten erkennen. Und durch diese Borsten vermittelte das kleine Gerät den Eindruck einer sehr kleinen, aber ziemlich unsanften Zahnbürste.
»Das werden Sie gleich brauchen«, erklärte ich, reichte Bruno das handliche Werkzeug und nahm noch einen Lungenzug.
»Und was macht man damit?«, erkundigte er sich, während er das Gerät in seinen großen Händen drehte und wendete.
»Man nennt das eine Harke. Die steckt man in den Schlüsselkanal des Schlosskerns und stemmt sie gegen die Stifte, die das Schloss daran hindern aufzuspringen. Währenddessen schiebt man den Schraubenzieher unten ins Schloss und drückt damit die Stifte herunter.« Ich drückte ihm einen meiner Mikro-Schraubenzieher in die Hand – den mit dem roten, sechseckigen Griff. »Dann zieht man die Harke wieder raus. Bei einem einfachen Schloss schieben die Plastikborsten die Stifte genau auf die richtige Höhe, sodass sich der Kern des Schließzylinders drehen lässt.«
»Und Sie meinen, das funktioniert hier auch?«
Ich zog an meiner Zigarette und hielt den Rauch einen Moment in der Lunge. »Ich glaube, das funktioniert an diesem Schloss, aber Sie müssen schon noch den Knauf drehen, damit die Tür aufgeht.« Womit ich meine Zigarette in die Mülltonne warf. Schon jetzt umzüngelten die Flammen einen großen Teil des Mülls, und der Geruch von verbranntem Plastik und der Duft warmer, vergammelter Bananen lagen in der Luft. »Normalerweise würde ich bei so etwas Handschuhe tragen. Aber diesmal dürfte es auch ohne gehen. Also, sind Sie so weit?«
Er schaute mich an und nickte ernst.
»Also gut«, rief ich aufmunternd und klopfte kräftig gegen die Holztür.
Dreimal hämmerte ich energisch gegen die Tür, dann gab ich Bruno einen Schubs und schob ihn in Richtung Straße. Er stolperte ungelenk über seine eigenen Füße, taumelte ein paar Schritte, fing sich dann aber und rannte los. Ich blieb ihm dicht auf den Fersen. Am Ende der Gasse wollte Bruno schon hektisch um die Ecke galoppieren, aber ich packte ihn geistesgegenwärtig am Kragen und hielt ihn zurück.
»Nicht so schnell«, ermahnte ich ihn und drückte ihn gegen eine Obstauslage vor dem Gemüsegeschäft. »Zuerst müssen wir uns vergewissern, dass er weg ist.«
Vorsichtig schlich ich ein paar Schritte weiter und reckte den Hals, um durch die Glastür ins Foyer zu spähen. Dabei erhaschte ich gerade noch einen Blick auf die braunen Ärmel des Portiers, als der in der kleinen Kammer hinter seinem Schalter verschwand. Ich winkte Bruno, zu mir zu kommen.
»Zuerst die Harke«, befahl ich und schaute zu, wie er die Harke ins Schloss steckte. Dann packte ich sein Handgelenk und führte seine Hand energisch nach oben, sodass die Borsten gegen die Stifte im Inneren des Schlosses gedrückt wurden. »Gut. Und nun den Schraubenzieher. Wunderbar. Jetzt ziehen Sie die Harke rasch heraus und drehen im gleichen Moment den Schraubenzieher im Uhrzeigersinn herum.«
»Einfach das Ding rausziehen und drehen?«
»Jawohl. Einfach schwungvoll rausziehen und drehen und dabei den Türknauf nicht vergessen.«
»Moment.« Verdutzt schaute er mich an. »Den Türknauf soll ich auch noch drehen?«
»Ich mache das«, knurrte ich. »Konzentrieren Sie sich ganz auf das Schloss. Okay?«
Wieder nickte er.
»Also los.«
Und was soll ich sagen, das tat er dann auch.
»Wahnsinn«, staunte Bruno, als der Sperrriegel zurückglitt und ich im exakt richtigen Augenblick den Türknauf drehte.
»Nach Ihnen«, gab ich zurück und ließ ihm den Vortritt.
ZWEI
Genau in dem Moment, als wir das Foyer betraten, erschien der Nachtportier wieder auf der Bildfläche. Erstaunt runzelte er die Stirn, und seine Hand erstarrte nur Zentimeter über dem Feuerlöscher, der an der Wand hinter seinem Schalter hing.
»Bonsoir Monsieur«, grüßte ich verwegen mit einem beiläufigen Winken und einer leichten Verbeugung, packte Bruno unauffällig am Ellbogen und dirigierte ihn freundlich, aber bestimmt durch das Foyer. Brunos Füße schienen ihm im Weg zu sein. Ich riskierte einen verstohlenen Seitenblick auf den Portier. Der hatte sich noch immer nicht vom Fleck gerührt.
»Quatrième étage«, stammelte ich noch und zeigte mit dem ausgestreckten Finger nach oben.
Endlich zuckte der Portier eher gleichgültig und gelangweilt mit den Schultern und murmelte irgendwas in seinen Bart, als sei es ihm ohnehin egal, wo wir hinwollten.
»Bonsoir«, rief ich ihm noch vollkommen unnötig hinterher, während er uns schon den Rücken zugedreht hatte, den Feuerlöscher aus der Wandbefestigung wuchtete und dann durch die Tür in die Seitengasse verschwand.
Am anderen Ende des Foyers angekommen, drückte Bruno den Aufzugsknopf. Ich hörte einen antik klingenden Glockenton und das Surren unsichtbarer Zahnräder und Kabel, gefolgt vom gedämpften Läuten des Fahrstuhlglöckchens, als die Fahrkabine zu uns herunterschwebte. Von draußen war das Zischen und Spucken des Feuerlöschers zu vernehmen. Dann eine Pause, gefolgt von einem zweiten und dritten spritzenden Strahl aus dem Löscher, begleitet von einem der wenigen französischen Wörter, an die ich mich von meinem Schüleraustausch noch erinnerte.
Im Foyer selbst war es schon beinahe gespenstisch still, und das Licht war gedämpft. Die Gestaltung des Eingangsbereichs wirkte elegant, aber minimalistisch. Den Boden unter unseren Füßen bedeckten Marmorfliesen, und an den cremefarbenen Wänden hingen einige wenige, recht gewagte moderne Gemälde.
Auch wenn der Portier eben vielleicht nichts gesagt haben mochte, so arbeitete er doch in einem vornehmen Haus, und es war gut möglich, dass ihn unsere Ankunft zeitgleich mit dem Feuer stutzig machen könnte.
»Das dauert alles viel zu lange«, flüsterte ich Bruno zu.
»Wir können auch die Treppe nehmen.«
»Nein – damit würden wir uns nur noch verdächtiger machen. Ich wünschte bloß, der Aufzug käme endlich.«
Bruno warf einen Blick auf die Anzeige über unseren Köpfen. »Noch zwei Stockwerke.«
»Na toll.«
Angestrengt betrachtete ich meine Schuhspitzen, wobei mir auffiel, dass ich meine Schuhe mal wieder putzen müsste. Eigentlich hatte ich das noch vor der Lesung erledigen wollen. Wobei es nicht den Anschein gehabt hatte, als hätte sich irgendwer an meiner schlampigen Aufmachung gestört. Am Ende des Abends hatte ich mehr Bücher verkauft als erhofft, und dieser glückliche Umstand hatte erheblichen Einfluss darauf gehabt, wie viel Wein ich anschließend getrunken hatte, und der Wein hatte erheblichen Einfluss darauf gehabt, warum ich mich hatte breitschlagen lassen, Bruno zu zeigen, wie man in eine Wohnung einbrach. Hätte ich zu den Leuten mit gewienerten Schuhen gehört, hätte ich mich vermutlich nie im Leben auf eine derart aberwitzige Idee eingelassen. Eigentlich verblüffend, wie viel Ärger man sich durchs Schuheputzen ersparen könnte.
Hätte ich genügend Zeit gehabt, wären mir sicher noch allerhand andere Dinge eingefallen, die ich stattdessen besser gemacht hätte, aber genau in diesem Augenblick klingelte das Aufzugsglöckchen noch zweimal, und die polierten Metalltüren öffneten sich widerstrebend. Als wir einstiegen, sah ich aus dem Augenwinkel, dass Bruno auf den Knopf mit der Nummer drei drücken wollte.
»Nein«, fuhr ich ihn an, schlug energisch seine Hand weg und drückte auf die Taste für das vierte Stockwerk, ehe er die Gelegenheit hatte, mit dem Finger irgendeinen anderen Knopf zu betätigen.
Verwirrt drehte Bruno sich zu mir um, doch ich lächelte unbewegt weiter, während wir darauf warteten, dass die Fahrstuhltüren sich hinter uns schlossen. Sobald sie zugegangen waren und die Kabine nach oben zu fahren begann, fragte Bruno: »Was sollte das denn?«
Entnervt verdrehte ich die Augen. »Weil ich dem Portier gesagt habe, dass wir in den vierten Stock wollen.«
»Aber die Wohnung ist doch im dritten.«
»Ich weiß, ich hab’s vermasselt. Das letzte Glas Wein hätte ich wohl besser nicht getrunken.«
Bruno schüttelte theatralisch den Kopf, als hätte ich gerade eine Beule in seinen Wagen gefahren.
»Nicht weiter schlimm«, beruhigte ich ihn. »Wir steigen einfach im vierten Stock aus und laufen dann die Treppe runter.«
»Wir hätten ohnehin besser die Treppe genommen.«
Ich seufzte. »Hören Sie, niemand benutzt in einem Haus wie diesem die Treppe, wenn es einen funktionierenden Aufzug gibt. Und wir wollen doch nichts tun, womit wir unnötig Aufmerksamkeit erregen.«
Bruno guckte mich streng an.
»Zugegeben, dieser Abend mag da die Ausnahme sein, die die Regel bestätigt. Aber an der Theorie an sich ist nicht zu rütteln.«
Das Klingeln des Aufzugsglöckchens unterbrach uns, und dann hielt die Fahrkabine mit einem Ruck an, weshalb mein Magen einen kleinen Überschlag machte. Ratternd öffneten sich die Türen.
»Nur zu«, sagte ich aufmunternd und bedeutete Bruno, vor mir aus dem Aufzug zu steigen.
Ungefähr so unauffällig wie eine aufgedonnerte, singende und Cancan tanzende Moulin-Rouge-Tänzerin stolperte Bruno in den Flur, wobei er gleich einen Bewegungsmelder auslöste, der im Korridor die Wandlampen aufleuchten ließ. Die Wände waren ungefähr bis auf Schulterhöhe dunkelrot gestrichen, darüber schimmerten sie satt cremefarben. Dem Aufzug direkt gegenüber standen ein Gummibaum mit großen, glänzenden Blättern und eine niedrige, mit hellbraunem Leder bezogene Sitzbank. Ich betrat hinter Bruno den Korridor und folgte ihm an zwei identisch aussehenden, einander gegenüberliegenden Türen vorbei zu einer unscheinbaren cremefarbenen Tür am Ende des Gangs. Eine grüne Lampe mit der Aufschrift »Sortie de Secours« beleuchtete den Weg zum Notausgang.
Wir marschierten durch die Tür und fanden uns in einem Treppenhaus wieder. Die Luft war hier merklich kühler als im bewohnten Teil des Hauses, und als wir hinuntergingen, hallten unsere Schritte dumpf von den Wänden wider. Beim Betreten des Korridors im dritten Stock flammten wieder die Wandlampen auf. Dieser Flur war genauso gestaltet wie der im Stockwerk darüber, nur dass hier anstelle des Gummibaums ein Schirmständer aus Aluminium stand.
»Ich sehe gar keine Überwachungskameras«, stellte ich fest.
»Nein«, stimmte Bruno mir zu.
»Im Foyer auch nicht?«
»Nur der Portier.«
»Wundert mich.«
»Ist ein altes Haus.«
Ich kaute auf meiner Unterlippe herum. »Aber renoviert und modern gestaltet. Und eine ziemlich teure Adresse. Recht ungewöhnlich heutzutage.«
»In London vielleicht.«
Hartnäckig schüttelte ich den Kopf. »Wissen Sie, in meinem Haus in der Nähe von Grenelle gibt’s auch keine Kameras. Aber es ist immer noch sehr viel sicherer als das hier.«
»Ach ja?«
»Einer der Gründe, weshalb ich dort lebe. Vor allem wegen der Abschreckung.«
Skeptisch schaute Bruno mich von der Seite an. »Wenn ich also eine sichere Wohnung suche, sollte ich mich vorher wohl erst erkundigen, ob ein Dieb im Haus wohnt.«
»Sie haben’s erfasst. Aber wie wollen Sie das anstellen? Die Augen aufhalten, ob Sie einen Kerl mit gestreiftem Overall und Augenmaske sehen, der einen dicken Sack mit der Aufschrift Beute über der Schulter trägt?«
Bruno lächelte schief und wies auf eine cremefarbene Tür mit der Nummer 3 A. In die Tür war ein Messing-Spion eingelassen, und ein bisschen tiefer etwas, das wie ein handelsüblicher Türriegel aussah.
»Geht das damit?«, fragte er, öffnete die Hand und zeigte mir die Harke.
»Mit ein bisschen Glück vielleicht.« Ich schloss seine Finger um das Werkzeug. »Aber noch sind wir nicht so weit. Sie haben sich noch nicht vergewissert, dass niemand in der Wohnung ist.«
Bruno wirkte verwirrt. »Aber das weiß ich doch schon.«
»Falsch«, entgegnete ich und wackelte mahnend mit dem Zeigefinger. »Sie glauben es zu wissen. Aber Sie wissen es nicht hundertprozentig. Und wenn Sie die Sache wie ein Profi angehen wollen, dann klopfen Sie.«
Bruno zog den Kopf ein. »Ist das nicht ein bisschen albern?«
»Für Sie vielleicht. Für mich nicht.«
Ich wies auf die Tür. Bruno wedelte mit der Harke vor meiner Nase herum.
»Trauen Sie mir nicht?«, fragte er.
»Ich wäre nicht hier, wenn ich Ihnen nicht trauen würde.«
»Ich habe Sie nämlich schon bezahlt. Schon vergessen?«
»Darum geht es nicht.«
Bruno kniff ein Auge zusammen und stierte mich aus dem anderen durchdringend an. Sah aus wie eine komplizierte Gesichtsmuskelübung. Vielleicht übte er das zu Hause vor dem Spiegel.
»Die Sache ist die«, fuhr ich fort, »wir haben uns gerade erst kennengelernt, stimmt’s? Und Ihr Anliegen ist doch eher ungewöhnlich. Und natürlich haben Sie mich im Voraus bezahlt, und ich habe zugestimmt, aber ich weiß genauso wenig wie Sie, ob wirklich niemand in der Wohnung ist. Dabei will ich doch nichts weiter, als dass Sie an die verflixte Tür klopfen, und Sie machen so einen Aufstand deswegen.«
Bruno stöhnte und ließ die Schultern hängen. Mit einem resignierten Blick auf seine Handrücken schüttelte er den Kopf. Dann verdrehte er die Augen, ballte die rechte Hand zu einer Faust und klopfte mit Bedacht gegen die Tür.
Wir warteten.
»Klopfen Sie noch mal.«
Ungläubig riss Bruno die Augen auf, tat aber, wie ihm geheißen. Ich trat näher heran und drückte mein Ohr gegen die Tür. Von drinnen war kein Laut zu hören. Also schubste ich Bruno beiseite und schaute durch den Messing-Spion. Leider ohne Erfolg.
»Ich habe Ihnen doch gesagt, dass niemand da ist«, nörgelte Bruno.
»Scheint so«, stimmte ich ihm zu und trat zurück.
»Also?«
»Also gut. Knacken Sie das Schloss, dann haben wir ’s geschafft. Wir sollten sowieso nicht so lange hier herumstehen.«
Noch habe ich keinen Pariser je das Wort Sacrebleu ausstoßen gehört, aber ich brüste mich mit dem Gedanken, dass Bruno in diesem Augenblick ganz kurz davor war. Stattdessen brummte er aber nur missmutig und ging dann in die Hocke, um das Schloss in Augenschein zu nehmen, wobei er mir mit dem Hinterkopf die Sicht versperrte. Ich schaute zu, wie er die Harke in den Schließzylinder einführte und gegen die Stifte stemmte, wie ich es ihm gezeigt hatte. Dann brachte er den Schraubenzieher in Position und übte ein wenig seitlichen Druck aus. Schließlich holte er tief Luft, straffte die Schultern und zog die Harke heraus.
Nichts passierte.
Bruno knurrte unwillig und schob die Harke wieder ins Schloss. Dann drückte er sie noch etwas energischer nach oben, wobei er den Griff ein ganz klein wenig verbog. Ein zweites Mal zog er die Harke heraus, diesmal mit mehr Bedacht.
»Zu langsam«, bemerkte ich.
Unwillkürlich spannte Bruno die Schultern an. Er sah mich zwar nicht an, aber man merkte, dass es ihn wurmte.
»Sie müssen schneller sein. Stellen Sie sich die Stifte einfach bildlich vor und …«
»Schon gut«, blaffte er mich an. »Mache ich ja.«
Ein drittes Mal ließ Bruno die Harke ins Schloss gleiten und zog sie wieder heraus – auch diesmal ohne Erfolg. Er versuchte es ein viertes und ein fünftes Mal. Nach dem sechsten Misserfolg spuckte er ein paar Flüche aus und warf die Harke auf den Boden.
»Immer mit der Ruhe«, mahnte ich und legte ihm beruhigend eine Hand auf die Schulter. »Das ist kein einfaches Schloss. Falls Ihnen das eine Hilfe ist, Sie machen alles richtig. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Harke einfach nicht das richtige Werkzeug.«
Bruno zuckte mit den Schultern wie ein aufsässiger Teenager, dem man eine Gardinenpredigt hält.
»Soll ich das Schloss lieber knacken? Sie können es gerne selbst versuchen, aber man braucht dazu ein bisschen Übung, also wäre es vielleicht das Beste, Sie schauen mir erst mal dabei zu.«
»Also gut, zeigen Sie ’s mir«, murmelte er.
Folgsam trat ich an die Tür, griff in die Innentasche meiner Jacke und zog ein ganz gewöhnlich wirkendes Brillenetui heraus. Ich klappte es auf und wählte aus meinem Werkzeugarsenal einen der etwas biegsameren Haken und einen Schraubenzieher mit geringfügig größerer Klinge als dem, den ich Bruno gegeben hatte. Nachdem ich dann die verbogene Plastikharke vom Boden aufgehoben und das Brillenetui eingesteckt hatte, kniete ich mich hin und nahm das Schloss ins Visier. Behutsam steckte ich den Haken in den Schließzylinder und machte mich an die Arbeit.
Und, siehe da, keine drei Minuten später hatte ich das Ding geknackt. Der Riegel glitt mit einem beruhigenden satten Plock zurück, ein Geräusch wie vom Kofferraumdeckel eines deutschen Sportwagens, und ich griff nach oben und drehte den Türknauf.
Genau im selben Moment hörte ich das piep-piep-piep einer Alarmanlage, die kurz davor war, loszugehen.
»Verdammt«, knurrte ich, als Bruno sich an mir vorbei nach drinnen schob. »Sie haben mir nicht gesagt, dass die Wohnung eine Alarmanlage hat.«
»Vielleicht hätten Sie zuerst nachschauen sollen«, rief er über die Schulter, knipste im Vorbeigehen einen Lichtschalter an und beeilte sich, zur Alarmanlage zu kommen. Eine Reihe Deckenleuchten beschien den Flur, und das helle Strahlen spiegelte sich im Parkettboden. Rasch schlüpfte ich hinein und schloss die Tür hinter mir, dann richtete ich meine ganze Aufmerksamkeit auf das Ende des Flurs, wo Bruno stand und gerade einen deckenhohen Wandschrank öffnete. Ungeschickt tastete er nach der Zugschnur, um die Lampe anzuschalten, und klappte dann die Plastikabdeckung des Bedienfelds der Alarmanlage herunter.
Wenn ich nicht irrte, blieben ihm noch ungefähr acht Sekunden, um den richtigen Code einzutippen, ehe die Alarmanlage losging. Das war mir in der Vergangenheit ein, zwei Mal passiert, und so was sollte man niemals auf die leichte Schulter nehmen. Selbst wenn man es schließlich schaffte, das nervige Ding endlich auszuschalten, was nützte einem das, wenn es erst mal ordentlich losgeheult hatte? Es hatte seine Pflicht getan und sämtliche Leute in der näheren Umgebung auf den Plan gerufen. Zumindest habe ich mir das sagen lassen – ich bin nie lange genug geblieben, um mich mit eigenen Augen davon zu überzeugen.
Klar, hätte ich von der Alarmanlage gewusst, hätte ich sie austricksen oder umgehen können. Und normalerweise hätte ich die Tür nach Hinweisen auf eine Alarmanlage abgesucht, bevor ich mich mit meinen Haken ans Werk machte. Aber dafür war es nun zu spät. Ich war mit der Tür ins Haus gefallen, buchstäblich, war Brunos Frustration und der heimtückischen Falle, die mein eigenes übergroßes Ego mir gestellt hatte, auf den Leim gegangen. Und sicher lag es auch am Alkohol. Wie viel hatte ich eigentlich getrunken? Drei, vielleicht sogar vier Gläser von diesem schweren Bordeaux? Zu viel, um noch Auto zu fahren, aber anscheinend gerade genug, um mich wohlig wie ein Fisch im Wasser kopfüber in einen kleinen spontanen Einbruch zu stürzen. Und genau das ging mir so gegen den Strich – wie leichtfertig ich mich auf die Sache eingelassen hatte.
Ich schaute zu, wie Bruno den Code in die Tastatur eintippte, woraufhin vier rasch aufeinanderfolgende tiefere Töne das Gepiepse unterbrachen. Dann kam noch ein langgezogenes Piep, danach Stille.
Bruno drehte sich zu mir um.
»Sollte das ein Test sein?«
Er blinzelte und schüttelte den Kopf. »Hatte ich ganz vergessen. Mehr nicht.«
Ich nickte und versuchte, es mir nicht zu Herzen zu nehmen. »Wollen Sie mich nicht reinbitten?«
Also führte Bruno mich durch einen Türbogen am Ende des Flurs in einen offenen Wohnraum mit einer teuer wirkenden Küchenzeile am einen Ende. Dann betätigte er einen Dimmer, und auf den Anblick, der sich mir da bot, war ich nicht im Geringsten vorbereitet. Es gab kaum Möbel – nur eine große, kahle Fläche nackten Betonbodens, der völlig farbverkrustet war. Der verschüttete, verspritzte Lack schillerte in allen Farben des Regenbogens wie eine riesige Installation von Jackson Pollock. Ringsum lehnten unzählige Gemälde – fertige und unfertige – an den Wänden des Zimmers, die meisten davon abstrakt, aber auch das ein oder andere etwas klassischere Porträt darunter. Bei den bodentiefen Fenstern standen einige Bilder auf Staffeleien, und zwischen den Staffeleien etwas, das aussah wie ein Tapeziertisch, der sich unter der Last zahlloser Farbtuben und Pinsel und Spatel und Terpentinkanistern bog.
Scharfsinnig, wie ich nun mal bin, drehte ich mich zu Bruno um und fragte: »Sie malen?«
»Ein bisschen«, entgegnete Bruno mit einem knappen Nicken.
Dann nahm er den Rucksack ab, machte den Reißverschluss auf und kramte mein Buch heraus, das er auf die Arbeitsfläche legte.
»Möchten Sie einen Kaffee?«, fragte er.
»Gerne«, erwiderte ich und ging rüber zu den Gemälden. Meine Schuhsohlen klebten am Boden. Vielleicht doch nicht so blöd, dass ich sie noch nicht geputzt hatte. »Die sind gut, Bruno. Wirklich.«
Bruno gab keine Antwort. Er hatte alle Hände voll damit zu tun, zwei gestreifte Tassen und ein Päckchen Kaffee aus einem Hängeschrank zu nehmen. Stumm schaute ich zu, wie er die Kaffeemaschine ein Stückchen von der Wand abrückte, etwas von dem Pulver hineinschüttete und dann einen Schalter an der Maschine betätigte, der daraufhin gelb aufleuchtete. Schnell begann der Kaffee durchzulaufen, und Bruno öffnete die Kühlschranktür. Er steckte den Kopf hinein.
»Keine Milch«, stellte er bedauernd fest.
»Ich trinke ihn auch schwarz«, gab ich zurück und strich mit der Hand über eins der Bilder. »Vielleicht werde ich dann wieder nüchtern.«
Ach, wäre mir dieser Gedanke doch bloß ein paar Stunden früher gekommen …
DREI
Ich möchte, dass Sie etwas für mich stehlen.« Diesen Satz hörte ich nicht zum ersten Mal. Wobei derjenige, der ihn äußerte, üblicherweise zunächst ein bisschen um den heißen Brei herumredete. Anders der Amerikaner. Der kam sofort auf den Punkt, völlig ohne Umschweife …
So begann mein letztes Buch, Amsterdam – Ein Meisterdieb jagt seinen Schatten, und als ich von dem Exemplar aufschaute, das ich gerade in der Hand hielt, und den Blick über die vielen Gesichter vor mir schweifen ließ, musste ich mich zusammenreißen, um den beinahe unwiderstehlichen Drang zu unterdrücken, eine kurze Pause einzulegen und mich zu vergewissern, ob mein Publikum auch wirklich und tatsächlich wollte, dass ich weiterlas.
Wäre ich vor einem Jahr im Buchladen Paris Lights aufgekreuzt und hätte erklärt, wer ich bin und was für Bücher ich schreibe, hätte man mir sofort die Tür gewiesen, noch ehe ich die Gelegenheit gehabt hätte zu fragen, ob vielleicht einige meiner Werke vorrätig seien, ganz zu schweigen davon, ob man sich möglicherweise vorstellen könne, eine Lesung mit mir zu veranstalten. Doch inzwischen hatte sich das Blatt gewendet. Mit nur einem Buch war aus dem unbekannten Schundromanschreiber praktisch über Nacht der ebenfalls unbekannte Autor der Memoiren eines Meisterdiebes geworden, die nun allerdings drohten, mir erhebliche Glaubwürdigkeit zu verleihen. Die wenigen Kritiker, die Amsterdam bisher rezensiert hatten, bezeichneten den Roman einhellig als geniale Täuschung – nicht nur, dass der Autor zahlloser Groschenromane über einen professionellen Dieb vorgab, im wahren Leben ebenfalls ein Dieb zu sein, nun tat er auch noch, als habe er ein Buch über seine Erlebnisse geschrieben. Die Sache hatte nur einen Haken: Das Ganze war keine Erfindung.
Natürlich hatte ich das ein oder andere Detail ein wenig abgewandelt – Namen, Schauplätze, was tatsächlich gestohlen wurde. Aber in meinen Augen war dieses Buch weit mehr als eine vage Anlehnung an wahre Begebenheiten – jedes Wort, das ich zu Papier gebracht hatte, brachte mich mit dem in Verbindung, was damals in Amsterdam wirklich passiert war.
Nicht dass die Leute, die vor mir saßen, auch nur den blassesten Schimmer davon gehabt hätten. Entweder sie kauften mir genau wie alle anderen diese ganze Scharade unbesehen ab, oder sie hatten ohnehin nicht die geringste Ahnung, worum es in dem Buch überhaupt ging. Wieso sollten sie auch? Ich war ein Autor, der an einem lauen Sommerabend in Paris eine Lesung unter freiem Himmel gab, und das sollte doch nun wirklich reichen, um auch den kaltherzigsten meiner Mitmenschen kurz innehalten und mir ein Weilchen zuhören zu lassen.
Was schätzungsweise an die vierzig Leute auch tatsächlich getan hatten. Die meisten davon Studenten oder Rucksacktouristen, die sich auf den grünen Parkbänken rings um mich herum lümmelten. Das restliche Publikum bestand zu großen Teilen aus dem Aushilfspersonal von Paris Lights; ein heruntergekommener, bunt gemischter Haufen von Leuten, die nachts in klapprigen Feldbetten unter den windschiefen, durchgebogenen Bücherregalen schliefen und als Gegenleistung für die freie Logis tagsüber im Laden arbeiteten. Aber es waren auch noch ein paar andere Zuhörer da: ein britisches Pärchen mittleren Alters, das heimlich über meine Schulter Fotos von dem herrlichen Ausblick über die Seine auf Notre-Dame schoss; eine Nonne in grau-braunem Habit, die ganz in die Betrachtung der Fassade von Saint-Julien-le-Pauvre versunken war; und zwei verschrumpelte alte Franzosen in blauen Overalls, die uns, wie es schien, mit schierer Willenskraft vom Square Viviani vertreiben wollten, damit sie endlich ihren vermutlich seit mehreren Jahrzehnten tobenden Boule-Wettkampf fortsetzen konnten.
Lange würden sie sich nicht mehr gedulden müssen. Ich wollte nur rasch das Eröffnungskapitel meines Buchs vorlesen und anschließend vielleicht ein oder zwei Fragen aus dem Publikum beantworten, sollte es denn welche geben, und zum krönenden Abschluss dann womöglich sogar das eine oder andere Exemplar signieren. Und dann nichts wie los in eine der vielen Brasserien gleich um die Ecke, die ganze Meute vom Buchladen im Schlepptau, wo ich dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so viele Runden ausgeben musste, dass ich den Erlös dieses Abends schnell wieder verprasst hatte.
Sollte mir alles recht sein, solange nur Paige mit von der Partie war.
Paige war es, die mich eingeladen hatte zu lesen, müssen Sie wissen, und eine glückliche Fügung des Schicksals wollte es, dass sie rein zufällig auch noch umwerfend hübsch war. Ihre Augen waren das Erste, was mir an ihr aufgefallen war – rehbraun waren sie und glänzend und ein klitzekleines bisschen zu groß, fast, als sei das heillose Durcheinander in ihrem Köpfchen einfach zu viel für sie. Das gefiel mir so an ihr: die unbändige Energie, die sie verströmte, dieses eigenartige Flirren und Beben. Und ich mochte ihre elfengleiche Figur und ihren blassen Teint, so blass, das man an den Schläfen das zarte Gewirr blauer Äderchen durchschimmern sah. Und mir gefielen die Kringellöckchen, die ihr bis auf die Schultern und ins Gesicht fielen, und wenn sie redete, mochte ich am allerliebsten ihre Stimme. Sie war Amerikanerin, aus dem mittleren Westen, wie ich vermutete, und sie plapperte wie ein Vögelchen, federleicht und ungezwungen und untermalt von kleinen, schrillen Lachern. Himmel, wie gerne ich sie küssen wollte!
Aber soll ich Ihnen mal etwas Schockierendes verraten? Ich war anscheinend nicht der Einzige. Fast kam es mir vor, als bestünde die Kundschaft des Ladens zur Hälfte aus jungen Männern, die sich allesamt krampfhaft bemühten, irgendwie Paiges Aufmerksamkeit zu erregen. Ziemlich viele davon waren amerikanische Gaststudenten, die schwer bepackt mit den Lehrbüchern ihrer Kurse an der Sorbonne in den Laden stiefelten. Lässig schlenderten sie durchs Geschäft, schmökerten in Beat-Gedichten, warfen sich in literarisch anmutende Posen und lugten über Émile-Zola-Taschenbücher zur Hauptkasse hinüber, an der Paige residierte. Und verdammt, ich konnte es ihnen nicht verdenken, hätte ich selbst doch tagelang dasselbe tun können.
Drei Besuche brauchte ich, bis ich mich entschloss, sie anzusprechen, und weitere zwei, bis ich endlich all meinen Mut zusammennahm und es auch tatsächlich tat. Da unterhielt sie sich gerade mit einem der ungewaschenen Hippies, die dort arbeiteten – ein Typ, in dessen dreckverkrusteten Rastalocken und verfilztem knallroten Strickpulli sicher ganze Kulturen bislang unentdeckter Lebewesen nisteten. Paige war laut und rechthaberisch und benahm sich überhaupt nicht so, wie man sich eigentlich in einem Buchladen benehmen sollte. Und ich fand es großartig.
»Hallo!«, tönte ich, trat mit einem schiefen Lächeln an die Kasse und reichte ihr die Hand. »Ich heiße Charlie Howard. Ich bin einer der hiesigen Schriftsteller.«
Paige unterbrach sich mitten im Satz und guckte mich mit ihren atemberaubenden Glupschaugen an. In diesem Moment schien die Welt stillzustehen. Dann bedachte sie mich mit einem Hundert-Watt-Strahlen und schüttelte energisch meine Hand.
»Hallo. Ich bin Paige.«
»Charlie«, wiederholte ich.
»Dichter?«, fragte der Typ neben ihr mit einem schroffen, nach Manchester klingenden Akzent.
»Krimiautor«, gestand ich und hielt ein Exemplar meines Buches in die Höhe.
Paige überflog den Titel. »Sieht … interessant aus«, brachte sie mühsam hervor und wandte sich gleichzeitig von mir ab, um die Reaktion des Typen im roten Pulli abzuwarten.
Der Kerl war sich noch nicht ganz sicher, was er von mir halten sollte, also streckte er die Hand nach dem Buch aus, warf einen prüfenden Blick darauf und guckte dabei ganz schamlos auf den Verlag. Seine Augenbrauen hoben sich minimal. »Das bist du?«
»Fürchte schon«, brummte ich und zuckte verschämt mit den Achseln.
»Ich schreibe gerade einen Roman«, erklärte er mir von irgendwo hinter seinen Rastalocken. »Eine epische Fantasy-Geschichte, eingebettet in einen sozialistischen dystopischen Albtraum.«
»Das ist … toll«, stammelte ich und sah aus den Augenwinkeln, wie Paige mir verschwörerisch zuzwinkerte.
Der Rasta-Kerl zog die Nase hoch, wischte sie am Ärmel seines roten Pullis ab und streckte mir die Hand hin. »Mike«, erklärte er. »Willst du ein paar Bücher signieren?«
»Warum nicht? Ihr habt da hinten noch ein, zwei Exemplare stehen, glaube ich.«
Über den Kassenschalter hinweg drückte Paige mir die Hand. »Ach, aber wir können doch schnell welche nachbestellen, jetzt, wo wir dich kennen. Und du machst eine Lesung bei uns, ja?«
»Ähm …«
»Och, komm schon, sag ja.«
»Also …«
»Bitte, bitte«, fügte sie hinzu und klimperte mit den Wimpern.
»Na gut«, gab ich achselzuckend zurück. »Wenn du mich so nett bittest …«
Und das hatte ich jetzt davon. Im Angstschweiß meines Angesichts war ich nun endlich fast am Ende des Kapitels angelangt und mittlerweile felsenfest davon überzeugt, mein Publikum längst verloren zu haben. Ich hatte mir wirklich größte Mühe gegeben, die Lesung so fesselnd wie möglich zu gestalten, aber wer weiß, ob es mir auch gelungen war? Ich hatte meine Stimme moduliert, auch wenn das einfacher gesagt als getan war, und es sogar riskiert, mich in einigen Dialogpassagen an einem amerikanischen Akzent zu versuchen, was allerdings unzweifelhaft in die Hose gegangen war. Angesichts derlei unschöner Gedanken, die mir im Kopf herumspukten, wand ich mich innerlich und las noch ein bisschen schneller, um möglichst schnell zum Ende zu kommen, ohne aus Atemnot in eine Schnappatmung zu verfallen.
Zwei Absätze vor Schluss schaute ich kurz auf und sah, wie Paige munter und vergnügt mit einem der Typen aus dem Laden plapperte. Zwar hielt sie sich dabei dezent die Hand vor den Mund, aber das war eigentlich ziemlich blöde, weil das erst recht darauf hinwies, dass sie unerlaubterweise dazwischenquatschte. Das sagte wohl alles – sogar meine Gastgeberin hatte die Nase bereits gestrichen voll von mir. Verlegen spürte ich, wie mir die Schamesröte ins Gesicht stieg, und prompt verhaspelte ich mich. Paige hob den Kopf, sah zu mir herüber und zwinkerte mir zu. Ich hielt kurz inne, sammelte mich wieder und stürzte mich dann Hals über Kopf in den letzten Absatz.
Als es endlich, endlich vorbei war, wurde ich mit etwas spärlichem Applaus bedacht, und dann fragte ich in die Runde, ob noch jemand Fragen habe.
»Ja«, meldete sich eine junge Engländerin, die links von mir saß. Auf der Nase hatte sie eine große Lesebrille, zu der sie einen praktischen Mittelscheitel trug, und um ihre Mundwinkel tummelten sich jede Menge Pickel.
»Bitte sehr.« Ich nickte ihr aufmunternd zu.
Sie wies auf einen beachtlichen Stapel ziemlich zerlesener Taschenbücher gleich neben ihr. »Ähm, schreiben Sie in nächster Zeit auch mal wieder einen Michael-Faulks-Roman?«
Ich nickte, verblüfft, dass jemand im Publikum die gelesen hatte. »Zufälligerweise sitze ich gerade an dem neuen Band.«
»Ach, toll. Und …«
»Ja?«
»Na ja, es ist bloß, also … das Autorenfoto in all diesen Büchern.« Sie griff zu dem Buch ganz oben auf dem Stapel und hielt es in die Höhe, wobei sie mit einem abgekauten Fingernagel auf das Umschlagbild zeigte. »Das sieht Ihnen überhaupt nicht ähnlich.«
Betreten verzog ich das Gesicht. »Das könnte daran liegen, dass ich das nicht bin.«
Das Mädchen runzelte verwirrt die Stirn und guckte blinzelnd auf das Schwarzweiß-Porträtfoto des aalglatten Männermodels im Smoking. »Aber, ähm, macht man das denn immer so?«
»Nein, eigentlich nicht«, musste ich gestehen und rieb mir mit einem verlegenen Grinsen den Nacken. »Ehrlich gesagt hat sich mein Verlag das so ausgedacht. Die waren der Meinung, damit würden sich meine Bücher besser verkaufen.«
Was natürlich eine glatte Lüge war. In den vergangenen Jahren, seit ich die Michael-Faulks-Krimis schrieb, hatte ich es immer wieder geschafft, mich mit fadenscheinigen Ausflüchten um ein persönliches Treffen mit den Verlagsleuten und sogar mit meiner Agentin Viktoria herumzudrücken. Was rückblickend sogar ziemlich einfach gewesen war, da ich oft reiste und es mich immer, wenn ich einen Roman zu Ende geschrieben oder einen spektakulären Diebeszug erfolgreich über die Bühne gebracht hatte, in ein anderes Land zog. Die Idee, das Bild dieses Katalogmodells für die Umschlaggestaltung meines ersten Romans einzuschicken, war mir damals ganz spontan gekommen. Ich hatte gar nicht weiter darüber nachgedacht, aber bei meiner Lektorin war das Foto überraschend gut angekommen, und später auch bei meiner Leserschaft, die wohl hauptsächlich aus Frauen bestand. Um ehrlich zu sein, habe ich im Laufe der Jahre nicht wenige Fanbriefe erhalten, bei deren Lektüre ich rote Ohren bekam, und fast bereute ich den Entschluss schon wieder, bei Amsterdam so nachdrücklich darauf bestanden zu haben, überhaupt kein Foto abzubilden.
»Das ist aber irgendwie … seltsam«, meinte das Mädchen.
Dem konnte ich kaum widersprechen. Also machte ich ein schuldbewusstes Gesicht, schaute mich dann um und stellte fest, dass es noch eine Hand voll weiterer Fragen zu beantworten gab. Als ich auch dem letzten Fragesteller geduldig Rede und Antwort gestanden hatte, ging ich rüber zu dem Klapptisch, den Paige aufgestellt hatte, und setzte mich hinter den dort ausgelegten Stapel gebundener Ausgaben von Amsterdam – darauf gefasst, zuzusehen, wie die Menge sich vor meinen Augen zerstreute. Zu meiner Verwunderung bildete sich aber rasch eine kleine Schlange, sodass ich schließlich gut zwanzig Minuten lang Bücher signierte und mit meinen Lesern plauderte.
Währenddessen standen die Angestellten des Buchladens etwas abseits, rauchten selbstgedrehte Zigaretten und unterhielten sich. Es war schon ein eigenartiger Haufen: Belesen und gebildet, weit gereist und voller Existenzängste, hausten sie in einer abbruchreifen Ruine ohne Heißwasser und sanitäre Anlagen. Etliche von ihnen steckten in schmutzstarrenden Klamotten, die aussahen, als seien sie seit Wochen nicht mehr gewechselt worden. Weshalb es mich auch nicht weiter verwunderte, dass keiner von ihnen eins meiner Bücher kaufte. Hätten sie genug Geld, sich Bücher zu kaufen, dann würden sie gar nicht erst im Buchladen kampieren. Im Buchladen zu wohnen hieß nämlich, jederzeit jedes beliebige Buch umsonst lesen zu können.
Und es wunderte mich auch nicht, dass sie trotzdem hartnäckig weiter hier herumlungerten. Die Hälfte von ihnen sah aus, als hätten sie seit Wochen keine anständige Mahlzeit mehr gegessen, weshalb sie wohl darauf spekulierten, im Anschluss könne vielleicht noch etwas mehr für sie herausspringen als bloß ein paar Runden Freibier. Sollte mir recht sein. Hätte ich vom Erlös des Verkaufs meiner Bücher leben müssen, dann hätte die Sache wohl ganz anders ausgesehen, aber das musste und tat ich nicht, und mit dem Gewinn meiner nicht ganz legalen Nebentätigkeit konnte ich locker mal eben ein paar Teller warmes Essen bezahlen.
Also widmete ich meine ganze Aufmerksamkeit wieder dem Mädchen vor mir, bei dem es sich, wie ich dann merkte, um meinen pickeligen Fan mit dem Mittelscheitel handelte. Sie war die letzte in der Schlange und ließ sich sämtliche ihrer zerfledderten Faulks-Romane von mir signieren, ohne das neue Buch zu kaufen. Also saß ich da, kritzelte unermüdlich meinen Namen und merkte, wie sie dabei aufmerksam mein Gesicht studierte. Dann klappte ich den allerletzten Krimi zu und wünschte ihr noch einen schönen Abend. Als ich gerade den Verschluss auf meinen Füllfederhalter schraubte und mir überlegte, mit welchen Worten ich Paige wohl danken sollte, trat ein junger, muskulöser Mann mit einem selbstbewussten Grinsen an den Klapptisch. Er schnappte sich ein Exemplar von Amsterdam vom Stapel und warf es mir lässig vor die Nase.
»Möchten Sie, dass ich es signiere?«
»Ja, klar«, erwiderte er auf Englisch mit starkem französischen Akzent.
»Für wen soll die Widmung denn sein?«
Wieder grinste der Kerl mich breit an. »Schön fände ich ›Meinem Protegé‹«, entgegnete er.
VIER
Mein Protegé saß neben mir an der Theke. Ich selbst qualmte wie ein Schlot – sehr französisch – und trank dazu einen kräftigen Rotwein aus einem sehr großen Glas. Es war bereits mein zweites Glas, aber ich kapierte es immer noch nicht.
»Jetzt noch mal ganz langsam zum Mitschreiben. Sie möchten also, dass ich Ihnen dabei helfe, in Ihre eigene Wohnung einzubrechen?«
»Ja«, antwortete Bruno und schaute mich unverwandt an.
»Wenn Sie wissen wollen, wie einbruchsicher Ihre Wohnung ist, dann gibt es Fachfirmen, die Ihnen das ganz genau haarklein auseinanderlegen. Da rufen Sie einfach an und machen einen Termin aus, und dann schicken die jemanden mit einer Checkliste und ein paar bunten Broschüren bei Ihnen vorbei.«
»Das will ich aber nicht.«
»Weil Sie, verstehe ich das richtig, diesen Leuten nicht trauen, wohl aber irgendeinem dahergelaufenen Kerl, der zufälligerweise ein Buch über einen Einbrecher geschrieben hat?«
»Na ja, wenn Sie das so sagen …«
»… klingt es ziemlich abgefahren.«
Bruno kräuselte die Lippen und zuckte mit den Schultern. Ein typisch pariserisches Schulterzucken. Sicher übte er das schon seit seiner Geburt, genauso wie jedes andere französische Kind. Der Barkeeper beherrschte die hohe Kunst des Achselzuckens nämlich ebenfalls aus dem Effeff. Ich beobachtete, wie er gestikulierte und mit den Schultern zuckte wie ein Olympionike, während er einer Dame mittleren Alters mit feuerroten Haaren, die am anderen Ende der Theke saß, einen Absinth einschenkte. Mir drängte sich der Eindruck auf, die Rothaarige müsse ein Stammgast sein und der Absinth ihr liebster Begleiter. Der Barkeeper stellte die Flasche ins Regal zurück und wischte sich die Hände an der gestärkten Schürze ab.
Wieder nahm ich einen tiefen Zug von der Zigarette. Gauloises rauchte ich zwar nicht – dazu war mir mein Hals dann doch zu lieb und teuer –, aber ich qualmte deutlich mehr als sonst. Und das ließ sich nicht allein auf die schummrige Atmosphäre der Bar schieben, sondern hatte auch mit meinem eher dünnen Nervenkostüm zu tun. Das hier war schließlich keine alltägliche Anfrage, kein gewöhnliches Anliegen.
»Und das ist auch wirklich Ihre eigene Wohnung?«, fragte ich Bruno und kniff skeptisch die Augen zusammen.
»Natürlich.«
»Denn mir kommt da gerade der Gedanke, Sie könnten mich dazu überreden wollen, Ihnen dabei zu helfen, in eine fremde Wohnung einzusteigen.«
»Schauen Sie her, ich beweise es Ihnen.«
Er kramte in seinem Rucksack herum, bis er schließlich ein verknittertes Blatt Papier hervorholte, das er auseinanderfaltete, es auf die Theke legte und es sorgfältig glatt strich.
Schnell überflog ich das Schriftstück. Meine Französischkenntnisse sind zwar bestenfalls rudimentär, aber ich sah sehr wohl, dass es ein maschinengeschriebener Brief von einer der nobleren Pariser Banken war, adressiert an einen gewissen M. Bruno Dunstan, Rue de Birague, Paris.
»Und das sind Sie?«
»Ja«, erklärte Bruno und zog zum Beweis eine Kreditkarte mit seinem Namen aus dem Portemonnaie.
Nachdenklich nippte ich an meinem Wein und trank dann das Glas in einem Zug leer. Dann winkte ich dem Barkeeper, das Glas noch mal zu füllen, und gab Bruno den Brief zurück.
»Diese Geschichte mit dem Protegé, wollten Sie mir damit bloß schmeicheln, oder war das ernst gemeint?«
»Todernst«, entgegnete er und guckte mich an, als meinte er es auch so.
»Warum bitten Sie mich dann nicht, Ihnen zu zeigen, wie man in eine Wohnung einbricht, die nicht Ihre eigene ist? Wir könnten beide nebenbei noch etwas dazuverdienen.«
Entschlossen schüttelte Bruno den Kopf und rieb sich gedankenverloren den Bizeps. Der Muskel quoll unter dem Ärmel seines Polohemds hervor.
Neben mir zog der Barkeeper den Korken aus dem nicht allzu teuren Rotwein, den ich bestellt hatte, und schüttete etwas davon aus der Flasche in mein Glas. Dann nickte er mir zu, und ich nickte zurück und wandte mich wieder Bruno zu.
»Sie trauen mir nicht?«
»Vielleicht«, gab er zurück. »Vielleicht sind Sie ja doch bloß ein Schriftsteller.«
Mir klappte, ziemlich bühnenreif, die Kinnlade herunter. »Soll ich Ihnen jetzt etwa meine Referenzen zeigen?«
Mit einer wegwerfenden Handbewegung wischte Bruno diesen abwegigen Gedanken fort. »Es geht um mich. Ich finde die Vorstellung sehr reizvoll, ein Dieb zu sein«, erklärte er, wobei er die letzten Worte ganz leise flüsterte, obwohl uns ohnehin niemand belauschen konnte, denn der Barmann war schon wieder abgezogen, und die Musik war einfach viel zu laut. »Aber möglicherweise stelle ich mich ja auch ganz furchtbar dumm an«, fuhr er fort, die »R« mit Wonne rollend. »Vielleicht zeigen Sie mir, wie es geht, und dann sehe ich, ob ich das auch kann.«
Ich fuhr mir mit beiden Händen über das Gesicht und hielt mir die Augen zu. Hinter den gespreizten Fingern hervor guckte ich ihn an. »Ein Einbruch in die eigene Wohnung dürfte wohl eine sehr beschränkte Aussagekraft haben. In diesem Job geht es nämlich mehr als um alles andere darum, nie die Nerven zu verlieren.«
Wieder stellte er seine Schulterzuckkünste eindrucksvoll unter Beweis. »Aber so kann ich wenigstens nicht verhaftet werden, oder? Ist ja schließlich meine eigene Bude.«
»Das stimmt wohl. Wie haben Sie sich das denn vorgestellt? Dass ich Ihnen erst mal einen kleinen Einführungskurs gebe? Zuerst brechen wir in Ihre Wohnung ein und dann in eine fremde?«
Er zog eine Schnute. »Das überlasse ich Ihnen.«
»Denn eins will ich Ihnen mal sagen, so einfach, wie Sie sich das denken, wird das nicht. Schlösser zu knacken erfordert eine Menge Übung. Und es gibt Tausend verschiedene Schlösser. Jeder Hersteller lässt sich was anderes Nettes einfallen. Ich meine, im Grunde genommen ist es immer das Gleiche, aber trotzdem.«
»Ich würde es trotzdem gerne versuchen.«
Missmutig griff ich zu meinem Weinglas und führte es an die Lippen, wobei ich versuchte, unauffällig über Brunos Schulter zu einem der Ecktische hinüberzulinsen, an dem Paige mit einigen ihrer Kollegen aus dem Buchladen saß. Auf dem Tisch stapelte sich schmutziges Geschirr neben leeren Weinflaschen. Einer der Männer am Tisch, der aussah wie ein Italiener, mit öligen, zurückgekämmten Haaren und einer hohen, eckigen Stirn, fasste Paige dauernd an. Lässig paffte er ein Zigarillo, legte Paige die Hand auf die Schulter und zog sie zu sich heran, und – so sehr es mich schmerzt, das zugeben zu müssen – es schien sie nicht im Geringsten zu stören. Ihre Wangen waren leicht gerötet vom Alkohol, und hin und wieder verdrehte sie die Augen und lachte laut über die anscheinend unfassbar witzigen Bemerkungen des Italieners.
Mike, der Kerl aus Manchester mit den Rastalocken, den ich im Buchladen kennengelernt hatte, saß den beiden genau gegenüber und goss gerade noch etwas Wein nach. Auch heute trug er den ausgefransten roten Pulli. Den hatte er auch schon angehabt, als ich Paige das erste Mal angesprochen hatte, und ich sah, wie er beim Einschenken mit den ausgeleierten Ärmeln den Rand der Weingläser streifte. Neben ihm saß ein Kerl mit einem knallbunten Scheitelkäppchen und einem spitzen Ziegenbart, der von einer farbenfrohen Glasperle geziert wurde. Außerdem saß an dem Tisch noch eine ernst wirkende junge Frau mit sehr feinen, rabenschwarzen Haaren, lila Lippenstift und ungefähr acht Ohrsteckern.
»Warum möchten Sie ein Dieb sein?«, fragte ich Bruno, den Blick noch immer unbeweglich auf den Tisch in der Ecke im Allgemeinen und das Gefummel der flinken Finger des Italieners an Paiges Ausschnitt im Besonderen geheftet.
»Vielleicht wegen der Herausforderung«, überlegte er und legte die ausgebreiteten Hände auf die Theke. »Es ist nicht leicht, wie Sie schon sagten. Vielleicht möchte ich ja gerade so etwas lernen. Ein Fenster einschlagen kann jeder, nicht? Einen anderen Weg hinein finden die wenigsten.«
»Sie betrachten das Ganze also mehr als intellektuelle Fingerübung?«
»Ja, ich glaube schon«, entgegnete er und setzte sich kerzengerade auf.
»Nun, mir persönlich geht es mehr ums Geld. Also, jetzt mal raus mit der Sprache, was sind Ihnen meine Dienste wert?«
Bruno schien etwas vor den Kopf geschlagen von meiner unverblümten Frage nach der Bezahlung, fasste sich aber schnell wieder, griff in die Gesäßtasche seiner Jeans und zog ein Bündel Geldscheine hervor. Entsetzt packte ich ihn beim Handgelenk und drückte seine Arme unter die Theke, wobei ich mich rasch vergewisserte, dass der Barkeeper nichts mitbekommen hatte.
»Wollen Sie, dass es so aussieht, als würde ich hier mit Drogen dealen? Lassen Sie das Geld in der Tasche. Wie viel?«
»Fünfhundert Euro.«
Verblüfft riss ich die Augen auf. »Und Sie glauben, das reicht?«
»Mehr habe ich nicht. Ich könnte noch ein bisschen was besorgen, aber …«
Stumm schaute ich ihn an, schüttelte dann den Kopf und zog an meiner Zigarette. Nachdenklich pustete ich den Rauch über seine Schulter. Just in diesem Augenblick platzte Paige mit einem lauten, ausgelassenen Lachen heraus. Ihr ganzer Körper bebte, und sie schmiegte sich neckisch an den Italiener.
So gut es ging, versuchte ich zu verdrängen, was sich da hinten zwischen den beiden anbahnte, und mich darauf zu konzentrieren, was Bruno mir angetragen hatte. Auf den Job war ich nicht scharf und auf die damit verbundenen Scherereien schon gar nicht, aber es ließ sich auch nicht leugnen, dass mein Interesse geweckt war. Im Laufe meines Lebens hatte ich genügend Trickbetrüger kennengelernt, um gleich zu durchschauen, auf welch plumpe Art Bruno mir zu schmeicheln versuchte, aber das tat dem Effekt keinen Abbruch. Schließlich hatte ich nicht jeden Tag die Gelegenheit, meine Fähigkeiten vor Publikum unter Beweis zu stellen. Normalerweise lege ich allergrößten Wert darauf, nach Möglichkeit überhaupt keine Zuschauer zu haben, wenn ich ein Schloss knacke. Aber bei Bruno könnte ich ein bisschen mit meiner Fingerfertigkeit prahlen und ganz nebenbei noch ein hübsches Sümmchen verdienen. Damit könnte ich dann sicher locker die hier anfallende Rechnung begleichen, und anschließend würde ich die ganze Geschichte als Dummejungenstreich, als harmlosen Spaß zu den Akten legen.
Spaß schien auch Paige zu haben. Sie kicherte schon wieder lauthals und sah den Italiener mit einem unverkennbaren Funkeln in den Augen an. Ich trank meinen Wein aus.
»Verschwinden wir«, raunzte ich Bruno an. »Mir reicht’s für heute Abend.«





























