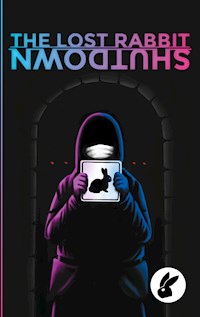
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Von heute auf Morgen wurde das System der alten Welt heruntergefahren und mit dem der neuen ausgetauscht. Dutzende Menschen verloren ihr Hab und Gut. Dutzende Familien wurden zerteilt. Wieso das alles? Ganz einfach: Niemand hat sich mehr für Irgendwas interessiert. Niemand hat sich mehr mit der Politik des Landes auseinandergesetzt. Niemand wollte mehr verantwortlich sein. Niemand außer einer. Die Sorglosigkeit aller hielt lange genug inne. Irgendwas scheint nicht zu stimmen, als plötzlich die Tiere in der Umgebung damit begangen zu leuchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine gesellschaftskritische Dystopie. Mehr Infos unter: www.thelostrabbit.klime.ink
Für die, die seit ihrem 18. Lebensjahr dieselbe Partei wählen und nicht einmal das Wahlprogramm kennen.
»Wenige Menschen denken, und doch wollen alle entscheiden.«
Friedrich der Große
Inhaltsverzeichnis
Part I
[ 2027 ]
Irgendwas ist anders
- Kapitel 1: Unnützer Fortschritt
- Kapitel 2: Sicherheit und Uneinigkeit
- Kapitel 3: Alltagsänderung
- Kapitel 4: Lebensraumraub
- Kapitel 5: Stille Ermittlungen
- Kapitel 6: Spielzeugideologien
- Kapitel 7: Warum Tauben das Fliegen verlernen
- Kapitel 8: Stille Zeit
- Kapitel 9: Knut ist nicht der Einzige
- Kapitel 10: Weiß
- Kapitel 11: Warum ich?
Part II
[ 2061 ]
Die Zeit steht still
- Kapitel 12: Neuanfang
- Kapitel 13: Zeit ist relativ
- Kapitel 14: Unerschöpfliche Energie
- Kapitel 15: Sie sind alles, was wir haben
- Kapitel 16: Ein Blick hinter die Kulissen
- Kapitel 17: Durch jede Tür kann man gehen
- Kapitel 18: Eine Nadel im Heuhaufen
- Kapitel 19: Gefühle lassen sich nicht kontrollieren
- Kapitel 20: Die Rohrreinigung
Part III
[ 2062 ]
Und jetzt?
- Kapitel 21: Kaltes Erwachen
- Kapitel 22: Zwei Nummern zu groß
- Kapitel 23: Utopia?
- Kapitel 24: Künstliches Leben
- Kapitel 25: Glück im Unglück
- Kapitel 26: Willkommen in Alt-Bechtal
- Kapitel 27: Automatisierung gegen Freiheit
- Kapitel 28: Dystopia
- Kapitel 29: Ein Leben in Kälte und Angst
- Kapitel 30: Der Leqè
- Kapitel 31: Zusammenbruch
UNNÜTZER FORTSCHRITT
Mama sagt immer, dass sich in den letzten zwanzig Jahren absolut nichts verändert hat. Ich bin da anderer Meinung.
Die Häuser sind zwar immer noch von den gleichen bunten Dächern bedeckt wie noch vor gut fünfzig Jahren, deren Einwohner aber sind lange nicht mehr dieselben. Sie sind …, nun ja, austauschbarer. Keiner stellt mehr Fragen. Jeder nimmt es einfach so hin. Alle wählen seit ihrem 18. Lebensjahr die gleiche Partei und keiner liest sich mehr das Wahlprogramm durch. Dabei machen die meisten Parteien mittlerweile etwas völlig anderes. Sie nutzen die Tatsache aus, dass sich kaum noch einer ernsthaft mit der politischen Lage beschäftigt. Unbemerkt ändern sie Dinge, die für die meisten Bürger zwar schädigend sind, aber trotzdem ohne Kommentar akzeptiert werden.
Die Menschen haben ihre Selbstständigkeit verloren. Niemand weiß, ob es daran liegt, dass die Technologie uns das Leben mit der Zeit immer leichter macht, oder schlicht daran, dass sich für eine ganze Weile wirklich kaum etwas geändert hat und die Bürger einfach gelangweilt sind. Allein an den neuen Technologien kann es jedenfalls nicht liegen, da das Zeug zwar immer besser wird, aber gleichzeitig auch immer teurer. Kaum ein normaler Mensch kann sich das noch leisten.
Unsere Waschmaschine stammt noch aus einer Zeit, in der Mikroprozessoren gute zehn Zentimeter groß waren. Sie funktioniert kaum noch und ist lauter als eine Flugzeugturbine. Meine Mutter kann sich bei dem Lärm kaum konzentrieren und hat deshalb schon des Öfteren überlegt, sich eine neue zu kaufen. An diese Hightech-Dinger, die mithilfe von Kameras ermitteln, was für Wäsche man eingeworfen hat, ist kaum zu denken. Wir können uns nicht einmal eine normale leisten, da meine Mutter mit ihrem Gehalt gerade so die Fixkosten decken kann. Der Besitzer der Bar, in der sie arbeitet, zahlt ihr nämlich nicht mal den Mindestlohn. Dem Staat ist das völlig egal. Die haben gerade etwas Wichtigeres zu tun, als sich um das Wohl ihrer Bürger zu sorgen, da sie an irgendeiner Art Großprojekt arbeiten. Jedenfalls berichtet die Zeitung schon seit einiger Zeit davon. Dafür haben sie zwar keine richtigen Beweise, aber immerhin viele unscharfe Bilder und aus der Luft gegriffene Aussagen. Aus diesem Grund hat meine Mutter auch keine andere Wahl, als es einfach so hinzunehmen.
Die Schulen in Sperrkan sind ebenfalls viel zu teuer. Es gibt hier nur noch Privatschulen, die mit smarten Tafeln, Tablets als Schreibblockersatz und perfekt konstruiertem Schulessen ausgestattet sind. Ich muss bis nach Kanberg fahren, um zur Schule zu gehen, da dort die einzige noch öffentliche steht. In dieser gibt es sogar noch Schulhefte aus Papier. Freizeitbeschäftigungen gibt es dafür mehr als genug. Einer meiner liebsten Orte zum Zeitvertreib ist der Showtruck vom alten Patrick. In diesem veranstaltet er immer die unterschiedlichsten Dinge.
Patrick kurbelt seine Scheibe nach unten, beugt sich aus seinem Auto und blickt zu mir runter.
»Na, Fiona, hast du nicht auch Lust mitzumachen?«, fragt er.
Ich starre ihm tief in die Augen.
»Ein Malwettbewerb?«, lasse ich mir durch den Kopf gehen. Meine monotone Bildersammlung könnte sicherlich noch das ein oder andere Bild gebrauchen. Also gehe ich schnell zu meiner Mutter und bitte um ihre Erlaubnis. Sie willigt ein und setzt sich gespannt zu uns.
Der Tisch ist voll mit Zeug. Dort liegen sowohl große als auch kleine Buntstifte, Lineale in den komischsten Formen und Farben und zum krönenden Abschluss die allerneusten Hightech-Anspitzer. Na ja, so hightechmäßig sind die nun auch wieder nicht. Es sind eigentlich nur ganz gewöhnliche. Der einzige Unterschied zwischen ihnen und regulären ist die Kurbel, die man zum Anspitzen drehen muss. Der scheint ein echtes Faible für solche Spielereien zu haben.
Es braucht keinen Augenblick und schon habe ich eine Idee. Also greife ich mir einen der Stifte und lege los.
Während ich die ersten Flächen mit blauer Farbe ausmale, setzt sich ein Mädchen vor mich hin. Erst starrt sie mich nur an, doch dann beginnt sie zu sprechen: »Hey, du«, sagt sie mit leiser und eher schüchtern klingender Stimme.
Ich blicke ihr in die Augen.
»Du hast da einen Farbklecks auf deinem Shirt«, fährt sie mühsam fort.
Erst erschrecke ich innerlich, dann wage ich einen Blick runter auf mein Shirt. Doch da ist kein Fleck. Ich sehe sie leicht irritiert an und frage: »Wo denn?«
Sie hebt in konstantem Tempo ihren Arm und zeigt mit dem Finger auf meine rechte Schulter. Und tatsächlich, mein Shirt ist an der Stelle komplett mit blauer Farbe beschmiert. Ich hatte meinen Kopf nur kurz an meinem Arm abgestützt und dabei völlig vergessen, dass ich noch den Pinsel in der Hand hatte.
»Ist aber nicht so schlimm. Das fällt gar nicht auf. Du bist ja eh komplett blau«.
Das Mädchen scheint recht gelangweilt zu sein. Jedenfalls lässt ihr Sprachstil das vermuten. Sie beugt sich zu mir und fragt mich, was ich da male.
»Das Meer«, antworte ich, ohne näher auf die Details einzugehen. Daraufhin fragt sie, warum ich die Schildkröte mit blauer und nicht, wie für Schildkröten üblich, mit grüner Farbe ausgemalt habe.
»So sieht es einfach besser aus.«
Sie schaut mich fragend an und sagt recht monoton und fast schon mechanisch klingend: »Ach so, okay …«, ihre Stimme senkt sich.
Kurz darauf steht sie wieder auf und geht. Sie war echt merkwürdig drauf.
»Die hatte wohl einen schlechten Tag«, sagt meine Mutter.
»Wohl er `ne schlechte Woche«, antworte ich.
Sie deutet auf meine Schulter und sagt: »Zeig mal her.«
Als sie das ganze Ausmaß des Flecks registriert, schaut sie geschockt, wie Mütter es eben manchmal tun.
»Oje, das müssen wir aber schleunigst waschen.«
Sie steht auf und will mit mir nach Hause. Da mein Bild lange noch nicht zu Ende gemalt ist, mache ich einen Aufstand. Doch sie besteht darauf, da sie den Fleck sonst nie wieder herausbekommen würde. Ausdiskutieren kann ich das auch nicht.
Da meine Mutter aufgrund ihres Jobs keine Lust auf überflüssigen Stress hat, nimmt sie meine Hand und zieht mich schnurstracks durch den halben Park. Jedenfalls hat es sich für einen Moment so angefühlt. Als wir dann zu Hause ankommen, zögert sie keine weitere Sekunde und reißt mir das Shirt ruckartig vom Leib.
»Aua, Mama, du ziehst mir an den Haaren«, krächze ich, während mir das Shirt für einen kurzen Augenblick die Sicht verdeckt und dann mit einem Zug über meine Stirn gleitet.
»Tschuldige, Fio.«
Sie knüllt das Shirt zusammen, schnappt sich noch ein paar andere Teile aus dem Wäschekorb und stopft alles in die Waschmaschine.
Meine Haare sind nun komplett zerzaust, weshalb ich kurzerhand beschließe, mich in meinen Palast zurückzuziehen, um mich wieder zurechtzumachen. Palast in Anführungsstrichen, denn wirklich geräumig ist mein Zimmer nicht. Es ist recht klein und eher nüchtern eingerichtet. Aber für mich reicht es.
Immerhin ist mein Spiegel ziemlich groß. So muss ich mich beim Kämmen meiner Haare nicht verrenken.
An den Wänden hängen zwei blaue Regale. Eines heller, das andere etwas dunkler. Auf ihnen habe ich all die Dinge aufgestellt, die mir zu schön für die olle Kiste sind, in der mein restliches Gerümpel liegt. Unter den Regalen hängen einige meiner gemalten Bilder. Sie sind zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber auch keine billigen Kopien berühmter Kunstwerke, die zuhauf die Zimmer anderer zieren.
Nach einer guten Stunde hört das Rattern der Waschmaschine endlich auf. Normalerweise braucht sie für einen Waschgang gute drei Stunden. Als ich dann aber zu ihr hingehe, um sie zu öffnen, wird mir klar, warum sie so schnell fertig ist. Meine Mutter hat sie auf die intensivste Stufe gestellt. Dadurch wäscht sie zwar wesentlich schneller und effektiver, aber auch deutlich heißer. Das hat dafür gesorgt, dass das Shirt jetzt nicht nur komplett blau ist, nein, es ist auch noch um eine gute Einheitsgröße geschrumpft. Mir selbst ist das völlig egal, meiner Mutter aber geht das ganz schön auf die Nerven. Ich werfe das Shirt nicht weg, sondern hänge es neben meine Bilder an die Wand. So etwas nennen gehobene Leute »Moderne Kunst«.
Später am Abend ist die Sonne schon fast untergegangen, als ich einen merkwürdigen Geruch wahrnehme. Ich drehe mich um und bemerke, dass aus dem Wohnzimmer grelle Funken sprühen. Ich stürme durch den Flur und bleibe im Türrahmen stehen. Meine Mutter ist gerade dabei, einen Baumstamm mit einer Schleifmaschine zu bearbeiten. »Du kannst das ja voll gut, Mama«, sage ich, woraufhin sie mir erzählt, dass sie so etwas zuletzt in ihrer Schulzeit gemacht hat.
»Macht das Spaß?«
Meine Mutter stellt die Maschine ab, wischt sich mit ihrer Hand den Schweiß von der Stirn und sagt: »Wäre ich etwas kräftiger, würde das sicherlich mehr Spaß machen.«
Sie lacht und fragt mich, ob ich Hunger habe. In diesem Moment knurrt wie herbeigerufen mein Magen, was wohl nur eines bedeuten kann. Ich habe einen riesigen Kohldampf. Meine Mutter legt die Sachen zum Schleifen weg und geht mit mir in die Küche.
»Worauf hast du denn Lust, Fio?«
Blitzschnell antworte ich mit: »Pizza!« Das ist nämlich mein Lieblingsgericht. Vor allem Pizza mit Spiegelei. Ich weiß, Spiegelei auf Pizza ist etwas ungewöhnlich, aber mir schmeckt das nun mal. Wir holen alle Zutaten und legen sie auf den Esstisch. Meine Mutter kramt unsere Schürzen hervor. Ihre ist braun mit hellgrünem Karomuster und meine ist himmelblau mit weißen Wolken. Die hatte ich zu meinem achten Geburtstag geschenkt bekommen.
Meine Mutter stellt den Ofen an, um ihn vorzuheizen. Während sie das tut, lege ich die Zutaten in die Schüssel. Danach schneidet meine Mutter die Rinde des Bries weg und schnippelt diesen und etwas Mozzarella in dünne Scheiben … Ich rolle den Pizzateig aus, lege die zugeschnittenen Käsescheiben auf den Teig und meine Mutter schiebt sie in den Ofen. In der Zeit, in der die Pizza im Ofen backt, bereitet meine Mutter den Spargel vor und ich mixe das Dressing zusammen. Zum krönenden Abschluss holen wir die Pizza kurz aus dem Ofen, schlagen gemeinsam die Eier auf und lassen sie auf die Pizza gleiten, die wir danach wieder hineinschieben.
Wenn die Eier so herumblubbern, sehen sie aus wie die Wangen eines Frosches beim Quaken. Meine Mutter bemerkt das ebenfalls und hüpft quakend hinter mir her. Ich drehe mich. Sie kommt mit ausgestreckten Armen auf mich zu und beginnt mich durchzukitzeln, worauf ich in Lachen ausbreche.
Die Pizza braucht noch eine Weile, also gehen wir ins Wohnzimmer, um etwas fernzusehen. Wenn wir eine Küchenmaschine und einen besseren Ofen hätten, würde das sicherlich schneller gehen, aber Geld wächst nun mal nicht auf Bäumen. Deshalb habe ich keine andere Wahl, als mir zum Zeitvertreib zusammen mit meiner Mutter das langweilige Programm im TV anzusehen. Im Flimmerkasten läuft die Sendung ''Günter am Yachthafen''. Dabei vergessen wir völlig die Zeit. Erst als plötzlich der Feuermelder anfängt zu piepen und der Rauch aus der Küche bis ins Wohnzimmer dringt, kommt uns die Pizza wieder in den Kopf. Meine Mutter schaltet den Ofen sofort aus und versucht, das Feuer mit einem Eimer Wasser und der Tischdecke zu löschen, was ihr tatsächlich gelingt. Währenddessen schalte ich den Feuermelder mit unserem Besen aus und falle dabei fast vom Stuhl. Wir haben echt Glück gehabt.
»Der Ofen ist jetzt hin«, sagt meine Mutter. Sie sitzt niedergeschlagen auf einem unserer beiden äußerst wackligen Sperrholzstühle
»Wir können ja Milchshakes machen«, schlage ich vor, während ich meine Finger wie eine Nervenkranke wiederholt aufeinandertippe.
»Gute Idee! Nach dem kleinen Feuerchen können wir jetzt eine Abkühlung gebrauchen.«
Wir lachen.
»Haben wir noch Erdbeeren?«, frage ich.
Meine Mutter schaut in den Kühlschrank: »Nope, keine mehr da.« Ich stichle sie ein wenig mit Fragen, da ich jetzt richtig dolle Lust auf Erdbeershakes bekommen habe. Sie schaut in jede Ecke der Küche und tatsächlich findet sie noch ein Fläschchen Erdbeeraroma. Wir mixen kalte Milch, etwas Vanilleeis und das Erdbeeraroma in einem großen Glas und stecken zwei bunt gestreifte Strohhalme aus Metall hinein. Als wir den Shake fast aufgeschlürft haben, wird mir etwas schwummrig.
»So schmecken also Sägespäne«, geht mir dabei durch den Kopf.
Meine Mutter erzählte mir nämlich mal, dass Erdbeeraroma aus Sägespänen gemacht wird – und das ist mir natürlich in genau diesem Moment wieder eingefallen. An sich schmeckt es ja richtig gut, aber der Gedanke ist trotzdem etwas eklig. Wir essen schließlich auch keine Bäume …
Es kam sogar so weit, dass ich meine Mutter gefragt habe, weshalb es keine Lutscher mit Holzgeschmack gibt, wenn das Zeug ja so gut schmeckt. Daraufhin hat sie nur gelacht und total verdutzt geguckt …
Scheinbar war das mit den Sägespänen nur eine ihrer Quatschgeschichten gewesen. Aber egal wie skurril ihre Geschichten, die sie mir erzählt, manchmal sind, an meine kommt sie niemals ran. Eine ihrer Lieblingsquatschgeschichten von mir ist die über die Färbung des Himmels, die jegliche wissenschaftlichen Thesen auf den Kopf stellt. Der Himmel hat tagsüber immer einen so schönen Blauton, und da der Himmel meiner Meinung nach für die unendliche Ewigkeit steht, liebe ich diese Farbe auch über alles. Mein Nachname ist Kalter. Kalter ist Albanisch und heißt blau. Das bedeutet im Klartext, dass auch ich – wie die Farbe Blau – für die unendliche Ewigkeit stehe. Jedenfalls rede ich mir das immer ein. Abends verwandelt sich der Himmel stets in einen mystischen Schleier. Der Sonnenuntergang färbt ihn in den unterschiedlichsten Farben. Und wenn in der Nacht die Sterne herauskommen, bekommt er einen noch sehr viel magischeres Flair. Früher bin ich dann immer zu meiner Mutter gerannt, und habe ihr erzählt, in welche Farbe der Himmel an dem jeweiligen Abend eingefärbt wurde. Diese Vorstellung, dass das jemand jeden Abend macht, kommt mir bis zum heutigen Tage immer mal wieder hoch. Aber genug über Farben und Quatschgeschichten. Morgen ist schon wieder Montag und ich muss ganz früh aufstehen, um pünktlich zur Schule zur kommen. Um sieben ist Schlafenszeit. Das ist eine festgelegte Regel. Sie steht zwar nirgendwo geschrieben, aber das macht sie nicht weniger gültig. Aufgestellt habe ich sie selbst, da ich, wenn ich mal nicht ganz ausgeschlafen bin, einfach nicht anders kann, als ununterbrochen zu gähnen. Man könnte meinen, dass ich Gähnfieber bekomme, ausgelöst von den Sandüberresten des Sandmännchens, die noch auf mich wirken, weil ich zu spät ins Bett gegangen bin. Und dann kommt noch der Fakt hinzu, dass ich ein ganz schöner Morgenmuffel bin. Ich freue mich zwar jeden Tag wie kein anderer auf die Schule, aber der Weg dorthin ist so unglaublich langweilig. Am liebsten würde ich mich einfach dorthin teleportieren und die dadurch gewonnene Zeit zum Frühstücken nutzen. Doch einen Teleporter können sich wahrscheinlich nicht einmal diejenigen leisten, die ihn erfunden haben …
SICHERHEIT UND UNEINIGKEIT
Um von Sperrkan nach Kanberg zu kommen, muss ich mit der Bahn fahren und dafür muss ich erst einmal zum Bahnhof laufen. Dieser befindet sich am Ende einer ewig langen Einkaufsmeile, die voll mit den unterschiedlichsten Geschäften ist, von denen ich mich schon des Öfteren habe ablenken lassen, was nicht nur einmal dazu führte, dass ich den Zug verpasst habe.
Einer meiner Lieblingsläden ist der 2100er Expro. Dort bummele ich an langweiligen Nachmittagen ab und zu herum. Im Expro gibt es viele außergewöhnliche Sachen. Hauptsächlich Technikzeug, aber ab und an auch recht coole Spielsachen aus dem Osten. Meine Mutter sagt mir andauernd, dass ich dort nichts kaufen soll, weil die Sachen angeblich aus giftigen Stoffen gemacht sind. Ich glaube ihr das nicht so wirklich.
Auf dem Weg zum Bahnhof trample ich beinahe in heißen Teer, da ich – völlig in Gedanken versunken – geradewegs auf eine frisch gemachte Stelle am Boden zulaufe. Hätte ich in diesem Moment nicht gerade auf die ulkigen Muster des Bodens geschaut, wäre ich sicher dort reingetreten und hätte mir im schlimmsten Fall meinen Fuß verbrannt. Man kann also von Glück reden, dass sich die Architekten dazu entschieden haben, in der gesamten Einkaufmeile diese blumenähnlichen Muster zu verlegen.
Als ich am Bahnhof ankomme, bemerke ich, dass sich vor dem Eingang eine riesige Menschenhorde gebildet hat. Ich frage einen der Beteiligten, was sie hier genau machen. »Wir stellen uns gegen diese dämlichen Karten hier auf.« Er hält mir ein Blatt vors Gesicht, auf das jemand etwas »gezeichnet« hat.
Ich quetsche mich durch die Masse und versuche mit einer Person zu reden, die etwas mehr involviert ist.
»Hallo, was machen Sie da?«, frage ich einen älteren Herrn. Er ist etwas rundlich und trägt einen Jogginganzug.
»Ja kundtun, dat sieht man doch oder biste blind?«, sagt er in einem seltsamen Dialekt.
Der kommt wohl aus der westlichen Region.
Als ich ihn frage, warum er protestiert, erklärt er mir, dass die hier niemanden mehr ohne eine Xek-Karte nach Kanberg lassen und das gefällt scheinbar niemandem. Ich selbst hatte eine dauerhaft gültige Xek-Karte von der Schule bekommen. Die wurden angeblich aus Sicherheitsgründen eingeführt, damit die Stadt frei von Kriminalität bleibt. Ich kann verstehen, weshalb so viele gegen diese Karten sind. Die meisten sind dort nämlich nur zum Shoppen und diese Karten sind nicht gerade billig. Als Schülerin habe ich sie immerhin kostenlos bekommen, aber alle anderen müssen sie selbst bezahlen und viele sehen das eben nicht ein. Zudem haben sie noch nicht einmal wirklich geholfen. Ganz im Gegenteil, die Kriminalität soll sogar gestiegen sein, weil es sich dort jetzt viel mehr lohnen soll, da die Ärmeren durch dieses System aus der Stadt vertrieben wurden.
An sich sind die Leute ja selbst schuld daran, wenn sie bei den Wahlen ihr Kreuzchen aus Bequemlichkeit einfach in die erste Spalte setzen. Wirklich viel Zeit, um mich mit politischen Themen auseinanderzusetzen, habe ich aber auch nicht. Ich muss jetzt nämlich zur Schule. Also renne ich zum Bahnsteig und kann gerade noch so, bevor sich die Türen schließen, in die Bahn hüpfen. Doch was mich dort drinnen erwartet, überrascht mich total. Die Bahn ist wie leergeräumt. Das muss an diesen Xek-Karten liegen. Im gesamten Zug sind nur fünf Personen. Eigentlich ist das sogar ein wenig cool, einen ganzen Waggon für sich allein zu haben, aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen gruselig. Es ist richtig still. Das Einzige, was ich hören kann, ist das Blättern der Zeitung, die eine Frau, die einen blauweiß gestreiften Rollkragenpullover trägt, gerade liest. In dem Moment fällt mir auf, dass ich gar nichts zum Zeitvertreib eingepackt habe. Wie soll ich das bloß aushalten? Zwei Stunden ohne auch nur irgendeine Art von Beschäftigung in diesem komplett leer gefegten Waggon?
Plötzlich höre ich jemanden von links: »Möchtest du da noch ewig rumstehen und an die Wand starren?«
Erst jetzt bemerke ich, dass ich schon seit zehn Minuten hier bewegungslos stehe und wie eine Verrückte ausgesehen haben muss. Ich drehe mich nach links und sehe eine ältere Dame. Sie schaut mich etwas misstrauisch an und wartet wohl auf eine Antwort.
»Verzeihung, ich war gerade mit den Gedanken woanders.« »Sicher ...«, sagt sie, woraufhin sie sich mürrisch wegdreht.
Ich will nicht jeden glauben lassen, dass ich gerade aus einer Anstalt ausgebrochen bin, also suche ich mir kurzerhand einen Platz, um mich hinzusetzen. Die Sitzbezüge sind knallgelb und sehr kratzig. Wenn sie mal ausrangiert werden, könnte man sie sicher als Kratzbaum verwenden.
Ich lege meinen Rucksack unter den Sitz und ziehe meine blaue Wollmütze ab.
»Was macht man in einem Waggon, in dem sich keine Kinder befinden und man keine Beschäftigung hat?«, frage ich mich.
Man schaut aus dem Fenster und guckt sich die Gegend an. Doch die Aussicht ist nicht gerade überwältigend oder anders ausgedrückt, so gut wie gar nicht vorhanden, da direkt neben den Schienen eine gigantische Betonmauer gebaut wurde, die mir die Sicht versperrt.
»Na toll«, denke ich, während ich mit den Augen rolle und den Kopf nach links hängen lasse.
Da mir nun richtig langweilig ist, hole ich den Rucksack wieder hervor und ziehe mein Deutschheft heraus. Ich blättere ein wenig herum und entschließe mich dazu, einfach ein paar Aufgaben zu bearbeiten. Wenn ich die Zeit schon für nichts Spaßiges nutzen kann, kann ich wenigstens produktiv sein.
Nach einer Weile kommt der Kontrolleur in den Waggon, in dem ich sitze. Zu diesem Zeitpunkt habe ich schon das halbe Deutschheft ausgefüllt. Wenn ich so weitermache, muss ich mich in der Schule genauso langweilen wie hier. Als er zu mir kommt, lege ich das Heft auf den kleinen Klapptisch und krame mein Kartenetui aus der Jackentasche. In dem bewahre ich all meine Karten auf. Ich ziehe meine Bahnkarte und die Xek-Karte heraus und zeige sie ihm. Er nickt und geht weiter zu der älteren Frau, mit der ich vor einer Weile »gesprochen« habe. Sie scheint überrascht, als er die Xek-Karte erwähnt. Die Frau sagt ihm, dass sie noch nie etwas davon gehört hat. Er macht ihr klar, dass sie ohne diese Karte nicht weiterfahren kann und bei der nächsten Station aussteigen muss. Das passt ihr gar nicht und sie schreit ihn an. Der Kontrolleur dreht seinen Kopf zu mir und guckt mich völlig verzweifelt an, woraufhin ich nur mit den Schultern zucke und versuche, mir das Lachen zu verkneifen, da sein Blick so unglaublich ulkig aussieht. Doch es hilft nichts, ich breche in Lachen aus. Die Frau scheint zu denken, dass ich sie auslache, weshalb sie mich jetzt ebenfalls anschreit. Ich versuche, es ihr zu erklären, doch sie ist mittlerweile wohl so voreingenommen von mir, dass sie mich nicht mehr zu Wort kommen lässt. Als wir an der nächsten Station ankommen, steigt sie freiwillig aus dem Zug und sagt, wie unerhört doch die Kinder von heute sind und dass sie keine Manieren haben. Der Kontrolleur meint, dass ich das, was sie gesagt hat, nicht so ernst nehmen soll und geht weiter.
Jetzt, wo der ganze Trubel vorbei ist, wage ich einen Blick auf den Monitor, auf dem die einzelnen Stationen mit den jeweiligen Ankunftszeiten angezeigt werden. Wir befinden uns kurz vor dem Hauptbahnhof von Kanberg. Ich setze die Wollmütze wieder auf, greife meinen Rucksack und gehe zur Tür.
Meine Mutter hat mir gesagt, dass man sich festhalten muss, wenn die Bahn anhält, damit man nicht hinfällt. Einmal hatte ich das total vergessen und bin durch den halben Waggon geflogen. Das tat ganz schön weh. Seitdem halte ich mich manchmal sogar so fest, dass ich die Stange locker abbrechen würde, wenn ich nur noch ein wenig fester zugreifen würde. Das ist mal einem Mann in der U-Bahn passiert …
Eine elektronische Stimme sagt über die Lautsprecher die Station Kanberger Hauptbahnhof an. Kurze Zeit später hält der Zug. Die Türen öffnen sich und ich springe hinaus.
Der Bahnhof ist mit unzähligen Menschen gefüllt. Als die Menschenmenge versucht, in den Zug einzusteigen, aus dem ich gerade gehüpft bin, werde ich ganz schön herumgeschubst. Sie scheinen allesamt um einen Platz im Zug zu kämpfen. Innerhalb weniger Minuten ist der Zug bis zum Rand voll mit Menschen. Das ganze Gewusel am Bahnhof bringt mich komplett aus dem Konzept. Ich werfe einen Blick auf die große Bahnhofsuhr. Es ist sieben Uhr vierunddreißig. Das heißt, dass in elf Minuten die Schule beginnt. Glücklicherweise ist die Kanberger Gesamtschule direkt neben dem Bahnhof. Der Weg dauert keine drei Minuten.
Auf dem Weg zum Schulgebäude spricht mich ein Typ mit einer weißen Schürze an, der Brötchen verschenkt. Er stammt von einer Bäckerei, die neu ist und verteilt diese zur Eröffnung als Kostprobe.
»Na, Kleene, möchtest `ne Stulle ham?«, fragt er mich und hält mir sein Tablett hin.
»Gerne, Sir!«, antworte ich ihm, während ich mir ein Brötchen herunternehme.
»Schönen Tag noch«, sagt er und geht geradewegs zur nächsten Person weiter.
Das Brötchen ist mit Käse und Salat belegt. Als ich den ersten Bissen nehme, verziehe ich das Gesicht. Das Brötchen ist eiskalt. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er die gar nicht frisch gebacken hat. Er hat sie bestimmt aus dem Kühlregal einer Tankstelle genommen und vergessen, dass sie noch gefroren sind.
»Brrr.«
Ich esse das Brötchen zwar noch auf, aber wirklich schmecken tut es mir nicht.
Vor dem Eingang meiner Schule sitzt eine Gruppe von Jugendlichen, die sich gegenseitig kleine Tüten zustecken. Als sie bemerken, dass ich sie beobachte, steht einer von ihnen auf und sagt, dass ich nicht so gucken soll. Da ich eh zum Unterricht muss, gehe ich schnell weiter.
Kaum bin ich in der Klasse angekommen, beginnt auch schon wieder diese eine Sache, die mich jeden Tag aufs Neue in den Wahnsinn treibt. Das Kugelschreibergeklicke. Fast jeder aus meiner Klasse benutzt Kugelschreiber und gerade die machen beim Ausfahren ein extrem nerviges Geräusch. Das wäre ja an sich nicht so schlimm, wenn meine Mitschüler damit schreiben würden, aber sie benutzen die viel lieber zum Stressabbauen, was dazu führt, dass sie damit ununterbrochen herumklicken. Es gibt nur ein Fach, in dem man keine Kugelschreiber hört und das ist der Naturwissenschaftsunterricht. Sobald unsere Lehrerin hereinkommt, hört das Klicken auf, da sie das absolut nicht ausstehen kann. Um dem vorzubeugen, hatte sie mal an einem Tag alle Kugelschreiber eingesammelt und stattdessen welche ohne diesen Klickmechanismus ausgeteilt. Die waren aus scharfkantigem Plastik und gingen so leicht kaputt, dass sie glatt hätten vom Expro stammen können …
ALLTAGSÄNDERUNG
Erst als der Deutschunterricht angefangen hat, fällt mir auf, dass ich mein Deutschheft nicht wieder eingepackt habe und dass es wahrscheinlich noch im Zug liegt. Die Frau aus dem Waggon hat mich echt alles vergessen lassen. »Hoffentlich gibt das keinen Eintrag ins Klassenbuch«, denke ich. Doch zum Glück hat sich unsere Lehrerin für den heutigen Tag vom normalen Unterrichtsverlauf abgewendet und sich dafür entschieden, mit uns einen Film anzuschauen. Sie geht an ihren Computer und legt die CD ein. Auf dem Bildschirm erscheint ein DVD-Menü. Die hatte ich schon ewig nicht mehr gesehen.
Sie dreht sich zur Klasse und sagt: »Der Film ist zwar schon etwas älter, aber immer noch sehenswert.«
Das DVD-Menü ist recht monoton gestaltet. Im Hintergrund läuft traurige Musik und die gesamte Oberfläche ist farblos. Die erste Reaktion der Jungs war wie zu erwarten … Nun ja, eben nicht so angebracht.
In der Sekunde, in der Frau Knut auf Play klickt, geht plötzlich das Licht aus. Ich blicke hoch zur Lampe, dann auf den Monitor. Der Strom ist ausgefallen. Erst denke ich mir nicht viel dabei, aber dann beginnen die anderen Schülerinnen und Schüler wie wild geworden darüber zu reden. Im Klassenraum wird es unerträglich laut. Frau Knut scheint sich auch nicht erklären zu können, was gerade passiert ist, da sie erst ans Fenster und dann durch die Tür aus dem Klassenraum geht. Nach einer kurzen Weile kommt sie wieder zurück. Sie geht an ihren Tisch und bittet um Ruhe.
Ein schrilles Geräusch ertönt aus den Lautsprechern. Gleichzeitig gehen die Lichter wieder an. Aus den Lautsprechern spricht eine hohe, etwas nervöse Stimme: »Äh …, a… aufgrund von g… gesetzlichen Änderungen s… sind wir dazu verpflichtet worden, k… keinen ö… örtlichen Strom mehr zu verwenden. Alle Lampen, Smartboards und sonstige t… technischen Geräte können daher nicht mehr genutzt werden. Wir b… bitten um Ihr Verständnis.«
Für einen kurzen Moment tritt wieder Ruhe ein, doch dann beginnt das Geschnatter wieder von neuem. Es ist unerträglicher als das Kugelschreibergeklicke. Wie kann eine Gruppe Menschen nur so unzivilisiert sein?













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















