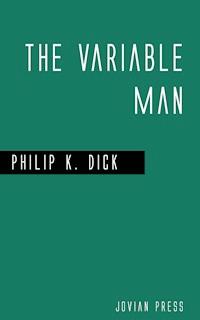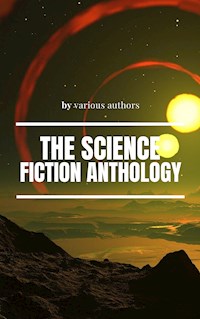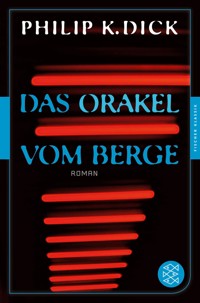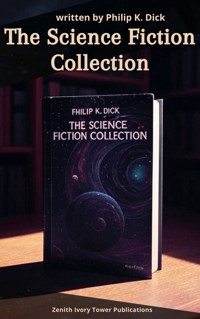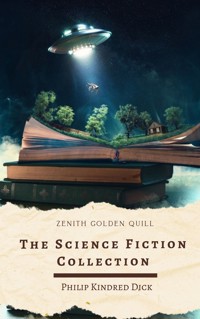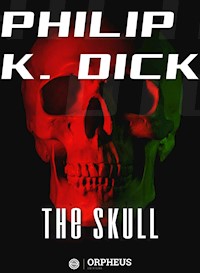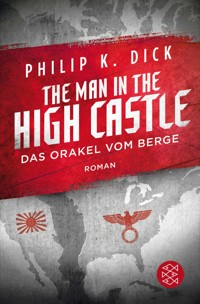
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Was, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte? Diese Frage machte Philip K. Dick zum Ausgangspunkt seines waghalsigsten und berühmtesten Romans. Amerika 1962: Das Land ist geteilt - die Westküste japanisch, der Osten deutsch. Nur in den Rockies gibt es eine neutrale Zone. Dort sucht die junge Judolehrerin Juliana einen mysteriösen Autor, der den Widerstand entfachen könnte. Nur er scheint zu wissen, wie man dem Albtraum der falschen Geschichte entkommt. Das Original zur US-Erfolgsserie »The Man in the High Castle«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Philip K. Dick
The Man in the High Castle /Das Orakel vom Berge
Roman
Über dieses Buch
Was wäre, wenn Deutschland und Japan den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten? Und die USA untereinander aufgeteilt hätten? Die Grenze durch die Rocky Mountains verliefe, wo es ein »Orakel vom Berge« gäbe?
Die junge Judolehrerin Juliana begibt sich auf den gefährlichen Weg in die Rocky Mountains, um den mysteriösen Mann hinter dem »Orakel vom Berge« aufzuspüren. Dieser wird zum Hoffnungsträger für die Amerikaner, die sich den neuen Machthabern unterordnen müssen.
›The Man in the High Castle‹ (1962 erschienen; auf Deutsch ›Das Orakel vom Berge‹) ist gegen den Strich erzählte Historie und ein legendärer Klassiker der amerikanischen Literatur.
»Das ist typisch Dick: […] Seine Menschen sind vielschichtig und einfach zugleich. Sie sind keine Helden und können gerade deshalb welche werden.«
Jan Küveler, Die Welt
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Philip K. Dick hat Science-Fiction nicht erfunden, aber aus ihr eine Kunst gemacht. Mit prophetischem Blick und genialischer Phantasie sah er Szenarien voraus, in denen unsere Gegenwart zum Albtraum wird: ›Blade Runner‹, ›Minority Report‹, ›Total Recall‹, ›Impostor‹, ›Paycheck‹, ›Der dunkle Schirm‹ – all diese Filme basieren auf seinen Büchern. 1928 in Chicago geboren, rettete er sich aus seiner psychotischen Jugend nach Berkeley. Er nahm so ziemlich alle Aufputschmittel und Drogen, die es gab, hatte Visionen und göttliche Erscheinungen, schrieb bis zu 60 Seiten am Tag und fühlte sich von FBI und KGB verfolgt. 1982 starb er wenige Wochen vor der Filmpremiere von ›Blade Runner‹.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 1962
unter dem Titel ›THE MAN IN THE HIGH CASTLE‹ bei G. P. Putnam's Sons
Copyright © 1962, Philip K. Dick
Copyright renewed © 1990, Laura Coelho, Christopher Dick and Isa Dick
All rights reserved
Die Rechte an der deutschen Übersetzung von Norbert Stöbe
liegen beim Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH.
Für diese Ausgabe:
© 2014 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestalung und Coverabbildung: www.buerosued.de
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490411-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Für meine Frau Tessa und meinen Sohn Christopher, in tiefer Liebe
Eins
Seit einer Woche wartete Mr. Robert Childan nun schon mit Spannung auf die Post. Aber die wertvolle Sendung aus den Rocky-Mountain-Staaten war wieder nicht eingetroffen. Als er am Freitagmorgen seinen Laden aufschloss und auf dem Boden unter dem Postschlitz nur Briefe vorfand, dachte er: Da werde ich wohl Ärger mit meinem Kunden bekommen.
Er zapfte sich eine Tasse Instant-Tee aus dem Fünf-Cent-Automaten an der Wand, nahm einen Besen und begann sauberzumachen; bald darauf war das American Artistic Handcrafts Inc. blitzsauber und bereit für den Tag. Die Registrierkasse war voll Wechselgeld, in der Vase waren frische Ringelblumen, aus dem Radio tönte Hintergrundmusik. Draußen hasteten die Geschäftsleute zu ihren Büros in der Montgomery Street. In der Ferne fuhr eine Straßenbahn vorbei; Childan hielt mit der Arbeit inne und sah ihr mit Behagen nach. Frauen in langen, farbenfrohen Seidenkleidern … auch denen sah er nach. Dann läutete das Telefon. Er nahm ab.
»Ja«, sagte eine wohlbekannte Stimme, als er sich gemeldet hatte. »Hier ist Mr. Tagomi. Ist das Rekrutierungsplakat aus dem Bürgerkrieg eingetroffen, Sir? Bitte erinnern Sie sich, Sie haben es mir schon für letzte Woche versprochen.« Die pedantische, scharfe Stimme, kaum noch höflich, kaum noch auf Manieren achtend. »Habe ich Ihnen nicht eine Anzahlung gemacht, Mr. Childan? Es soll ein Geschenk sein, wissen Sie. Das habe ich Ihnen doch bereits erklärt. Für einen Geschäftspartner.«
»Umfangreiche Nachforschungen«, setzte Childan an, »für die ich selbst aufkommen musste, Mr. Tagomi, Sir. Wie Sie wissen, kommt das erwartete Paket von außerhalb, und daher …«
Tagomi ließ ihn jedoch nicht ausreden. »Dann ist es also noch nicht eingetroffen.«
»Nein, Mr. Tagomi, Sir.«
Eisiges Schweigen.
»Ich kann nicht länger warten«, sagte Tagomi dann.
»Nein, Sir.« Childan blickte verdrießlich durch das Ladenfenster in den warmen Sonnentag und zu den Bürogebäuden von San Francisco hinaus.
»Dann etwas anderes. Ihre Empfehlung, Mr. Childan?« Tagomi sprach den Namen absichtlich falsch aus; eine wohldosierte Beleidigung, die Childan das Blut zu Kopf steigen ließ. Eine demütigende Zurechtweisung. Robert Childans Hoffnungen, Ängste und Qualen überwältigten ihn, lähmten ihm die Zunge. Er stammelte, seine Hand, die den Telefonhörer hielt, fühlte sich klebrig an. Im Laden roch es nach Ringelblumen; die Musik spielte weiter, doch ihm war, als stürze er in irgendein fernes Meer.
»Also …«, brachte er mühsam hervor. »Ein Butterfass. Ein Speiseeisbereiter, circa 1900.« Er konnte nicht mehr nachdenken. Gerade dann, wenn man es vergisst; wenn man sich etwas vormacht. Er war achtunddreißig Jahre alt und erinnerte sich noch gut an die Zeit vor dem Krieg, als alles anders war. An Franklin D. Roosevelt und die Weltausstellung; an die bessere Welt, die nun Vergangenheit war. »Könnte ich Ihnen vielleicht ein paar interessante Gegenstände ins Büro bringen?«, murmelte er.
Sie verabredeten sich für zwei Uhr. Ich muss den Laden schließen, dachte Childan, als er auflegte. Keine andere Wahl. Solche Kunden muss ich mir gewogen halten; das Geschäft hängt davon ab.
Er zitterte, und auf einmal merkte er, dass jemand den Laden betreten hatte – ein Pärchen. Ein junger Mann und ein Mädchen, beide gutaussehend, gutgekleidet. Perfekt. Er beruhigte sich und trat ihnen mit einem geschäftsmäßigen Lächeln entgegen. Sie beugten sich gerade über eine Auslage, hatten einen hübschen Aschenbecher hochgehoben. Vermutlich verheiratet. Wohnten wohl außerhalb in der Nebelstadt, in den neuen, exklusiven Hochhausapartments oberhalb von Belmont.
»Hallo«, sagte er und fühlte sich gleich besser. Ihr Lächeln war ohne Herablassung, pure Freundlichkeit. Seine Exponate – tatsächlich die besten ihrer Art an der ganzen Küste – hatten sie wohl beeindruckt; das sah er und war dankbar dafür. Sie zeigten Verständnis.
»Wirklich ausgezeichnete Stücke, Sir«, sagte der junge Mann.
Childan verneigte sich spontan.
Ihre Augen leuchteten warm. Verliebtheit zeigte sich darin, aber auch das Vergnügen, das sie bei der Betrachtung der Kunstgegenstände miteinander teilten; sie dankten ihm dafür, dass er all dies für sie bereithielt, Dinge, die sie in die Hand nehmen und betrachten konnten, auch ohne sie kaufen zu müssen. Ja, dachte er, sie wissen, in was für einem Laden sie sind; das sind keine Ramschwaren für Touristen, keine billigen Rotholzspangen mit der Aufschrift Muir Woods, Marin County,PSA, keine komischen Anstecker, Plastikringe, Postkarten oder Ansichten von der Brücke. Besonders die Augen des Mädchens, groß und dunkel. Wie leicht, dachte Childan, könnte ich mich in ein solches Mädchen verlieben. Wie tragisch mein Leben dann wäre – als wäre es nicht schon schlimm genug. Das modisch frisierte schwarze Haar, die lackierten Fingernägel, die für die herabbaumelnden handgefertigten Messingohrringe durchbohrten Ohren.
»Ihre Ohrringe«, murmelte er. »Hier gekauft?«
»Nein«, sagte sie. »Zu Hause.«
Childan nickte. Keine zeitgenössische amerikanische Kunst; in einem Laden wie seinem hatte nur die Vergangenheit Platz. »Bleiben Sie länger hier?«, fragte er. »In San Francisco?«
»Ich wurde auf unbestimmte Zeit hierher versetzt«, erwiderte der Mann. »Zur Kommission zur Verbesserung des Lebensstandards benachteiligter Regionen.« Stolz spiegelte sich in seinem Gesicht wider. Kein Militär. Keiner dieser Kaugummi kauenden ungehobelten Rekruten mit den gierigen Bauerngesichtern, die über die Market Street schlenderten und die Pornoläden begafften, die Sexfilme, die Schießbuden, die billigen Nachtclubs mit den Fotos grinsender, gealterter Blondinen, die mit schrumpligen Fingern ihre Brustwarzen rubbelten … die Jazzschuppen, die sich in der flachen Gegend San Franciscos drängten, aus Wellblech und Dachpappe errichtete Kaschemmen, die aus den Ruinen entstanden waren, noch ehe die letzte Bombe gefallen war. Nein – dieser Mann gehörte zur Elite. Kultiviert, gebildet, vielleicht sogar in höherem Maße als Mr. Tagomi, der immerhin ein hoher Beamter bei der Handelsmission für die Pazifikküste war. Tagomi war ein alter Mann. Seine ganze Haltung war zu Zeiten des Kriegskabinetts geprägt worden.
»Suchen Sie traditionelle amerikanische Volkskunst als Geschenk?«, fragte Childan. »Oder wollen Sie eine Wohnung für die Dauer Ihres Aufenthalts ausstatten?« Sollte er mit der zweiten Vermutung recht haben … Sein Herz schlug unwillkürlich schneller.
»Gut geraten«, sagte das Mädchen. »Wir fangen gerade an, uns einzurichten. Sind noch ein bisschen unentschlossen. Könnten Sie uns vielleicht beraten?«
»Ja, ich könnte in Ihre Wohnung kommen. Ich bringe ein paar Musterkoffer mit, dann können Sie in aller Ruhe aussuchen. Das ist nämlich unsere Spezialität.« Childan senkte die Augen, um seine Hoffnung zu verbergen. Hier waren womöglich Tausende zu holen. »Ich bekomme demnächst einen Tisch aus Neuengland, Ahorn, alles mit Holzteilen gefertigt, keine Nägel. Wunderschön und wertvoll. Und einen Spiegel aus der Zeit des Krieges von 1812. Und Eingeborenenkunst: einen Satz Ziegenhaarteppiche, gefärbt mit Pflanzenfarben.«
»Ich persönlich«, sagte der Mann, »ziehe die städtische Kunst vor.«
»Ja«, erwiderte Childan eifrig. »Hören Sie, Sir. Ich habe da ein Wandgemälde aus der Zeit von Roosevelts Arbeitsbeschaffungsprogramm für Künstler, auf dem Horace Greeley abgebildet ist. Ein Original, ausgeführt auf Holz, in vier Teilen. Für Sammler von unschätzbarem Wert.«
»Oh«, machte der Mann, und seine Augen funkelten.
»Und einen Grammophonschrank von 1920, umgebaut zu einer Hausbar.«
»Oh.«
»Und jetzt kommt das Beste, Sir: ein gerahmtes, signiertes Foto von Jean Harlow.«
Der Mann riss staunend die Augen auf.
»Wollen wir eine Verabredung treffen?«, fragte Childan, den psychologisch günstigen Moment beim Schopf ergreifend. Er zückte Kugelschreiber und Notizbuch. »Ich werde mir Ihren Namen und Ihre Adresse notieren, Sir.«
Anschließend ging das Pärchen hinaus. Childan blickte auf die Straße, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Freude. Wenn das Geschäft immer so liefe … Doch es ging nicht bloß ums Geschäft, um den Erfolg seines Ladens. Dies war eine Gelegenheit, ein junges japanisches Paar privat kennenzulernen, auf der Basis, dass sie ihn als Menschen akzeptierten und nicht bloß als Yank oder bestenfalls als Kunsthändler. Ja, diese jungen Leute der heranwachsenden Generation, die sich nicht mehr an die Vorkriegszeit oder den Krieg erinnerten – sie waren die Hoffnung der Welt. Standesunterschiede bedeuteten ihnen nicht mehr viel.
Irgendwann wird Schluss sein, dachte er. Eines Tages. Kein Standesdünkel mehr. Keine Regierten und Regierenden mehr. Nur noch Menschen.
Gleichwohl zitterte er vor Angst bei der Vorstellung, wie er an ihre Tür klopfte. Er zog seine Notizen zu Rate. Die Kasouras. Man würde ihn einlassen und ihm bestimmt Tee anbieten. Würde er sich richtig verhalten? Würde er in jedem Moment das Richtige tun und das Richtige sagen? Oder würde er sich Schande bereiten, wie ein Tier, durch irgendeinen dummen Fauxpas?
Das Mädchen hieß Betty. So viel Verständnis in ihrem Gesicht, dachte er. Dieser sanfte, mitfühlende Blick. Zweifellos hatte sie schon in der kurzen Zeit im Laden seine Hoffnungen und Niederlagen durchschaut.
Seine Hoffnungen – auf einmal fühlte er sich benommen. Welche Ambitionen, die an Wahnsinn, wenn nicht an Selbstmord grenzten, hatte er denn? Doch es gab Beziehungen zwischen Japanern und Yanks, obwohl der Mann zumeist ein Japaner und die Frau eine Yank war. Diese … Bei der Vorstellung verzagte er. Und sie war verheiratet. Er verbannte die auf ihn einstürzenden Gedanken aus seinem Bewusstsein und machte sich stattdessen daran, die Morgenpost zu öffnen.
Seine Hände zitterten noch immer. Dann erinnerte er sich an die Verabredung, die er um zwei Uhr mit Mr. Tagomi hatte; auf einmal hörten seine Hände zu zittern auf, und seine Nervosität verwandelte sich in Entschlossenheit. Ich muss mir irgendetwas einfallen lassen, dachte er. Wo? Wie? Was? Ein Anruf. Quellen auftun. Geschäftstüchtig sein. Vielleicht sollte ich einen restaurierten Ford Baujahr 1929 mit Stoffdach (schwarz) auftreiben – nach einem solchen Coup würde er mir auf ewige Zeiten als Kunde sicher sein. Oder ein in Kisten verpacktes dreimotoriges Postflugzeug, entdeckt in einer Scheune in Alabama. Oder der mumifizierte Kopf von Mr. N. Bill, weißer Haarschopf inklusive; ein sensationelles amerikanisches Artefakt. Damit würde ich mir im ganzen Pazifikraum, die Heimatinseln nicht ausgeschlossen, einen Ruf in Top-Kennerkreisen erwerben.
Um sich zu inspirieren, steckte er sich eine Marihuanazigarette an, Marke Land des Lächelns.
Frank Frink lag in seinem Zimmer in der Hayes Street im Bett und überlegte, wie er aufstehen sollte. Die Sonne schien am Rollo vorbei auf einen Haufen Kleider, die auf den Boden gefallen waren. Auch seine Brille lag da. Ob er darauftreten würde? Ich muss irgendwie anders ins Bad kommen, dachte er. Entweder kriechend oder mich wälzend. Er hatte Kopfschmerzen, doch er fühlte sich nicht niedergeschlagen. Schau niemals zurück, sagte er sich. Wie spät? Die Uhr stand auf der Kommode. Elf Uhr dreißig! Du liebe Güte. Trotzdem blieb er liegen.
Ich bin gefeuert, dachte er.
Gestern hatte er in der Fabrik einen Fehler gemacht. Hatte Mr. Wyndam-Matson gegenüber die falschen Reden geschwungen, Wyndam-Matson mit dem eingebeulten Gesicht, der Sokratesnase, dem Diamantring und dem goldenen Reißverschluss. Mit anderen Worten, eine Macht. Eine Institution … Frink ließ die Gedanken müde schweifen.
Ja, dachte er, und jetzt komme ich auf die schwarze Liste; meine Kenntnisse sind wertlos, ich bin meinen Job los. Fünfzehn Jahre Erfahrung. Alles umsonst.
Jetzt musste er bei der Arbeitskommission vorstellig werden und seine Arbeitskategorie neu festlegen lassen. Da er nie dahintergekommen war, in welcher Beziehung Wyndam-Matson zu den Pinocs stand – der weißen Marionettenregierung in Sacramento –, konnte er auch nicht sagen, wie groß der Einfluss seines Ex-Chefs auf die wahren Autoritäten, die Japaner, war. Die AK wurde von den Pinocs geleitet. Er würde vier oder fünf plumpen Weißen mittleren Alters vom Typ Wyndam-Matson gegenübersitzen. Wenn er dort keine Zusage bekam, würde er sich an eine der Import-Export-Handelsmissionen wenden müssen, die von Tokio aus operierten und in ganz Kalifornien, Oregon, Washington und dem den Pazifischen Staaten von Amerika angehörenden Teil Nevadas Niederlassungen hatten. Und wenn er es dort auch nicht schaffte …
Er lag im Bett und betrachtete versonnen den alten Beleuchtungskörper an der Decke. Er könnte zum Beispiel in die Rocky-Mountain-Staaten gehen. Die aber standen in loser Verbindung mit den PSA und würden ihn möglicherweise ausliefern. Und der Süden? Er schauderte. Nein, nicht das. Als Weißer würde er dort mehr Spielraum haben als in den PSA. Aber … mit einem solchen Land wollte er nichts zu tun haben.
Und schlimmer noch, der Süden war eng mit dem Reich verflochten, wirtschaftlich, ideologisch, auf allen möglichen Ebenen. Und Frank Frink war Jude.
Eigentlich hieß er Frank Fink. Aufgewachsen war er an der Ostküste, in New York, bis er unmittelbar nach dem Zusammenbruch Russlands in die Armee der Vereinigten Staaten von Amerika eingezogen worden war. Nachdem die Japse Hawaii erobert hatten, schickte man ihn an die Westküste. Bei Kriegsende befand er sich auf der japanischen Seite der Demarkationslinie. Und das tat er heute, fünfzehn Jahre später, immer noch.
Im Jahre 1947, am Tag der Kapitulation, war er mehr oder minder durchgedreht. In seinem Hass auf die Japse schwor er Rache; er versteckte seine Dienstwaffen gut verpackt und geölt drei Meter unter der Erde in einem Keller, für den Tag, da er und seine Kameraden sich erheben würden … Die Zeit aber heilt alle Wunden, was er nicht berücksichtigt hatte. Wenn er sich heute an sein ursprüngliches Vorhaben erinnerte, an das geplante große Blutbad, die Vertreibung der Pinocs und ihrer Herren, dann war ihm, als blättere er in einem der zerfledderten Jahrbücher aus Highschool-Zeiten. Frank »Goldfisch« Fink möchte Paläontologe werden und gelobt, Norma Prout zu heiraten. Norma Prout war die Klassenschönheit gewesen, und er hatte wirklich gelobt, sie zu heiraten. Das alles lag so verflucht weit zurück, so weit wie die Songs von Fred Allen oder die Filme von W.C. Fields. Seit dem Jahr 1947 hatte er bestimmt schon sechshunderttausend Japaner gesehen oder mit ihnen geredet, und der Wunsch, einem von ihnen oder ihnen allen Gewalt zuzufügen, war nach den ersten Monaten einfach nicht mehr aufgetaucht. Es war einfach nicht mehr wichtig.
Aber Halt! Einen gab es, einen gewissen Mr. Omuro, der in der Innenstadt von San Francisco eine Anzahl von Mietshäusern erworben hatte und eine Zeitlang Frinks Vermieter gewesen war. Der war ein faules Ei, dachte Frink. Ein Blutsauger, der keine Reparaturen ausführen ließ, die Zimmer immer kleiner und kleiner abteilte und ständig die Miete erhöhte … Omuro hatte die Armen ausgenommen, besonders die nahezu mittellosen ehemaligen Soldaten in den Jahren der Depression Anfang der Fünfziger. Doch dann hatte eine der japanischen Handelsmissionen dafür gesorgt, dass Omuro wegen seiner Habgier geköpft wurde. Und heutzutage war ein solcher Verstoß gegen die harten, aber gerechten japanischen Gesetze einfach undenkbar. Dies war den unbestechlichen japanischen Besatzungsbeamten zuzuschreiben, zumal denen, die nach dem Sturz des Kriegskabinetts ins Land gekommen waren.
Der Gedanke an die ruppige, unerschütterliche Ehrlichkeit der Handelsmissionen war beruhigend. Selbst Wyndam-Matson würden sie abwimmeln wie eine lästige Fliege. Ob ihm nun die W-M Corporation gehörte oder nicht. Zumindest hoffte Frink das. Ich glaube, ich habe wirklich Vertrauen in dieses Gerede von wegen Pazifischer Allianz Gemeinsamen Wohlstands, dachte er. Seltsam. Damals, als alles anfing, sah es nach leeren Versprechungen aus. Nach bloßer Propaganda. Aber jetzt …
Er stand auf und wankte ins Bad. Während er sich wusch und rasierte, hörte er sich die Mittagsnachrichten im Radio an.
»Wir wollen diese Leistung nicht geringschätzen«, hieß es, als er gerade das Warmwasser abstellte.
Nein, das wollen wir nicht, dachte Frink verbittert. Er wusste, um welche spezielle Leistung es im Radio ging. Gleichwohl hatte die Vorstellung, dass sture, mürrische Deutsche auf dem Mars herumliefen, auf dem roten Sand, den vor ihnen noch kein Mensch betreten hatte, etwas Komisches an sich. Als er sich die Wangen einschäumte, begann Frink vor sich hin zu singen. Gott, Herr Kreisleiter. Eignet sich dieser Ort vielleicht für ein Konzentrationslager? Das Wetter ist so schön. Heiß, aber schön …
Der Radiosprecher sagte: »Die Gesellschaft des Gemeinsamen Wohlstands muss innehalten und sich überlegen, ob wir in unserem Streben nach einem gerechten Gleichgewicht wechselseitiger Pflichten und Verantwortlichkeiten in Verbindung mit Belohnungen …« – der typische Jargon der herrschenden Hierarchie, dachte Frink – »… haben wir die zukünftige Arena nicht verkannt, in der sich die Geschicke der Menschen erfüllen werden, seien sie nun nordisch, japanisch oder negroid …« Und so weiter und so fort.
Beim Ankleiden spann Frink seine Satire mit Behagen weiter. Das Wetter ist schön, so schön. Aber es fehlt an der Luft zum Atmen …
Eines ließ sich jedenfalls nicht abstreiten: Der Pazifik hatte nichts zur Kolonisierung der Planeten beigetragen. Er hatte sich in Südamerika engagiert – festgerannt, sollte man besser sagen. Während die Deutschen gewaltige Roboterkonstruktionen durchs Weltall jagten, brannten die Japaner noch immer den brasilianischen Regenwald nieder und errichteten achtstöckige Lehmbauten für ehemalige Kopfjäger. Wenn die Japse ihre erste Rakete vom Erdboden hochbekamen, würden die Deutschen bereits das ganze Sonnensystem eingesackt haben. In der guten alten Zeit hatten die Deutschen abseitsgestanden, als das übrige Europa seine Kolonialreiche ausbaute – diesmal würden sie nicht leer ausgehen, dachte Frink; sie haben dazugelernt.
Und dann fiel ihm Afrika ein und das Experiment, das die Nazis dort durchführten. Einen Moment lang stockte ihm das Blut in den Adern.
Diese riesige, menschenleere Ruine.
Der Radiosprecher sagte: »… voller Stolz sollten wir uns vergegenwärtigen, welch großen Wert wir auf die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen gelegt haben, auf ihr subspirituelles Trachten, das …«
Frink schaltete das Radio aus. Dann, als er sich ein wenig beruhigt hatte, schaltete er es wieder ein.
Heilige Scheiße, dachte er. Afrika. Die Gespenster getöteter Stämme. Ausgelöscht, um ein Land zu schaffen, das – ja, wie sollte es eigentlich aussehen, dieses Land? Vielleicht wussten das nicht einmal die Meisterarchitekten in Berlin. Ein Haufen Automaten, die aufbauten und schufteten. Aufbauten? Niederrissen! Monster aus irgendeinem paläontologischen Museum, im Begriff, Trinkgefäße aus den Schädeln ihrer Feinde zu fertigen, nachdem sie sie zuvor säuberlich ausgekratzt und einträchtig das rohe Hirn verzehrt hatten. Sodann nützliche Gerätschaften aus menschlichen Beinknochen. Ganz schön umsichtig, daran zu denken, nicht nur die Menschen zu essen, die man nicht mochte, sondern sie obendrein aus ihren eigenen Schädeln zu verspeisen. Die ersten Techniker! Prähistorische Menschen in sterilen weißen Laborkitteln, in irgendeinem Universitätslabor in Berlin, damit beschäftigt, sich neue Verwendungsmöglichkeiten für Schädel, Haut, Ohren und Fett anderer Menschen auszudenken. Jawohl, Herr Doktor. Eine neue Einsatzmöglichkeit für einen großen Zeh; sehen Sie, man kann das Gelenk für einen Zigarettenanzünder verwenden. Wenn jetzt nur noch Herr Krupp damit in die Massenfertigung gehen kann …
Die Vorstellung, dass der uralte, riesenhafte, halbmenschliche Kannibale jetzt gedieh und abermals die Welt regierte, entsetzte ihn. Eine Million Jahre waren wir vor ihm auf der Flucht, dachte er, und nun ist er wieder da. Und das nicht bloß als Gegner – sondern als Herrscher.
»… können wir nur bedauern«, tönte die Stimme des kleinen Gelbbauchs aus Tokio. Mein Gott, dachte Frink, und wir haben sie für Affen gehalten, diese zivilisierten krummbeinigen Zwerge, die eher ihre Frauen zu Siegelwachs einschmelzen als Gaskammern errichten würden. »… und in der Vergangenheit haben wir häufig die mit diesem fanatischen Ehrgeiz einhergehende furchtbare Verschwendung von Menschenleben bedauert, welche die breite Masse der Menschen gänzlich außerhalb der gesetzlichen Gemeinschaft stellt.« Ja, die Japse verstanden sich auf Recht und Gesetz. »… um einen wohlbekannten westlichen Heiligen zu zitieren: ›Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nähme Schaden an seiner Seele?‹« Der Sprecher legte eine Pause ein. Frink, der sich gerade die Krawatte band, hielt ebenfalls inne. Die morgendliche Minute der Besinnung.
Ich muss hier meinen Pakt mit ihnen schließen, dachte er. Schwarze Liste hin oder her; es wäre mein Tod, wenn ich das japanisch kontrollierte Gebiet verlassen und in den Süden oder nach Europa gehen würde – an einen Ort innerhalb des Reiches.
Ich werde mich mit dem alten Wyndam-Matson arrangieren müssen.
Auf der Bettkante sitzend, neben sich eine Tasse lauwarmen Tee, schlug Frink das I Ging auf. Er nahm die neunundvierzig Schafgarbenstängel aus dem Lederköcher und wartete, bis er sich gesammelt und seine Fragen formuliert hatte.
Laut sagte er: »Wie soll ich mich Wyndam-Matson gegenüber verhalten, um zu einer vernünftigen Regelung zu gelangen?« Er schrieb die Frage auf die Tafel, dann wechselte er die Schafgarbenstängel von Hand zu Hand, bis er die erste Linie, den Anfang, hatte. Eine Acht. Die Hälfte der vierundsechzig Hexagramme fiel damit bereits weg. Er teilte die Stängel und erhielt die zweite Linie. Geschickt, wie er war, hatte er bald alle sechs Linien beisammen; das Hexagramm lag vor ihm, und er brauchte gar nicht erst nachzuschlagen. Er hatte das Hexagramm fünfzehn gleich erkannt: Kiën – die Bescheidenheit. Aha. Die Niederen werden erhoben, die Hohen erniedrigt, mächtige Familien gedemütigt werden; er kannte den Text auswendig. Ein gutes Zeichen. Das Orakel war günstig.
Dennoch war er ein wenig enttäuscht. Das Hexagramm fünfzehn hatte etwas Albernes an sich. Zu klar, zu eindeutig. Natürlich sollte er bescheiden sein. Aber vielleicht lag trotzdem ein tieferer Sinn darin. Schließlich hatte er keine Macht über den alten W-M. Er konnte ihn nicht zwingen, ihn wiedereinzustellen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich die Sichtweise des Hexagramms fünfzehn zu eigen zu machen; in Momenten wie diesem musste man eben bitten, hoffen, Zuversicht zeigen und warten. Zu gegebener Zeit würde ihn der Himmel wieder in seinen alten Job erheben oder vielleicht sogar darüber hinaus.
Er brauchte keine einzelnen Linien zu interpretieren, das Zeichen hatte weder Neunen noch Sechsen; es war unbewegt. Damit war er fertig, das Zeichen wandelte sich nicht in ein zweites Hexagramm.
Die nächste Frage. Er straffte sich und sagte: »Werde ich Juliana je wiedersehen?«
Juliana war seine Frau. Oder vielmehr seine Exfrau. Sie hatte sich vor einem Jahr von ihm scheiden lassen, und er hatte sie seit Monaten nicht mehr gesehen; er wusste nicht einmal, wo sie lebte. Anscheinend hatte sie San Francisco verlassen. Vielleicht sogar die PSA. Entweder ihre gemeinsamen Freunde hatten ebenfalls nichts von ihr gehört, oder sie sagten es ihm nicht.
Den Blick auf die Striche gerichtet, hantierte er geschäftig mit den Schafgarbenstängeln. Wie oft hatte er das Orakel schon nach Juliana befragt? Allmählich fügte sich das Hexagramm zusammen, hervorgebracht vom passiven, zufälligen Wirken der Pflanzenstängel. Zufällig und dennoch verwurzelt in jenem Augenblick, in dem er lebte, in dem sein Leben mit allen anderen Lebewesen und Partikeln im Universum verbunden war. Das Hexagramm bildete mit seinen Mustern aus durchbrochenen und ungeteilten Linien den Jetztzustand ab. Er, Juliana, die Fabrik in der Gough Street, die mächtigen Handelsmissionen, die Erforschung der Planeten, die Millionen Chemikalienhaufen in Afrika, die man nicht einmal mehr als Leichen bezeichnen konnte, die Hoffnungen der vielen tausend Menschen ringsumher in den Slums von San Francisco, die Wahnsinnigen in Berlin mit ihren ausdruckslosen Gesichtern und ihren verrückten Plänen – dies alles wurde in dem Moment miteinander in Beziehung gesetzt, da er die Schafgarbenstängel warf, um die zutreffende Weisheit aus einem Buch auszuwählen, dessen erste Zeilen im dreißigsten Jahrhundert vor Christus niedergeschrieben worden waren. Aus einem Buch, erschaffen von den Weisen Chinas über einen Zeitraum von fünftausend Jahren hinweg, an dem sie immer wieder gefeilt und das sie immer weiter vervollkommnet hatten, eine großartige Kosmologie – und Wissenschaft –, die niedergelegt worden war, ehe Europa auch nur die ungekürzte Division entdeckt hatte.
Das Hexagramm. Seine Stimmung verdüsterte sich. Vierundvierzig. Gou – das Entgegenkommen. Ein ernüchterndes Urteil. Das Mädchen ist mächtig. Man soll ein solches Mädchen nicht heiraten. Es war nicht das erste Mal, dass er es in Verbindung mit Juliana erhielt.
Oje, dachte er und lehnte sich zurück. Dann hat sie also nicht zu mir gepasst. Aber das weiß ich; danach habe ich nicht gefragt. Weshalb erinnert mich das Orakel daran? Eine schlechte Fügung für mich, sie getroffen und mich in sie verliebt zu haben – sie immer noch zu lieben.
Juliana – die bestaussehende Frau, die er je geheiratet hatte. Pechschwarz die Augenbrauen und das Haar; Spuren spanischen Bluts. Ihr fließender, geräuschloser Gang; sie hatte immer zweifarbige Schuhe getragen, die sie von der Highschool übrig behalten hatte. Eigentlich waren alle ihre Sachen abgetragen und verwaschen gewesen. Sie beide waren dermaßen pleite gewesen, dass Juliana trotz ihres Aussehens gezwungen gewesen war, Baumwollsweater, eine Stoffjacke mit Reißverschluss, einen braunen Tweedrock und Söckchen zu tragen, und sie hatte ihn und ihre Kleidung gehasst, weil sie darin, wie sie sich ausdrückte, aussah wie eine Tennisspielerin oder (schlimmer noch) wie eine Frau, die im Wald Pilze sammelte.
Was ihn am Anfang vor allem zu ihr hingezogen hatte, war ihre seltsame Angewohnheit gewesen, Fremde völlig grundlos mit einem undurchdringlichen Mona-Lisa-Lächeln zu begrüßen, so dass sie nicht wussten, ob sie freundlich zurückgrüßen sollten oder nicht. Und sie sah so gut aus, dass sie es meistens taten – worauf Juliana an ihnen vorbeischwebte. Zunächst hatte er geglaubt, sie sei vielleicht kurzsichtig, war dann aber zu dem Schluss gelangt, dass dieses Verhalten Ausdruck einer tiefverwurzelten und ansonsten gut versteckten Dummheit war. Daher hatte ihn ihr angedeutetes Lächeln schließlich ebenso geärgert wie ihr pflanzenhaftes, schweigendes Kommen und Gehen, als habe sie irgendeinen Geheimauftrag zu erledigen.
Trotzdem sah er sie sogar noch gegen Ende, als sie so viel miteinander gestritten hatten, nie anders denn als unmittelbare Schöpfung Gottes, die aus Gründen, die er nie erfahren würde, in sein Leben gestolpert war. Und deshalb – wegen einer Art religiöser Intuition oder Überzeugung – kam er nie darüber hinweg, dass er sie verloren hatte.
Im Augenblick schien sie ihm so nah … als sei sie immer noch bei ihm. Dieses Wesen, das sich noch immer in seinem Leben herumtrieb, das durch sein Zimmer tappte und irgendetwas suchte – was immer es sein mochte, das Juliana suchte. Und das ihm gegenwärtig war, wann immer er die Bände des Orakels zur Hand nahm.
Auf dem Bett sitzend, umgeben von der Unordnung des Einsamen, im Begriff, nach draußen zu gehen und den Tag zu beginnen, fragte sich Frank Frink, wer in dem riesigen, undurchschaubaren San Francisco in diesem Augenblick wohl sonst noch das Orakel befragen mochte. Ob ihnen ähnlich trübsinniger Rat zuteilwurde? War ihnen das Schicksal momentan ebenso abhold wie ihm?
Zwei
Mr. Nobusuke Tagomi befragte das Fünfte Buch konfuzianischer Weisheit, das taoistische Orakel, das seit Jahrhunderten als I Ging oder Buch der Wandlungen bezeichnet wurde. Gegen Mittag hatte er begonnen, sich über das Treffen mit Mr. Childan Gedanken zu machen, das in zwei Stunden stattfinden würde.
Seine Bürosuite lag im zwanzigsten Stock des Nippon Times Building in der Taylor Street und bot Ausblick auf die Bucht. Durch die Glaswand konnte er die Schiffe beobachten, die unter der Golden Gate Bridge hindurchfuhren. In diesem Moment war unmittelbar hinter Alcatraz gerade ein Frachter zu sehen, doch Tagomi beachtete ihn nicht. Er ging zur Wand, löste die Schnur des Bambusrollos und ließ es herab. Es wurde dunkler in dem großen Büro; er brauchte nicht mehr gegen die Helligkeit anzublinzeln. Jetzt konnte er besser nachdenken.
Es lag nicht in seiner Macht, entschied er, seinen Geschäftspartner zufriedenzustellen. Ganz gleich, was Mr. Childan ihm auch anbieten würde – sein Besucher würde unbeeindruckt bleiben. Damit muss man sich abfinden, dachte Tagomi. Aber zumindest können wir vermeiden, dass er sich ärgert.
Wir können es vermeiden, ihn mit einem unansehnlichen Geschenk zu beleidigen.
Sein Geschäftspartner würde in Kürze auf dem San Francisco Airport eintreffen, mit dem neuen deutschen Raketenschiff, der Messerschmitt 9-E. Tagomi war noch nie mit einem solchen Flugapparat gereist; wenn er Mr. Baynes sah, würde er darauf achten müssen, einen blasierten Eindruck zu machen, ganz gleich, wie groß die Maschine auch sein würde. Und das musste er nun üben. Er stellte sich vor den Wandspiegel, setzte eine gelassene, ein wenig gelangweilte Miene auf und forschte in seinen kalten Gesichtszügen nach verräterischen Schwächen. Ja, sie sind sehr laut, Mr. Baynes, Sir. Man kann nicht lesen. Andererseits dauert der Flug von Stockholm nach San Francisco bloß eine Dreiviertelstunde. Dann vielleicht noch eine Bemerkung über irgendein technisches Versagen der Deutschen? Ich nehme an, Sie haben Radio gehört. Über Madagaskar gab es einen Zusammenstoß. Ich muss sagen, die alten Propellerflugzeuge haben doch einiges für sich.
Vor allem durfte er nicht über Politik reden. Baynes’ Ansichten über die aktuellen Themen kannte er nämlich nicht. Gleichwohl konnte die Rede darauf kommen. Baynes würde als Schwede neutral sein. Trotzdem flog er lieber mit der Lufthansa anstatt mit SAS. Behutsam vorgehen … Mr. Baynes, Sir, es heißt, Herrn Bormann gehe es ziemlich schlecht. Die Partei werde im Herbst einen neuen Reichskanzler wählen. Bloße Gerüchte? Ach, es gibt so viele Heimlichkeiten zwischen dem Pazifik und dem Reich.
In der Mappe auf dem Schreibtisch lag ein Artikel der New York Times, der sich mit einer Rede befasste, die Baynes kürzlich gehalten hatte. Tagomi studierte ihn aufmerksam und beugte sich vor dabei, da seine Kontaktlinsen einen winzigen Korrekturfehler aufwiesen. Die Rede hatte mit der Notwendigkeit zu tun, ein weiteres – zum achtundneunzigsten? – Mal auf dem Mond nach Wasser zu suchen. »Es ist durchaus möglich, dass wir dieses grundlegende Problem noch meistern werden«, wurde Baynes zitiert. »Unser nächster Nachbar, und bislang, abgesehen für militärische Zwecke, höchst unergiebig.« Sic!, dachte Tagomi, wobei er das hochgeschraubte lateinische Wort benutzte. Ein wichtiger Hinweis. Also nicht nur an militärischen Dingen interessiert …
Tagomi schaltete die Sprechanlage ein und sagte: »Miss Ephreikian, bitte bringen Sie mir das Tonbandgerät.«
Die Bürotür glitt auf, und Miss Ephreikian, heute mit hübschen blauen Blumen im Haar, kam herein.
»Spanischer Flieder«, bemerkte Tagomi. Früher einmal hatte er sich zu Hause in Hokkaido mit professioneller Blumenzucht befasst.
Miss Ephreikian, eine hochgewachsene, braunhaarige Armenierin, verneigte sich.
»Der Zip-Trach Speed Master ist bereit?«, fragte Tagomi.
»Ja, Mr. Tagomi.« Miss Ephreikian setzte sich, das tragbare, batteriebetriebene Diktiergerät neben sich.
Tagomi sagte: »Ich habe das Orakel gefragt: ›Wird das Treffen mit Mr. Childan erfolgreich verlaufen?‹, und habe leider das ominöse Hexagramm Des Großen Macht erhalten. Zu viel Stärke in der Mitte, kein Gleichgewicht. Weit entfernt vom Tao.« Das Tonbandgerät surrte.
Tagomi überlegte.
Miss Ephreikian sah ihn erwartungsvoll an. Das Surren hörte auf.
»Mr. Ramsey möchte bitte einen Moment hereinkommen«, sagte Tagomi.
»Ja, Mr. Tagomi.« Sie stand auf und setzte das Diktiergerät ab; mit klackernden Absätzen ging sie zur Tür hinaus.
Ramsey trat mit einer dicken Mappe Frachtbriefen unter dem Arm ein. Lächelnd näherte er sich Tagomi. Er trug die schmucke Kordelkrawatte des Mittleren Westens, ein kariertes Hemd und engsitzende, gürtellose Bluejeans, wie sie im Moment bei den jungen Leuten gerade in Mode waren. »Hallo, Mr. Tagomi«, sagte er. »Schöner Tag heute, Sir.«
Tagomi verneigte sich.
Ramsey zuckte zusammen und verneigte sich ebenfalls.
»Ich habe das Orakel befragt«, sagte Tagomi, während sich Miss Ephreikian wieder setzte. »Es ist Ihnen bekannt, dass Mr. Baynes, der, wie Sie wissen, in Kürze hier eintreffen wird, der nordischen Ideologie gegenüber der sogenannten orientalischen Kultur den Vorzug gibt. Ich könnte versuchen, ihn mit echten Schriftrollen der Tokugawa-Periode zu beeindrucken … doch es ist nicht unsere Aufgabe, ihn zu ändern.«
»Ich verstehe«, sagte Ramsey und verzog vor Anspannung das Gesicht.
»Daher werden wir seine Vorurteile pflegen und ihm stattdessen ein kostbares amerikanisches Artefakt überreichen.«
»Ja.«
»Sie, Sir, sind amerikanischer Abstammung. Allerdings haben Sie sich der Mühe unterzogen, Ihre Hautfarbe dunkler zu machen.« Er musterte Ramsey scharf.
»Sonnenbräune durch Bestrahlung mit Höhensonne«, murmelte Ramsey, sich der knappen Ausdrucksweise der Japaner bedienend. »Bloß um Vitamin D aufzubauen.« Sein verlegener Gesichtsausdruck verriet ihn jedoch. »Ich kann Ihnen versichern, dass ich die Wurzeln zu meinen Vorfahren …« Er verhaspelte sich. »Ich habe noch nicht alle Bindungen an die … ethnischen Wurzeln abgeschnitten.«
Tagomi wandte sich an Miss Ephreikian: »Weiter, bitte.« Abermals begann das Diktiergerät zu surren. »Als ich nach erneuter Befragung des Orakels das Hexagramm achtundzwanzig, Da Go, erhielt, stand die ungünstige Neun auf fünftem Platz. Der Kommentar lautet:
Eine dürre Pappel treibt Blüten.
Ein älteres Weib bekommt einen Mann.
Kein Makel, kein Lob.
Dies deutet darauf hin, dass Mr. Childan uns um zwei nichts Wertvolles anbieten wird.« Tagomi hielt inne. »Lassen Sie uns offen sein. Wenn es um amerikanische Kunst geht, ist auf mein Urteil kein Verlass. Aus diesem Grund …« Er suchte nach Worten. »Aus diesem Grund brauche ich Sie, Mr. Ramsey, da Sie sozusagen ein Eingeborener sind. Wir müssen uns tüchtig anstrengen.«
Ramsey wusste nicht, was er darauf entgegnen sollte. Sosehr er sich auch zu beherrschen versuchte, war ihm doch anzusehen, wie gekränkt und zornig er war, eine frustrierte, stumme Reaktion.
»Ich habe das Orakel ein weiteres Mal befragt«, fuhr Tagomi fort. »Aus politischen Gründen kann ich Ihnen die Frage nicht nennen, Mr. Ramsey.« Mit seinem Tonfall drückte er aus: Sie und die anderen Pinocs haben kein Recht, an den wichtigen Dingen teilzuhaben, mit denen wir uns befassen. »Es reicht, wenn ich sage, dass ich eine äußerst provozierende Antwort erhalten habe, die mir einiges Kopfzerbrechen bereitet hat.«
Ramsey und Miss Ephreikian beobachteten ihn aufmerksam.
»Es geht um Mr. Baynes«, sagte Tagomi.
Sie nickten.
»Meine Frage Mr. Baynes betreffend hat mittels des geheimnisvollen Wirkens des Tao das Hexagramm Schong, sechsundvierzig, hervorgebracht. Ein gutes Urteil. Und eine Sechs auf dem ersten und eine Neun auf dem zweiten Platz.« Tagomis Frage hatte folgendermaßen gelautet: Werde ich erfolgreich mit Mr. Baynes verhandeln? Und die Neun auf zweitem Platz bedeutete, dass es so sein würde. Das Urteil lautete:
Wenn man wahrhaftig ist,
So ist es fördernd, ein kleines Opfer zu bringen.
Kein Makel.
Offenbar würde Mr. Baynes mit jedem Geschenk zufrieden sein, das ihm die mächtige Handelsmission durch Tagomi überreichte. Tagomi hatte jedoch noch eine viel tiefgründigere Frage im Sinn gehabt, deren er sich kaum bewusst gewesen war. Wie so häufig hatte das Orakel auch diesmal auf die eigentliche Frage reagiert und sie gleich mit beantwortet.
»Wie wir wissen«, sagte Tagomi, »bringt Mr. Baynes uns einen detaillierten Bericht über ein neuartiges Spritzgussverfahren mit, das in Schweden entwickelt wurde. Sollten wir zu einer Vereinbarung mit seiner Firma gelangen, könnten wir viele seltene Metalle durch Plastik ersetzen.«
Der Pazifik bemühte sich schon seit Jahren, im Bereich der synthetischen Werkstoffe Unterstützung vom Reich zu bekommen. Die großen deutschen Chemiekonzerne, vor allem die IG Farben, hielten ihre Patente jedoch unter Verschluss; im Grunde genommen hatten sie auf dem Gebiet der Kunststoffe, insbesondere bei der Entwicklung von Polyestern, ein Weltmonopol geschaffen. Auf diese Weise hatte sich das Reich seinen Vorsprung vor dem Pazifik bewahrt, ja war ihm in technischer Hinsicht mindestens zehn Jahre voraus. Die interplanetaren Raketen, die von der Festung Europa aus starteten, bestanden überwiegend aus hitzebeständigem Kunststoff, waren äußerst leicht und dabei so stabil, dass sie selbst einem größeren Meteoriteneinschlag standhielten. Der Pazifik besaß nichts Vergleichbares; dort wurden noch immer Naturfasern sowie die allgegenwärtigen Schmelzfarbgläser verwendet. Auf Handelsmessen hatte Tagomi einige hochentwickelte Produkte der Deutschen gesehen, darunter ein vollsynthetisches Auto, den D.S.S. – »Der Schnelle Spuk« –, der für umgerechnet etwa sechshundert Dollar angeboten wurde.
Die Frage, die ihn jedoch viel mehr beschäftigte und die er den Pinocs, die in den Büros der Handelsmission herumwuselten, niemals verraten hätte, befasste sich mit einem Aspekt dieses Mr. Baynes, den das Chiffretelegramm aus Tokio angesprochen hatte. Verschlüsselte Nachrichten waren selten und hatten meist mit Fragen der Sicherheit und nicht mit geschäftlichen Dingen zu tun. Außerdem war der Schlüssel metaphorisch gewesen und hatte sich der poetischen Anspielung bedient, um die Reichsüberwacher zu täuschen, die in der Lage waren, jeden Code zu knacken, ganz gleich, wie kompliziert er auch sein mochte. Somit zielten die Vorsichtsmaßnahmen auf das Reich ab, nicht auf unzuverlässige Gruppierungen der Heimatinseln. Der Schlüsselsatz »Entrahmte Milch in seinem Essen« bezog sich auf Pinafore, das unheimliche Lied, dessen Lehre lautete: »Die Dinge sind selten, was sie scheinen – entrahmte Milch verkleidet sich als Sahne.« Und als Tagomi das I Ging zu Rate zog, hatte es diese Sichtweise bestätigt. Der Kommentar hatte gelautet:
Man unterstellt hier einen starken Mann. Wohl wahr, er passt sich seiner Umgebung nicht an, insofern als er zu brüsk ist und zu wenig auf Formen achtet. Doch er ist aufrechter Art und reagiert mit Feingefühl …
Die Schlussfolgerung war, dass Mr. Baynes nicht der war, der er zu sein schien; dass er nicht nach San Francisco gekommen war, um einen Vertrag über Spritzgussmaschinen zu unterzeichnen; dass Mr. Baynes in Wahrheit ein Spion war.
Gleichwohl konnte Tagomi sich, solange er auch darüber nachgrübelte, nicht vorstellen, für wen Baynes spionierte und worauf er es abgesehen hatte.
Um ein Uhr vierzig an diesem Nachmittag sperrte Robert Childan voller Widerwillen die Ladentür des American Artistic Handcrafts Inc. ab. Er stellte seine schweren Koffer am Bordstein ab, winkte ein Pedotaxi herbei und sagte dem Chink, er solle ihn zum Nippon Times Building bringen.
Der Chink, hager, gebeugt und schwitzend, hauchte unterwürfig eine Bestätigung und lud Childans Koffer ein. Nachdem er Childan behilflich gewesen war, auf dem mit Teppich ausgeschlagenen Sitz Platz zu nehmen, schaltete er die Uhr ein, stieg seinerseits auf und radelte zwischen Personenwagen und Bussen über die Montgomery Street davon.
Childan war den ganzen Tag damit beschäftigt gewesen, etwas für Mr. Tagomi herauszusuchen, und während die Gebäude an ihm vorbeizogen, wurde er beinahe überwältigt von Bitterkeit und Angst. Und gleichzeitig verspürte er – Triumph. Er hatte das Richtige gefunden, Mr. Tagomi würde zufrieden und sein Geschäftspartner, wer immer dies sein mochte, überglücklich sein. Ich mache es jedem recht, dachte Childan. Allen meinen Kunden.
Wie durch ein Wunder war es ihm gelungen, eine tadellos erhaltene Erstausgabe zu beschaffen; den ersten Band der Tip Top Comics. Es handelte sich um einen der ersten amerikanischen Comics aus den Dreißigern, der bei den Sammlern in höchstem Kurs stand. Natürlich hatte er auch noch andere Dinge dabei, die er als Erstes anbieten wollte. Erst zum Schluss würde er den Comic präsentieren, der in seiner Ledermappe und in Seidenpapier eingeschlagen gut geschützt im größten Koffer lag.
Das Radio des Pedotaxis dudelte Schlager und wetteiferte mit den Radios der anderen Taxis, Personenwagen und Busse. Childan hörte nicht hin; er war daran gewöhnt. Auch die riesigen Neonreklamen, die die Vorderfront jedes größeren Gebäudes verschandelten, beachtete er nicht. Schließlich hatte er sein eigenes Reklameschild; bei Nacht blinkte es im Verein mit all den anderen Neonreklamen der Stadt. Wie sollte man sonst auch werben? Schließlich musste man realistisch sein.
Genau genommen schläferten ihn der Lärm der Radios und des Verkehrs, die Neonreklamen und die Menschen ein. Sie überdeckten seine Sorgen. Und es war angenehm, von einem anderen Menschen umhergeradelt zu werden, zu spüren, wie sich die Muskelanspannung des Chink in regelmäßige Schwingungen umwandelte: eine natürliche Entspannungsmaschine, überlegte Childan. Gezogen zu werden, anstatt selbst zu ziehen. Und einmal oben zu sein, und sei es nur für einen Moment.
Schuldbewusst schüttelte er den Kopf, um wach zu werden. Es gab so viel zu planen; er hatte keine Zeit für ein Mittagsschläfchen. War er für das Nippon Times Building auch angemessen gekleidet? Womöglich würde er im Expresslift ohnmächtig werden. Jedenfalls hatte er Tabletten gegen Übelkeit dabei, ein deutsches Präparat. Die unterschiedlichen Anredeformen – die kannte er. Er wusste, wen man höflich und wen man grob behandeln musste. Dem Pförtner, dem Liftboy, der Dame an der Rezeption, dem ganzen Personal gegenüber musste man kurz angebunden sein. Vor den Japanern musste man sich natürlich verneigen, selbst wenn man dies Hunderte Male tun musste. Aber die Pinocs … Ein verschwommener Bereich. Sich verneigen, aber durch sie hindurchsehen, als wären sie gar nicht da. Waren damit alle Situationen abgedeckt? Wie verhielt es sich mit Fremden auf Besuch? In den Handelsmissionen traf man häufig auf Deutsche und auch Leute aus neutralen Ländern.
Vielleicht würde er sogar einen Sklaven sehen.
Deutsche Schiffe oder Schiffe aus dem Süden legten ständig im Hafen von San Francisco an, und gelegentlich gab man den Schwarzen für kurze Zeit Ausgang. Stets waren sie höchstens zu dritt. Außerdem mussten sie spätestens bei Einbruch der Dunkelheit zurück sein; selbst nach dem pazifischen Gesetz mussten sie die nächtliche Ausgangssperre beachten. Auch die Schiffsladungen in den Docks wurden von Sklaven gelöscht, und diese lebten ständig an Land, in Verschlägen in den Kellern der Lagerhäuser, unmittelbar über der Wasserlinie.
In den Büros der Handelsmission würden keine sein, doch falls gerade irgendwelche Ladung gelöscht wurde – sollte er beispielsweise seine Koffer selbst zu Mr. Tagomis Büro schleppen? Auf gar keinen Fall. Er würde einen Sklaven auftreiben müssen, und wenn er eine Stunde lang warten musste, ja selbst auf die Gefahr hin, seinen Termin zu verpassen. Es war völlig undenkbar, dass er von einem Sklaven dabei beobachtet wurde, wie er etwas schleppte, darauf musste er achten. Ein solcher Fehler würde ihn teuer zu stehen kommen; dann würde er bei denen, die es mitbekamen, nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen.
Irgendwie, dachte Childan, würde es mir einen Mordsspaß machen, meine Koffer am helllichten Tag ins Nippon Times Building zu schleppen. Was für eine große Geste. Verboten ist es eigentlich nicht, ich würde nicht dafür ins Gefängnis kommen. Und würde meine wahren Gefühle zeigen, die Seite eines Mannes, der niemals in der Öffentlichkeit steht, aber …
Ich könnte es tun, dachte er, wenn nicht überall diese verfluchten schwarzen Sklaven herumlungern würden. Ich könnte die Verachtung der Höhergestellten ertragen – schließlich demütigen sie mich jeden Tag. Aber von den Tiefergestellten beobachtet zu werden, ihre Verachtung zu spüren … Zum Beispiel dieser Chink, der mich hier fährt. Wenn ich kein Pedotaxi genommen hätte, wenn ich versucht hätte, zu Fuß zu einer geschäftlichen Verabredung zu gehen …
Schuld an dieser Situation waren die Deutschen. Sie neigten dazu, sich zu übernehmen. Kaum dass sie mit Mühe den Krieg gewonnen hatten, machten sie sich auch schon an die Eroberung des Sonnensystems, während sie zu Hause Gesetze erließen, die … nun, zumindest der Ansatz war gut. Schließlich waren sie mit den Juden, den Zigeunern und den Zeugen Jehovas erfolgreich gewesen. Und die Slawen waren dorthin zurückgedrängt worden, von wo sie vor zweitausend Jahren hergekommen waren, nach Zentralasien. Vollständig aus Europa hinaus, zu aller Erleichterung. Zurück zu den Yaks und der Jagd mit Pfeil und Bogen. Und diese großartigen Hochglanzmagazine, die in München gedruckt wurden und in Bibliotheken und an Kiosken auslagen … Da sah man sie auf ganzseitigen Farbfotos abgebildet: die blauäugigen, blondhaarigen arischen Siedler, die jetzt in der Kornkammer der Welt, der Ukraine, emsig den Boden bestellten, Minderwertiges ausmerzten, pflügten und so weiter. Diese Burschen wirkten jedenfalls glücklich. Und ihre Farmen und Landhäuser waren sauber. Man sah keine Fotos von betrunkenen, stumpfsinnigen Polen mehr, die auf verfallenen Veranden herumhockten oder auf dem Dorfmarkt ein paar armselige Rüben verhökerten. Das alles war Vergangenheit, genau wie die unbefestigten Straßen, die sich früher während der Regenzeit in Schlammlöcher verwandelt hatten, in denen die Pferdewagen stecken geblieben waren.
Aber Afrika … Dort war die Begeisterung mit ihnen durchgegangen, und das musste man anerkennen, wenngleich sie besser beraten gewesen wären, vielleicht noch ein wenig zu warten, etwa bis das Projekt Bauernland abgeschlossen war. Dort hatten die Nazis ihr Genie unter Beweis gestellt, dort war der Künstler in ihnen zum Vorschein gekommen. Das Mittelmeer mittels Atomenergie trockengelegt und in Kulturland umgewandelt – welcher Wagemut! Die Spötter waren verstummt, etwa gewisse Händler in der Montgomery Street. Und Afrika wäre beinahe ein Erfolg gewesen … aber bei einem solchen Projekt war beinahe eben nicht genug. Rosenbergs wohlbekanntes Pamphlet, veröffentlicht im Jahre 1958; darin war das Wort zum ersten Mal aufgetaucht. Was die Endlösung des Afrikaproblems angeht, haben wir unsere Ziele beinahe verwirklicht. Doch bedauerlicherweise …
Jedenfalls hatte es zweihundert Jahre gedauert, die amerikanischen Eingeborenen zu beseitigen, und Deutschland hätte es in Afrika beinahe in fünfzehn Jahren geschafft. Kritik war daher nicht angebracht. Darüber hatte Childan sich kürzlich noch bei einem Essen mit einigen dieser Geschäftsleute ausgelassen. Sie erwarteten von den Nazis offenbar Wunder, als könnten diese die Welt durch ein Zauberwort ummodeln. Nein, es ging um Wissenschaft und Technik und ihr sagenhaftes Talent, hart zu arbeiten. Die Deutschen ließen niemals locker, und wenn sie eine Aufgabe anpackten, dann richtig.