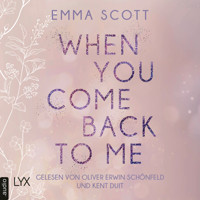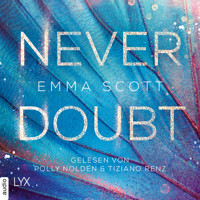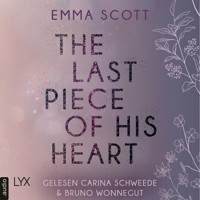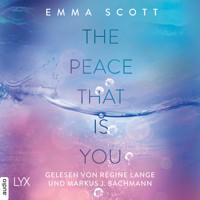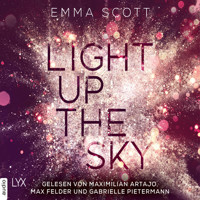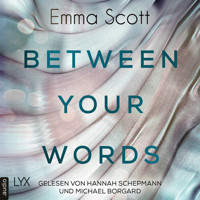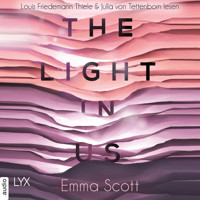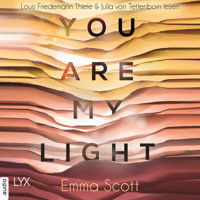9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Dreamcatcher-Duett
- Sprache: Deutsch
»Nur bei dir habe ich jemals Frieden verspürt.«
Die junge Fiona lebt in ständiger Angst, dass ihr Ex-Mann sie finden könnte. Trotzdem beschließt sie eines Tages, einen One-Night-Stand zu wagen. Als sie in einer Bar auf Nikolai trifft, scheint die Welt in den Hintergrund zu treten. Sie ahnt nicht, dass der tatöwierte junge Mann mit den traurigen Augen ebenfalls auf der Flucht ist. Er schlägt sich mit illegalen Poker-Spielen durch und trägt ein unbegreifliches Geheimnis mit sich. Aus einer Nacht werden viele, und die Gefühle zwischen ihnen sind tiefer als alles, was sie je kannten. Doch Nik weiß, dass sie nur eine Zukunft haben, wenn er Fiona alles über sich offenbart - er weiß aber auch, dass er sie dadurch für immer verlieren könnte ...
»Dieses Buch hat mich umgehauen! Euer Herz wird für Fiona und Nik bluten. Dieses Buch ist so vieles, dass man es nur schwer beschreiben kann. Den dunklen Seiten des Lebens stellt die Autorin so viel Liebe und Hoffnung entgegen.« SCHMEXY GIRL BOOK BLOG
Band 2 der DREAMCATCHER-Dilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Playlist
Leser:innenhinweis
Widmung
Prolog
1. Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
2. Teil
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
3. Teil
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
4. Teil
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Epilog I
Epilog II
Noch ein Sonnenaufgang
Miniglossar von Pokerausdrücken
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Emma Scott bei LYX
Impressum
EMMA SCOTT
The Peace That Is You
Roman
Ins Deutsche übertragen von Inka Marter
ZU DIESEM BUCH
Fiona hat es geschafft, sich unter einem falschen Namen ein neues Leben aufzubauen. Sie liebt ihre Arbeit in einer Gärtnerei und hat ein paar Freunde, denen sie vertrauen kann. Doch ihr größter Traum ist ein Häuschen in Costa Rica. Ein Ort, an dem sie sich wirklich sicher fühlt. Denn die Angst, dass ihr manipulativer Ex-Mann sie finden könnte, verlässt sie nie. Trotzdem beschließt sie eines Tages, ihrer Furcht die Stirn zu bieten und einen One-Night-Stand zu wagen. Als sie in einer Bar auf Nikolai trifft, scheint die Welt in den Hintergrund zu treten. Sie ahnt nicht, dass der tätowierte junge Mann mit den traurigen Augen ebenfalls auf der Flucht ist. Er schlägt sich mit illegalen Poker-Spielen durch und trägt ein unbegreifliches Geheimnis mit sich. Aus einer Nacht werden viele, und die Gefühle zwischen ihnen sind tiefer als alles, was sie je kannten. Fiona spürt, dass auf Nick etwas lastet, das ihn langsam zerstört. Doch als er ihr schließlich die Wahrheit über sich offenbart, holt Fionas Vergangenheit sie wieder ein, und ihre Liebe wird auf eine Zerreißprobe gestellt. Fiona muss sich entscheiden, ob sie bereit ist, Nik zu vertrauen und sich ihren Ängsten endlich zu stellen.
PLAYLIST
Fiona Apple: Criminal
Dimitri Vegas: Hey Baby
Sam Smith: Stay with Me
Cage the Elephant: Trouble
K. Flay: Blood in the Cut
The Revivalists: Keep Going
Coldplay: Yellow
LP: Lost on You
The Revivalists: Wish I Knew You
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Für Robin in Dankbarkeit, die größer ist als ein einfaches Danke
PROLOG
Der Mann fuhr aus dem Schlaf hoch. Die Nacht war still und undurchdringlich, das Hausboot unter ihm schaukelte. Er versuchte, den Traum festzuhalten, der am Rand seines Bewusstseins tanzte. Bilder zogen vor seinen Augen vorüber wie Geister. Ein dunkler Highway. Eine Gestalt kniete am Straßenrand. Und Regen. So viel Regen. Aber der Rest des Traums zerrann ihm wie Sand zwischen den Fingern, und er konnte nur ein paar wenige Dinge klar erkennen.
Highway 23
Margo Pettigrew
Eine Dankbarkeit, die größer war als ein einfaches Danke …
Wie bei den anderen Träumen dieser Art wusste er nicht, was all das bedeutete, nur dass er es am Ende erfahren würde.
Er wandte sich seiner Frau zu, die neben ihm schlief, und küsste sie. Sie bewegte sich, und ihre Hände legten sich schützend auf ihren gerundeten Bauch.
»Ich muss weg«, flüsterte er.
Sie blinzelte im Halbdunkel, strich sich das dunkle Haar aus dem Gesicht. Eine Narbe teilte ihre linke Wange von oben bis unten. »Weg …?« Ihr schläfriger Blick fiel auf den Digitalwecker, der 3:21 anzeigte. »Jetzt?«
Der Mann nickte. »Jetzt.«
»Warum?« Sie setzte sich auf. »Wo musst du hin?«
»Ein Traum«, sagte er schlicht. »Ich weiß noch nicht, wohin.« Er legte den Kopf schief, als würde er einer Stimme lauschen, die nur er hörte. »Nach Osten. Ich muss nach Osten. Und ich muss den Pick-up nehmen.«
Er stand auf und schaltete die Lampe an, die den kleinen Raum in gelbes Licht tauchte. Er zog Jeans und ein T-Shirt an. Das Hausboot schaukelte leicht, als er zu der kleinen Kommode ging, ein paar Sachen zum Wechseln herausnahm und aufs Bett warf.
»Moment mal«, sagte sie. »Du … du kannst mich nicht allein lassen. Du kannst uns nicht allein lassen.« Sie schlang die Arme um ihre Körpermitte. »Was ist, wenn dir etwas passiert?«
Der Mann hielt inne und drehte sich zu ihr um. »Es wird nicht gefährlich, versprochen. Aber ich muss gehen. Ich muss jemandem helfen.«
»Wem?«
»Das weiß ich noch nicht«, sagte er. »Ich erkenne ihn, wenn ich ihn sehe.«
»Warum braucht er deine Hilfe?«
Ihr Mann zuckte die Achseln, ein leichtes Lächeln auf den Lippen. »Liebe«, sagte er. »Es hat was mit Liebe zu tun.«
Sie lehnte sich an die Kissen, die dunklen Augen besorgt. Der Mann nahm ihr Gesicht in die Hände und drückte seine Stirn an ihre.
»Weißt du noch, was ich das letzte Mal gesagt habe?«, fragte er. »Es stimmt noch. Ich schwöre es, Baby. Es ist immer noch wahr.«
»Du kommst immer zu mir zurück«, flüsterte sie, schloss die Augen und legte ihre Hände auf seine.
»Immer«, sagte er. »Ich schwöre es.«
Sie sah zu, wie er fertig packte.
»Wie lange?«, fragte sie.
Er hielt inne, lauschte. »Sechs Tage«, sagte er schließlich.
»Du musst die nächsten sechs Tage nicht auf die Feuerwache«, sagte sie. »War das geplant?«
Er lächelte zerknirscht. »Ist es das je?«
Sie antwortete mit einem trockenen Lächeln, das schnell verblasste. »Ich dachte, du hättest diese Träume nicht mehr. Ich dachte, es wäre vorbei.«
»Das dachte ich auch«, sagte er. »Aber es ist wichtig. Ich muss da hin. Ich fühle …«
»Was fühlst du?«
»Wenn ich nicht hinfahre, wird er sie verpassen. Sie haben sich in der Dunkelheit verlaufen.«
»Wer?«, fragte sie, dann winkte sie ab. »Vergiss es. Du weißt es erst, wenn du es weißt.«
»Genau.«
Er hängte sich die gepackte Reisetasche über die Schulter und ging mit ihr zum Eingang des Hausboots. Dort umarmte er sie, legte die Hand auf ihren Bauch und ihren Sohn, der seit über fünf Monaten darin wuchs.
»Ich bin bald zurück«, flüsterte er am dunklen Haar seiner Frau. »Ich liebe dich.«
»Ich liebe dich auch.« Sie löste sich von ihm und sah ihn eindringlich an. Ihre Narbe hob sich deutlich ab auf ihrer Haut. »Versprich es mir. Sag es noch einmal.«
Er küsste sie und strich mit dem Finger über die glänzende Linie auf ihrer Wange. »Ich komme immer zu dir zurück.«
Dann trat er aufs Deck, und die Dunkelheit verschluckte ihn ohne ein Geräusch.
1. TEIL
Der Teufel in mir
Gesicht, das; -[e]s, -e: Sehvermögen, Vorstellung, Vision; das Zweite Gesicht haben, ein Gesicht sehen /haben
1. KAPITEL
Nikolai
»Wann hat es angefangen, Nik?«
»Das weiß ich nicht mehr. Es war schon immer da.«
»Spürst du, was ich jetzt fühle?«
»Ja. Es sieht aus wie bräunlich oranger Staub und riecht nach … nassen Blättern.«
»Was?«
»Was Sie fühlen. Ich kann es sehen. Sie glauben mir nicht, aber Sie sind aufgeregt, weil Sie so was noch nicht kennen. Es ist neu.«
»Und du nennst es dein Gesicht?«
»Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe das Wort in einem Wörterbuch gefunden. Ein anderes weiß ich nicht.«
Er schreibt sich etwas auf. »Konntest du das schon immer? Gefühle ›sehen‹?«
»Ja, es ist netschistaja sila. Stimmt’s, Mama?«
Er sieht meine Mutter an, dann wieder mich. »Was bedeutet das?«
»Ich hab den Teufel in mir.«
»Glaubst du, was du kannst – das Gesicht –, ist falsch?«
»Ich mag es nicht. Ich will es nicht haben. Können Sie machen, dass es weggeht?«
»Ich glaube, diese Behandlung könnte genau das leisten. Du hast nicht den Teufel in dir, Nikolai. Dein Gehirn spielt dir einen Streich, und du denkst nur, du kannst wahrnehmen, was andere fühlen.«
»Aber ich kann den Staub sehen … Ich kann ihn schmecken …«
»Alles nur Halluzinationen.«
»Und Sie werden die aus mir rausschocken?«
»So etwas in der Richtung.« Sein Lächeln ist aschgrauer Rauch, und ich muss an Lügen denken. »Stell dir dein Gehirn als einen Computer vor, der eine kleine Störung hat. Ihn herunterzufahren hilft, die Störung zu beseitigen. Der Strom funktioniert wie eine Art Neustart.«
»Sie schalten mein Gehirn aus und wieder an?«
»Das sollte nur erklären, wie es funktioniert.«
»Ich weiß nicht …«
»Die Medikamente helfen nicht, oder?«
»Nein. Ich hasse die. Da bin ich wie betäubt.«
»Ich glaube, diese Behandlung passt besser zu deinem besonderen Leiden.«
»Dann bin ich krank? Das hat Dad gesagt, bevor er weggegangen ist. Krank im Kopf.«
Sein Lächeln wird angespannt, und er antwortet, als hätte er mich nicht gehört. »Was denkst du, Nikolai? Bis du bereit, es auszuprobieren?«
»Ich denk schon.«
»Sehr gut.« Er blickt zu meiner Mutter. »Wenn Sie dann die Einverständniserklärung für ihn unterschreiben würden …«
»Mama?«
Sie wendet sich ab. Vielleicht kann sie mich wieder angucken, wenn ich das mache.
Sie führen mich in ein anderes Zimmer, und ich muss mich hinlegen. Sie geben mir eine Spritze in den Arm und halten mir eine Maske vors Gesicht. Ich atme Gas ein und fühle mich leichter als Luft. Ich schwebe an die Decke, und auf einmal kann ich runtergucken. Ich schlafe. Sie kleben mir runde Dinger auf die Stirn, an denen Kabel befestigt sind. Dann stecken sie mir einen Stock in den Mund.
Der Arzt mit dem verlogenen Lächeln drückt auf einen Knopf, und nichts passiert. Nur ein Fuß, der unter der Decke rausguckt, zittert, als wäre ihm kalt, weil er nicht zugedeckt ist.
Eine Sekunde später werden meine Gedanken zerschnitten. Blitze durchschlagen mich, blenden, reißen, brennen. Ich sehe nur Chaos, und dann verrottet alles zu dem Grau toten Fleisches.
Ich schreie meinen schlafenden Körper an.
NEIN! STOPP! BITTE!
Schwestern und Ärzte, die ruhig dagesessen haben, flitzen jetzt herum. Das langsame Piepen meines Herzschlags ist jetzt so schnell wie der weiße Blitz, der durch mich hindurchschießt, bis alles ein einziger Lärm ist, ein einziger schrecklicher Schmerz …
WACHAUF!
Der Arzt stellt die Maschine ab. Der Blitz löst sich knisternd in nichts auf, und ich falle wieder in meinen Körper hinab.
Ich öffne die Augen und schnappe nach Luft, als hätte ich seit Jahren nicht geatmet. Mein Kopf dröhnt vor Schmerz. Stimmen umringen mich.
»Er war unter Vollnarkose …«
»Schwere Tachykardie …«
»Das kann nicht sein …«
Ich setze mich auf und höre noch mehr verwirrte Schreie. Ich reiße die Kabel ab und ziehe mir die klebrigen Dinger von der Stirn; dann reiße ich mir die Schläuche aus dem Arm.
»Nikolai, bitte beruhige dich …«
Ich werfe die dünne Decke zur Seite. Der Boden ist kalt unter meinen Füßen, als ich losrenne. Jemand versucht, mich festzuhalten, aber ich entwische. Der Schmerz hämmert, treibt mich wie eine Trommel an, durch die Tür. Ich renne mit dem Kopf voran in das blendend weiße Tageslicht, das mich bremst wie eine Mauer. Ich halte mir den Arm vor die Augen, um sie zu schützen. Dann packt man mich grob an den Schultern und reißt mich zurück.
Ich wehre mich, aber die anderen sind zu stark, und das Licht ist so hell … so hell …
»Bist du noch da, Nik?«
Ich blinzelte heftig und riss den Blick von der einzelnen Glühbirne über dem Tisch los. Es dauerte eine Sekunde, bis die Erinnerung schwand und die Realität erschien, als würde eine Szene in einer Fernsehserie zur nächsten überblenden. Der fünfzehnjährige Junge im Krankenhaushemd wurde wieder zum tätowierten Vierundzwanzigjährigen, der mit Muskeln bepackt war – weil mich verdammt noch mal nie wieder jemand einsperren würde.
»Unser neuer Kumpel Nik hat sich verabschiedet«, sagte Paulie.
Atlanta. Das Pokerspiel. Ich setzte mich gerade hin und lachte schnaubend. »Ich bin noch da und werd euch Vollpfosten ausnehmen.«
Die Beleidigung wurde von den anderen sechs Typen mit einem Lachen quittiert, das angespannt und freudlos klang. Sie mochten mich nicht. Alle hatten unterschiedlich hohe Stapel Chips vor sich, aber ich hatte am meisten.
Wir saßen im Keller von Paulies Pfandleihe in der Innenstadt von Atlanta, Georgia. Über uns im Erdgeschoss versetzten verzweifelte Menschen ihre Familienerbstücke oder Omas besten Schmuck für ein paar Kröten, um weiterzumachen. Um die Stromrechnung zu bezahlen oder an den nächsten Schuss zu kommen. Hier unten war es nicht viel anders.
Paulie veranstaltete dreimal die Woche ein Texas-Hold’em-Spiel, und ein paar der Spieler setzten die Miete oder das Haushaltsgeld. Blinds von fünfzehn und fünfundzwanzig Dollar bei einem Buy-in von zweihundertfünfzig Dollar.
Einsätze in dieser Höhe hätte ich überall finden können, bei jedem illegalen Pokerspiel in fast jeder Stadt. Und das hatte ich auch auf meiner endlosen Fahrt durch das Land. Aber ich wollte eine Großstadt. Die endlosen Tage auf der Straße forderten ihren Tribut. Ich brauchte Menschen.
Ich kann ihnen nur nicht so verdammt nahe kommen.
Atlanta war zu viel. Es war dumm gewesen zu glauben, ich könnte damit klarkommen. Es fühlte sich an, als befände sich die ganze Stadt über meinem verdammten Kopf, nicht nur die Pfandleihe. Der Ansturm all dieser Existenzen traf mich wie ein LSD-Trip, der nicht zu Ende ging. So viele Menschen mit so vielen Emotionen. Sie brüllten mir in Farbexplosionen ihr Leben entgegen, im Mund hatte ich den bitteren Geschmack ihrer schlechten Erinnerungen.
Schweiß lief mir den Hals hinunter, obwohl die Klimaanlage auf Hochtouren gegen die Sommerhitze von Georgia kämpfte, und ich hatte Kopfschmerzen, als würde mir ein Hammer von innen gegen den Schädel schlagen. Ich war am Meeresgrund, das vernichtende Gewicht des Wassers drückte mich zu Boden …
Ich hob die Ecken meiner zwei Karten mit dem Daumen an. Herzass und Herzvier. Der Flop bestand aus Herzzehn, Herzsieben und Karobube.
Ich ließ die Karten liegen und zeigte keine Regung. Ein Flush war keine schlechte Hand. Ich konnte gewinnen, und danach würde ich verschwinden. Atlanta war zu viel. Ich musste hier weg.
»Herz, Herz, Herz, Mann, was für eine Scheiße!«, sagte der große Typ – Oliver –, der links von mir saß.
Lügner.
Es war Olivers Tell. Dass er bei jedem Spiel kryptische Bemerkungen über die Karten machte, verwirrte die anderen Spieler. Manchmal bluffte er, manchmal nicht. Ich durchschaute ihn immer. Ich durchschaute sie alle. Selbst ohne das Gesicht konnte ich in ihnen lesen wie in einem Buch. Mit dem Gesicht war ich unschlagbar. In meinen vierundzwanzig Jahren Pseudo-Leben war das die einzige verdammte Sache, zu der ich gut war.
»Und, Nik?«, sagte Paulie und kaute an seiner Zigarre. »Was machst du beruflich?«
Ich betrüge beim Poker.
»Ich bin Vertreter«, sagte ich und bemühte mich, normal zu klingen. Ich war dran mit Bieten. Normalerweise würde ich nur mitgehen, um die anderen in Sicherheit zu wiegen, aber diesmal hielt ich den Big Blind und erhöhte um fünfzig Dollar.
Der Tisch atmete kollektiv ein, und der Rauch, der im Licht der Glühbirne waberte, verfärbte sich, nahm kranke, argwöhnische Schattierungen von Grünlichgrau an und das Pissgelb der Angst eines jungen Typen namens Eli schräg gegenüber von mir. Eigentlich konnte er sich den Buy-in von zweihundertfünfzig Dollar nicht leisten, aber er spielte trotzdem. Für ziemlich viele Typen hatte Poker eine stärkere Wirkung als Heroin.
»Motorradteile, oder?«, fragte Angus. Er war mein Zugang zu diesem Spiel gewesen. Ich hatte ihn bei einem Onlinespiel kennengelernt, mit ihm gechattet und eine Einladung gekriegt. Meine übliche Vorgehensweise.
»Ja, Motorradteile«, sagte ich und nahm einen Schluck aus meiner Bierflasche.
Angus hielt meinen Raise und warf die Chips in den Pot, statt sie für alle ersichtlich vor sich zu schieben.
»Mann, Angus, hör auf mit dieser Scheiße«, sagte Eli. Er arbeitete in der Pfandleihe und war meiner bescheidenen Meinung nach ein Idiot. Jeder, nicht nur ich, hätte begreifen müssen, dass Angus die Chips in den Pot warf, wenn er bluffte. Es war sein Tell.
»Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß«, sagte Angus zu Eli und warf mir einen Seitenblick zu. »Ich muss mit Nik hier mithalten, der den ganzen Abend schon einen Lauf hat.«
»Den ganzen Abend schon«, zischte ein Typ namens Will.
Er saß mir genau gegenüber, harte Kanten, steinerne Blicke und Argwohn in einem schlaksigen Körper. Die Sorte Typ, der ein Messer zog, wenn man ihn überraschte – ein geborenes Arschloch, das keinen Spaß verstand, selbst wenn sein Leben davon abhinge.
Ich kannte solche Typen – er beobachtete alles, was passierte, mit Adleraugen und führte mit analfixierter Gewissenhaftigkeit Buch darüber, wer die Blinds hatte. Ich hatte ihn sofort gehasst.
Er taxierte mich zum hundertsten Mal an dem Abend, stierte auf die Tattoos auf meinen Armen und meinem Hals und auf die Silberkrallen-Piercings mit zweieinhalb Millimeter Durchmesser, die ich in den Ohren trug.
»Hoax und Pawn«, las er die Tattoos auf den Fingergliedern meiner beiden Hände. »Soll das irgendwas bedeuten?«
»Verrat ich nie vor dem dritten Date.«
Der Tisch wieherte in einer Wolke aus Rauch, Krach und Farben los. Will war sauer.
Paulie legte die Turn-Karte auf den Tisch und drehte sie um. Eine Herzsechs, ich hatte meinen Flush.
Oliver pfiff durch die Zähne und stieg aus. »Für irgendjemanden ist anscheinend heute Valentinstag, aber das bin nicht ich.«
Dem dumpfen Grau um mich herum nach zu urteilen, hatte außer mir keiner was Gutes auf der Hand. Eli, der zu dumm war, um zu wissen, wann er aufgeben sollte, versuchte einen Bluff, den nur ein Blinder mit Krückstock nicht durchschaut hätte. Drei andere hielten oder stiegen aus, und dann war ich dran mit Setzen.
»Du bist dran«, sagte Will, als würde ich das verfickt noch mal nicht wissen.
Will beobachtete mich aufmerksam. Obwohl er ein erstklassiges Arschloch war, spielte er gut; keine Tells. Wenn ich nicht das Gesicht hätte. Der dezente Geschmack seines Zweifels sagte mir, dass seine Hand nicht schlecht war, er sich aber fragte, ob ich eine bessere hatte. Ohne das Gesicht hätte ich konservativ gespielt und angenommen, dass er den besseren Flush hatte. Das Gesicht zeigte mir etwas anderes.
Ich hätte einfach All-in gehen und alle anderen zwingen sollen, auszusteigen, aber ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen, und es gefiel mir nicht, wie Will mich ansah; wie sein Argwohn sich wie Rauch um ihn verdichtete.
»Zwanzig«, sagte ich.
Will hielt meine zwanzig und erhöhte um fünfzig. Ich kämpfte gegen die Kopfschmerzen, diesen unerbittlichen Druck, der in meinem Kopf pochte.
»Du siehst nicht gut aus, Nik«, sagte Will und grinste. »Zweifel?«
»Nein.« Ich hielt seine fünfzig und trank noch einen Schluck. Es juckte mich unter der Nase, und ich rieb mit der Hand drüber, in der ich das Bier hielt. Die Tattoos auf dem Handrücken waren mit Rot verschmiert.
Fuck.
Paulie teilte die letzte Gemeinschaftskarte aus, die River Card. Kreuzfünf. Die hatte für keinen irgendeinen Wert, auch nicht für Will. Aber bei ihm machte der Stolz die Einsätze; er steckte zu tief drin, um jetzt noch aufzugeben. Die noch dabei waren, stiegen aus. Will setzte All-in.
»Idiot«, sagte Oliver. »Nik hat einen Flush. Warum schmeißt du dein Geld aus dem Fenster raus?«
»Er blufft«, sagte Will. »Er wird einknicken wie ein Liegestuhl.«
Ich nahm mir schnell eine Papierserviette und hielt sie mir unter die Nase, damit niemand das Blut sah. Es war nicht viel. Wenn ich schnell genug hier rauskam …
»Ich erhöhe«, sagte ich. Ich musste meine Chips nicht in die Mitte schieben. Sie gehörten jetzt alle mir.
»Arschloch«, sagte Will und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.
»Ich hab’s dir ja gesagt.« Oliver schnaubte.
Ich drehte meine Herzkarten um und griff nach dem Pot. Dreihundert Dollar, womit der Gewinn dieses Abends bei über sechshundert Dollar lag. »Zahl mich aus«, sagte ich zu Paulie. »Ich hör auf.«
»Nichts da«, sagte Will. »Du kannst das nicht alles einsacken, ohne uns die Chance zu geben, es zurückzugewinnen.«
»Doch, kann ich«, sagte ich dumpf und stapelte schnell meine Chips. »Ich brüte irgendwas aus. Ich hau ab.«
Paulie zahlte mich schweigend aus, und der kleine Kellerraum fühlte sich an wie der Himmel, bevor der Blitz einschlägt, brachte die Hautoberfläche zum Kribbeln.
»Ich mag dich nicht«, sagte Will und stieß mit dem Finger nach mir wie mit einem Messer.
»Beruht auf Gegenseitigkeit.«
Will war Berufsspieler wie ich. Ein Typ, der mit dem Pokern seinen Lebensunterhalt verdiente. Ich würde ihm wahrscheinlich irgendwann wieder gegenübersitzen und dann aufpassen müssen. Er wusste, dass ich falsch gespielt hatte, er wusste nur nicht wie. Ich musste mir wieder die Nase abtupfen, und Will sah das Rot auf der weißen Serviette. Er kniff die Augen zusammen und trommelte mit den Fingern vor sich auf dem leeren Filz.
Ich verließ den Keller durch eine Seitentür, die zu einer Treppe und hoch zur Straße führte, verfolgt von Feindseligkeit und Wut.
Draußen war es nicht weniger drückend als im Keller. Atlanta toste, und ich musste hier verschwinden. Ich verstaute den Gewinn in einer der beiden Satteltaschen meines Motorrads – eine Bonneville T100 Baujahr 2012, die bald 150 000 Kilometer auf dem Buckel hatte – und zog die schwarze Lederjacke an. Dann setzte ich den Helm auf, und das Visier färbte die Welt grau.
Mit spritzendem Kies fuhr ich bei dem Pfandleiher los, in den frühen Morgen hinein und raus aus Atlanta. Der bleierne Himmel drohte mit Regen.
Ein Sturm zog auf. Ein heftiger.
Ich stellte mir vor, wie er aus dem Himmel runterkäme wie eine große Faust, mich packte und zerquetschte, bis nichts mehr übrig blieb.
Ich fuhr einfach immer weiter, und meine Gedanken begaben sich auf gefährliches Terrain. In letzter Zeit hatten sie das öfter getan auf meiner endlosen Fahrt kreuz und quer durch das Land.
Es wäre so leicht, das Motorrad einfach über die Mittellinie driften zu lassen, wo im Gegenverkehr Autos an mir vorbeirasten. Die Augen zu schließen und die Maschine frontal vor einen rumpelnden Sattelschlepper zu steuern, der panisch hupte, weil er zu groß war, um noch rechtzeitig ausweichen zu können …
Manchmal dachte ich, nur die Tatsache, dass ich jemand anderen verletzen könnte, hielt mich davon ab. Andere Male war es mir egal, und meine wandernden Gedanken zogen den Lenker zu dieser Mittellinie. Ich könnte auch einfach Gas geben, alles an Geschwindigkeit rausholen, bis die Straße nur noch ein verschwommener grauer Fleck war und mich in Stücke reißen könnte; die Polizei würde mich portionsweise vom Asphalt kratzen müssen …
Das schaurige Bild war merkwürdig tröstlich. Ich wollte nicht sterben, aber das hier war kein Leben. Es sollte einfach enden.
Savannah, 5 km
Das Schild flog verschwommen vorbei. Ich beschleunigte auf über 120 Kilometer pro Stunde, um schneller zu sein als der aufziehende Regen und so viel Distanz wie möglich zwischen Atlanta und mich zu bringen. Um den Schildern nach Savannah zu folgen, hätte ich von der 16 West abfahren müssen, aber ich blieb auf dem Highway, bis das Ortsschild für Garden City, 8905 Ew. erschien. Savannah war zu groß. Dort wäre ich untergegangen, vor allem direkt nach Atlanta. Garden City war klein genug.
Selbst Hunderte von Kilometern und vier Stunden später konnte ich noch spüren, wie Atlanta an mir klebte wie der Schweiß und Dreck einer langen Reise. Ich musste zurück auf Anfang. Unter dem ganzen Lärm graben und endlich selbst etwas fühlen. Und wenn es Schmerz war. Bevor ich mich um was zu essen oder ein Motel kümmerte, fand ich in Garden City ein Tattoostudio in einer kleinen Einkaufsstraße. Ich parkte meine Bonneville vor GC Tattoos & Piercings und nahm den Helm ab.
Trotz der dunkelgrauen Sturmwolken, die sich über mir sammelten, war das sommerliche Grün von Bäumen und Gras vor den Ladenfronten kräftig und lebendig. Feuchte Luft fing das elektrische Sirren der Zikaden ein, das ewige Lied von Georgia im Juni. Anders als menschliches Leben bestürmte das Tierleben aus irgendeinem Grund nicht jeden meiner verfluchten fünf Sinne – oder die verschiedenen anderen Sinne, die außer mir niemand zu haben schien. Ich mochte die ständige Geräuschkulisse der Insekten im Süden. Wie das Surren einer Tätowiermaschine.
Im Tattoostudio war es gnädigerweise kühler und sah aus wie in einem Barbershop. Weiße Böden, dunkle Stühle, die Wände schlicht bis auf gerahmte Designs. Zwei Tätowierer waren gerade bei der Arbeit. Ein dritter kam auf mich zu, als ich mich aus der schwarzen Lederjacke schälte und sie zusammen mit dem Helm auf eine Bank neben der Tür legte. Der Typ war groß und komplett kahlgeschoren, ein roter Drache wand sich an seinem einen Arm hoch und verschwand unter seinem T-Shirt.
Ich konnte sehen, dass er gelangweilt war und endlich weg wollte aus Georgia. Ein graugrüner Nebel aus Haschrauch überlagerte seine Gedanken und dämpfte sein Bedürfnis zu verschwinden.
»Was darf’s sein?«, fragte er, als wäre er ein Barkeeper. Sein Blick wanderte über die Tattoos auf meinen Händen und Armen, hoch zu meinem Hals, dann zu den silbernen Krallen in meinen Ohren. »Ich kann tätowieren, aber unser Mann für Piercings ist heute nicht da.«
»Tattoo.«
»Okidoki.«
Er führte mich nach hinten zu seinem Arbeitsplatz, einer kleinen Nische mit gerahmten Beispielen seiner Arbeit überall an der Wand. Auf dem Weg kamen wir an den anderen zwei Tätowierern vorbei. Der Kunde auf dem ersten Platz bemühte sich nach Kräften, nicht zu zeigen, dass es zu sehr wehtat. Die jüngere Frau auf dem zweiten Platz hatte Zweifel, war aber schon zu weit, um jetzt noch aufzuhören.
»Hast du schon eine Vorstellung, was du willst?«, fragte mich der Typ.
Fast wäre mir ein »Völlig egal« rausgerutscht, aber ich konnte es noch zurückhalten. Abgesehen von PAWN und HOAX bedeuteten meine Tattoos nichts. Das Aussehen war nicht wichtig. Ich wollte nur den Schmerz.
Ich brauchte ihn.
Ich sah mich um, warf einen schnellen Blick auf seine Arbeiten. Ich entdeckte einen japanischen Koi in leuchtendem Orange und Pink, der sich um sich selbst drehte, die Schuppen fast irisierend. Ich tat so, als würde ich ein paar seiner anderen Bilder genauer betrachten, dann sah ich den Typen an.
»Ich dachte an was Japanisches«, sagte ich. »Einer von diesen … Wie nennt man die? Die großen Goldfische?«
»Koi«, sagte der Typ und tippte auf das Bild an der Wand. »Etwas in dieser Art?«
»Ja, das ist es, Mann«, sagte ich. »Genau das hatte ich mir vorgestellt.«
Er runzelte die Stirn. »Keine Veränderungen?«
»Mach ihn eher orange als pink«, sagte ich. »Und vielleicht auf einer Seite von einem japanischen Schriftzeichen in Schwarz überlagert.«
»Welchem?«, fragte der Typ, und der Ärger in seiner Stimme war deutlich zu hören. Dank des Gesichts brannten mir trübe Dämpfe leicht in meinem geistigen Auge. »Es gibt … ’n’ ziemlichen Haufen.«
Wie wär’s mit ›Scheiß auf diesen Quatsch‹, dachte ich.
»Ausdauer«, sagte ich.
»Okay. Ich bin übrigens Gus.«
»Nik«, sagte ich. »Was wird das kosten?«
Gus zuckte die Achseln. »Wie groß willst du’s haben?«
Ich hielt die Hände wie um eine unsichtbare Zuckermelone gelegt.
»So hundertachtzig«, sagte er.
»Geht klar.«
Obwohl Atlanta versucht hatte, mich zu erdrücken, wäre das Geld, das ich Will und Co. abgenommen hatte, eine hübsche Ergänzung für die zwanzigtausend Dollar, die auf meinem Bankkonto lagen – meine einzige fassbare Verbindung zur realen Welt. Ich hatte immer zweitausend in bar für Ausgaben dabei, plus eine mit dreitausend Dollar aufgeladene Prepaid-Kreditkarte für Onlinespiele. Der Punkt ist, ich hätte mir ein größeres Tattoo leisten können, aber ich hatte langsam kein freies Stück Haut mehr. Ich war überall am Hals, auf der Brust, einem großen Teil des Rückens, beiden Armen, Händen und Fingern tätowiert. Auf den Beinen hatte ich nur ein paar, aber wenn ich in diesem Tempo weitermachte, hatte ich lange vor dreißig einen Full Body.
Und was zur Hölle mach ich dann?
Der Gedanke, das beschissene Gesicht weitere sechs Jahre ertragen zu müssen, machte mich wahnsinnig. Wenn sich nicht bald etwas änderte, würde ich es nicht bis dreißig schaffen. Mann, ich würde es nicht mal bis fünfundzwanzig schaffen.
»Bereit?«, fragte Gus und riss mich aus meinen Gedanken.
»Klar.«
Ich zog mein schwarzes T-Shirt aus und zeigte ihm die einzige leere Stelle, die ich noch auf dem Rücken hatte – einen Streifen von unterhalb des Schulterblatts bis zur Taille.
»Irgendwo da ist gut«, sagte ich.
»Okidoki.«
Ich streckte mich auf der Liege aus, legte den Kopf auf die Arme und schloss die Augen, als würde ich irgendwo am Strand liegen und in der Sonne dösen. Gus legte sich Tinte und Nadeln bereit. Er versuchte Small Talk über die vielen anderen Tattoos zu machen, die meine Haut schmückten, aber meine Antworten waren kurz und knapp; er kapierte es schnell und hielt die Klappe.
Seine behandschuhten Hände berührten meine Haut, und das verstärkte die Verbindung zwischen uns, doch das Latex half. Das Surren der Nadel half auch, dämpfte das Flüstern seiner Gedanken, die Farben und Gerüche seines Lebens. Aber der Schmerz radierte sie komplett aus.
Die Nadel stach in meine Haut, ich konzentrierte mein ganzes Bewusstsein darauf, um jede Sekunde und jede halbe Sekunde dazwischen zu spüren. Der Schmerz des Tätowierens war perfekt – nicht unerträglich, aber auch nicht schwach. Dieser Tätowierer war nicht besonders sanft, und ich genoss jeden stechenden Moment. Es war meine Haut, mein Schmerz, und gehörte niemandem sonst.
Für fast zwei Stunden war ich frei.
Als er fertig war, blieb ich noch einen Moment liegen und genoss den pochenden Schmerz an der linken Seite meines Rückens.
»Hey, Kumpel. Schläfst du?«
»Nein«, murmelte ich an meinem Arm. »Ich bin … hier.«
Ich bin noch hier.
Ich fühlte mich besser. Sauberer. Ich hatte mir ein wenig Zeit verschafft. Ich setzte mich auf und schnappte mir mein T-Shirt.
»Willst du es dir vielleicht ansehen?«, fragte Gus, und eine rauchige Wolke des Argwohns kräuselte sich um ihn. Das passierte mir öfter in letzter Zeit. Er machte sich Sorgen, ich könnte verschwinden, ohne zu zahlen.
Für ihn warf ich einen Blick in den Spiegel. Der Typ war gut. Ein zähnefletschender Koi schwamm über die leicht geschwollene, gerötete Haut, die Schuppen schimmerten in iridisierendem Orange. Darüber lag auf einer Seite ein schwarzes Zeichen. Es konnte das japanische Zeichen für »Ausdauer« sein, um das ich ihn gebeten hatte. Es konnte auch heißen »Der Träger dieses Tattoos ist ein Arschloch«. Es war mir scheißegal.
»Sieht super aus«, sagte ich. Als Gus ein großes Pflaster draufklebte, holte ich meine Brieftasche raus und gab ihm zwei Hunderter.
»Danke«, murmelte ich. Ich zog das T-Shirt wieder an, warf mir die Lederjacke an einem Finger über die Schulter und ging.
Draußen ballten sich die düsteren Wolken. Wie ein Gedränge beim Rugby, kurz vor dem nächsten Angriff. Ich überlegte, mir ein Motel zu suchen, aber in derselben Strip Mall wie das Tattoostudio war ein Internetcafé. Ich konnte genauso gut das nächste Spiel finden, wo ich schon mal hier war.
Ich nahm einen Computer in einer Ecke, damit mich niemand beobachten konnte, und ging auf eine Onlinepoker-Seite. Zum Glück gab’s in dem Laden keine Beschränkungen, und ich konnte spielen. Ich gab die Nummer meiner Prepaid-Kreditkarte ein und klinkte mich in ein Texas-Hold’em-Spiel auf einem lokalen Server ein.
Innerhalb von Minuten lud mich ein User mit dem Alias TMoney1993 für übermorgen Abend zu einem Undergroundspiel in Port Wentworth, nördlich von Garden City, ein. Ich sagte zu, und er schickte mir eine PN mit der Adresse. Er hielt mich wahrscheinlich für leichte Beute.
Tut mir wirklich leid, TMoney, dachte ich. Aber ich werd dich leider abziehen.
»Tut mir leid?«, murmelte ich angewidert vor mich hin und loggte mich aus. Als würde eine gedachte Entschuldigung irgendwohin führen. Soweit ich wusste, war diese Form der Wahrnehmung eine Einbahnstraße. Trotz meiner verzweifelten Online-Suche über die Jahre hatte ich nie von jemandem gehört, der konnte, was ich konnte.
Kein einziger beschissener Mensch, nirgendwo.
Das Motel in Garden City war genau wie jedes andere Motel, in dem ich in den letzten paar Jahren übernachtet hatte. Alle verschmolzen zu einem: Doppelbett, dünner Teppich, ein Bad mit kleinen Plastikfläschchen mit billigem Duschgel. Selbst die Gefühle der Leute in den Nebenzimmern hatten dieselben Farbtöne und Geschmäcker. Ich wusste immer, wer in meiner Nähe war: gelangweilte Geschäftsreisende, Eltern, die sich bemühten, für ihre zankenden Kids so viel wie möglich aus einem billigen Familienurlaub zu machen; Touristen, die den Wunsch hatten, das größte Kordelknäuel der Welt zu sehen, bevor sie starben.
Und so war’s, wenn ich Glück hatte!
Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung sind schwarz vor meinem geistigen Auge, und in abgelegenen Motels fanden sich oft einsame und verzweifelte Gestalten. Die schlimmsten Nächte verbrachte ich in einer Dunkelheit, die schwärzer war als die Nacht, wenn der düstere Schmerz eines Menschen im Nebenzimmer in mein Zimmer sickerte wie ein Tintenfleck.
So viel Elend auf der Welt …
Und alles wurde jede wache Stunde meines Lebens in mich hineingestopft.
Ich setzte mich im Motel aufs Bett, lauschte dem lauter werdenden Donner und dem Sturm, der seine Kräfte sammelte.
Das Pflaster auf dem neuen Tattoo juckte. Ich riss es ab und genoss den Schmerz, aber er verblasste schnell.
Ich kann so nicht weitermachen …
Ich hatte das Gesicht, seit ich denken konnte, und war jahrelang hin und her gependelt zwischen hoffnungsloser Resignation und dem wütenden Drang zu erfahren, was es war oder ob es einen Sinn hatte. Hin und her, hin und her, genau wie meine Fahrten durch das Land … auf der Suche nach einer Antwort oder auf der Flucht vor ihr.
Ich stand auf und ging in dem kleinen Zimmer auf und ab. Vor dem Fenster wankten die Bäume im Wind, und die ersten Regentropfen platschten gegen das Fenster. Unwillkürlich griff ich nach dem Jagdmesser, das ich an meinem Gürtel trug. Das dumpfe Pochen des neuen Tattoos war weg.
Es funktioniert nicht mehr.
Immer öfter fragte ich mich, warum ich mir überhaupt noch die Mühe machte mit den Tattoos oder dem Pokern … oder mit sonst irgendwas.
Du brauchst die Pokergewinne zum Leben, flüsterte eine lächerliche Stimme in meinem Kopf, mein eigener sterbender Selbsterhaltungstrieb.
Ich lebte nicht. Ich war auf einem endlosen Trip nirgendwohin. Aber ich hatte ohne einen Grund, den ich hätte benennen können, zwanzigtausend Dollar Gewinne auf einem Konto, auf das ich immer mehr einzahlte. Die Ersparnisse waren wie das Gesicht; ihr Sinn und Zweck entzog sich mir. Ein hohes Buy-in vielleicht? Das größte Spiel meines Lebens? Das letzte Spiel meines Lebens? Ein Pokerspiel mit Einsätzen wie beim Russischen Roulette?
Falls ich gewann, würde ich weitermachen.
Falls ich verlor …
Du musst aufhören, so was zu denken, bevor du was Dummes machst.
Ich nahm die Hand vom Messer und schnappte mir die Jacke. Ich brauchte einen Club. Einen Ort, wo ich nicht allein war. Wo ich umgeben von Menschen war, aber ihre Gerüche, Farben und Gedanken vom Duft nach Eau de Cologne, stampfender Musik und blitzenden Lichtern gedämpft wurden.
Ich fragte den gelangweilt aussehenden Typen an der Rezeption, ob er einen Tipp hatte.
»Der nächste ist der Club 91, kurz vor Savannah«, sagte er. »Ist nicht groß, aber die Drinks sind billig.« Er sah mich komisch an, und seine Neugier tauchte seine Worte in einen zitronigen Geruch. »Kann mir nicht vorstellen, dass da heute der Bär steppt, mit dem Sturm und so.«
»Gibt nur einen Weg, das herauszufinden«, murmelte ich.
2. KAPITEL
Fiona
Es war nicht viel los bei Garden City Greens. Wegen des aufziehenden Sturms war der Verkehr auf der Route 25, an der die Gärtnerei lag, ziemlich ausgedünnt, und nur wenige Kunden schlenderten durch den Außenbereich, wo Grünpflanzen, Bäume und eine Auswahl farbenprächtiger Blumen aufgereiht waren. Ganz hinten stand Marco, unsere Aushilfe, zwischen orangenen Tontöpfen auf einer Leiter und bediente einen Kunden.
Ich half gerade einer Stammkundin, Mrs Paulson, einen über einen Meter hohen Pekannussbaum für ihren Vorgarten auszusuchen. Als ich kassierte, stellte die ältere Dame mir tausend Fragen zur richtigen Pflege des Baums, dem besten Boden und der Wahrscheinlichkeit, dass ihr Garten von Eichhörnchen gestürmt würde, die an die Nüsse wollten. Ich beantwortete alle ihre Fragen, bis ihr nichts mehr einfiel.
»Mit Botanik kennen Sie sich wirklich aus, meine Liebe«, sagte sie schließlich.
Ich zuckte die Achseln und lächelte. »Die Pflanzen sollen sich wohlfühlen.«
»Hmmm.« Zum hundertsten Mal an diesem Nachmittag fiel Mrs Paulsons scharfer Blick auf meine taillenlangen blonden Haare mit den rosa Strähnen. Unter der Garden-City-Greens-Schürze trug ich eine zu große, an den Knien mit Erde verschmutzte Männerlatzhose, dazu Doc Martens, ein ärmelloses Oberhemd, das ein Hibiskus-Tattoo auf meiner rechten Schulter zeigte, und zahllose Stoffbänder an den Armen.
»Ich weiß, ich seh’ aus wie eine Bäuerin, die gerade von einem Rave nach Hause kommt«, sagte ich grinsend.
Mrs Paulson schürzte die Lippen. »Eine was?«
»Nichts.« Ich unterdrückte ein Lachen und setzte mein schönstes Kundenservicelächeln auf. »Haben Sie jemanden, der den Baum für Sie einpflanzt, Mrs Paulson?«
»Mein Neffe und seine Frau kommen heute Abend«, sagte die ältere Dame. »Aber ich brauche Hilfe, um ihn ins Auto zu laden, am besten, bevor wir durchnässt werden.«
»Bin schon dabei«, sagte ich.
»Der muss furchtbar schwer sein«, sagte Mrs Paulson zweifelnd. Ihr Blick landete erneut auf meinen dünnen Armen, dann sah sie sich nach jemand anderem um. »Vielleicht können wir den Jungen rufen …?«
Ich ging in die Hocke und hob den Baum am Topf hoch. »Gehen Sie vor.«
Ich trug den Baum aus dem Holzgebäude der Gärtnerei, die nach reichhaltiger Erde und Blumen roch, und über den unbefestigten Parkplatz. Ich zwängte ihn schräg hinter den Beifahrersitz von Mrs Paulsons weinrotem Viertürer. Die Zweige kratzten am Dach, aber er passte.
Ich klopfte mir die Hände an der dreckigen Latzhose ab. »Schon erledigt, Mrs Paulson.«
»Ich muss zugeben, dass ich meine Zweifel hatte«, sagte die ältere Frau. »Sie haben ja nichts auf den Rippen.«
Um Himmels willen, kannst du bitte mal was essen? Du blamierst mich …
Ich zuckte innerlich zusammen bei der hässlichen Erinnerung, die plötzlich in meinem Geist aufploppte wie ein höhnisch grinsender Kastenteufel. Wir hatten über dreißig Grad, aber ich bekam eine Gänsehaut und rieb mir über die Arme.
»Ich bin stärker, als ich aussehe«, sagte ich zu Mrs Paulson und versuchte, mich an meinem Lächeln festzuhalten.
»Offensichtlich.« Sie kniff die faltigen Augen zusammen und blickte in den Himmel zu den dichter werdenden Wolken. »Ich hoffe, die schicken Sie nach Hause, bevor der Regen losgeht«, sagte sie und stieg in den Wagen. »Nicht, dass Sie noch weggespült werden.«
Ich ignorierte ihre Bemerkungen, entschlossen, mir von nichts und niemandem – weder kleinen alten Damen noch Gespenstern aus der Vergangenheit – die Laune verderben zu lassen.
Als ich wieder drinnen war, ging ich zur Kasse, wo Opal Crawford, die Geschäftsführerin, ein bisschen Buchhaltung machte. Sie hielt sich das krause Haar mit einem leuchtenden Tuch aus der Stirn, und die Leinenschürze über ihrer türkisfarbenen Bluse war makellos sauber.
Ich stützte die dreckigen Ellbogen auf dem dreckigen Tresen ab. »Mrs Paulson meinte, du sollst mich früher nach Hause schicken«, sagte ich grinsend. »Und du weißt ja, was man sagt: Der Kunde hat immer recht.«
Opal lächelte, ihre Zähne weiß im Kontrast zu ihrer warmen braunen Haut. »Könnte sein, dass dein Wunsch in Erfüllung geht und mehr als das. Ich erwarte jeden Moment, dass Mr Carlson anruft und mich bittet, die Gärtnerei zu schließen.«
Ich ließ die Schultern hängen. »Wie lange?«
»Ein paar Tage, wenn der Sturm so schlimm wird wie angesagt.«
Ich kaute auf meiner Lippe. »Ich bin sehr dafür, Freitagabend ein bisschen früher aufzuhören, aber gleich mehrere freie Tage? Ich brauch die Arbeit.«
»Apropos …« Opal nahm einen kleinen Stapel Umschläge aus der Schublade unter der Kasse, suchte den mit meinem Namen heraus und übergab ihn mir. »Weil Louisa krank war, hattest du ziemlich viele Überstunden, wobei ich nicht glaube, dass Mr C dir noch mehr genehmigen wird.«
Ich nahm meinen Gehaltsscheck in Empfang und steckte ihn in die Brusttasche der Latzhose. »Ich werde mehr brauchen, wenn wir ein paar Tage schließen.« Ich beugte mich über den Tresen und lächelte durchtrieben. »Ich hab gehört, dass Louisa einen Rückfall hatte. Ganz schlimm. Hochansteckend. Ich glaub, sie muss bestimmt noch zwei Wochen zu Hause bleiben …«
»Sie hat eine schlimme Erkältung, nicht die Beulenpest, und nein«, sagte Opal. »Ich werde nicht deine Helfershelferin!«
»Bei was?«, fragte ich lachend.
»Das weißt du genau«, sagte Opal. »Ich helfe dir nicht auch noch, Geld zu sparen, um noch schneller von hier zu verschwinden als sowieso schon.« Sie schüttelte den Kopf und schnalzte mit der Zunge. »Nein, Ma’am. Mach ich nicht. Ich werd dich viel zu sehr vermissen.«
Ich lächelte meine Freundin liebevoll an. Opal war verheiratet und zehn Jahre älter als ich mit meinen dreiundzwanzig. Sie war ruhig und gelassen, während ich in der Gärtnerei herumsprang und mir die Hände so schmutzig machte wie möglich. Ihre steife Leinenschürze von Garden City Greens war stets makellos sauber und gebügelt, während meine immer voller Erde war. »Unsere Freundschaft ergibt keinen Sinn«, scherzte sie immer, aber irgendwie passten wir zusammen. Sie war meine beste Freundin. Eine von wenigen …
Undankbare Zicke, was ist mit mir? Bin ich dir etwa nicht gut genug?
Ich zuckte wieder zusammen und wehrte mich gegen seine höhnische Stimme in meinem Kopf. An manchen Tagen war er still, dann war ich beinahe wirklich die fröhliche, glückliche Person, als die ich mich gab. An anderen Tagen – wie diesem – verfolgte er mich und sprang mich aus den dunklen Ecken meiner Erinnerung an wie bei einem makabren Paintball-Spiel. Ich musste kämpfen, um fröhlich zu bleiben, als würde ich unter einem dunklen Himmel hin und her rennen und versuchen, im Sonnenschein zu bleiben.
In Costa Rica wird immer die Sonne scheinen, dachte ich und stupste Opal gegen den Ellbogen. »Du bist schon meine Helfershelferin. Du hilfst mir, meinen Traum wahr zu machen, nach Costa Rica zu gehen.«
Sie schniefte. »Du bist nah dran, oder?«
»Ja, bin ich«, sagte ich, und Freude erblühte in meinem Herzen und warf die bösen Erinnerungen hinaus, wie ein helles Licht die Schatten vertrieb. »Ich denke, ich könnte in sechs Monaten genug haben, um mich da unten einzurichten.«
Opal wollte etwas sagen, dann klappte sie den Mund zu. »Nein. Egal.«
»Was?«, fragte ich, auch wenn ich glaubte, es zu wissen.
»Nichts.« Sie wischte ein bisschen Dreck ab, den ich auf ihrem Ärmel hinterlassen hatte, und arbeitete weiter an der Kasse.
»Oh-oh«, sagte ich, weil ich wollte, dass die Leichtigkeit zwischen uns blieb. »Da ist schon wieder dieses Opal-Crawford-Bärenmama-Ding. Immer, wenn ich über Costa Rica rede …«
»Keine Ahnung warum«, murmelte sie, ohne von den Quittungen aufzusehen, die sie zählte. »Bestimmt nicht, weil du erst dreiundzwanzig bist und fünfzigtausend Kilometer weit weg in ein fremdes Land ziehst, dessen Sprache du nicht mal sprichst. Ganz allein. Nein, damit kann es auf keinen Fall was zu tun haben.«
»Es wird mir dort gutgehen«, sagte ich. »Besser als gut. Es ist das, was ich will. Ein kleines, von Dschungel umgebenes Stück Land, mit den Bergen im Rücken und dem Strand zu meinen Füßen. An wie vielen Orten auf der Welt gibt es das schon?«
Opal sah mich aus ihren schönen braunen Augen an, und in ihrem tiefen Blick lag mehr als nur scherzhaftes Beschützen. »Ich will einfach nur sicher sein, dass du da hinziehst, weil du es willst«, sagte sie langsam. »Nicht, um von ihm weiter weg zu sein.«
Ich erstarrte und schob mir dann eine lange rosa Haarsträhne hinters Ohr. »Warum geht nicht beides?«
Opals nachdenklicher Blick wurde tiefer, ein nüchterner, mitfühlender Blick, hinter dem sich tausend Gedanken verbargen. Sie ging zur Abendschule, um einen Abschluss als Psychotherapeutin zu machen, und ich wusste, dass sie mich als eine Art Freizeitprojekt sah und dazu bringen wollte, offener über ihn zu reden. Meinen Ex. Steve Daniels. Ich hatte ihr fast nichts von ihm erzählt, nur dass ich einen Ex hatte (ich ließ sie in dem Glauben, es wäre ein Exfreund) und dass es schlecht ausgegangen war. Sie wusste, dass mehr dahintersteckte, aber ich konnte mich nicht überwinden, ihr davon zu erzählen.
Es ist zu erniedrigend.
Ich wollte die Worte nicht aussprechen. Sie sollten die Jahre der Ehe mit diesem Soziopathen nicht real machen. Ich wollte nicht zugeben, dass ich eine naive und leicht manipulierbare Achtzehnjährige gewesen war. Nicht gestehen, dass er mich verzaubert und zu einer stürmischen Romanze überredet hatte, bis die Maske seines falschen Charmes von ihm abgefallen war und sich dahinter der manipulative Lügner gezeigt hatte. Er hatte mich belogen, beleidigt, klein gemacht und mein Selbstwertgefühl zerstört, und dann hatte er in meinem Schoß geweint, dass ich der einzige Mensch sei, der ihn verstehen würde. Und er hatte die Kontrolle über das Geld und mich zu einer Gefangenen gemacht, nicht nur im Haus, sondern in meinem eigenen Kopf.
Steve hatte alles ausgelöscht, was ich über mich zu wissen glaubte, und die Leere mit Zweifeln, Hass und der Unfähigkeit gefüllt, meinen eigenen Gefühlen zu vertrauen. Costa Rica war alles, was er nicht war – grün und golden und voller Sonne.
Finde den Sonnenschein …
»Hey«, sagte ich fröhlich, stützte die Unterarme auf die Theke, beugte mich vor und hob die Füße an. »Ich will heute Abend tanzen gehen. Kommst du mit?«
»Ich hab von deinem Themenwechsel gerade ein Schleudertrauma gekriegt.« Opal sah mich noch einen Moment lang an, dann beließ sie es dabei. Fürs Erste. »Seit wann gehst du tanzen?«
»Seit dieser Minute. Willst du?«
»Ich kann heute nicht«, sagte sie. »Jeff schleppt mich zum Bingoabend bei den Shriners mit. Ist das zu glauben? Wahrscheinlich kommt sogar Mrs Paulson, Herrgott.« Sie schloss mit einem lauten Knall die Registrierkasse.
»Bingo? Bei den Shriners?« Ich legte mir die Hand auf den Mund, und ein Dutzend bunter Stoffarmbänder rutschten mir den Arm hinunter.
»Ja, ja, ich weiß«, murmelte Opal. »Aber er macht es ehrenamtlich, und zwei zusätzliche Hände können wahrscheinlich nicht schaden.«
»Du meinst, du konntest nicht widerstehen, jemandem zu helfen«, sagte ich liebevoll.
Opal winkte ab. »Ich bin sowieso zu alt, um tanzen zu gehen«, sagte sie. »Zu jung für Bingo bei den Shriners, zu alt zum Tanzengehen. Heißt das, ich bin mittleren Alters? Jetzt schon?«
»Absolut«, neckte ich sie, schnappte mir einen Besen und fegte den Bereich vor der Kasse.
»Ich freue mich, dass du ausgehst«, sagte Opal. »Vielleicht triffst du einen netten Mann, mit dem du dich gut verstehst …« Sie zuckte die Achseln, bemühte sich, neutral zu klingen. »Du arbeitest hier seit zwei Jahren, und ich hab dich nie mit jemandem gesehen.«
»Ich ziehe bald nach Costa Rica«, sagte ich schnell. »Wozu jetzt noch was anfangen. Das wär nicht fair.« Ich hörte einen Moment auf zu fegen und stützte mich auf den Besen. »Andererseits ist es eine Ewigkeit her, dass ich die Gesellschaft eines Menschen männlichen Geschlechts genossen habe.« Ich warf ihr ein anzügliches Grinsen zu. »Ein Mädchen hat schließlich Bedürfnisse.«
Die Miene meiner Freundin hellte sich sofort auf. »Du kleines Luder!«, sagte sie. »Ein One-Night-Stand?«
Ich zögerte. Das mit den »Bedürfnissen« hatte ich eigentlich als Scherz gemeint, aber es laut auszusprechen, hatte sie geweckt. Es war ewig her, dass ich mit einem Mann zusammen gewesen war. Ich hatte mich so sehr darauf konzentriert, von Steve wegzukommen und für Costa Rica zu sparen, dass ich diesen Teil der menschlichen Erfahrung völlig vernachlässigt hatte. Meinem Körper fehlten die Berührungen eines Mannes. Andere Leute hatten ständig One-Night-Stands. Das könnte ich doch auch … oder nicht?
Seit ich Steve vor zwei Jahren weggelaufen war, hatte ich mir geschworen, nach meinen Regeln zu leben, und das hieß, keine zu haben. Wenn ich Lust auf etwas hatte, was aufregend war oder Spaß machte, dann tat ich es. Ich hatte es satt, mich in den Schatten zu ducken. Ich würde lautstark drauflos leben. Warum nicht einen One-Night-Stand haben, wenn ich wollte?
»Warum nicht?«, sagte ich und fegte die toten Blätter unter dem Gummibaum neben der Tür zusammen. »Eine großartige Nacht voller Leidenschaft und ohne Verpflichtungen? Damit könnte ich leben.«
Mir wurde heiß. Ich konnte mehr als nur damit leben, merkte ich. Ich vermisste das Gewicht einer männlichen Hand auf meinem Körper, vermisste es, mich in der Ekstase zu verlieren. Vielleicht würden die flüsternden Stimmen der Vergangenheit in Gegenwart von jemand anderem ausgeblendet. Einem attraktiven Fremden, den ich nicht länger als eine Nacht kennen musste.
»Ja, vielleicht mach ich das«, sagte ich. »Oder ich guck einfach, was passiert.«
Opal sah mich an. »Wie funktioniert ein One-Night-Stand heutzutage überhaupt? Man gräbt jemanden an und geht mit zu ihm?«
»Ich bin keine Expertin«, sagte ich. »Aber ich glaube, ich sollte ihn mit zu mir nehmen. Am nächsten Morgen geht die Sonne auf, ich bleibe, er geht.«
»Muss er denn gehen?«, fragte Opal sanft.
»Ja, muss er«, gab ich zurück, erwiderte ihren Blick und fegte den kleinen Blätterhaufen hin und her.
»Nicht alle Männer sind wie Steve.«
»Ich weiß«, sagte ich. »Aber ich bin nicht dazu in der Lage, den Unterschied zu erkennen.«
Du bist so dumm … eine dämliche kleine Idiotin …
Ich schüttelte den Kopf und fegte energischer weiter.
»Ich muss nach Costa Rica. Wenn ich erst einmal dort bin, kann ich … einfach sein. Wenn ich mich selbst wiederfinde … Nein.« Ich schüttelte entschieden den Kopf. »Wenn ich mir mein Selbst zurückhole, kann ich auch wieder daten. Und vielleicht wieder lieben.«
Das klang unmöglich. Der Gedanke, mein Herz in die Hände eines Mannes zu legen, ihm einfach zu vertrauen, kam mir völlig unmöglich vor.
»Das wünsche ich dir«, sagte Opal. »Aber mir wäre es einfach lieber, du würdest hierbleiben, damit ich es sehe.«
»Es wird irgendwann passieren«, sagte ich für sie und brachte ein Lächeln zustande. »Und bis dahin muss eben ein leidenschaftlicher One-Night-Stand reichen.«
Opal lachte wider Willen. Ich wusste, dass sie mir helfen wollte, aber das Einzige, was mir helfen konnte, war Costa Rica. In ein anderes Land zu gehen würde mir helfen. Dann könnte ich endlich aufhören, mir ständig über die Schulter zu gucken.
Ich wäre frei.
»Wie du meinst, Fi«, sagte Opal. »Ich sage nur, verschließ dich dem nicht grundsätzlich, okay?«
»Okay«, sagte ich, weil es am leichtesten war. Viel leichter, als zu erklären, dass mein Leben jetzt mir gehörte und ich nicht so dumm wäre, es aus der Hand zu geben. Nie wieder.
Opal behielt recht. Mr Carlson, der Besitzer der Gärtnerei, rief an und gab ihr die Anweisung zu schließen, bis der Sturm vorbei wäre. Opal legte auf und drehte sich zu mir um.
»Sag noch schnell Marco, dass wir zumachen, dann hast du frei und kannst mit einem großen dunklen Unbekannten Matratzensport treiben.«
»Hast du wirklich gerade Matratzensport gesagt?« Ich lachte. »Ich glaub, ein Bingoabend ist vielleicht doch dein Ding.«
»Ach, halt den Mund.«
Ich suchte Marco, und wir schlossen die Gärtnerei zu. Opal umarmte mich auf dem Parkplatz neben meinem alten blauen Prius. Der Himmel über uns war gelblich grau, und in der Ferne grollte Donner.
»Pass auf dich auf«, sagte Opal, ihre Mamabärstimme war wieder da. »Tu nichts, was ich nicht auch tun würde.«
»Da bleibt ja nicht viel übrig«, neckte ich sie.
Sie schnaubte. »Fahr. Amüsier dich. Sei vorsichtig.«
Ich fuhr auf der 25 nach Norden in die Randgebiete von Garden City. Das Haus, in dem ich wohnte, war klein und sah aus wie ein einstöckiges Motel inmitten von Kastanien und Eichen, als würde es in seinem eigenen kleinen Wäldchen stehen.
Auf dem Weg dachte ich über meine Pläne für den Abend nach. Bei dem Gedanken an einen One-Night-Stand flatterten Schmetterlinge in meinem Bauch, und meine Wangen wurden heiß. Ich fragte mich, ob Griff und Nate mitkommen würden, um mir den Rücken zu stärken.
Ich parkte vor Nummer 4, stieg aus und klopfte bei Nummer 5, während ich nervös zum Himmel blickte, an dem sich die Gewitterwolken verdichteten. Das Zirpen der Zikaden war immer im Hintergrund, es übertönte den Verkehrslärm der Route 25 fast, was noch dazu beitrug, dass das Gebäude irgendwie abgeschieden wirkte. Regnen würde es wahrscheinlich erst in ein paar Stunden.
Nate Miller machte die Tür auf und sah wahnsinnig gut und ein bisschen schickimicki aus in Polohemd und Khaki-Hosen. Sein kurzes, dunkles Haar war perfekt gegelt.
»Fiona, Schatz! Mein Gott, du bist ja total verdreckt.« Er umarmte mich vorsichtig, damit der Dreck von der Latzhose nicht an seiner Kleidung hängenblieb. »Du bist für heute fertig mit Mulch-Herumkarren und Raupen-Verkaufen?«
»Bin ich«, sagte ich. »Und ich hab mich gefragt, ob du und Griff nicht Lust habt, heute mit mir im Club 91 tanzen zu gehen.«
»Ich würd total gern, Süße, aber meine bessere Hälfte besteht darauf, sich in Savannah das Theaterstück von einem Freund von ihm anzugucken. Ein experimentelles Stück, das garantiert absolut furchtbar ist, aber …« Er seufzte. »Ich hab versprochen, dass ich mitkomme.«
Griffin erschien an der Tür, sein blondes Haar lockte sich um seine Ohren. Er hatte sich auch in Schale geworfen, trug eine stylische Jeans und ein Seidenhemd, das am Kragen offen stand. »Genau«, sagte er und warf seinem Mann einen bewundernden Blick zu. »Nathaniel hat versprochen, seinen Teil dazu beizutragen, die Künste zu unterstützen.«
»Die Künste«, sagte Nate, malte Anführungszeichen in die Luft und verdrehte die Augen.
Ich lachte. »Dann muss ich wohl allein los.«
»Wohin?«, fragte Griffin.
»Tanzen im Club 91.« Und einen Fremden aufgabeln und für rein sexuelle Zwecke mit nach Hause nehmen. Ich biss mir in die Backe, um nicht loszulachen. Ein leises aufgeregtes Kribbeln wanderte mir über den Rücken. Mein Leben, meine Regeln.
»Das fällt leider ins Wasser, Fi«, sagte Griffin. Er gab mir ein Küsschen auf die Wange, dann blickte er in den Himmel. »Wortwörtlich. Dieser Sturm soll ziemlich heftig werden.«
Nate runzelte die Stirn. »Vielleicht solltest du lieber nicht fahren.«
»Und wenn, dann trink nichts«, fügte Griffin hinzu.
»Oder ruf ein Uber.«
»Oder ruf uns an.«
Ich winkte kopfschüttelnd ab. »Gott, ihr seid schlimmer als Opal. Und mit schlimm meine ich wunderbar und unglaublich und ich liebe euch.« Ich ging rückwärts den Weg zu meiner Tür und warf beiden eine Kusshand zu. »Viel Spaß beim Unterstützen der Künste.«
»Spaß, sagt sie«, stöhnte Nate. »Bis dann, Süße.«
»Wir haben dich lieb, Fi!«, rief Griffin mir nach.
An meiner Tür wollte ich gerade den Schlüssel ins Schloss stecken, als ich es hupen hörte. Ich drehte mich um und sah Nancy Davis und ihre vierjährige Tochter Hailey aus der Nummer 8 in Nancys silbernem SUV vom Parkplatz fahren. Hailey winkte hektisch mit ihrer kleinen Hand und lächelte.
Ich winkte zurück. Ich passte immer, wenn Nancy mich brauchte, auf sie auf. Am liebsten würde ich jeden Abend babysitten. Es gab nichts Schöneres, als wenn Hailey beim Einschlafen ihr süßes kleines Köpfchen unter meinen schob oder den Geruch ihrer Haare oder dass sie jeden Tag mehr Worte wusste; ein kleines Kind, das heranwuchs und lernte und seinen Weg durch die Welt machte …
Ich hatte Opal gesagt, dass Steve mir die Fähigkeit genommen hatte, meinen Gefühlen zu vertrauen, aber das war nicht das Schlimmste. Er hatte mir noch etwas anderes genommen, was ich mehr wollte als alles auf der Welt.
Der Schmerz rammte mir eine Faust in den Magen, und ich wusste nicht, ob er erinnert oder nur eingebildet war.
Ich unterdrückte ein Schluchzen und winkte Nancy schwach, als sie davonfuhren.
»Verdammt«, flüsterte ich. Ich hielt mich am Türknauf fest, bis es nicht mehr wehtat, und verdrängte das Gefühl, bevor es seine Zähne in mich schlug und mir den Abend komplett verdarb. Ich konnte nach Costa Rica, nach Nepal oder an den Nordpol weglaufen, und es wäre nicht weit genug. Ich könnte ganze Felder vollpflanzen und mich um tausend Tiere kümmern, und es würde nichts bewirken. Die Leere würde trotzdem bleiben. Für immer.
Ich atmete geräuschvoll ein, schloss die Tür auf und betrat meine kleine Einzimmerwohnung. Ich machte die Tür hinter mir zu und stellte mir vor, dass ich auch Steve und die schrecklichen Jahre damit ausschloss. In meiner perfekt quadratischen Wohnung fühlte ich mich sicher. Das Bad und mein Bett waren rechts von der Tür, eine Küchenzeile links an der Wand und davor ein kleiner Wohnbereich. Hinten umrahmte ein altes, breites Fenster den Blick auf die Eichen und Kastanien, die das Gebäude umringten.
Abgesehen von der superniedrigen Miete, dank der ich für Costa Rica sparen konnte, war es dieser Blick, dessentwegen ich mich vor zwei Jahren für die Wohnung entschieden hatte. Ich konnte so tun, als wäre ich schon in meinem Wald, weit weg von der Zivilisation, mitten im üppigen Grün der Wildnis. Und weil sie von innen nicht so viel hermachte, dekorierte ich sie mit Dutzenden Topfpflanzen.
Lemony Snicket trillerte eine Begrüßung in seinem Käfig am Fenster. Mein kleiner Kanarienvogel hüpfte von einer Stange auf die andere und wieder zurück, seine gelben Flügel flatterten.
Ich ging zu seinem Käfig und legte meine Finger an das Gitter. »Hallo mein Süßer«, flötete ich. Er pickte einmal sanft daran und hüpfte weg.
»Es gibt Sturm«, sagte ich und hob den Käfig von seinem Haken am Fenster. »Ich stell dich hier hin, damit du keine Angst kriegst, wenn es blitzt, okay?«
Ich stellte den Käfig auf die Küchentheke und pfiff. Er sang zur Antwort. Draußen grummelte in der Ferne der Donner.
»Ein heftiger Sturm«, murmelte ich. »Vielleicht sollte ich doch zu Hause bleiben …«
Wo warst du? Draußen? Allein? Und hast mich nicht vorher gefragt?
Ich biss die Zähne zusammen. »Ich gehe«, sagte ich. Ich drehte mich zu Lemony in seinem Käfig um. »Ich will ausgehen, also gehe ich aus. Und wenn ich einen Mann mit nach Hause nehmen will, mach ich auch das.«
Die Worte ausgesprochen zu hören half mir, mich in meinem Entschluss zu bestärken, gegen den unerbittlichen Geist meines Exmannes. Ich fragte mich, ob er überhaupt als Exmann betrachtet werden konnte, da ich mich nie wirklich hatte scheiden lassen.
»Ja«, antwortete ich mir laut und vernehmlich und erinnerte mich daran, dass ich unsere Ehe im Kopf schon vor langer Zeit annulliert hatte.
»Eine Ehe«, sagte ich zu Lemony, »soll ein Pakt zwischen zwei Menschen sein, die sich lieben und füreinander sorgen. Sie ist nicht dazu da, die andere Person einzuschüchtern, sich ihr Geld zu nehmen und sie im eigenen Zuhause einzusperren. Hab ich recht oder hab ich recht?«
Lemony hüpfte hin und her.
Ich machte den Kühlschrank auf, um Abendessen zu machen. »Er ist weit weg, und ich bin hier und werde heute jemanden mit nach Hause nehmen, weil ich eine erwachsene Frau bin«, sagte ich und holte einen frischen Salatkopf, eine Tüte Erbsen und einen Maiskolben aus dem Kühlschrank. Ich legte alles auf die Arbeitsplatte, und ein kleines Lächeln fand den Weg auf meine Lippen. »Ich entschuldige mich schon im Voraus, Lemony, für das, was du heute Nacht vielleicht sehen wirst, aber ich brauche ein bisschen körperliche Nähe. Oder, ehrlich gesagt, ziemlich viel.«
Hitze überlief meine Haut, vertrieb die Kälte von Steves Stimme, die in meinem Kopf widerhallte.
Ich hackte den Salat, schälte die Erbsen, löste die Maiskörner mit einem Messer vom Kolben und tat alles in eine Schüssel. Dann goss ich Ranch-Dressing drüber und ließ mich auf den Hocker an der Küchentheke fallen, um zu essen. Die Schüssel war bis obenhin voll mit Grünzeug und Mais, aber … es war nur ein Salat.
Ist das alles, was du essen willst? Mein Gott …
»Ja«, antwortete ich und aß einen großen Bissen. Ich hatte nie viel Appetit, und mein Stoffwechsel war schnell. Ich konnte unglaublich viel essen und nicht zunehmen …
Magersüchtige Zicke …
Ich schloss die Augen, und das Essen verwandelte sich in meinem Mund in Lehm. Es fiel mir schwer zu schlucken.
»Wie wär’s mit Musik?«, fragte ich meinen Vogel.
Ich öffnete iTunes auf meinem Smartphone, und bald wurde die kleine Wohnung von Fiona Apples »Criminal« erfüllt. Ich mochte den Song. Er handelte von einer Frau, die mit dem Herzen eines Mannes spielte, nicht andersrum. Ich liebte Fiona Apple, ihre volle Stimme, die kluge Poesie, den Sound …
Und ihren Namen.
Ich aß den Salat ganz auf, obwohl ich schon nach der halben Schüssel satt war. Ich zwang mich, aufzuessen, und hasste es, dass mir der letzte Bissen wie eine Niederlage vorkam, obwohl er ein Sieg sein sollte.
Nein, dachte ich und stellte die Schüssel in die Spüle. Tränen brannten mir in den Augen, aber ich blinzelte sie weg. EsgibtkeinenSiegundkeineNiederlage;esistnureindämlicherSalat.
Es donnerte wieder, diesmal in der Nähe, und der Himmel vor dem Fenster verdunkelte sich. Ich kämpfte, um meine gute Laune wiederzufinden. Der Wunsch, zu tanzen und Spaß zu haben, war noch da. Wie immer musste ich mich nur wie ein Bergarbeiter durch die Überbleibsel von Steves Manipulierungsversuche graben und, bedeckt mit schwarzem Staub und mit Asche im Mund, versuchen, an die darunterliegenden Diamanten zu kommen.
»Scheiß auf ihn«, murmelte ich.
Ich ging in mein kleines Bad. In meiner rosa gefliesten Dusche wusch ich den Dreck von der Arbeit ab und summte, um die Erinnerungen fernzuhalten. Das war auch ein Grund, weshalb ich den Lärm und die stampfende Musik eines Clubs liebte – beides übertönte das heimtückische Flüstern und erfüllte mich stattdessen mit Musik.
Als ich aus dem Bad kam, hatte ich mein Lächeln wieder.