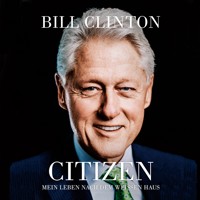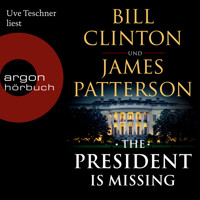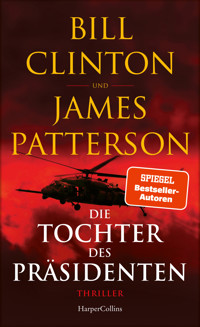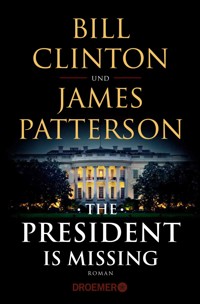
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nackte Angst hält die USA im Würgegriff, Gerüchte brodeln über: Von Cyberterror und Spionage ist die Rede, ja selbst von einem Verräter im Kabinett. Sogar der Präsident gerät unter Verdacht – und ist plötzlich verschwunden … Über drei dramatische Tage wirft The President Is Missing ein Schlaglicht auf die Störanfälligkeit jener komplizierten Mechanismen, die für das reibungslose Funktionieren der hoch entwickelten Industrienation USA sorgen. Gespickt mit Informationen, über die nur ein ehemaliger Oberbefehlshaber verfügt, ist dies wohl der authentischste Polit-Thriller, der je über die USA geschrieben wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Bill Clinton / James Patterson
THE PRESIDENT IS MISSING
Roman
Aus dem Amerikanischen von Anke und Eberhard Kreutzer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Es gibt Dinge, die nur ein Präsident wissen kann.
Es gibt Dinge, die nur ein Präsident tun kann.
Doch was geschieht, wenn der Präsident verschwindet?
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
Widmung
Donnerstag, 10. Mai
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Freitag, 11. Mai
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
Samstag in Amerika
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
104. Kapitel
105. Kapitel
106. Kapitel
107. Kapitel
108. Kapitel
109. Kapitel
110. Kapitel
111. Kapitel
112. Kapitel
113. Kapitel
114. Kapitel
115. Kapitel
116. Kapitel
117. Kapitel
118. Kapitel
119. Kapitel
120. Kapitel
121. Kapitel
122. Kapitel
123. Kapitel
Sonntag
124. Kapitel
125. Kapitel
126. Kapitel
Montag
127. Kapitel
128. Kapitel
Epilog
Danksagung
Die Figuren und Ereignisse in diesem Buch
sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit
tatsächlichen lebenden oder verstorbenen Personen
sind rein zufällig und von den Verfassern
nicht beabsichtigt.
Besonderer Dank gebührt Robert Barnett, unserem Anwalt und Freund, der uns zu diesem Buchprojekt zusammengebracht, uns mit Rat, mit Zuckerbrot und manchmal Peitsche zur Seite gestanden hat.
Auch David Ellis sei Dank, der uns – mit Geduld und kluger Umsicht – von den Recherchen über die ersten beiden Handlungsskizzen bis zum letzten von zahlreichen Entwürfen die Treue gehalten hat. Ohne Davids Hilfe und Inspiration wäre diese Geschichte so nicht zustande gekommen.
Dank an Hillary Clinton, die mit der Bedrohung und den Konsequenzen nicht beherzigter Warnungen gelebt und gekämpft hat, für ihre fortgesetzte Ermutigung zur Wirklichkeitsnähe.
An Sue Patterson für ihre besondere Fähigkeit, Kritik mit Ermutigung zu verknüpfen, oft in einem Atemzug.
An Mary Jordan, die immer einen kühlen Kopf behält, selbst wenn alle um sie herum die Nerven verlieren.
An Deneen Howell und Michael O’Connor, die dafür sorgten, dass wir uns alle an den Vertrag und pünktlich an den Zeitplan hielten.
An Tina Flournoy und Steve Rinehart dafür, dass sie dabei geholfen haben, dem Neuling der beiden Partner pflichtgetreu seinen Part beizusteuern.
Und an die Männer und Frauen des US Secret Service sowie alle anderen, die im Gesetzesvollzug, beim Militär, in den Geheimdiensten und im diplomatischen Dienst mit großem persönlichem Einsatz für unser aller Sicherheit und Wohlergehen sorgen.
Donnerstag, 10. Mai
1
»Der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses eröffnet die erste Anhörung …«
Die Haie ziehen ihre Kreise, riechen Blut. Dreizehn an der Zahl, acht von der Oppositionspartei und fünf von meiner, Haie, gegen die ich gemeinsam mit Anwälten und Beratern Verteidigungsstrategien vorbereitet habe, denn wie ich aus leidvoller Erfahrung weiß, kommt man gegen Raubtiere mit Stillhalten nicht weit. Früher oder später bleibt einem keine andere Wahl, als zum Gegenangriff überzugehen und sich seiner Haut zu wehren.
Tun Sie das nicht, hat mich meine Stabschefin Carolyn Brock gestern Abend angefleht, und das nicht zum ersten Mal. Sie müssen um diese Anhörung einen großen Bogen machen, Sir. Sie können nur verlieren.
Sie dürfen deren Fragen nicht beantworten, Sir.
Das wäre das Ende Ihrer Präsidentschaft.
Ich lasse der Reihe nach den Blick über die dreizehn Gesichter schweifen, die mir wie in einer Neuauflage der spanischen Inquisition entgegenstarren. Der Mann mit dem silbergrauen Haar in der Mitte, hinter dem Namensschild Mr Rhodes, räuspert sich.
Lester Rhodes, der Sprecher des Repräsentantenhauses, nimmt gewöhnlich nicht an Ausschuss-Hearings teil, doch diesen Sonderausschuss, den er mit handverlesenen Abgeordneten seiner Partei besetzt hat, Leuten, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, meine Agenda zu sabotieren und mich politisch wie persönlich zu vernichten, diesen Leckerbissen lässt er sich nicht entgehen. Brutalität im Streben nach Macht ist älter als die Bibel, und ein paar meiner Gegner hegen gegen mich einen abgrundtiefen Hass. Es genügt ihnen nicht, mich einfach nur aus dem Amt zu jagen. Sie werden nicht ruhen und rasten, bis sie mich hinter Gittern, gestreckt und gevierteilt sehen, meinen Namen aus den Geschichtsbüchern getilgt haben. Was sag ich, sie würden auch noch mein Haus in North Carolina abfackeln und auf das Grab meiner Frau spucken, wenn sie könnten.
Ich ziehe das Mikrofon am Flexarm zu voller Länge aus, so nah wie möglich zu mir heran. Ich will mich nicht vorbeugen müssen, wenn ich spreche, während die Ausschussmitglieder auf ihren Lederstühlen kerzengerade wie Königinnen und Könige thronen. Vorgebeugt sähe ich schwach und eingeschüchtert aus – eine unterschwellige Botschaft, dass ich ihnen nicht gewachsen wäre.
Ich sitze ihnen allein gegenüber. Keine Berater, keine Anwälte, keine Notizen. Das amerikanische Volk wird mich nicht zu sehen bekommen, wie ich mich, die Hand über dem Mikrofon, im Flüsterton mit einem Anwalt berate, bevor ich sie wegziehe und meinen Gegnern erkläre: Das ist mir momentan entfallen, Herr Abgeordneter. Ich habe es nicht nötig, mich zu verstecken. Ich sollte nicht hier sitzen, und ganz bestimmt will ich nicht hier sitzen, aber was soll ich machen? Da bin ich nun mal, nur ich. Der Präsident der Vereinigten Staaten stellt sich den Fragen einer pöbelnden Meute.
In einer Ecke des Raums verfolgt das Triumvirat meiner engsten Berater das Geschehen: Stabschefin Carolyn Brock; Danny Akers, mein ältester Freund und Rechtsberater des Weißen Hauses; Jenny Brickman, meine stellvertretende Stabschefin und engste politische Beraterin – alle mit stoischer, undurchdringlicher Miene, besorgt. Jeder von ihnen hat versucht, mir die Sache auszureden. Sie sind der einhelligen Meinung, ich sei dabei, den größten Fehler meiner Präsidentschaft zu begehen.
Aber da bin ich nun mal. Es ist so weit. Wir werden sehen, ob sie richtigliegen.
»Mr President.«
»Mr Speaker.« Streng genommen sollte ich ihn in dieser Konstellation mit Mr Chairman ansprechen, doch mir fallen noch eine Menge andere Bezeichnungen für ihn ein, die ich für mich behalten werde.
Für den Auftakt gibt es eine Reihe von Optionen. Zum Beispiel eine als Frage verschleierte selbstgerechte Ansprache des Sprechers. Doch ich habe genügend Videomaterial von Lester Rhodes gesehen, von Zeugenbefragungen aus der Zeit vor seinem Karrieresprung, als er noch ein mittelmäßiger Abgeordneter im Kontrollgremium war, um zu wissen, dass er am liebsten mit einem Frontalangriff eröffnet und dem Zeugen sofort an die Gurgel springt, um ihn aus dem Konzept zu bringen. Er weiß – wie jeder andere auch, seit Michael Dukakis 1988 in der Debatte um die Todesstrafe die erste Frage vergeigt hat –, wie entscheidend die Eröffnungsfrage ist. Geht sie daneben, kann man den Rest vergessen.
Ob der Sprecher gegen einen amtierenden Präsidenten dieselbe Strategie verfolgt?
Aber ja!
»President Duncan«, fängt er an, »seit wann machen wir es uns zur Aufgabe, Terroristen zu schützen?«
»Tun wir nicht«, kontere ich so prompt, dass ich ihm dazwischenfahre, weil man eine solche Frage nicht eine Sekunde lang im Raum stehen lassen darf. »Werden wir nie. Jedenfalls nicht, solange ich Präsident bin.«
»Sind Sie sich da ganz sicher?«
Hat er das wirklich gerade gesagt? Mir steigt die Hitze ins Gesicht. Es ist noch keine Minute vergangen, und schon hat er bei mir einen Nerv getroffen.
»Mr Speaker«, setze ich nach, »wenn ich es gesagt habe, dann meine ich es auch. Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: Wir machen es uns nicht zur Aufgabe, Terroristen zu schützen.«
Nach dieser Bekräftigung schweigt er einen Moment. »Nun, Mr President, um uns hier nicht in Wortklaubereien zu verlieren: Sind die Söhne des Dschihad für Sie eine Terrororganisation?«
»Selbstverständlich.« Meine Berater haben mir davon abgeraten, selbstverständlich zu sagen; es kann, wenn man nicht genau den richtigen Ton trifft, herablassend klingen.
»Diese Gruppierung wurde schon von Russland unterstützt, nicht wahr?«
Ich nicke. »Von Zeit zu Zeit hat Russland die SdD unterstützt, das stimmt. Wir haben Russlands Unterstützung der SdD und anderer Terrororganisationen verurteilt.«
»Die Söhne des Dschihad haben auf drei verschiedenen Kontinenten Terrorakte begangen, ist das korrekt?«
»Das ist eine zutreffende Zusammenfassung, ja.«
»Und sie sind für den Tod Tausender Menschen verantwortlich?«
»Ja.«
»Einschließlich Amerikaner?«
»Ja, das ist korrekt.«
»Zum Beispiel für die Explosionen im Hotel Bellwood Arms in Brüssel, bei denen siebenundfünfzig Menschen ums Leben kamen, darunter eine Delegation bundesstaatlicher Abgeordneter aus Kalifornien? Für den Hackerangriff auf das Flugsicherungssystem der Republik Georgien, der drei Flugzeuge zum Absturz brachte, wobei in einem davon der Botschafter der Vereinigten Staaten in Georgien saß?«
»Ja«, antworte ich. »Diese beiden Terrorakte liegen zwar vor meiner Präsidentschaft, aber in der Tat hat sich die Terrormiliz Söhne des Dschihad zu diesen beiden Anschlägen bekannt –«
»Gut, dann reden wir doch mal davon, was passiert ist, seit Sie Präsident sind. Ist es nicht so, dass die Söhne des Dschihad hinter einem Hackerangriff auf militärische Datensysteme Israels stehen und geheime Informationen über verdeckte Einsätze sowie Truppenbewegungen Israels enthüllt haben? Und zwar erst vor wenigen Monaten?«
»Ja«, antworte ich, »das stimmt.«
»Dann der nächste Anschlag, diesmal bei uns vor der Haustür, hier in Nordamerika«, fährt er fort. »Vor gerade mal einer Woche. Freitag, den vierten Mai. Haben die Söhne des Dschihad da nicht einen weiteren Terroranschlag verübt, indem sie sich in die Rechner des U-Bahn-Systems von Toronto hackten und es zum Erliegen brachten, sodass Züge entgleisten und siebzehn Menschen starben, zig weitere verletzt wurden und Tausende stundenlang im Dunkeln ausharren mussten?«
Auch für diesen Angriff waren die SdD verantwortlich, da hat er recht. Und auch seine Opferzahlen stimmen. Nur dass es die SdD nicht als Terroranschlag verbuchen.
Für sie war es ein Probelauf.
»Vier der Todesopfer in Toronto waren US-Amerikaner, korrekt?«
»Das ist richtig«, bestätige ich. »Zwar haben sich die Söhne des Dschihad zu diesem Anschlag nicht bekannt, doch wir sind davon überzeugt, dass sie dahinterstecken.«
Er nickt, wirft einen Blick auf seine Notizen. »Der Anführer der Söhne des Dschihad, Mr President. Das ist ein Mann namens Suliman Cindoruk, richtig?«
Jetzt geht’s zur Sache.
»Ja, Suliman Cindoruk ist der Anführer der SdD«, bestätige ich.
»Der gefährlichste und umtriebigste Cyberterrorist der Welt, richtig?«
»Da stimme ich zu.«
»Ein türkischstämmiger Muslim, nicht wahr?«
»Er ist türkischstämmig, aber kein Muslim«, erwidere ich. »Er ist ein säkularer rechtsradikaler Nationalist, der gegen den Einfluss des Westens in Süd- und Osteuropa kämpft. Sein ›Dschihad‹ hat nichts mit Religion zu tun.«
»Sagen Sie.«
»In Übereinstimmung mit jeder geheimdienstlichen Einschätzung, die ich gesehen habe, ja«, kontere ich. »Und die auch Sie gelesen haben, Mr Speaker. Wenn Sie unbedingt islamfeindliche Emotionen schüren wollen, nur zu, aber damit tragen Sie ganz bestimmt nicht zur Sicherheit unseres Landes bei.«
Er ringt sich ein säuerliches Lächeln ab. »Fest steht, dass er der meistgesuchte Terrorist der Welt ist, nicht wahr?«
»Den wir fassen wollen«, sage ich. »So wie wir jeden Terroristen fassen wollen, der versucht, unserem Land Schaden zuzufügen.«
Er schweigt für einen Moment. Er kämpft mit sich, ob er mich noch einmal fragen soll: Sind Sie sich da sicher? Wenn er das wagt, werde ich mich mächtig zusammenreißen müssen, um diesen Tisch nicht umzustoßen und ihm an die Gurgel zu springen.
»Nur der Klarheit halber«, sagt er. »Die Vereinigten Staaten wollen Suliman Cindoruk fassen.«
»Das bedarf keiner Klärung«, blaffe ich. »Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel. Hat es nie gegeben. Wir jagen Suliman Cindoruk nun schon seit einem Jahrzehnt. Wir werden nicht ruhen, bis wir ihn haben. Ist Ihnen das klar genug?«
»Nun, Mr President, bei allem gebotenen Respekt –«
»Nein«, falle ich ihm ins Wort. »Wenn Sie eine Frage einleiten mit ›bei allem gebotenen Respekt‹, heißt das nur, dass Sie etwas ganz und gar Respektloses sagen wollen. Denken Sie, was Sie wollen, Mr Speaker, aber Sie sollten Respekt zeigen, wenn schon nicht vor mir, dann gegenüber all den anderen Menschen in diesem Land, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, den Terrorismus zu bekämpfen und unser Land zu schützen. Wir sind nicht perfekt, werden wir auch nie sein. Aber wir werden nicht aufhören, unser Bestes zu geben.« Ich winke missbilligend ab. »Stellen Sie schon Ihre Frage.«
Mir pocht der Puls in den Schläfen, ich hole tief Luft und spähe zu meinem Mitarbeitertrio hinüber. Jenny, meine politische Beraterin, nickt; sie wünscht sich schon lange, dass ich unserem neuen Sprecher des Repräsentantenhauses die Zähne zeige. Danny gibt keine Regung preis. Carolyn, meine stets besonnene Stabschefin, sitzt ein wenig vorgebeugt, die Ellbogen auf die Knie gestützt, die Hände unterm Kinn verschränkt. Als Punktrichter bei den Olympischen Spielen würde mir Jenny für diesen Ausbruch eine Neun geben, bei Carolyn gäbe es nicht einmal eine Fünf.
»Ich lasse mir von Ihnen meinen Patriotismus nicht infrage stellen, Mr President«, sagt mein silbergrauer Gegenspieler. »Das amerikanische Volk ist über das, was letzte Woche in Algerien passiert ist, tief besorgt, und damit haben wir uns noch nicht befasst. Das amerikanische Volk hat jedes Recht zu erfahren, auf wessen Seite Sie stehen.«
»Auf wessen Seite ich stehe?« Ich schnelle so heftig nach vorn, dass ich fast das Mikrofon vom Tisch stoße. »Ich stehe auf der Seite des amerikanischen Volkes und sonst nirgends.«
»Mr Pres–«
»Ich stehe auf der Seite der Leute, die rund um die Uhr arbeiten, um unser Land vor Angriffen zu bewahren. Der Menschen, die sich nicht davon leiten lassen, wie etwas in der Öffentlichkeit ankommt oder woher gerade der politische Wind weht. Die nicht mit ihren Erfolgen hausieren gehen und die sich nicht verteidigen können, wenn sie kritisiert werden. Auf deren Seite stehe ich.«
»President Duncan, die Männer und Frauen, die sich tagtäglich für die Sicherheit unserer Nation einsetzen, haben meine volle Unterstützung«, fühlt er sich bemüßigt, klarzustellen. »Um die geht es hier nicht. Hier geht es um Sie, Sir. Hier geht es nicht um irgendwelche Spielchen. Mir macht das hier keinen Spaß, das können Sie mir glauben.«
Unter anderen Umständen hätte ich gelacht. Lester Rhodes hat sich auf diese Anhörung vor dem Sonderausschuss gefreut wie ein Collegestudent auf seinen einundzwanzigsten Geburtstag.
Der Mann zieht seine Show ab. Speaker Rhodes hat das mit diesem Sonderausschuss gedeichselt, und zwar mit dem einzigen Ziel, dass mich dieser Zirkus eines Vergehens im Amt für schuldig befindet und der Justizausschuss des Repräsentantenhauses daraufhin ein Amtsenthebungsverfahren einleitet. Die acht Kongressmitglieder auf seiner Seite sitzen alle fest im Sattel: Sie haben ihre Bundeswahlkreise so schamlos manipuliert, dass sie ihre Wiederwahl in zwei Jahren in der Tasche haben; sie könnten mitten im Hearing die Hose runterlassen oder am Daumen lutschen und hätten trotzdem keinen ernsthaften Gegenkandidaten zu fürchten.
Meine Berater haben recht. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob die Beweislage gegen mich stark oder schwach ist oder in sich zusammenfällt. Die haben sich längst entschieden.
»Stellen Sie Ihre Fragen«, sage ich. »Bringen wir dieses Affentheater hinter uns.«
Drüben in der Ecke verzieht Danny Akers schmerzlich das Gesicht und flüstert Carolyn etwas zu, die nickt, ohne ihr Pokergesicht zu verziehen. Danny hat meine Bemerkung über das Affentheater, mein Angriff auf dieses Verfahren, nicht gefallen. Mehr als einmal hat er mir zu verstehen gegeben, meine Vorgehensweise sehe »schlecht, sehr schlecht« aus und liefere dem Kongress einen triftigen Grund für Ermittlungen.
Womit er nicht falschliegt. Nur dass er nicht die ganze Geschichte kennt. Er hat nicht die höchste Zugangsermächtigung und weiß nicht, was Carolyn weiß. Wäre er im Bilde, würde er die Dinge anders sehen. Er würde begreifen, welcher Bedrohung unser Land ausgesetzt ist, in einem Ausmaß, wie wir es noch nie gesehen haben.
Eine Bedrohung, die mich dazu gebracht hat zu handeln, wie ich es in meinen kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten hätte.
»Mr President, haben Sie am Sonntag, dem neunundzwanzigsten April dieses Jahres, Suliman Cindoruk angerufen? Also vor etwas über einer Woche? Haben Sie sich mit dem meistgesuchten Terroristen der Welt telefonisch in Verbindung gesetzt oder nicht?«
»Mr Speaker«, antworte ich, »wie ich bereits mehrfach ausgeführt habe, obwohl das eigentlich nicht nötig sein sollte, können wir nicht alles, was wir tun, um unser Land zu schützen, in aller Öffentlichkeit verhandeln. Das amerikanische Volk versteht, dass die nationale Sicherheit, dass die Außenpolitik hochsensible, komplexe Erfordernisse mit sich bringt und dass ein Teil meiner Regierungsarbeit der Geheimhaltung unterliegen muss. Nicht etwa, weil wir etwas geheim halten wollen, sondern weil wir es müssen. Darum geht es ja gerade beim Exekutivrecht des Präsidenten.«
Rhodes würde die Anwendbarkeit des Exekutivrechts auf Verschlusssachen wahrscheinlich bestreiten. Doch Danny Akers, der Rechtsberater des Weißen Hauses, ist davon überzeugt, dass wir diesen Kampf gewinnen werden, da es hier um meine verfassungsmäßige Befugnis in auswärtigen Angelegenheiten geht.
So oder so verkrampft sich mir bei meinen eigenen Worten der Magen. Doch laut Danny kann ich, wenn ich mich nicht darauf berufe, gleich ganz auf das Vorrecht des Präsidenten verzichten. Und wenn ich das tue, muss ich die Frage beantworten, ob ich am Sonntag vor zwei Wochen Suliman Cindoruk angerufen habe.
Ich werde diese Frage nicht beantworten.
»Also, Mr President, ich weiß nicht, ob das amerikanische Volk mit dieser Antwort viel anzufangen weiß.«
Also, Mr Speaker, ich weiß nicht, ob das amerikanische Volk Sie für einen so tollen Sprecher hält, aber schließlich hat das amerikanische Volk Sie ja auch nicht zum Sprecher gewählt, oder? Sie haben im dritten bundesstaatlichen Wahlkreis von Indiana mickrige achtzigtausend Stimmen bekommen. Ich wurde mit vierundsechzig Millionen Stimmen gewählt. Aber Ihre Kumpane in Ihrer Partei haben Sie zu ihrem Vorsitzenden erkoren, weil Sie so viele Spendengelder für sie gesammelt und ihnen meinen Kopf versprochen haben.
Das würde im Fernsehen vermutlich weniger gut rüberkommen.
»Demnach leugnen Sie nicht, Suliman Cindoruk an dem besagten Tag angerufen zu haben, sehe ich das richtig?«
»Ich habe Ihre Frage bereits beantwortet.«
»Nein, Mr President, haben Sie nicht. Sie sind sich dessen bewusst, dass die französische Zeitung Le Monde, unter Berufung auf eine anonyme Quelle, eine ihr zugespielte Telefonaufzeichnung veröffentlicht hat, der zufolge Sie Suliman Cindoruk am Sonntag, dem neunundzwanzigsten April dieses Jahres, angerufen und mit ihm gesprochen haben. Sie wissen davon?«
»Ich habe den Artikel gelesen.«
»Und leugnen Sie es?«
»Ich gebe Ihnen dieselbe Antwort wie zuvor. Ich diskutiere das nicht. Ich lasse mich auf dieses Katz-und-Maus-Spiel, ob ich es getan oder nicht getan habe, nicht ein. Etwaige Schritte, die ich im Sicherheitsinteresse unseres Landes unternehme, werde ich hier weder bestätigen noch bestreiten. Nicht, solange es erforderlich ist, sie im Interesse der nationalen Sicherheit geheim zu halten.«
»Nun ja, Mr President, wenn eine der größten Zeitungen Europas darüber schreibt, weiß ich, ehrlich gesagt, nicht so recht, was daran noch ein so großes Geheimnis sein soll.«
»Sie haben meine Antwort gehört«, sage ich. Gott, ich klinge wie ein Arschloch. Schlimmer, ich klinge wie ein Anwalt.
»Le Monde berichtet …« Er hält eine Zeitung hoch. »›Der amerikanische Präsident Jonathan Duncan führte auf eigene Initiative ein Telefonat mit Suliman Cindoruk, dem Anführer der Söhne des Dschihad, einem der meistgesuchten Terroristen der Welt, um zwischen der Terrororganisation und dem Westen eine Annäherung zu finden.‹ Bestreiten Sie das, Mr President?«
Ich kann nicht antworten, und er weiß es. Er will mich zappeln lassen.
»Ich habe dem Gesagten nichts hinzuzufügen. Ich werde mich nicht wiederholen.«
»Das Weiße Haus hat zu dem Artikel in Le Monde nie einen Kommentar abgegeben.«
»Das ist richtig.«
»Suliman Cindoruk aber schon, nicht wahr? Er hat ein Video veröffentlicht, in dem er sagt: ›Der Präsident mag um Gnade flehen, wie er will, die Amerikaner haben von uns keine Gnade zu erwarten.‹ Das hat er gesagt, nicht wahr?«
»Das hat er gesagt.«
»Das Weiße Haus hat darauf mit einer Verlautbarung reagiert. Darin heißt es: ›Die Vereinigten Staaten werden nicht auf Hetztiraden eines Terroristen reagieren.‹«
»Das ist richtig«, bestätige ich.
»Und? Haben Sie ihn um Gnade angefleht?« An diesem Punkt ist meine politische Beraterin Jenny Brickman drauf und dran, sich die Haare zu raufen. Auch sie hat nicht die höchste Zugangsermächtigung und kennt nicht die ganze Geschichte; ihr geht es vor allem darum, dass ich bei diesem Hearing wie ein Kämpfer dastehe. Wenn Sie sich nicht wehren können, hat sie gesagt, dann gehen Sie besser nicht hin. Sonst machen Sie sich zum Prügelknaben.
Und sie hat recht. In diesem Moment hebt Lester Rhodes seinen Stock, um einen Haufen streng geheimer Informationen sowie politischer Fehltritte aus mir herauszuprügeln.
»Sie schütteln den Kopf, Mr President. Nur dass ich Sie richtig verstehe – Sie leugnen, Suliman Cindoruk um Gna-«
»Die Vereinigten Staaten werden niemals irgendjemanden um irgendetwas anflehen«, sage ich.
»Na schön, damit widersprechen Sie Suliman Cindoruks Behauptung, Sie hätten ihn –«
»Ich wiederhole: Die Vereinigten Staaten«, sage ich mühsam beherrscht, »werden niemals irgendjemanden um irgendetwas anflehen. Reicht das jetzt, Mr Speaker? Oder soll ich es noch mal sagen?«
»Nun, wenn Sie ihn nicht angefleht –«
»Nächste Frage«, sage ich.
»Haben Sie ihn dann vielleicht freundlich gebeten, uns nicht anzugreifen?«
»Nächste«, wiederhole ich, »Frage.«
Er hält inne und geht seine Notizen durch. »Meine Zeit ist gleich um«, sagt er. »Nur noch ein paar Fragen.«
Einer ist abgehakt – fast abgehakt –, zwölf kommen noch, alle mit jeder Menge Spitzfindigkeiten und Fangfragen im Köcher.
Rhodes ist fast so sehr für seine Schlussfragen wie für seine Eröffnungen berüchtigt. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Und er weiß schon jetzt, dass ich darauf nicht antworten kann. »Mr President«, sagt er, »sprechen wir über Dienstag, den ersten Mai. In Algerien.«
Das war vor über einer Woche.
»Am Dienstag, dem ersten Mai«, sagt er, »ist eine Gruppe proukrainischer, antirussischer Separatisten in Nordalgerien in ein Gehöft eingefallen, auf dem sich Suliman Cindoruk mutmaßlich versteckte. Was sich als richtig erweisen sollte. Sie hatten Cindoruk aufgespürt und befanden sich auf diesem Gehöft, um ihn zu töten.
Aber ihre Pläne wurden vereitelt, Mr President, und zwar von einem Sonderkommando sowie von CIA-Agenten aus den Vereinigten Staaten. Auf diese Weise gelang Suliman Cindoruk die Flucht.«
Ich schweige.
»Haben Sie diesen Gegenangriff angeordnet?«, fragt er. »Und falls ja, warum? Wieso entsendet ein amerikanischer Präsident ein Einsatzkommando der Vereinigten Staaten, um einem Terroristen das Leben zu retten?«
2
»Der Vorsitzende erteilt dem Gentleman aus Ohio, Mr Kearns, das Wort.«
Ich presse Daumen und Zeigefinger gegen die Nasenwurzel, um gegen die Erschöpfung anzukämpfen. Im Lauf der letzten Woche habe ich nur wenige Stunden geschlafen, und die Anstrengung, mich zu verteidigen, während mir die Hände gebunden sind, laugt mich aus. Vor allem aber bin ich wütend. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich habe keine Zeit für diesen Mist.
Ich blicke nach links – zum rechten Flügel der Kommission. Mike Kearns ist der Vorsitzende des Justizausschusses und Lester Rhodes’ Günstling. Er trägt gerne Fliege, um zu zeigen, wie intelligent er ist. Ich für meinen Teil habe schon Haftnotizen mit mehr Tiefgang gesehen.
Aber der Bursche kann Fragen stellen, das muss man ihm lassen. Bevor er in den politischen Ring stieg, war er Bundesanwalt. Zu den Köpfen, die er hat rollen lassen, gehören zwei Geschäftsführer aus der Pharmaindustrie und ein ehemaliger Gouverneur.
»Der Kampf gegen den Terror ist eine sehr ernste Angelegenheit der nationalen Sicherheit, Mr President. Würden Sie dem zustimmen?«
»Absolut.«
»Würden Sie mir dann auch darin beipflichten, dass sich ein amerikanischer Bürger, der uns daran hindert, Terroristen zu bekämpfen, des Hochverrats schuldig macht?«
»Ich würde eine solche Handlungsweise verurteilen«, sage ich.
»Und wäre das ein Fall von Hochverrat?«
»Darüber müssten Anwälte und Gerichte entscheiden.«
Wir sind beide Anwälte, aber ich habe meinen Standpunkt deutlich gemacht.
»Wenn nun der Präsident den Kampf gegen Terroristen behindern würde, wäre das ein Vergehen, das ein Amtsenthebungsverfahren rechtfertigen würde?«
Gerald Ford hat einmal bemerkt, ein Vergehen, das eine Amtsenthebung rechtfertigt, sei das, was die Mehrheit des Repräsentantenhauses dafür hält.
»Es ist nicht meine Aufgabe, darüber zu befinden.«
Er nickt. »Nein, ist es wohl nicht. Sie haben sich vorhin geweigert, die Frage zu beantworten, ob Sie Sondereinsatzkräfte und CIA-Agenten entsendet hätten, um einen Anschlag auf Suliman Cindoruk in Algerien zu vereiteln.«
»Mr Kearns, ich habe gesagt, dass einige Angelegenheiten, die die nationale Sicherheit betreffen, nicht öffentlich diskutiert werden können.«
»Laut der New York Times haben Sie aufgrund streng geheimer Informationen gehandelt, denen zufolge diese antirussische Miliz Suliman Cindoruk ausfindig gemacht hatte und kurz davor war, ihn zu töten.«
»Das habe ich gelesen. Ich werde das nicht kommentieren.«
Früher oder später sieht sich jeder Präsident vor Entscheidungen gestellt, bei denen er trotz richtiger Wahl für sich und seine Regierung, zumindest kurzfristig, politischen Schaden in Kauf nehmen muss. Wenn viel auf dem Spiel steht, muss man tun, was richtig ist, und darauf hoffen, dass sich die politischen Wogen wieder glätten. Das gehört zu dem Job, den man übernommen hat.
»Mr President, ist Ihnen Titel 18, Paragraf 798 des United States Code geläufig?«
»Ich kenne zwar die Paragrafen des United States Code nicht auswendig, Mr Kearns, aber ich denke, Sie beziehen sich auf das Spionagegesetz.«
»In der Tat, Mr President. Es geht um den missbräuchlichen Umgang mit geheimen Informationen. In dem entsprechenden Abschnitt heißt es, dass es einen Verstoß gegen Bundesrecht darstellt, geheime Informationen vorsätzlich so zu handhaben, dass es der Sicherheit oder dem Interesse der Vereinigten Staaten abträglich ist. Erscheint Ihnen das plausibel?«
»Ihre Lesart ist sicher richtig, Mr Kearns.«
»Wenn ein Präsident in voller Absicht geheime Informationen dazu nutzen würde, einen Terroristen zu beschützen, der davon besessen ist, uns anzugreifen, würde ein solcher Fall Ihrer Meinung nach unter diese Bestimmung fallen?«
Meinem Rechtsberater zufolge nicht, da diese Klausel sicher nicht auf den Präsidenten anwendbar ist. In seinen Augen wäre es eine neue Auslegung des Spionagegesetzes zu behaupten, ein Präsident könne mal eben so die amtliche Geheimhaltung von sensiblen Informationen aufheben.
Aber egal. Selbst wenn ich in der Stimmung wäre, mich in juristischen Wortgefechten über den Geltungsbereich eines Bundesgesetzes zu ergehen – was ich nicht bin –, können sie auch so ein Amtsenthebungsverfahren einleiten und sich irgendwelche Begründungen aus den Fingern saugen. Es muss keine Straftat sein.
Alles, was ich getan habe, diente dazu, mein Land zu schützen. Ich würde es wieder tun. Nur dass ich darüber Stillschweigen wahren muss.
»Ich kann Ihnen nichts weiter dazu sagen, als dass es mir bei allen meinen Entscheidungen ausschließlich um die Sicherheit meines Landes ging. Und daran wird sich auch künftig nichts ändern.«
Ich sehe, wie Carolyn in der Ecke etwas auf ihrem Handy liest und eine Antwort tippt. Für den Fall, dass ich hier abbrechen muss, um auf etwas, das sie gerade erfahren hat, zu reagieren, suche ich Blickkontakt mit ihr. Etwas von General Burke im Zentralkommando? Oder vom Staatssekretär im Verteidigungsministerium? Von unserem Cybersicherheitsteam, das wir eingerichtet haben, um herauszufinden, womit wir es zu tun haben und wie wir uns dagegen wehren können? Wir müssen jederzeit mit der nächsten Hiobsbotschaft rechnen. Wir glauben – wir hoffen –, uns bleibt noch mindestens ein Tag. Sicher ist derzeit allerdings nur eines: dass die Lage extrem unsicher ist. Wir müssen jederzeit bereit sein, für den Fall –
»Dienen Telefonate mit den Anführern des IS dem Schutz unseres Landes?«
»Was?«, schnauze ich und wende meine Aufmerksamkeit wieder dem Hearing zu. »Was reden Sie da? Ich habe nie mit den Anführern des IS telefoniert. Was hat der IS mit alledem zu tun?«
Bevor ich den letzten Satz zu Ende bringe, wird mir siedend heiß bewusst, was ich getan habe. Ich wünschte, ich könnte meine unbedachten Worte zurücknehmen und herunterschlucken. Aber es ist zu spät. Er hat mich volle Breitseite erwischt, als ich gerade nicht aufmerksam war.
»Interessant«, sagt er, »wenn ich Sie frage, ob Sie die IS-Anführer angerufen haben, verneinen Sie das kategorisch. Wenn Sie der Speaker hingegen fragt, ob Sie mit Suliman Cindoruk telefoniert haben, kommen Sie uns mit dem ›Exekutivprivileg‹. Ich denke, das amerikanische Volk versteht den Unterschied.«
Ich schnaube hörbar und spähe zu Carolyn Brock hinüber, die keine Miene verzieht, auch wenn ich ihr von den zusammengekniffenen Augen ablesen kann: Hab ich’s Ihnen nicht gesagt?
»Abgeordneter Kearns, hier geht es um eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit. Fangfragen-Spielchen sind da völlig fehl am Platz. Wir haben es mit ernsten Angelegenheiten zu tun. Wenn Sie so weit sind, mir eine ernsthafte Frage zu stellen, werde ich Ihnen gerne Rede und Antwort stehen.«
»Bei diesem Kampf in Algerien ist ein Amerikaner ums Leben gekommen, Mr President. Ein Amerikaner, ein CIA-Agent namens Nathan Cromartie, ist gestorben, als er diese antirussische Miliz daran hinderte, Suliman Cindoruk zu töten. Ich denke, das ist für das amerikanische Volk eine ernste Angelegenheit.«
»Nathan Cromartie war ein Held«, sage ich. »Wir trauern um ihn. Ich trauere um ihn.«
»Sie haben gehört, was seine Mutter darüber zu sagen hatte«, fährt er fort.
Habe ich. Wie wir alle. Nach dem Vorfall in Algerien haben wir nichts an die Öffentlichkeit gebracht. Wie denn auch! Doch dann stellte diese Miliz ein Video von dem toten Amerikaner ins Netz, und es dauerte nicht lange, bis Clara Cromartie darauf ihren Sohn Nathan identifizierte. Und ihn als CIA-Agenten enttarnte. Ein gigantischer Shitstorm brach los. Die Medien stürzten sich auf die Mutter, und binnen Stunden verlangte sie Auskunft darüber, wieso ihr Sohn hatte sterben müssen, um einen Terroristen zu retten, der für den Tod Hunderter unschuldiger Menschen verantwortlich war, einschließlich vieler Amerikaner. In ihrer Trauer und ihrem Schmerz schrieb sie praktisch das Drehbuch für die Anhörung vor dem Sonderausschuss.
»Finden Sie nicht auch, dass Sie der Familie Cromartie Antworten schuldig sind, Mr President?«
»Nathan Cromartie war Patriot«, erwidere ich. »Und er hat sehr wohl verstanden, dass vieles von dem, was wir im Interesse der nationalen Sicherheit tun, unter die Geheimhaltung fällt. Ich habe persönlich mit Mrs Cromartie gesprochen, und ich bin über das Schicksal ihres Sohnes tief betroffen. Darüber hinaus werde ich mich zu der Angelegenheit nicht äußern. Ich kann und werde es nicht.«
»Nun, kommen Ihnen im Nachhinein, Mr President«, macht er ungerührt weiter, »nicht doch vielleicht Zweifel daran, ob Ihre Strategie, mit Terroristen zu verhandeln, wirklich funktioniert hat?«
»Ich verhandle nicht mit Terroristen.«
»Wie auch immer Sie es nennen wollen«, sagt er. »Sie anzurufen. Sich mit ihnen zu besprechen. Sie zu hätscheln –«
»Ich verbitte mir –«
An der Decke flackern, für den Bruchteil einer Sekunde, die Lampen, zwei Mal. Der eine oder andere im Raum stöhnt genervt, Carolyn Brock horcht auf und macht sich eine Notiz.
Sein Gegner nutzt den Moment und holt zum nächsten Schlag aus.
»Sie machen kein Geheimnis daraus, Mr President, dass Sie dem Dialog gegenüber der Demonstration von Stärke den Vorzug geben, dass Sie lieber mit Terroristen diskutieren.«
»Nein«, sage ich deutlich und merke, wie mir der Puls in den Schläfen pocht, denn diese Art von Simplifizierung bringt alles, was in unserer politischen Kultur schiefläuft, auf den Punkt. »Ich betone nur immer wieder, dass ich, solange Hoffnung auf eine friedliche Beilegung von Konflikten besteht, der friedlichen Alternative den Vorzug gebe. Das Gespräch zu suchen hat nichts mit Kapitulation zu tun. Sind wir hier, um eine außenpolitische Debatte zu führen, Herr Abgeordneter? Ich möchte diese Hexenjagd nur ungern mit einer substanziellen Debatte stören.«
Ein kurzer Blick in die Ecke. Carolyn Brock verzieht das Gesicht, eine seltene Regung in ihrer kontrollierten Miene.
»Der eine nennt es mit dem Feind im Gespräch bleiben, Mr President, der andere nennt es hätscheln.«
»Ich hätschle unsere Feinde nicht«, sage ich. »Ebenso wenig schließe ich Gewaltanwendung aus. Gewaltanwendung ist immer eine Option, doch für mich erst, wenn alle anderen Mittel erschöpft sind. Einem Country-Club-Söhnchen, das sein Leben mit Bierbongs und dem Verprügeln von Anwärtern in geheimen Studentenverbindungen verbracht hat und jeden mit seinen Initialen anredet, mag das nicht in den Kopf gehen, aber ich habe auf einem echten Schlachtfeld mit dem echten Feind Bekanntschaft gemacht und überlege es mir deshalb dreimal, bevor ich unsere Söhne und Töchter ins Gefecht entsende. Ich war einer von diesen Söhnen, und ich bin mir der Risiken bewusst.«
An dieser Stelle lehnt sich Jenny vor, um mehr zu hören. Sie drängt mich schon lange, Einzelheiten aus meiner Militärzeit preiszugeben. Erzählen Sie denen von Ihrer Zeit als Soldat. Sagen Sie denen, was Sie in der Kriegsgefangenschaft erlebt haben. Erzählen Sie denen von Ihren Verwundungen, von der Folter. Im Wahlkampf war das ein endloses Hin und Her – etwas in meinem Lebenslauf, mit dem ich hätte punkten können. Hätte ich auf meine Ratgeber gehört, wäre es das beherrschende Thema gewesen. Aber ich habe mich nie darauf eingelassen. Es gibt Dinge, über die spricht man einfach nicht.
»Sind Sie fertig, Mr Pres–«
»Nein, noch lange nicht. Ich habe das alles bereits dem Vorstand des Repräsentantenhauses dargelegt, dem Sprecher und anderen. Ich habe ihnen klargemacht, dass ich für diese Anhörung keine Zeit habe, weil ich gegenwärtig ganz und gar von ernsteren Dingen in Anspruch genommen werde. Sie hätten sagen können, ›In Ordnung, Mr President, auch wir sind Patrioten und werden respektieren, was Sie tun, selbst, wenn Sie uns nicht gänzlich ins Bild setzen können.‹ Aber was machen Sie? Sie konnten der Versuchung nicht widerstehen, mich vor diesen Ausschuss zu zerren, um politisches Kapital daraus zu schlagen. Lassen Sie mich daher in aller Öffentlichkeit wiederholen, was ich Ihnen bereits unter vier Augen gesagt habe. Ich werde Ihnen keine spezifischen Fragen über etwaige Gespräche oder Aktionen beantworten, die ich möglicherweise geführt oder veranlasst habe, denn das wäre gefährlich. Es geht um eine Bedrohung unserer nationalen Sicherheit. Falls mich meine Bemühungen, diese Bedrohung abzuwenden, das Amt kosten sollten, sei’s drum. Aber damit eines klar ist: Ich habe nichts getan oder gesagt, ohne dabei einzig und allein die Sicherheit der Vereinigten Staaten im Auge zu haben. Und daran wird sich auch nichts ändern.«
Mein Fragesteller lässt sich durch die Beleidigungen, die ich ihm eben ins Gesicht geschleudert habe, nicht im Mindesten irritieren. Im Gegenteil, die Tatsache, dass mir seine Fragen offensichtlich unter die Haut gehen, scheint ihn nur noch anzustacheln. Er wirft erneut einen Blick auf seine Notizen und seine Fragenliste, während ich mich um Haltung bemühe.
»Was ist die schwierigste Entscheidung, die Sie diese Woche zu treffen hatten, Mr Kearns?« Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, den Spieß einmal umzudrehen. »Welche Fliege Sie zu dieser Anhörung tragen sollen? Auf welcher Seite Sie Ihre lächerliche Resthaarfrisur scheiteln sollen?
Bei mir hat sich in den letzten Tagen und Wochen fast alles um die nationale Sicherheit gedreht, was äußerst schwierige Entscheidungen erfordert; bei Gleichungen mit vielen Unbekannten weiß man nie, ob das Kalkül aufgeht. Zuweilen sind sämtliche Optionen schlicht und ergreifend beschissen, und ich suche nach derjenigen, die am wenigsten beschissen ist. In einem solchen Fall tue ich einfach mein Bestes. Natürlich frage ich mich dann, ob es die richtige war und ob es am Ende gut geht. In manchen Fällen ist der Ausgang ziemlich offen, aber ich kann nicht die Hände in den Schoß legen. Ich muss handeln und dann mit dem Ergebnis leben.
Das gilt auch für die Kritik, die ich dafür ernte, selbst von einem politischen Mitläufer, der sein Fähnchen nach dem Winde hängt, der einen Zug auf dem Schachbrett macht, ohne den übrigen Spielverlauf zu kennen, und sich dann endlos über diesen genialen Zug auslässt, ohne auch nur zu ahnen, in welche Gefahr er unsere Nation damit bringt.
Mr Kearns, ich würde meine Handlungsweise gerne mit Ihnen diskutieren, aber es liegt nun mal in unserem nationalen Interesse, in dieser Sache Geheimhaltung zu wahren. Was Sie natürlich wissen. Man nennt das, glaube ich, ›das Wohl der Nation über die eigenen Interessen zu stellen‹. Sollten Sie auch mal versuchen.«
In der Ecke hebt Danny Akers die Hände, das Zeichen für eine Unterbrechung.
»Klar. Wissen Sie was? Sie hatten recht, Danny. Machen wir Schluss. Ich bin hier fertig. Das war’s.«
Mit einer ausladenden Handbewegung fege ich das Mikro vom Tisch. Als ich aufstehe, kippe ich meinen Stuhl um.
»Ich hab’s kapiert, Carrie. Ist keine gute Idee, auszusagen. Die werden mich in Stücke reißen. Schon kapiert.«
Carolyn Brock springt auf und streicht ihr Kostüm glatt. »Okay, besten Dank an alle. Wenn Sie dann bitte den Raum verlassen.«
Es handelt sich um den Roosevelt Room gegenüber dem Oval Office. Ein passender Ort für ein Meeting – oder wie in diesem Fall für eine Probeanhörung vor dem Sonderausschuss –, denn diesen Raum ziert zum einen das Porträt von Teddy Roosevelt hoch zu Ross als Rough Rider wie auch der Nobelpreis, den er für die Beendigung des Kriegs zwischen Japan und Russland bekommen hat. Es gibt keine Fenster, und die Türen sind leicht zu sichern.
Alle stehen auf. Einer der Anwälte im Juristenteam des Weißen Hauses zieht sich die Fliege vom Hals, ein hübsches kleines Accessoire, das er beigesteuert hat, um in die Rolle des Abgeordneten Kearns zu schlüpfen. Er sieht mich schuldbewusst an, doch ich winke ab. Schließlich hat er nur seinen Part gespielt, um mir zu zeigen, was schlimmstenfalls passieren kann, wenn ich an dem Plan festhalte, nächste Woche auszusagen.
Auch mein Pressesprecher, der heute in die Haut von Lester Rhodes geschlüpft ist, bis hin zur grauen Perücke, mit der er eher an Anderson Cooper als an den Sprecher des Repräsentantenhauses erinnert, wirft mir einen verlegenen Blick zu, und ich erteile ihm ebenfalls Absolution.
Während sich der Raum allmählich leert, sinkt mein Adrenalinspiegel, und ich fühle mich entmutigt und ermattet. In welchem Maße sich dieser Job wie eine Achterbahnfahrt anfühlt – prickelnde Höhen, abgründige Talfahrten –, das erzählt einem vorher niemand.
Zuletzt stehe ich alleine da und starre auf den Kavalleristen über dem Kamin, während sich die leisen Schritte von Carolyn, Danny und Jenny nähern.
»›Schlicht und ergreifend beschissen‹ war mein persönlicher Favorit«, sagt Danny ungerührt.
Rachel hat mich schon immer ermahnt, mit Kraftausdrücken sparsamer umzugehen. Sie findet, Fluchen und andere Unflätigkeiten zeugten von einem Mangel an Kreativität. Ich weiß nicht. Wenn’s hart auf hart kommt, kann ich mit meinen Schimpfkanonaden ziemlich kreativ sein.
Außerdem wissen Carolyn und meine anderen engen Mitarbeiter, dass ich diese Generalprobe als eine Art Therapie verstehe. Wenn sie mich schon nicht von meinem Vorhaben abbringen können, erhoffen sie sich zumindest davon, dass ich hier schon einmal Dampf ablasse, um mich im Ernstfall auf Antworten zu konzentrieren, die der Würde des Amts gerecht werden.
Jenny Brickman bemerkt in charakteristischer Feinfühligkeit: »Sie müssten vollkommen durchgeknallt sein, um sich nächste Woche vor den Ausschuss schleppen zu lassen.«
Ich nicke Jenny und Danny zu. »Ich brauche Carrie«, sage ich, die Einzige der drei mit der höchsten Zugangsermächtigung und somit die einzige Mitarbeiterin im Raum, mit der ich offen über die bedrohliche Lage sprechen kann.
Die anderen gehen.
»Was Neues?«, frage ich Carolyn, als wir alleine sind.
Sie schüttelt den Kopf. »Nein.«
»Dann passiert es also morgen?«
»Soweit ich weiß, ja, Mr President.« Sie deutet mit dem Kopf zur Tür, die Jenny und Danny gerade hinter sich zugezogen haben. »Die beiden haben recht, wissen Sie. Die Anhörung am Montag ist eine Lose-lose-Situation.«
»Vergessen wir die Anhörung, Carrie. Ich habe diesem Probelauf zugestimmt. Ich habe Ihnen eine Stunde gegeben. Das war’s. Wir haben wahrlich Wichtigeres um die Ohren, oder?«
»Ja, Sir. Das Team ist bereit für das Briefing, Sir.«
»Ich möchte mit dem Threat-Response-Team sprechen, dann mit Burke, dann mit der Staatssekretärin. In dieser Reihenfolge.«
»Ja, Sir«, sagt sie, »bin gleich zurück.«
»Danke.«
Carolyn geht.
Als ich wieder allein bin, blicke ich erneut zum ersten Präsidenten Roosevelt auf und denke nach. Allerdings nicht über die Anhörung am Montag.
Ich denke darüber nach, ob es am Montag unser Land noch gibt.
3
Als sie die Ankunftshalle des Reagan National Airport betritt, bleibt sie einen Moment stehen, scheinbar, um zu den Wegweisern aufzuschauen, in Wahrheit nur, um nach dem Flug den Moment im Freien zu genießen. Mit einem tiefen Atemzug saugt sie die Frische des Ingwerbonbons im Mund ein und horcht auf den eigenwilligen ersten Satz des ersten Violinkonzerts von Johann Sebastian Bach, gespielt von Wilhelm Friedemann Herzog, das leise aus ihren Ohrhörern dringt.
Setz eine glückliche Miene auf, sagen sie einem immer. Glück, so die Begründung, ist die beste Emotion, um keinen Verdacht zu erregen, wenn man beobachtet wird. Menschen, die lächeln, die zufrieden wirken, gar lachen und Witze machen, wirken nicht bedrohlich.
Sie gibt sich lieber sexy. Ohne Begleitung ist die Masche leichter abzuziehen, und bisher hat sie immer funktioniert – das ein wenig spöttische Lächeln, der stolze Gang, während sie ihren Bottega-Veneta-Trolley durchs Terminal zum Ausgang hinter sich herzieht. Es ist eine Rolle wie jede andere, ein Kostüm, in das sie schlüpft und das sie ablegt, sobald sie fertig ist, doch sie kann mit eigenen Augen sehen, dass es den Zweck nicht verfehlt: wie die Männer versuchen, ihren Blick auf sich zu lenken, wie sie unwillkürlich in ihren Ausschnitt starren, dessen Tiefe sie genauestens abwägt, nur so viel, dass beim Gehen ihre Titten wippen und im Gedächtnis der Kerle haften bleiben; wie die Frauen sie neidisch in der vollen Länge ihrer eins dreiundsiebzig, von den schokobraunen, kniehohen Lederstiefeln bis zum flammend roten Haar, beäugen, bevor sie zu ihren Männern schielen, um festzustellen, wie ihnen die Aussicht gefällt.
Der hochgewachsene, langbeinige, vollbusige Rotschopf, für alle sichtbar versteckt, wird ihnen in Erinnerung bleiben.
Auf dem Weg durch die Halle Richtung Taxistand müsste sie eigentlich schon in Sicherheit sein. Hätte sie jemand erkannt, wüsste sie es bereits. Sie wäre nicht bis hierher gekommen. Aber noch ist die Gefahr nicht ganz ausgestanden, und so erlaubt sie sich keine Unachtsamkeit. Niemals. In dem Moment, in dem man unachtsam wird, begeht man einen Fehler, hat der Mann zu ihr gesagt, der ihr vor etwas mehr als fünfundzwanzig Jahren zum ersten Mal ein Gewehr in die Hand gedrückt hat. Kühl und logisch lautet ihr Lebensmotto. Denken und sich nichts anmerken lassen.
Jeder Schritt ist eine Qual, was aber nur an ihren zusammengekniffenen Augen abzulesen wäre, und die versteckt sie unter ihrer Ferragamo-Sonnenbrille über dem selbstbewussten Lächeln.
Sie schafft es bis zu den Taxis draußen an der Auffahrt, freut sich über die frische Luft, verzieht die Nase, als ihr die Auspuffdünste entgegenschlagen. Flughafenmitarbeiter in Uniform brüllen den Taxifahrern etwas zu und dirigieren die Fahrgäste zu den Autos in der Schlange. Eltern mühen sich mit quengeligen Kindern und sperrigen Rollkoffern ab.
Sie begibt sich zum mittleren Gang und hält nach dem Fahrzeug mit dem Kennzeichen Ausschau, das sie sich eingeprägt hat, sowie dem Roadrunner-Aufkleber an der Seite. Es ist noch nicht da.
Sie schließt für einen Moment die Augen und hält sie geschlossen, bis das Andante, ihr Lieblingssatz im Stück, vorbei ist, eine zuerst sehnsüchtig melancholische, dann beruhigende, fast meditative Passage.
Als sie die Augen wieder öffnet, hat sich das Taxi mit dem richtigen Nummernschild und dem Aufkleber an der Seite in die Schlange eingereiht. Sie rollt ihren Koffer heran und steigt ein. Von dem überwältigenden Fast-Food-Mief im Wageninneren kommt ihr das Frühstück fast hoch. Sie unterdrückt die Übelkeit und lehnt sich zurück.
Mit Beginn des letzten, ungestümen Satzes, des Allegro assai, bricht sie das Konzert abrupt ab. Als sie die Ohrhörer herausnimmt, fühlt sie sich ohne die beruhigende Begleitung der Violinen und Cellos nackt.
»Wie ist der Verkehr heute so?«, fragt sie auf Englisch mit einem Akzent aus dem Mittleren Westen.
Durch den Rückspiegel sind die Augen des Fahrers auf sie gerichtet. Zweifellos wurde er instruiert, so etwas zu unterlassen.
Starren Sie Bach gefälligst nicht an.
»Ziemlich angenehm heute«, antwortet er, indem er jedes Wort betont, der Entwarnungscode, den sie zu hören hoffte. Zwar hat sie in dieser frühen Phase auch nicht ernsthaft mit Komplikationen gerechnet, aber man kann nie wissen.
Da sie sich nun einen Moment entspannen kann, schlägt sie ein Bein über das andere und zieht den Reißverschluss des ersten Stiefels auf, dann des zweiten. Mit einem leisen Seufzer der Erleichterung befreit sie ihre Füße von diesen Stiefeln mit der zehn Zentimeter hohen Fersenhebung. Sie wackelt mit den Zehen und streicht sich mit dem Daumen das Fußgewölbe entlang, die einzige Massage, die der enge Fond des Taxis erlaubt.
Wenn sie Glück hat, wird sie sich für den Rest ihres Unternehmens nicht mehr größer machen müssen; ihre eins dreiundsiebzig werden genügen. Sie öffnet den Reißverschluss ihres Handkoffers, verstaut die Gucci-Stiefel darin und zieht ein Paar Nike-Sportschuhe heraus.
Als sich der Wagen in den dichten Verkehr einfädelt, wirft sie einen prüfenden Blick aus dem linken und aus dem rechten Seitenfenster. Sie beugt sich herunter, bis der Kopf auf Kniehöhe ist. Als sie sich wieder aufrichtet, hat sie die rote Perücke auf dem Schoß und trägt ihr tintenschwarzes Haar in einem gnadenlos strengen Nackenknoten.
»Jetzt sind Sie … wieder Sie selbst, nicht wahr?«, fragt der Fahrer.
Sie antwortet nicht, sondern straft ihn mit einem kalten, durchdringenden Blick, der jedoch keine Wirkung zeigt, da er nicht in den Rückspiegel schaut.
Bach mag keinen Small Talk.
Hat man ihm das nicht gesagt? Abgesehen davon ist viel Zeit vergangen, seit sie das letzte Mal »sie selbst« gewesen ist. Wenn’s hochkommt, kann sie sich ab und zu einmal entspannen. Je länger sie in diesem Metier arbeitet, je öfter sie sich neu erfindet – eine Fassade gegen die nächste tauscht, im Schatten lauert oder sich, wie gerade eben, für jedermann sichtbar versteckt –, desto mehr rückt die Erinnerung an ihr wahres Selbst oder auch nur die Idee von einer eigenen Identität in weite Ferne.
Das wird sich bald ändern, hat sie sich geschworen.
Nachdem Perücke und Stiefel im Handkoffer auf dem Sitz neben ihr verschlossen sind, greift sie zur Bodenmatte unter ihren Füßen. Sie packt sie am Rand und löst sie mit einem Ruck von ihrer Klettbefestigung.
Darunter befindet sich eine mit Schnappriegeln gesicherte Bodenplatte. Sie öffnet die Riegel und klappt die Platte hoch.
Dann richtet sie sich kurz auf und wirft einen Blick auf den Tacho, um sich zu vergewissern, dass der Fahrer nicht das Tempolimit überschreitet oder andere Dummheiten macht und dass keine Polizeistreife in der Nähe ist.
Schließlich holt sie die Hartschalenbox aus dem Fach unter der Bodenverkleidung. Sie legt den Daumen auf das Siegel. Die Daumenabdruckerkennung braucht nur einen Moment, dann öffnet sich das Siegel.
Nicht, dass ihre Auftraggeber irgendeinen Grund hätten, sich an ihrer Ausrüstung zu schaffen zu machen, doch Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Sie öffnet die Box zu einer kurzen Inspektion. »Hallo, Anna«, flüstert sie den Namen, den sie ihrer Waffe gegeben hat. Anna Magdalena ist eine Schönheit, ein mattschwarzes halb automatisches Gewehr, mit dem sie in weniger als zwei Sekunden fünf Schuss abfeuern und das sie in weniger als drei Minuten nur mit einem Schraubenzieher zusammensetzen beziehungsweise auseinandernehmen kann. Sicher, es gibt neuere Modelle auf dem Markt, doch Anna Magdalena hat sie noch nie im Stich gelassen, egal aus welcher Entfernung. Dutzende von Leuten könnten – rein theoretisch – ihre Treffsicherheit bestätigen, darunter ein Staatsanwalt in Bogotá, Kolumbien, der bis vor sieben Monaten noch einen Kopf auf dem Körper trug, oder der Anführer einer Rebellenarmee in Darfur, der vor anderthalb Jahren plötzlich sein Hirn ins Lammragout vor sich ergoss.
Sie hat auf jedem Kontinent getötet, Generäle, Aktivisten, Politiker und Geschäftsleute liquidiert. Man kennt von ihr nur das Geschlecht, ihren Lieblingskomponisten klassischer Musik und ihre hundertprozentige Erfolgsrate beim Töten.
Das hier wird Ihre größte Herausforderung, Bach, hat der Mann gesagt, der sie für diesen Job angeheuert hat.
Nein, hat sie ihn korrigiert. Das wird mein größter Coup.
Freitag, 11. Mai
4
Ich schrecke aus dem Schlaf, starre in die Dunkelheit und taste nach meinem Handy. Es ist kurz nach vier Uhr morgens. Ich schicke Carolyn eine SMS.
Was Neues?
Ihre Antwort kommt prompt; auch sie ist wach.
Nein, Sir.
Hätte ich mir eigentlich denken können. Bei Neuigkeiten hätte mich Carolyn unverzüglich angerufen. Doch seit wir wissen, mit was für einer Bedrohung wir es zu tun haben, hat sie sich an diese frühmorgendlichen SMS gewöhnt. Ich atme langsam aus und strecke die Arme, um die Nervosität abzubauen. Kein Gedanke daran, wieder einzuschlafen. Heute ist der entscheidende Tag.
Ich verbringe einige Zeit auf dem Laufband. Das Bedürfnis, jeden Tag einmal ordentlich ins Schwitzen zu kommen, habe ich mir seit meinen Baseballtagen bewahrt, und jetzt, in diesem Job, habe ich es nötiger denn je. Es wirkt wie eine Massage vor dem Stress des Tages. Als Rachels Krebs wiederkam, hatte ich ein Laufband im Schlafzimmer aufstellen lassen, um sie selbst beim Training im Auge zu behalten.
Heute begnüge ich mich mit Rücksicht auf meinen derzeitigen körperlichen Zustand – das Wiederaufflammen meiner Krankheit wäre das Letzte, was ich im Moment brauchen kann – mit einer gemächlichen Gangart, statt zu joggen oder auch nur schnell zu gehen.
Ich putze mir die Zähne und sehe mir hinterher die Bürste an. Nichts als die schaumigen Reste der Zahncreme. Ich grinse in den Spiegel und überprüfe das Zahnfleisch.
Ich ziehe mich aus, drehe mich um und betrachte mich von hinten im Spiegel. Die Hautunterblutungen sind vor allem an den Waden, aber auch an der Rückseite der Oberschenkel zu sehen. Es wird schlimmer.
Nach dem Duschen ist es Zeit, den täglichen Geheimdienstbericht zu lesen und mich über die aktuellen Entwicklungen zu informieren. Dann geht’s zum Frühstück ins Speisezimmer. Darauf haben Rachel und ich immer großen Wert gelegt. »Der Rest der Welt kann dich in den nächsten sechzehn Stunden haben«, pflegte sie zu sagen. »Beim Frühstück gehörst du mir.«
Gewöhnlich auch beim Abendessen. Wir nahmen uns einfach die Zeit, auch wenn wir zu Rachels Lebzeiten nicht im Speisezimmer gegessen haben; meist haben wir uns an den kleinen Tisch in der Küche neben der Tür gesetzt, ein intimeres Ambiente, und manchmal sogar zusammen gekocht, um uns mal wie ganz normale Leute zu fühlen. Wie wir, nur wir beide, nicht anders als zu Hause in North Carolina, hier in der Küche im Weißen Haus Pfannkuchen gewendet oder Pizzateig ausgerollt haben, das gehört zu unseren glücklichsten Momenten.
Während ich ein Stück des hart gekochten Eis auf die Gabel nehme und geistesabwesend durchs Fenster zum Blair House im Lafayette-Park hinüberstarre, dient mir das Fernsehgemurmel im Hintergrund als weißes Rauschen. Den Fernseher gibt es erst seit Rachels Tod.
Ich frage mich, wieso ich überhaupt noch Nachrichten höre. Alles dreht sich um das Amtsenthebungsverfahren, die Sender biegen sich jede Meldung so zurecht, dass sie zu ihrer Version der Geschichte passt.
Auf MSNBC behauptet ein Auslandskorrespondent, die israelische Regierung verlege einen palästinensischen Top-Terroristen in ein anderes Gefängnis. Könnte das Teil des »Deals« von Präsident Duncan mit Suliman Cindoruk sein? Ein Deal, der mit Israel und einem Gefangenenaustausch zu tun hat?
CBS News glaubt zu wissen, ich trüge mich mit dem Gedanken, eine freie Stelle im Landwirtschaftsministerium mit einem oppositionellen Senator aus den Südstaaten zu besetzen. Hofft der Präsident, gegnerische Stimmen beim Absetzungsverfahren fürs eigene Lager zu gewinnen, indem er Posten verteilt?
Wenn ich jetzt zum Kochsender wechseln würde, geht es mir durch den Sinn, bekäme ich wahrscheinlich zu hören, ich hätte sie vor einem Monat nur deshalb im Weißen Haus empfangen und ihnen meine Vorliebe für Mais verraten, um mich bei den Senatoren aus Iowa und Nebraska einzuschmeicheln, Hardlinern, die mich aus dem Amt jagen wollen.
Fox News erklärt seinen Zuschauern, mein Mitarbeiterstab sei in der Frage, ob ich aussagen solle oder nicht, gespalten, Stabschefin Carolyn Brock sei die Anführerin der Pro-Aussage-Gruppe, während Vizepräsidentin Katherine Brandt an der Spitze der Kontrafraktion stehe. »Es werden bereits Pläne geschmiedet«, sagt gerade ein Reporter draußen vor dem Weißen Haus, »die Anhörung vor dem Repräsentantenhaus als parteipolitische Farce abzutun und dem Präsidenten somit eine Entschuldigung zu liefern, sich im letzten Moment vor einer Aussage zu drücken.«
In der Today Show sind auf einer farbcodierten Landkarte die fünfundfünfzig Senatoren der gegnerischen Partei sowie diejenigen Senatoren meiner Partei zu sehen, die sich demnächst zur Wiederwahl stellen müssen und daher in Versuchung geraten könnten, sich den Überläufern anzuschließen, von denen zwölf genügen würden, um mich bei einem Amtsenthebungsverfahren schuldig zu sprechen.
Auf CNN erfahre ich, wir bestellten schon an diesem Morgen Senatoren ins Weiße Haus, um sie für den Fall der Fälle auf meinen Freispruch festzunageln.
Good Morning America will von Quellen aus dem Weißen Haus wissen, ich hätte mich bereits entschieden, nicht zur Wiederwahl anzutreten, und bemühte mich, mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses eine Vereinbarung zu treffen, wonach sie mir die Amtsenthebung ersparen, wenn ich mich zum Verzicht auf eine zweite Amtszeit verpflichte.
Wo haben sie nur all diesen Blödsinn her? Zugegeben, es ist sensationell, und Sensationen verkaufen sich nun mal besser als Fakten.
Jedenfalls setzen die allgegenwärtigen Spekulationen über mein Geschick meinen Mitarbeitern mächtig zu, erst recht, wenn man bedenkt, dass die meisten von ihnen nicht in die Vorgänge in Algerien oder in mein Telefonat mit Suliman Cindoruk eingeweiht sind und somit nicht mehr wissen als der Kongress oder die Medien oder das amerikanische Volk. Doch bis jetzt haben sie sich von den Angriffen auf das Weiße Haus nicht in ihrer Loyalität erschüttern lassen und sind stolz auf ihren Zusammenhalt. Sie ahnen nicht, wie viel mir das bedeutet.
Ich drücke eine Taste auf meinem Handy. Rachel hätte mich umgebracht, hätte ich beim Frühstück zum Telefon gegriffen. »JoAnn, wo steckt Jenny?«
»Sie ist hier, Sir. Wollen Sie mit ihr sprechen?«
»Ja, danke.«
Carolyn Brock kommt herein, die einzige Person, die es sich erlauben kann, mich beim Essen zu stören. Dabei habe ich nie ausdrücklich gesagt, allen anderen sei der Zutritt verboten. So etwas gehört zu den vielen Dingen, die ein Stabschef für einen tut – für reibungslose Abläufe sorgen, als Torwächter fungieren, sich mit dem Personal herumschlagen, um mir den Rücken freizuhalten.
In ihrem makellosen Kostüm, das Haar streng nach hinten frisiert, erscheint sie korrekt und zugeknöpft wie immer. Es ist, wie sie mir mehr als einmal erklärt hat, nicht ihre Aufgabe, mit dem Stab auf Du und Du zu sein, sondern für eine straffe Organisation zu sorgen, die Leute für gute Arbeit zu loben und den täglichen Kleinkram zu erledigen, damit ich mich auf die großen, schwierigen Dinge konzentrieren kann.
Doch natürlich ist das stark untertrieben. Niemand hat einen härteren Job als der Stabschef des Weißen Hauses. Sicher, Carolyn kümmert sich um den Kleinkram, die Personalfragen und die Terminplanung. Doch sie ist ebenso bei den großen Dingen an meiner Seite. Das muss sie auch, denn schließlich ist sie die Ansprechpartnerin für die Abgeordneten, das Kabinett, die Interessenvertreter und die Presse. Eine bessere Unterstützung kann ich mir nicht wünschen. Sie erfüllt all diese Aufgaben und hält dabei ihr Ego im Zaum. Man versuche nur mal, ihr ein Kompliment zu machen. Sie wischt es weg wie einen Fussel von ihrem tadellosen Kostüm.
Dabei gab es einmal Zeiten, und das ist noch gar nicht so lange her, da sagte man von Carolyn Brock, sie werde es eines Tages zur Sprecherin des Repräsentantenhauses bringen. Als Abgeordnete hatte sie bereits drei Legislaturperioden gedient, eine Progressive, die es fertiggebracht hatte, einen konservativen Wahlkreis im südöstlichen Ohio zu gewinnen, und die zügig in den Rängen des Kongresses bis in die Führungsriege aufgestiegen war. Sie war intelligent, umgänglich, telegen – ein politisches Multitalent. Unter den Spendensammlern war sie der Renner; sie schmiedete Allianzen, die sie bis an die Spitze des Wahlkampfausschusses für die Kongresswahlen brachten. Mit gerade einmal vierzig Jahren war sie kurz davor, die oberste Sprosse der Parteiführung zu erklimmen, wenn nicht sogar, sich für ein höheres Amt zu empfehlen.
Dann kam das Jahr 2010. Niemand machte sich Illusionen darüber, dass bei den Zwischenwahlen in unserer Partei Blut fließen würde. Die gegnerische Seite brachte einen starken Kandidaten an den Start, den Sohn eines ehemaligen Gouverneurs. Schon nach einer Woche war es ein Rennen Kopf an Kopf.
Fünf Tage vor der Wahl machte sich Carolyn bei einer mitternächtlichen Flasche Wein mit ihren engsten Mitarbeiterinnen Luft und ließ sich zu einer abfälligen Bemerkung über ihren Gegner hinreißen, der soeben einen Wahlkampf-Spot mit böswilligen Attacken auf Carolyns Mann, einen bekannten Strafverteidiger, gesendet hatte. Ihre Bemerkung wurde von einem eingeschalteten Mikrofon aufgenommen. Bis heute weiß niemand, wer dahintersteckte und wie das passieren konnte. Carolyn hatte geglaubt, mit ihren beiden Mitarbeiterinnen in einem geschlossenen Restaurant unter sich zu sein.
Als »Schwanzlutscher« titulierte sie ihren Gegner. Binnen weniger Stunden verbreitete sich die Tonaufnahme wie ein Lauffeuer quer durch die Kabelnachrichtensender und im Internet.
Sie hatte zu diesem Zeitpunkt mehrere Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Sie hätte bestreiten können, dass ihre Stimme auf dem Band zu hören war. Oder eine ihrer beiden Mitarbeiterinnen hätte die Bemerkung auf sich genommen. Oder sie hätte erklären können, was wahrscheinlich der Wahrheit entsprach – sie sei müde und ein wenig beschwipst und wegen des negativen Wahlkampf-Spots über ihren Mann einfach wütend gewesen.
Doch sie tat nichts dergleichen, sondern gab folgende Erklärung ab: »Ich bedauere, dass meine private Unterhaltung abgehört wurde. Hätte ein Mann das gesagt, wäre es keine große Sache gewesen.«
Ich bewunderte sie für ihre Reaktion. Heutzutage wäre sie vielleicht damit durchgekommen. Doch damals hatte sie jede Menge Wertkonservative in ihrer Anhängerschaft und verlor das Rennen. Sie wusste, dass dieses S-Wort für immer an ihrem Namen haften würde und sie daher höchstwahrscheinlich nie wieder eine Chance bekäme. Die Politik geht oft brutal mit ihren Verwundeten um. Carolyns Verlust war mein Gewinn. Sie gründete eine politische Consulting-Firma und nutzte ihren Verstand und ihre Fähigkeiten fortan, um quer durchs Land anderen zum Sieg zu verhelfen. Als ich beschloss, mich um die Präsidentschaft zu bewerben, stand auf meiner Liste für meinen möglichen Wahlkampfleiter nur ein einziger Name.
»Sie sollten sich diesen Müll nicht ansehen, Sir«, sagt sie, als ein politischer Berater, von dem ich noch nie gehört habe, auf CNN erklärt, meine Weigerung, mich zu dem Telefonat zu äußern und damit dem Kongresssprecher das Feld zu überlassen, sei ein schwerer taktischer Fehler.
»Wussten Sie übrigens«, sage ich, »dass Sie mich zur Aussage vor dem Sonderausschuss drängen? Dass Sie die Pro-Aussage-Streitkräfte im Bürgerkrieg anführen, der im Weißen Haus tobt?«
»Nein, aber wenn Sie’s sagen.« Sie schlendert zur Tapete im Speisezimmer hinüber, mit Szenen aus dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Jackie Kennedy hat sie dort anbringen lassen, ein Freundschaftsgeschenk. Betty Ford mochte die Tapete nicht und ließ sie entfernen. Carter ließ sie wieder anbringen. Seitdem wurde sie mehrmals abgezogen und wieder angebracht. Rachel liebte die Malerei, und deshalb ist sie dort nun wieder zu sehen.
»Nehmen Sie sich einen Kaffee, Carrie, Sie machen mich nervös.«
»Guten Morgen, Mr President«, sagt Jenny Brickman, meine stellvertretende Stabschefin und engste politische Beraterin. Sie hat meine Kampagne zur Gouverneurswahl geleitet und bei meinem Wahlkampf um das Präsidentenamt unter Carolyn gearbeitet. Ihre Erscheinung kann man nur so beschreiben: eine zierliche Person mit wuscheligem blondiertem Haar und der Gabe, wie ein Bierkutscher zu fluchen. Sie ist mein »lächelndes Messer«. Wenn ich sie lasse, zieht sie für mich in den Krieg. Sie würde sich nicht damit zufriedengeben, den Gegner auseinanderzunehmen. Wenn ich sie nicht im Zaum hielte, würde sie ihn vom Kinn bis zum Nabel aufschlitzen. Mit der Sanftmut eines Pitbulls und etwas weniger Charme würde sie ihn in Stücke reißen.
Nach meinem Sieg hat sich Carolyn auf politische Strategien spezialisiert. Sie hat stets das Machtgefüge im scharfen Blick, auch wenn sie gegenwärtig die wichtigere Aufgabe erfüllt, mein Programm durch den Kongress zu bringen und meine Außenpolitik zu forcieren.
Jenny dagegen konzentriert sich gänzlich auf die politische Taktik, um meine Wiederwahl zu sichern. Und setzt, wie ich einräumen muss, zunächst einmal alles daran, dass ich wenigstens die ersten vier Jahre überstehe.
»Vorerst hält unsere Fraktion im Kongress still«, sagt sie nach Rücksprache mit unserer Parteiführung. »Sie sind begierig, Ihre Seite der Algerien-Geschichte zu hören.«
Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. »›Sagen Sie ihm, er soll gefälligst seinen Kopf aus dem Arsch ziehen und sich wehren‹, das kommt der Sache wohl näher?«
»Fast ein wortwörtliches Zitat, Sir.«