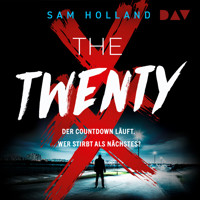9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Major Crimes Unit
- Sprache: Deutsch
Er beobachtet dich. Er kontrolliert dich. Er lässt dich büßen. DCI Cara Elliott wird gerufen, um den Selbstmord eines Mannes zu untersuchen, der bei voller Fahrt von einem Zug erfasst wurde. Cara, die bei jedem Fall ihr Bestes gibt, spürt, dass etwas nicht stimmt. Als sich die Suizide häufen, weiß sie, dass sie richtiglag. Doch wer ist derjenige, der hier hinter den Kulissen die Fäden zieht? Es scheint, als würde ein grausamer Killer seine Opfer beobachten und sie so manipulieren, dass sie ihr Leben selbst beenden. Cara und ihr Team arbeiten fieberhaft an dem Fall, doch immer ist ihnen der Täter einen Schritt voraus … »Eine großartige Autorin mit einer intelligenten, rätselhaften und rasanten Geschichte.« Chris Carter Der neue spannende Fall für das Ermittlerteam der Abteilung für Schwerverbrechen – mit einem Serienkiller der anderen Art. Lesen Sie von Sam Holland außerdem ›The Twenty‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
DCI Cara Elliott wird gerufen, um den Selbstmord eines Mannes zu untersuchen, den ein Zug in voller Fahrt erfasst hat. Cara, die bei jedem Fall ihr Bestes gibt, spürt, dass etwas nicht stimmt. Als sich die Suizide häufen, ahnt sie, dass sie richtigliegt. Doch wer zieht hinter den Kulissen die Fäden? Es scheint, als würde ein grausamer Killer seine Opfer beobachten und sie so manipulieren, dass sie ihr Leben selbst beenden. Cara und ihr Team der Major Crimes Unit arbeiten fieberhaft an dem Fall, doch der Täter ist ihnen immer einen Schritt voraus …
Von Sam Holland ist bei dtv außerdem erschienen:
The Twenty
Sam Holland
The Puppet Master
Thriller
Aus dem Englischen von Susanne Just
Für Dom
Der Tod ist der Wunsch einiger, die Befreiung vieler und das Ende aller.
Seneca, 4 v. Chr. – 65 n. Chr.
Teil 1
Tag 1Montag
1
Im Kampf zwischen einem Menschen und einer 127 Tonnen schweren Diesellokomotive kann es nur einen Gewinner geben.
Cara steht an der Bahnsteigkante und schaut über die Gleise. Hundert Meter links von ihr späht eine Schar von Polizisten mit Latexhandschuhen und gelben Beuteln für biologische Gefahrstoffe in den Händen unter die Räder eines stehenden Güterzugs. Eine Traube aus verärgerten Pendlern bildet sich um Cara. Manche Stimmen sind voller Mitleid, Schock. Andere beschweren sich über die Verspätung und ziehen ihre Handys zurate.
»Warum machen die das nicht zu Hause?«, sagt eine Frau neben Cara. »Das ist doch egoistisch, oder?«
Langsam dreht sich Cara um. Die Frau starrt sie an, wartet auf eine Antwort. Caras Erscheinung in schwarzer Jeans und schickem Mantel trügt. Sie ist keine frühmorgendliche Pendlerin, die gleich zustimmen wird – wie lästig es doch sei, hier herumzustehen und sich um 7:14 Uhr im trüben Licht eines kalten Januarmorgens zu Tode zu frieren.
»DCI Cara Elliott«, sagt sie und zückt ihren Polizeiausweis. »Und ich würde sagen, dass Sie hier die Egoistin sind. Sehen Sie sich doch mal an. In Ihrem Kaschmirschal und Ihren Lederhandschuhen. Sie kommen nicht ins Büro. Na und? Dann arbeiten Sie stattdessen eben von zu Hause aus, bei gemütlichen zweiundzwanzig Grad in Ihrer Wohnung mit Zentralheizung, mit einer Tasse Fairtrade-Kaffee, weil Sie sich bestimmt was drauf einbilden, immer das Richtige zu tun, oder?«
Die Frau schnappt sprachlos nach Luft.
»Denken Sie auf dem Heimweg mal drüber nach«, sagt Cara und kommt jetzt erst so richtig in Fahrt. »Wie glücklich Sie sich im Vergleich zu diesem armen Schwein hier schätzen können, das jetzt von der Bahnsteigkante bis nach ganz dort hinten auf den Gleisen, wo die Bullen stehen, verteilt liegt. Ist Ihnen eigentlich klar, dass ihm die Wucht beim Zusammenstoß mit dem Zug den Kopf abgerissen hat? Der liegt nämlich da drüben.« Sie deutet zu der Stelle, der Frau steht immer noch der Mund offen. »Seine Haare haben sich in dem Gestrüpp verfangen. Während der Rest von ihm …« Cara macht eine ausladende Handbewegung. »Als der Fahrer aus dem Zug gestiegen ist, stand er auf den Eingeweiden des Typen. Nervenzusammenbruch, musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wenn Sie also etwas genauer darüber nachdenken, wen es heute Morgen am schlimmsten getroffen hat, dann kommen Sie vielleicht zu dem Schluss, dass Sie es nicht sind.«
»Boss?«
Cara wird von dem großen Mann abgelenkt, der neben ihr auftaucht und sich jetzt verlegen räuspert.
»Sie warten auf uns«, sagt er.
Im Gehen wendet er sich noch an die perplexe Frau. Cara hört, wie er ihr »Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Haben Sie noch einen angenehmen Morgen« zumurmelt und sie dann wegschickt.
»Der hast du’s aber ganz schön gezeigt«, sagt Jamie, als sie sich unters Absperrband ducken. »Schlecht geschlafen?«
»Könnte man so sagen.«
»Hier.« Er reicht ihr seinen Kaffee. Sie nimmt ihn dankbar an. »Ich schulde dir einen.«
»Du schuldest mir fünf«, erwidert Jamie lächelnd.
Schweigend gehen sie den nun verlassenen Bahnsteig entlang, links von ihnen eine gelbe Linie, rechts von ihnen die mit weißer Farbe markierte Kante. Die elektrische Diesellokomotive steht still und massiv auf den Gleisen, mehrere Flachwagen mit Frachtcontainern noch immer angehängt. Ein schlafender Dinosaurier. So wird sie vermutlich noch eine Weile dastehen.
Cara fallen zwar die Deckenlampen, aber keine Kameras auf. Ein Maschendrahtzaun trennt sie vom Parkplatz. Gute 1,80 hoch, da herüberzuklettern wäre nicht leicht.
Sie steigen über schwarze Gummimatten mit Zacken, die die Leute davon abhalten sollen, das Ende des Bahnsteigs zu verlassen, hinunter auf Bodenplatten und dann Schotter. Vorsichtig nähert Cara sich der größten Gruppe von Beamten und achtet genau auf ihre Schritte. Sie hat keine Lust, auf etwas Ekliges zu treten – über den ganzen Gleisbereich liegen Stückchen des Opfers verteilt.
Der Anruf war um halb sechs eingegangen. Wahrscheinlich eine Kategorie zwei, ein brutaler und unnatürlicher Tod am Bahnhof Southampton Airport Parkway. Normalerweise würde ein Unfall auf den Gleisen in die Zuständigkeit der British Transport Police fallen. Cara tappt noch im Dunkeln, warum sie eigentlich hier sind.
Doch das wird sich hoffentlich bald klären. Neben dem Beamten in Uniform, auf dessen grellgelber Weste das Wappen der BTP prangt, bleiben Cara und Jamie stehen. Er lächelt, eine entschuldigende Grimasse.
»Sie müssen DCI Elliott sein. Ich bin Sergeant Pearson. Tut mir leid, dass ich Sie so weit rausbestellt habe. Langsam glaube ich, dass Sie umsonst hergekommen sind.«
»Jetzt sind wir ja schon hier«, antwortet Cara. »Das ist DS Jamie Hoxton.« Die zwei Männer schütteln sich die Hände, obwohl Pearson weiter Cara fixiert. »Erzählen Sie uns, was Sie wissen.«
»Na ja«, Pearson dreht sich um und besieht mit finsterem Blick die Polizisten, die sich einen Weg um die Gleise bahnen und dabei das, was man nur noch als »Proben« beschreiben kann, in gelbe Plastikbeutel eintüten. »Wie es scheint, stand unser Opfer ganz am Ende von Bahnsteig eins und wartete auf den Zug um 6:04 nach London Waterloo. Die normale Durchsage, dass die Diesellok durchfahren würde, wurde abgespielt, und während sich alle anderen hinter die gelbe Linie begaben, trat er nach vorn.«
Cara verengt die Augen. »Selbstmord also?«
»Ja, aber …« Pearson verstummt. »Unsere Zeugenaussagen waren anfänglich ziemlich verwirrend. Der Bahnsteig war überlaufen, rappelvoll mit Pendlern. Noch dunkel. Eine junge Frau hat etwas gefilmt. Alle haben zu ihr gesehen.«
»Gefilmt?«, wiederholt Jamie. »Diese Aufnahme brauchen wir.«
»So ein YouTube-Zeug, meinte sie. Ich helfe Ihnen, sie zu finden. Aber es ist alles so … verworren. Also haben wir Sie angerufen. Ihr Team ist eher darauf eingestellt, sich mit solchen Angelegenheiten auseinanderzusetzen. Mord und …«
Er hält abrupt inne. Serienmörder, wollte er gerade sagen. Cara ist es gewöhnt. Die leichte Nervosität, der ehrfürchtige Umgang. Sie ist schließlich DCI Cara Elliott. Die leitende Ermittlerin aus dem Fall mit dem Echo-Mann. Berühmt-berüchtigt, auf ihre ganz eigene Art.
»Außerdem sind wir unterbesetzt«, vollendet Pearson seinen Satz mit einer Entschuldigung. »Wir decken ein großes Gebiet ab, und in Basingstoke springt eventuell gleich einer. Mein Team wurde dorthin beordert. Lieber einen retten, bevor der auch noch …«
Seine Stimme erstirbt, und er senkt den Blick zum Boden. Zwischen ihnen, unter den ganzen Schottersteinen, liegt ein einzelner, weißer Zahn. Jamie nimmt einen Handschuh aus der Hosentasche und hebt den Zahn damit auf, dann legt er ihn feierlich auf seine offene Handfläche. Cara betrachtet ihn für einen Augenblick. Ein Stückchen Zahnfleisch hängt noch daran und hinterlässt eine dünne Blutspur auf dem blauen Latex. Jamie schließt die Finger und stapft auf einen der Polizisten zu.
Cara sieht dabei zu, wie er ihn in einen gelben Beutel mit doppelter Beschichtung fallen lässt, und denkt, dass sie dabei eigentlich etwas anderes verspüren sollte als knochentiefe Erschöpfung. Dies ist schließlich ein Stückchen eines Menschen.
Sie seufzt und kippt sich die letzten Schlucke von Jamies kaltem Kaffee in den Mund. »Holen Sie mir noch so einen«, sagt sie zu Pearson. »Und dann sehen wir mal, was wir tun können.«
Eine Stunde später ist Cara warm, mit Koffein vollgepumpt und sitzt vor den Bildschirmen der Überwachungskameras im Bahnhofsbüro. Auf den aufgereihten Monitoren sieht sie Jamie draußen, fast 15 Zentimeter größer als die meisten Leute um ihn herum, der eine vorläufige Zeugenaussage von einer Frau in Uniform auf dem Bahnsteig aufnimmt.
Er ist schon seit zehn Monaten ihre neue rechte Hand, und Cara hat sich an seine ruhige, gefestigte Art gewöhnt. An seine Verlässlichkeit, seine unerschütterliche Herangehensweise. Sie hat ihn gern um sich.
Die Videoaufnahmen von heute Morgen laden, und Cara reckt den Hals, während die Leute auf dem Bahnsteig umherwandern, Kaffee trinken, sich unterhalten und warten. Ein Zug fährt ein, einige steigen ein, einige aus. Die Anzeige ändert sich.
»Da ist er«, sagt Pearson und deutet auf den Bildschirm ganz links. Cara blinzelt. Der Mann ist eindeutig nervös, geht im Kreis wie ein Hund im Käfig, seine Hände zucken.
»Die Bahnhofsmitarbeiterin ist auf ihn aufmerksam geworden und rübergegangen, um nachzusehen, ob es ihm gut ging.«
Vor Caras Augen geht eine uniformierte Frau auf den Mann zu. Er ist aufgewühlt, die Unterhaltung macht ihn panisch.
»Sie hat versucht, ihn zum Mitkommen zu überreden, doch das hat er abgelehnt. Sie ist weggegangen, um Hilfe zu holen.«
»Was hatte er denn an?«, fragt Cara. Er sticht aus den restlichen Pendlern in schicken Anzügen und Business-Kleidung heraus.
»Das ist es ja gerade. Einen Jogginganzug, wie es scheint.«
»Oder einen Schlafanzug«, kommentiert sie.
Sie schaut ihm beim Auf- und Abgehen zu, bis er sich aus dem Blickfeld der Überwachungskamera bewegt.
»Gibt es einen besseren Winkel?«
»Nein, das ist …«
Pearson verstummt, denn da rast die Diesellok durch den Bahnhof. Der Moment des Aufpralls wurde zwar nicht eingefangen, doch Cara kann anhand des Schreckens und der Panik auf den Gesichtern der Wartenden erkennen, was passiert.
Hinter ihr geht die Tür auf, und Jamie kommt herein. Er hat eine Frau dabei – Cara erkennt sie von der Überwachungsaufnahme. Sie ist jung, trägt eine hellblaue Bluse und eine marineblaue Fleecejacke. Auf ihrem Aufnäher steht Sharon. Ich helfe gern. Unter den starren Blicken der drei Polizeibeamten schrumpft sie zusammen.
»Ich konnte ihn nicht aufhalten«, sagt sie sofort. »Ich hätte … keine Ahnung.«
Ein paar Tropfen Rotz rinnen ihr aus der Nase, sie schnieft.
Jamie deutet auf einen der Stühle, und widerwillig setzt sie sich. Cara rückt näher heran, sodass sich ihre Knie beinahe berühren. Sie lehnt sich nach vorn, die Hände ineinander verschränkt.
»Sharon, ich bin DCI Elliott«, beginnt sie mit sanfter Stimme. »Sie können mich Cara nennen. Sie haben nichts falsch gemacht. Aber könnten Sie mir sagen, was Sie vorher mit DS Hoxton besprochen haben? Mit Jamie hier. Ich würde gern direkt von Ihnen hören, was heute Morgen passiert ist.«
Die junge Frau nickt, schnieft wieder. Jamie reicht ihr ein Taschentuch.
»Was hat Sie dazu gebracht, mit diesem Mann zu sprechen?«
»Ich habe gerade erst eine Weiterbildung dazu gemacht. Sie wissen schon. Einen Kurs in Suizidprävention. Und ich dachte mir … er sieht genauso aus, wie mir das geschildert wurde.«
»Und zwar wie?«
»Nervös. Fehl am Platz – er hatte keine Tasche dabei und war total leger gekleidet. Er war ganz allein und wollte mich nicht ansehen. Er wirkte irgendwie … ziellos. Und …« Sie setzt sich auf und kommt in Fahrt. »Er hatte keinen Mantel dabei. Ihm muss doch eiskalt gewesen sein.«
»Was haben Sie dann getan?«
»Das, was ich gelernt habe. Ich bin auf ihn zugegangen, habe Hallo gesagt. Gefragt, ob ich helfen kann. Aber er hat mich nur angestarrt, herumgezappelt, seine Augen waren ganz glasig. Wie ein Zombie.«
Cara sieht zu Jamie hoch. Ihre Blicke treffen sich, er liest ihre Gedanken, doch beide sagen nichts.
»Und was dann?«, fragt sie Sharon.
»Ich hab nach seinem Namen gefragt. Und dann wusste ich nicht mehr weiter, also dachte ich, ich gehe lieber kurz wen holen. Ich hab gesagt, er soll dort bleiben und dass ich gleich wieder da wäre, aber dann hab ich den Zug kommen hören und die Schreie und …« Sie fängt wieder an zu weinen, aufgelöst, die Tränen verschmieren ihre Wimperntusche. Zitternd hebt sie einen Finger, um sie wegzuwischen, macht es dabei nur noch schlimmer. »Ich hätte …«
»Sie haben alles getan, was Sie konnten, Sharon«, sagt Cara sanft. Jamie gibt ihr ein weiteres Taschentuch. Die junge Frau tupft sich die Augen. »Haben Sie irgendwen in seiner Nähe gesehen? War irgendjemand bei ihm?«
»Nein. Nur die üblichen Pendler. Wenn überhaupt, hat er versucht, auf Abstand zu gehen, als hätte er Angst vor ihnen. Kann ich jetzt gehen? Hier sind so viele Leute, und ich muss meinem Chef helfen.«
»Ja, natürlich. Aber wissen Sie, wie er hieß?«
Sie stutzt. »Ich weiß es nicht. Hab ihn nicht verstanden. Ich hätte nachfragen sollen, aber ich dachte, es wäre wichtiger, jemanden zu holen. Ich …«
Cara legt ihr eine Hand auf den Arm. »Sie haben getan, was Sie konnten.«
Sharon nickt, ein Flehen in den Augen, sie will Cara unbedingt glauben. Cara dankt ihr, dann verlässt Sharon schnell den Raum.
Jamie rutscht mit dem Stuhl zu ihr. »Drogen?«, sagt er und spricht ihren Gedanken aus.
»Vielleicht.«
Wortlos spult Cara die Aufnahme zurück und lehnt sich nach hinten, damit Jamie sie auch sehen kann.
Als die furchtbare letzte Szene zum zweiten Mal durchgelaufen ist, dreht sich Cara zu ihm.
»Was meinst du? Tod durch Fremdeinwirkung oder Selbstmord?«
»Mehr haben wir nicht?«, fragt Jamie Pearson. Pearson verneint. Jamie wiegt den Kopf hin und her.
»Basierend darauf und auf der Aussage des Bahnhofsvorstehers würde ich zu Selbstmord tendieren. Er war aufgewühlt, panisch. Und eindeutig nicht wegen der Arbeit da. Er hat alle Warnsignale eines Menschen von sich gegeben, der sich gleich umbringen will.«
»Aber?«, kommt Cara ihm zuvor.
»Aber«, sagt Jamie mit einem Nicken in ihre Richtung, »wenn er auf Drogen war und verwirrt, hätte es auch ein Unfall sein können. Außerdem hat sich unsere angehende Stevie Spielberg unerlaubt entfernt.«
»Na ganz toll. Von der Überwachungsaufnahme haben Sie keinen besseren Winkel?«
Pearson schaut bedauernd drein. »Noch nicht. Tut mir leid.«
Cara seufzt. Es wäre zu einfach, die Sache der British Transport Police zu überlassen. Doch sie will an alles denken. Sich sicher sein, dass hier nichts Zwielichtiges vor sich geht, bevor sie den Ball zurückspielt.
»Nehmen Sie eine offizielle Aussage von dieser Zeugin auf«, weist sie Pearson an. »Senden Sie mir alle Aufnahmen. Außerdem werden wir mit dem Zugführer sprechen müssen. Wenn er dazu wieder imstande ist«, ergänzt sie grimmig.
»Verstanden, Boss«, antwortet Jamie. Pearson wirkt erleichtert.
»Fahren wir erst mal zurück aufs Revier. Dann sehen wir weiter.«
2
Die Einsatzzentrale der Einheit für Schwerverbrechen ist nur mehr eine verschrumpelte Hülle ihrer selbst. Einst gerammelt voll mit Detectives, Analysten und Verwaltungsangestellten, ist sie jetzt auf ein paar Detective Constables und einen Detective Sergeant zusammengeschrumpft, die alle hinter veralteten Computerbildschirmen stumm vor sich hin arbeiten. So viele sind gegangen.
Nach den Geschehnissen des letzten Februars ist keiner mehr sonderlich scharf darauf, den Schwerverbrechen beizutreten. Dem Team, das Serienmörder fängt – die Gefährlichen und die Psychos. Aber auch dem, wo die Detectives sterben. Wo sie erstochen, unter Drogen gesetzt und gefoltert werden, auf die schlimmste Weise zu Tode kommen. Wer will da schon arbeiten?
Der Job war immer schon hart, aber jetzt umso mehr, da nur noch die Eingefleischten bleiben. Der Loyalste von ihnen, DC Toby Shenton, sieht jetzt von seinem Schreibtisch auf, als Cara und Jamie zurückkommen.
»Die Presse vermeldet es als Selbstmord«, sagt er. Mit langen, feingliedrigen Fingern wischt er sich den blonden Pony aus den Augen. »Anscheinend war das Opfer depressiv.«
Cara lässt sich neben ihn auf einen Stuhl fallen. Sie deutet auf den Bildschirm, und Shenton dreht ihn, damit sie den Artikel lesen kann. Und tatsächlich, der Chronicle hat die üblichen Standardsätze – ›Zug konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten‹, ›massive Verspätungen‹ – und ein paar Bemerkungen über das Opfer rausgehauen. Colin Jefferies, einunddreißig. Arbeitslos.
»Wie haben die so schnell seine Identität herausbekommen?«, fragt Cara Shenton. »Und woher wissen sie von seiner psychischen Gesundheit?«
»Sie haben einen Zeugen interviewt. Der hat ihn mit der Mitarbeiterin auf dem Bahnsteig reden hören. Sie haben auch mit seiner Mutter gesprochen. ›Innig geliebter Sohn‹«, zitiert Shenton.
»Haben wir die Mutter da?«
»Nein. Das ist doch …«
»Was ist das?«, faucht Cara.
»Ich dachte, die BTP würde das übernehmen. Ist das nicht deren Gebiet?«
»Bestellt sie her«, sagt Cara und lässt ihn damit sitzen.
Sofort fühlt sie sich schuldig. Schon seit Monaten ist sie so gereizt. Null Toleranz gegenüber Trägheit. Sie hat es satt, darauf zu warten, dass ihre Untergebenen ihre Gedanken lesen.
Die andere DC kommt zögernd herüber und hält ihr als Friedensangebot eine Tasse Kaffee hin.
»Der Fall gehört also uns?«, fragt DC Alana Brody. Sie ist neu. Schwarze Haare, Nasenpiercing und eine Menge Löcher im Ohr, von oben bis unten. Brody mag ungewöhnlich aussehen, doch ihre Arbeit war immer einwandfrei. Eigentlich war Cara alle leid, die sich zu ihnen versetzen lassen wollten, aber Brody ist ihr ans Herz gewachsen, nachdem sie sich zuverlässig die ganzen nachholbedürftigen Fälle vornahm, die sich angestaut hatten, während Cara am Ende ihrer Kräfte war.
Mit einem dankbaren Lächeln nimmt Cara den Kaffee. »Für den Moment. Da ist noch nichts in Stein gemeißelt. Ich würde gern mit Sicherheit wissen, wie dieser Mann gestorben ist.«
»Überwachungskameras und Zeugenaufrufe?«
»Ja, bitte. Mit einer Sondernachfrage nach allen, die an diesem Morgen vielleicht etwas gefilmt haben.«
»Mach ich. Ach ja, Halstead will Sie sehen.«
Cara verzieht das Gesicht. Ihre neue Detective Chief Superintendent hat die Position erst seit zwei Monaten inne und macht sich schon einen Namen, wenn auch nur aus der Ferne, von ihrem Büro im vierten Stock aus. In ihrer ersten Woche wurde Cara beinahe täglich zu ihr beordert, meistens wegen kleiner Dienstwidrigkeiten oder Grundsatzentscheidungen, die man auch in einer E-Mail hätte klären – und ignorieren – können. Cara denkt an ihren letzten Boss, Marsh, mit seinem obligatorischen Zigarettengestank und gebrüllten Befehlen. Seit fast einem Jahr tot. Er war ein Ermittler, der wusste, was er tat – wann er einschreiten und wann er sie in Ruhe lassen musste. Meistens Letzteres. Sie vermisst ihn.
Cara stürzt den Kaffee hinunter und trottet zu Halsteads Kommandozentrale. Sie ist froh, dass sich die in einem anderen Zimmer als Marshs altem Büro befindet. Die Erinnerungen und die Trauer wären schwer erträglich gewesen.
Jedenfalls grüßt sie jetzt kurz Halsteads leidenden Sekretär und wird umgehend nach drinnen gerufen. Mit einem brüsken Schnipser zeigt Halstead auf den Stuhl vor ihrem Schreibtisch.
»Ich habe von diesem Selbstmord gehört«, fängt sie an, legt die Hände auf den akribisch aufgeräumten Schreibtisch, die Fingerspitzen zu einem Dreieck aneinander.
»Den werden wir so schnell es geht wieder los, Ma’am …«, setzt Cara an, verstummt jedoch, als sie Halsteads düstere Miene bemerkt.
DCS Halstead ist jung. Verdammt noch mal zu jung für diesen Job, Caras Meinung nach. Als man ihren Namen verkündet hat, wurde mit Wörtern wie »Blitzbeförderung« und »Vetternwirtschaft« um sich geworfen, aber jetzt ist sie hier, aus welchem Grund auch immer. Sie hat streng geglättete Haare, sorgfältig manikürte Nägel und eine Vorliebe für Blazer in knalligen Farben über schwarzen Blusen und Hosen. Heute ist es Knallpink, passend zu einer grellen Kitschkette.
»Behandeln Sie das als unklare Todesursache«, befiehlt Halstead. »Die BTP hat uns nicht zum Spaß gerufen. Das sind schließlich unsere geschätzten Kollegen.«
Cara wartet ab. Das kann nicht alles sein.
»Außerdem hat sich die Presseabteilung mit mir in Verbindung gesetzt.«
Ah, okay.
»Wir dürfen nichts anderes als Sorgfältigkeit vermitteln. Die Mutter hat schon am Telefon herumgeschrien, dass sich ihr geliebter Sohn niemals das Leben nehmen würde. Im Augenblick erstrahlt unsere Abteilung also nicht gerade in Glanz und Gloria«, sie macht eine Pause und schürzt die Lippen, »und das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Zwei Serienmörder in zwei Jahren, landesweit, die beide im Kreis um ihre Ermittler getanzt sind. Es wurden Fehler begangen …«
»Zwei Detectives wurden ermordet!«, ruft Cara.
»Wie ich schon sagte, es wurden Fehler begangen. Beweise übersehen.« Halstead wirft Cara einen warnenden Blick zu. Cara weiß, was sie damit sagen will. Von dir. »Und wir dürfen keinen anderen Anschein erwecken, als dass wir unser Möglichstes tun, damit es keine ungelösten Mordfälle mehr in unserem Zuständigkeitsbereich gibt. Klären Sie das rasch und effizient auf.« Sie lehnt sich nach vorn. »Ich weiß, dass Sie es schwer hatten, Elliott. Aber ich brauche meine beiden Chief Inspectors in voller Einsatztauglichkeit – DCI Ryder fängt im Hauptquartier in Basingstoke gerade erst an, haben Sie sie schon kennengelernt?«
»Nein, Ma’am.«
»Eine fantastische Polizistin. Voller Energie. Die noch mehr kann«, fügt Halstead hinzu, die Implikation darin eindeutig. Die übernimmt auch bald dein Kommando.
Cara wird rot. Sie braucht diesen Job. Sie muss arbeiten.
»Mir geht’s gut, Ma’am. Ich setze mein Team gleich darauf an.«
Halsteads Blick bleibt zweifelhaft. »Wie geht es mit der Rekrutierung voran?«
»Schleppend«, erwidert Cara vorsichtig. Das ist eine Lüge. Nicht existent, das trifft es eher.
»Nun ja, dann verdoppeln Sie Ihre Bemühungen. Es kommt nicht oft vor, dass ich das sage, aber wir brauchen mehr Detectives. Machen Sie das Beste aus dieser einzigartigen Situation und rekrutieren Sie so viele Leute wie möglich.«
Cara stutzt, überlegt. Eine Idee flackert auf.
»Egal, wen?«, fragt sie.
»Alle, die qualifiziert sind«, erwidert Halstead.
Cara murmelt noch ein paar Beschwichtigungen und ist dann entlassen. Sie eilt aus dem Büro, die Treppe hinunter Richtung Parkplatz. Sie muss jetzt sofort los, bevor sie noch einen Rückzieher macht. Ihr rationales, logisches Denken wird sonst einschreiten, und dann wird sie es nicht durchziehen.
Sie setzt sich ins Auto und fährt ein paar Kilometer aus der Stadt raus. Hübsche Doppelhaushälften werden zu heruntergekommenen Reihenhäusern. Abgezäunte, unbebaute Grundstücke, illegale Mülldeponien, Sex-Shops und Läden für E-Zigaretten.
Vor einer Gebrauchtwagenwerkstatt hält sie an. Auf dem Parkplatz stehen immer noch dieselben Fahrzeuge wie vor sechs Monaten, als sie zum letzten Mal hier war. Rechts ein Wohncontainer, das Licht ist an, drinnen bewegt sich jemand. Aber sie ist wegen jemand anderem hier.
Ganz hinten links steht ein Bürogebäude. Sie geht an der rauen Ziegelwand entlang zur großen, blauen Metalltür voller Rostspuren. Sie schlägt mit der Faust dagegen, dass das Scheppern nur so über den Parkplatz dröhnt.
Keine Reaktion. Sie hämmert noch mal, wartet. Ganz in der Nähe ist der dumpfe Beat von Rockmusik aus den Neunzigern zu hören. Sie will schon ihr Handy zücken, als sie schwere Schritte vernimmt, die die Metalltreppe drinnen hinaufstapfen.
Die Tür wird aufgerissen. Ein Mann steht vor ihr. Eins achtzig. Mit dunklen, ungekämmten Haaren, die ebenso dringend einen Friseur bräuchten wie sein Bart eine Rasur. Ganz in Schwarz: Jogginghose, ein T-Shirt, das über der Brust spannt. Ausgelatschte Turnschuhe, die Schnürsenkel offen. Aus hellbraunen Augen, die ihren eigenen sehr ähnlich sind, schaut er sie finster an.
»Was willst du, Cara?«
Sie versucht sich an einem kleinen Lächeln.
»Auch schön, dich zu sehen, Griffin«, antwortet sie.
3
»Hast du vor, mich hereinzubitten?«
»Kommt drauf an, was du gleich sagst.«
»Griffin …«, warnt Cara, er seufzt und öffnet die Tür, sodass sie sich durch den Spalt hineinquetschen kann.
Sie steigt die dunkle Metalltreppe hinunter, Griffins Schritte hinter sich, und betritt die Kellerwohnung.
Draußen wäre es ihr auf einmal lieber gewesen, sie hätte nicht darauf bestehen sollen. Dröhnende Musik: Rage Against the Machine, sein Geschmack hat sich seit Jugendzeiten nicht verändert. Es ist eiskalt, der leicht moschusartige Geruch von Männerschweiß hängt in der Luft. Eine große Langhantel liegt mitten auf dem Boden, zwei riesige Gewichte auf jeder Seite. Er schnappt sich ein Handtuch und wischt sich das Gesicht ab. Seine Untätigkeit zwingt sie, etwas gegen den Lärm zu tun.
Sie schaltet die Musik aus.
»Wie geht’s dir?«, fragt sie.
»Was glaubst du denn?«, erwidert er ungehalten und ist mit drei großen Schritten in der Küche. Er füllt ein Glas mit Leitungswasser und trinkt es in einem Zug. Dann drückt er den Knopf des Wasserkochers und hält eine Dose Instantkaffee hoch. »Auch einen?«
»Hast du Milch?«, fragt Cara.
»Ganz frisch gemolken.«
Er klingt sarkastisch, aber er nimmt zwei Tassen aus dem Küchenschrank. So etwas wie ein Waffenstillstand. Während sie wartet, sieht sie sich um, und ihr fällt die blitzeblanke Küche auf, das gemachte Bett.
»Du hast auf dich geachtet.«
»Du brauchst gar nicht so überrascht zu klingen.« Er sieht sie vielsagend an. »Aber ja. Ich mache Fitness und meine Physio.«
»Das sehe ich«, antwortet sie, da sich sein Bizeps beim Kaffeemachen unübersehbar wölbt. »Schläfst du auch genug, isst du gut?«
»Du bist meine Schwester, nicht meine Mutter. Hör auf damit.« Er rührt den Kaffee um, trägt dann beide Tassen zu dem abgenutzten Holztisch rüber, setzt sich hin und bedeutet ihr, es ihm gleichzutun. »Was willst du, Cara?«
»Ich …« Doch bevor sie weitersprechen kann, landet ein Wirbelwind aus schwarzem Fell auf dem Tisch. Kreischend springt sie wieder auf und lacht dann aber fast, als sich die Katze elegant vor ihr niederlässt und Caras Ausbruch aus ihren Bernsteinaugen betrachtet.
»Seit wann hast du denn eine Katze?« Cara kommt wieder zu Atem.
»Seit Frank beschlossen hat, dass er gern hier wohnen würde.«
»Frank?«
»Passt doch zu ihm.«
Jeder andere Name auf der Welt würde besser zu diesem geschmeidigen Wesen passen, aber Frank scheint das nichts auszumachen. Cara streckt die Hand aus, um den Kater zu streicheln, aber der reckt den Schwanz hoch in die Luft und legt sich dann lässig neben Griffin. Griffin ignoriert ihn.
»Was willst du?«, wiederholt Griffin.
»Dass du wieder zur Arbeit kommst.«
Er starrt sie an. »Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Damit bin ich durch.«
»Und was machst du stattdessen? Ein halbes Jahr bist du jetzt schon hier. Und gammelst in dieser Kellerwohnung vor dich hin. Hängst den ganzen Tag nur rum …«
»Ich habe einen Job.«
»Als Security für eine Gebrauchtwagenwerkstatt? Das ist wohl kaum ein Job. Wie viel zahlt er dir? Abgesehen davon, dass er dich hier hausen lässt?«
Griffin schweigt. Nicht viel, nimmt Cara an.
»Hier verschwendest du nur deine Zeit«, fährt sie fort. »Du musst doch vor Langeweile wahnsinnig werden. Führst dich auf wie ein Teenager, der wegen einer Trennung schmollt.«
»Du hast sie doch nie gemocht. Aber es geht gar nicht um Jess.«
»Um was dann?« Cara weiß, dass Griffin enttäuscht ist, dass es nicht geklappt hat. Der Umzug nach Manchester, um mit Jessica Ambrose zusammenzuwohnen, war in Caras Augen von Anfang an zum Scheitern verurteilt, aber welches Recht hat sie schon, darüber zu urteilen? Ihr eigenes Liebesleben ist nicht gerade spektakulär.
»Griffin?«, wagt sie einen Vorstoß. »Ist es etwa das Oxy-«
»Ich nehm keine Schmerztabletten mehr. Hab ich dir doch schon gesagt.«
»Dein Suchtberater hat dich aber zurück-«
»Was, wenn ich gar nicht mehr hingehen will? Ich kann das nicht noch mal.« Er schaut finster und krault den Kater am Kopf, dann sieht er Cara zum ersten Mal richtig an. »Warum bist du überhaupt so scharf darauf?«, will er wissen. »Früher wolltest du doch nie mit mir zusammenarbeiten.« Er sieht sie flüchtig an, überlegt. »Du bist am Arsch, oder? Marsh ist weg. Wie ist denn die neue Detective Chief Superintendent so?«
»Halstead ist … eine Bitch«, gibt Cara zu.
Griffin lacht. Cara muss trotz allem lächeln.
»Niemand will in deinem Team arbeiten«, fährt er fort. »Und das kann man ihnen nicht vorwerfen. Wie viele bleiben? Ziemlich wenige, alle werden von den Serienmördern abgeschlachtet, die du fangen sollst.« Er verstummt, und sie weiß, dass er an seine verstorbene Frau, Mia, denkt, die vor drei Jahren von dem Echo-Mann ermordet wurde. Ein Killer, den Cara nicht gefunden hat, weil sie daran gescheitert ist, die Zeichen direkt vor ihrer Nase zu sehen.
Doch Griffin erwähnt es nicht und unterdrückt die Wut, wie er es immer tut, seitdem sie zuletzt zusammengearbeitet haben. Er macht mit seiner Tirade weiter.
»Da haben wir Jamie Hoxton, der erst vor einem Jahr seine eigene Tragödie erlebt hat. Shenton, wobei der mit den Gedanken bei seinem Profiler-Ding ist. Schreibt er immer noch an der Doktorarbeit?«
Cara nickt mürrisch. »In Teilzeit.«
»Wen noch?«
»Brody«, antwortet Cara. »DC Alana Brody. Hat sich von der Metropolitan Police versetzen lassen.«
»Was ist ihr Problem? Warum ist sie bei dir?«
»Sie meinte, sie wollte eine neue Herausforderung.«
Griffin lacht noch mal dreckig. »Die hat sie ja jetzt. Heilige Scheiße.« Er lehnt sich nach vorn und nimmt sich eine Zigarette. Er begegnet ihrem missbilligenden Blick. »Was? Ich trinke nicht, ich bin von den Schmerztabletten los. Darf ich jetzt gar keinem Laster mehr frönen?«
»Die Kippen werden dich ins Grab bringen.«
»Genau wie viele andere Sachen. Ich bin noch nicht tot.«
Der Kater springt lautlos vom Tisch. Griffin grunzt und drückt die halb gerauchte Zigarette in einem Aschenbecher aus. Offenbar wiegt das Missfallen des Katers schwerer als Caras.
»Warum bist du hier, Cara?«, fragt er. »Es gibt Tausende gute Detectives. Warum brauchst du mich?«
Cara seufzt. Sie ist sauer auf ihren Bruder.
»Ich brauche jemanden, dem ich trauen kann. Alle außer Shenton sind neu. Und wir stecken bis zum Hals in irgendwelchen Fällen. Zum Beispiel in diesem unklaren Todesfall heute Morgen. Leiche auf den Zugschienen.«
»Was hat das denn mit dir zu tun? Das ist doch Sache der BTP.«
»Die Zeugenaussagen sind alle komplett gaga.«
Griffin zieht eine Grimasse.
»Ja, ja. Ich weiß. Sie haben keine Ressourcen, und auf dem Papier schreit alles nach Selbstmord.« Sie startet einen letzten Versuch. »Ich brauche deine Hilfe. Komm zurück, Nate. Bitte.«
»Ich denk mal drüber nach.«
»Nate …«
»Was Besseres bekommst du heute nicht mehr von mir, Cara. Lass es gut sein.«
»Okay.« Sie steht auf und wedelt den Zigarettenrauch weg. »Ich würde dich ja umarmen, aber ehrlich gesagt stinkst du. Falls du also wieder aus der Versenkung auftauchen willst, dusch zuerst.«
Griffin verdreht die Augen und winkt übertrieben zum Abschied. Sie schluckt ihren Ärger hinunter, wobei sie ihr Angebot fast schon wieder bereut.
Sie hatte vergessen, wie unausstehlich er sein kann. Was für eine Nervensäge. Aber auch ein brillanter Bulle.
4
So schlimm stinke ich auch wieder nicht, denkt Griffin, als er die Tür hinter seiner Schwester mit einem dumpfen Schlag zumacht. Er wartet, lauscht ihren Schritten, die auf der Metalltreppe bis nach oben nachhallen, dann dem Brummen, bis das Motorengeräusch ihres Autos langsam verklingt.
Er sieht sich in seiner Wohnung um, sieht sie aus ihrer Perspektive. Klar, sie ist winzig – ein Zimmer mit einem Bett auf der einen Seite und einem Sofa auf der anderen, der große Holztisch nimmt den gesamten Platz vor der Tür ein –, aber sie ist sauber und ordentlich und sein Zuhause.
Außerdem ist sie umsonst, im Tausch gegen sein wachsames Auge über die Werkstatt nachts. Nicht dass irgendjemand den Haufen klappriger Fiestas und Corsas auf dem Parkplatz stehlen wollen würde. Aber es reicht für ein ruhiges Leben, was ihm gerade unschätzbar viel wert ist.
Sein Ego ist angekratzt. Sein Stolz verstümmelt. Er hat es versucht, sein Herz aufs Spiel gesetzt, und es hat nicht geklappt. Aber warum wundert ihn das überhaupt?
Sein kurzes Intermezzo mit Jess kam nach weniger als einem halben Jahr zu einem vorhersehbaren Ende, und zwar in einer Kakophonie aus Geschrei und Türenknallen. Alles in allem waren elf Monate nicht schlecht, aber was hatte er sich dabei gedacht? Er ist nicht fürs Familienleben gemacht. Für ein Zuhause mit Freundin und Hund und samstagmorgendlichen Ausflügen zu Tesco. Nein, er gehört hierher. Allein.
Mit Frank.
Der Kater ist ihm vor ein paar Monaten zugelaufen, folgte ihm auf seinen Rundgängen über den Parkplatz und schmiegte sich an seine Beine, wenn er sich auf den Weg nach unten zu seiner Wohnung machte. Er ignorierte ihn, fütterte ihn nicht, aber das machte keinen Unterschied. Der kleine schwarze Kater machte sich bei ihm wohnhaft, ob es Griffin gefiel oder nicht.
Und jetzt hat er einen Namen, einen Lieblingsplatz auf dem Sofa sowie Futter- und Wasserschälchen – obwohl er frisst, was immer ihm gerade beliebt, und aus der Spüle trinkt. Er kommt und geht, wie er will, und behandelt das obere Fenster als seine persönliche Katzenklappe. Griffin macht es jetzt so gut wie nie mehr zu.
Er spürt eine Zugehörigkeit zu dieser rastlosen Seele. Außerdem mag er den kleinen, warmen Körper nachts neben sich inzwischen ganz gern, das laute Schnurren, wenn sie nebeneinander zu Abend essen, das weiche Fell, das ihn am Morgen als Erstes im Gesicht streift.
Jetzt beobachtet ihn Frank von seinem Platz aus, zusammengerollt auf Griffins Bett.
»Also, das ist Cara«, sagt er dem Kater. Frank hebt neugierig den Kopf. Aber Griffin gibt sich keiner Illusion hin: Er ist auf Fressen aus und nicht auf eine Gesprächstherapie, also öffnet Griffin eine Dose Thunfisch und kippt sie in seine Schüssel.
Während Frank frisst, denkt Griffin über ihre Unterhaltung nach. Caras Blick hat ihm nicht gefallen. Als wäre Griffin armselig, bemitleidenswert. Es geht ihm gut. Gut. Wie immer: eigenständig, zufrieden mit seiner eigenen Gesellschaft. Er braucht nicht viel. Er hat sein Leben gern einfach. Ein paar Pfannen, Teller und Tassen, einen halb leeren Schrank. Einen Ort, wo er trainieren und den Kopf zur Ruhe betten kann.
Bei einer Sache hatte seine Schwester allerdings recht: Ihm ist langweilig.
Er wiegt Caras Angebot ab. Doch eine Rückkehr zum Team Schwerverbrechen bedeutet Mord und Totschlag und alles, was er gern hinter sich lassen würde. Außerdem eine erneute Zusammenarbeit mit seiner Schwester. Eine tägliche Erinnerung daran, wie sie ihn enttäuscht hat, nicht bemerkt hat, was vor ihrer eigenen Nase vor sich ging. Ein Killer, der seine Frau ermordet hat. Und ihn ins Krankenhaus gebracht hat. Drei Mal.
Drei Mal, verdammt.
Jetzt reibt er sich beinahe unterbewusst über die jüngste Narbe, seine Hand folgt der Linie des Chirurgenskalpells unter dem T-Shirt. Der Heilungsprozess hat Monate gedauert. Ihn dazu gezwungen, sein Leben auf die Reihe zu bekommen, aber wohin hat ihn das jetzt geführt? Hierher. Allein. Wieder in dieser Kellerwohnung.
Entschlossen zieht er das T-Shirt nach unten. Grübeln hat keinen Sinn. Er überlegt, zu seinem Workout zurückzukehren, doch die Motivation ist dahin. Er fühlt sich schmierig, und ihm ist kühl, der Schweiß trocknet auf seiner Haut. Vielleicht wäre eine Dusche nicht verkehrt.
Eine Viertelstunde später, sauber, die Klamotten in der Waschmaschine, denkt er ans Mittagessen. Kurz raus zum Supermarkt, was Frisches und Gesundes einkaufen, das er später getrost ignorieren kann, wenn er sich wieder ein Curry bestellt. Aber als er zur Jacke greift, klopft es erneut. Er fragt sich, ob es noch einmal Cara ist, doch es klingt leiser, zurückhaltender.
Er weiß, wer das ist. Einen Augenblick steht er einfach nur da, regungslos, bis es noch mal klopft.
»Griffin?«, sagt die Frau mit gedämpfter Stimme. »Ich weiß, dass du da bist. Du kannst mich nicht ignorieren.«
Er seufzt und öffnet die Tür.
»Issy, wir haben doch schon darüber geredet.«
Die junge Frau tänzelt in den Raum, das hält sie wohl für sexy. Dabei ist sie besoffen und stößt sich die Hüfte am Holztisch. Sie bleibt stehen, taumelt, ihr Blick unstet, dann stolziert sie auf ihn zu und presst den Körper gegen seinen. Sie trägt eine enge Jeans und ein weißes, bauchfreies Top. Ihr schwarzer Eyeliner ist verwackelt. Eine Gänsehaut überzieht ihre nahezu durchscheinende Haut, draußen ist es kalt, und ihre Schulterknochen stechen stark hervor.
»Du riechst gut«, sagt sie.
Sie will sein Gesicht berühren, doch er hält sie auf, umfasst ihr Handgelenk mit der Faust.
Sie lächelt. Wehrt sich schwach. »So läuft das also?«
Schnell lässt er sie los und macht einen Schritt zurück. Sie lässt sich nicht beirren.
»Griffin«, umschmeichelt sie ihn. »Komm schon …«
»Nein, Issy. Ich hab’s dir doch schon gesagt. Nein.«
»Ist es wegen meinem Vater? Scheiß auf den.«
»Er ist mein Boss. Außerdem hat das nichts mit ihm zu tun.«
Sie stößt einen trotzigen Laut aus. »Was ist dann das Problem?«
Griffin ist sich nur allzu sehr bewusst, was das Problem ist. Sie ist neunzehn. Halb so alt wie er. Ihrem Vater gehört die Werkstatt. Aber sie macht ihm jetzt schon seit ein paar Monaten Avancen. Seit er wieder zurück ist, dumm, mit angekratztem Stolz und verwundbar, was den Charme einer heißen, jungen Frau angeht, die nie damit hinter dem Berg hält, was sie gern hätte.
Aber er hat sie damals abblitzen lassen. Und er wird sie auch jetzt abblitzen lassen.
Sie presst sich an seine Brust, schiebt sanft eine Hand unter sein T-Shirt. Es ist schon etwas länger her, dass Griffin das letzte Mal flachgelegt wurde. Und sie ist weich, riecht gut. Irgendwie blumig, feminin. Sie steht auf den Zehenspitzen und hebt die Lippen zu seinem Hals. Er zwingt sich, einen Schritt zurückzutreten. In ihren Augen glimmt es auf. In einer einzigen, flüssigen Bewegung zieht sie ihr Top aus, unter dem ein Spitzen-BH zum Vorschein kommt. Und dann schlägt sie ihn, hart.
Seine Wange brennt. Er zuckt zurück und spürt, wie ihm das Blut ins Gesicht schießt. Seine Kiefer mahlen. Sie hebt die Hand, um es noch einmal zu tun, aber er hält sie fest. Er sieht zu ihr hinab, und sie lächelt. Ein süffisantes, zufriedenes Grinsen, mit dem sie ihm hart in den Magen schlägt.
Er hat schon Schlimmeres eingesteckt. Diesen Schlag spürt er kaum. Doch Griffin hält nichts von dem Ärgernis, dem blauen Fleck, den er unweigerlich hinterlassen wird. Er nimmt ihre andere Hand und hält beide hoch über ihren Kopf.
»Schlag mich«, sagt sie.
Griffin lässt sie los, als hätte sie ihn gestochen. Er zwingt sich, den Kiefer zu entspannen, als sie ihn nochmals ohrfeigt, so hart sie kann. In seinen Ohren schrillt es, aber er tut nichts.
»Bestraf mich«, wiederholt sie.
»Issy …« Sie schlägt ihn noch mal. »Isabel, ich werde dich nicht schlagen.«
Sie hebt die Hand, diesmal wehrt er sie ab, wobei ihr Handgelenk auf seinen Unterarm trifft. Wütend versucht sie es wieder und wieder. Hofft verzweifelt auf eine Reaktion.
Beim ersten Mal war er betrunken gewesen. Ein Rückfall – eine Flasche Jack intus, Urteilsvermögen über Bord geworfen. Sie küssten sich nicht, aber fast. Und sie schlug ihn. Ein sauberer Kinnhaken. Ein alberner Versuch, aber genug, um seine Wut zu entfachen, sodass sich seine Muskeln automatisch zu einer Reaktion anspannten. Sie versuchte es wieder und wieder, bis er Reißaus nahm, schnell die Wohnung verließ. Sein gesunder Menschenverstand hatte gerade noch mal so die Überhand gewonnen.
Seitdem hat sie es viele Male versucht. Und jedes Mal hat er ihr den Rücken zugekehrt.
Jetzt schlägt sie wieder zu, aber vor lauter Frust tritt sie wild um sich, kratzt ihn im Gesicht. Er schnappt sich erneut ihre Handgelenke. Es ist nicht schwer, sie aufzuhalten, sie ist klein, und nach einer Weile spürt er, wie sie nachgibt.
»Isabel, ich werde dich nicht schlagen«, wiederholt er. »Ich werde nicht mit dir schlafen …«
»Fick dich!«, schreit sie. »Fick dich! Tu nicht so, als wärst du so ein netter Kerl. Ich weiß, was du bist. Du trauriger alter Mann.«
»Ich kann dir Hilfe besorgen …«
»Hilfe? Von dir?« Ihre Lippen verziehen sich zu einem angewiderten Lächeln. »Wie willst du mir schon helfen? Ich hab dich doch gesehen! Ein runtergekommener Junkie ohne Leben!«
»Du hast mich beobachtet?«
»Manchmal. Ich hänge nämlich in Dads Büro rum. Nachts. Mit einer Flasche, die mir Gesellschaft leistet. Ich dachte, du … du könntest mir das geben, was ich brauche.«
Das sagt sie ganz kokett und versucht erneut, sexy zu sein.
»Mir muss man sagen, was ich tun soll, Griffin. Ich muss bestraft werden.«
»Nicht von mir.«
»Du willst es doch auch. Zeig mir, wer der Boss ist. Fick mich, als wärst du derjenige, der hier das Sagen hat.«
Aber was auch immer sie hiermit erreichen will, funktioniert nicht. Griffin erstarrt vor Schreck.
»Nein.«
Ihre Augen werden wieder dunkel. »Ich werd’s ihm sagen. Wenn du nicht tust, was ich will, sag ich’s ihm.«
Griffin bleibt stumm.
»Ich werde meinem Dad sagen, dass du mich geschlagen hast. Dass du mich gezwungen hast, Sex mit dir zu haben. Dann schmeißt er dich raus. Du wirst obdachlos. Wenn er nicht die Polizei ruft.«
Mit zwei großen Schritten ist Griffin an der Tür. Er hält sie auf. »Raus hier.«
»Ich gehe. Aber denk mal drüber nach. Du weißt ja, wo ich bin. Es könnte dir Spaß machen.«
Sie schleicht an ihm vorbei, nur im BH, ihr Top noch in der Hand. Angewidert schließt er die Tür. Vielleicht wird er als Obdachloser oder im Knast enden. Er mag ein Ex-Drogenabhängiger sein, ein Versager. Aber nichts auf der Welt wird ihn dazu bringen, das zu tun.
5
Colin Jefferies hatte einmal braune Haare und blaue Augen. Er war schmächtig, Single und hatte eine Vorliebe für Fantasy und Schwarz-Weiß-Filme. Aber als Cara seiner Mutter im Raum für Opferschutz gegenübersitzt, kann sie einzig und allein daran denken, dass alles, was ihn einmal zu einem Menschen gemacht hat, jetzt unwiederbringlich verloren ist. Zermatscht unter den Rädern eines Zuges.
Diesen Gedanken behält sie allerdings für sich. Seine Mutter ist klein, ihr Körper in sich zusammengefallen, als hätte ihr die Trauer einen Schlag in die Magengrube versetzt.
»Sie sagten gerade?«, fragt Cara nach. Sie wirft einen flüchtigen Blick zu Brody rüber, die einen Notizblock in der Hand hat. Bevor sich Mrs Jefferies in einem Wasserfall aus Tränen ergoss, hatte sie ihnen von Colins psychischen Problemen erzählt.
»Es fing an, als er Mitte zwanzig war. Wir haben zwar schon früher vermutet, dass etwas nicht stimmt, aber als sein Vater gestorben ist, wurde es noch schlimmer.« Sie schnieft und wischt sich mit dem Taschentuch über die Augen. »Sein Dad ist auf der Straße zusammengebrochen. Niemand war da. Wenn er bei mir zu Hause gewesen wäre, hätte man ihn vielleicht retten können, haben die Ärzte gesagt. Damit hat es wahrscheinlich angefangen.«
»Was angefangen?«, fragt Cara.
»Die Agoraphobie. Er hat sich geweigert, rauszugehen. Zu der Zeit lebte Colin allein in seiner Wohnung, und eine Weile habe ich es nicht verstanden. Heutzutage kann man schließlich alles geliefert bekommen. Und er konnte auch von zu Hause arbeiten, zu Beginn hat es seinem Chef nichts ausgemacht. Das war vor fünf Jahren. Aber manchmal muss man eben doch rausgehen, nicht wahr?« Mrs Jefferies tupft sich die Nase, ihre geröteten Augen suchen nach Verständnis, Mitleid, was auch immer. Cara weiß nicht genau, ob sie es ihr gibt. Ob sie das überhaupt kann.
Mrs Jefferies fährt fort. »Sein Chef wurde ärgerlich. Er kam nicht mehr zu Team-Meetings, ging nicht mehr abends mit auf einen Drink unter Kollegen. Erfand Ausreden. Einfach zu stolz, um die Wahrheit zu sagen, wie sein Vater. Und dann wurde er gefeuert.«
»Colin hat also nie das Haus verlassen?« Cara späht zu Brody. »Niemals?«
»Nein. Nie. Das ist es ja, was ich nicht verstehe. Wie er überhaupt zum Bahnhof gelangt ist. Beim bloßen Gedanken daran hätte er schon eine Panikattacke bekommen.«
Cara lehnt sich nach vorn. »Wir haben seine Krankenakte aus seiner Hausarztpraxis bekommen. Colin nahm Medikamente. Gegen eine Angststörung und Panikzustände. Vielleicht hat er welche von denen genommen?«
Doch Mrs Jefferies gibt nicht nach. »Nein. Das haben wir einmal versucht. Er schaffte es nicht einmal aus dem Wohnblock raus.«
»Was, wenn er fest entschlossen war?«, wirft Brody ein.
Mrs Jefferies’ Kopf schnellt zu ihr herum. »Fest entschlossen, sich umzubringen, meinen Sie? Nein. Mein Colin hätte das nicht getan.«
»Wie können Sie sich da so sicher sein?«, fragt Cara sanft.
»Er hat in letzter Zeit mit jemand Neuem gesprochen. Er meinte, das würde helfen. Neue Medikamente. Er war zuversichtlich, als ich ihn das letzte Mal gehört habe. Beinahe glücklich. Er hatte einen neuen Job in Aussicht. Er hat eine Zukunft für sich selbst gesehen – und dass er das zuletzt gesagt hat, ist schon eine Weile her.«
Sie greift nach Caras Hand. Cara erschrickt. Mrs Jefferies’ Haut ist heiß und glitschig, die Verzweiflung dringt ihr wie Schweiß aus allen Poren.
»Sie werden doch weitersuchen? Die Zeitungen behaupten, er hätte sich umgebracht, aber ich weiß, dass Sie mich nicht befragen würden, wenn das so wäre. Sie sind doch eine Mordkommissarin. Sie glauben, es handelt sich um Mord.«
»Ich ermittle, Mrs Jefferies.« Cara zieht die Hand zurück. »Aber sagen Sie mir, wenn er wirklich am Bahnhof war, um einen Zug zu nehmen, wohin wäre er dann gefahren?«
»Das weiß ich nicht«, keift sie. »Ist es nicht Ihre Aufgabe, das herauszufinden?«
Mrs Jefferies lässt Cara und Brody im Korridor zurück.
»Ein Mann mit einer Angststörung vor öffentlichen Plätzen geht mitten in der Rushhour zum Bahnhof?«, fragt Cara. »Sogar mit viel Sarkasmus ergibt das keinen Sinn. Wenn er sich umbringen wollte, hätte er nicht zu diesem Zeitpunkt losgemusst. Er muss doch gewusst haben, dass der Bahnsteig voller Leute sein würde.«
»Vielleicht hat er gehofft, jemand würde ihn aufhalten?«, schlägt Brody vor, während sie zur Einsatzzentrale vorgehen. »Oder er wollte wirklich irgendwohin.«
»Aber wohin?«
Zurück in der Zentrale bleibt Cara neben Shenton stehen. »Toby, ruf die Aufnahmen vom Bahnhof auf. Schauen wir mal, ob wir verfolgen können, woher unser Opfer heute Morgen gekommen ist.«
Brody und Cara setzen sich an den Schreibtisch. Er ruft die Dateien auf – die Aufnahmen der Überwachungskameras am Bahnsteig, am Ticketschalter und im Warteraum. Letztere zeigt nur ein paar gelangweilte Geschäftsmänner, und die Aufnahmen des Bahnsteigs führen sie zu dem schicksalhaften Moment vor dem tödlichen Sturz, wobei der tatsächliche Absprung fehlt. Eine bewusste Lücke.
»Spul zurück«, weist sie ihn an. »Wie ist er angekommen? Hat er ein Ticket gekauft?«
Am Ticketschalter ist viel los. Die Kamera zeigt, wie er durch die rappelvolle Eingangshalle stolpert. Er schaut nicht auf die Tafel mit den Abfahrtszeiten, an den Ticketautomaten oder Verkaufsfenstern bleibt er auch nicht stehen.
Shenton wechselt zur Kamera im Außenbereich des Bahnhofs. Er schätzt Colins Ankunftszeit und spult zurück, die Leute gehen rückwärts. Es ist schwer, auf dem verpixelten Bildschirm etwas zu erkennen, und Cara ist frustriert.
»Irgendwie muss er doch dort hingekommen sein. Er hat kein Auto.«
»Bushaltestelle?«, schlägt Brody vor. »Oder ein Anschlusszug?«
»Selbstmordgefährdete wechseln oft die Bahnsteige oder den Bahnhof«, wirft Shenton ein, aber seine Aufmerksamkeit wird von etwas anderem in Anspruch genommen. »Hier, hier«, sagt er und deutet auf den Bildschirm.
Schweigend sehen sie zu, wie ein Auto vorfährt. Es ist klein, alt. Blau. Die Beifahrertür geht auf, und Colin taumelt auf den Gehsteig, als wäre er geschubst worden. Er sieht benommen aus, wackelig auf den Beinen. Schnell fährt das Auto weg.
Colin steht auf dem Gehweg, seine Augen schießen von einer Richtung in die andere, die Hände zucken.
»Wie sieht der für euch aus?«, fragt Cara.
»Verwirrt. Verängstigt.«
»Als hätte ihn das Auto ausgespuckt und sofort das Weite gesucht«, schlägt Brody vor.
»Können wir das Nummernschild erkennen?«
Cara wartet, während Shenton durch die Aufnahmen scrollt. »Vielleicht teilweise. Am besten lassen wir das Digitalteam mal ran.«
»Das machen wir. Und zwar schnell. Ich will mit diesem Fahrer reden.«
Cara lehnt sich zurück. Sie haben nichts, was darauf hindeutet, dass Colin Jefferies genötigt wurde. Er hatte eine Vorgeschichte mit psychischen Problemen. Es sieht nach Selbstmord aus.
Doch bei dieser Aufnahme hat es auf ihrer Haut geprickelt. Jede Zelle ihres Körpers sagt, dass es nicht so ist.
6
Die Hände des Zugführers zittern, als er vor DS Jamie Hoxton auf dem Sofa sitzt. Ein großer Mann, Ende fünfzig, dessen Besenreiser auf der Nase und ungekämmtes, graues Haar ihn sehr viel älter wirken lassen. Er hat sich vorgestellt – Stan – mit Händen wie Schmirgelpapier. Ein Leben voller harter Arbeit und Plackerei.
»Nehmen Sie Zucker? Tut mir leid, ich habe nicht gefragt«, sagt seine Frau und drückt Jamie eine Tasse Tee in die Hand. »Ich kann Ihnen welchen holen. Oder Kekse? Hätten Sie gern einen Haferkeks?«
»Susan«, fährt Stan sie an, »der Mann will keine Kekse.«
Susan wirbelt herum und trippelt schnell davon.
»Tut mir leid«, sagt Stan schwach. »Sie macht immer so ein Aufheben.« Er späht hinter sich, wo lautes Geklapper aus der Küche dringt. »Dafür werde ich später noch bezahlen.«
»Es ist gut, dass Sie jemanden haben, der sich um Sie kümmert«, sagt Jamie mit einem verständnisvollen Lächeln. »Und es tut mir sehr leid, dass ich Sie zwingen muss, das alles noch mal zu durchleben. Aber wenn Sie mir bitte erzählen könnten, was heute Morgen passiert ist?«
Stan nickt langsam. »Das ist mein Vierter. Wussten Sie das? Bei meinem Ersten, vor über dreißig Jahren jetzt, haben sie mir nicht mal den Rest des Tages freigegeben. ›Wieder rauf aufs Pferd‹, hat mein Boss gesagt. Als wäre nichts gewesen.« Er nimmt die Tasse, aber seine Hand zittert so stark, dass der Tee auf den Teppich schwappt. Rasch stellt er ihn wieder ab. »Heutzutage dreht sich alles um Therapie und Beratungsgespräche. Ich weiß nicht, was schlimmer ist.« Mit wässrigen Augen sieht er zu Jamie auf. »Dieser junge Mann. Er war doch jung, oder? In den Zeitungen steht das zumindest.«
»Anfang dreißig«, bestätigt Jamie. »Haben Sie ihn noch gut sehen können?«
»So gut wie gar nicht. Wir waren ziemlich flott unterwegs. Für den Bahnhof hatte ich ein bisschen runtergebremst, aber ich habe nicht mal …« Er sieht auf und blickt Jamie zum ersten Mal richtig an. »Sie sind ja gar nicht von der BTP. Warum haben die denn einen Detective geschickt?«
»Wir ermitteln in alle möglichen Richtungen …«
»Sie sind aber nicht wegen mir hier, oder? Ich habe nichts Falsches getan. Dieser Junge …«
»Ich bin nicht wegen Ihnen hier, Stan. Sie haben mein Wort.«
Stan begegnet Jamies Blick und fällt dann wieder in sich zusammen. Seine Streitlust verpufft so schnell, wie sie gekommen ist.
»Ich hatte nicht mal Zeit, auf die Bremse zu treten«, fährt Stan fort. »Ich hätte nicht gedacht … Er hat nicht mal in die richtige Richtung geschaut und … und … Das war’s.« Er breitet die Hände vor sich aus. »Flatsch.« Er versucht sich an einem Schmunzeln, doch das leise Lachen verwandelt sich in einen Schluchzer, und mit bebenden Schultern vergräbt er das Gesicht in den Händen.
Jamie tätschelt ihm, hoffentlich aufmunternd, den Arm und wartet. Er denkt an die Therapie, die man diesem Mann anbieten wird, und fragt sich, ob sie ihm die Hilfe wird geben können, die er braucht. Jamie bezweifelt es.
Die Schluchzer des Mannes verebben, und mit dicken, knotigen Fingern wischt er sich über die Augen. Jamie sieht nach unten, wo er die Erzählung des Mannes ordentlich mitgeschrieben hat. Etwas nagt an ihm.
»Entschuldigung«, sagt Jamie. »Sie meinten, er hätte nicht einmal in die richtige Richtung geschaut. In die richtige Richtung wofür?«
Stan sieht auf. »Zum Springen.« Er räuspert sich. »Normalerweise erkennt man sie. Diejenigen, die es tun werden. Manche springen. Hechten beinahe vor den Zug. Andere lassen sich einfach irgendwie … fallen. Dieser Typ hier. Der stand mit dem Rücken zu den Gleisen.«
Jamie setzt sich kerzengerade hin. »Er hat sich von Ihnen abgewandt?«
»Genau. Ja.«
»Entschuldigen Sie mich, ich muss kurz telefonieren.«
Jamie springt auf und zieht das Handy aus der Hosentasche. Cara geht sofort ran.
»Boss, ich hab hier was Seltsames.« Jamie erzählt ihr, was Stan ihm gerade mitgeteilt hat.
»Rückwärts?«, wiederholt Cara. »Niemand springt rückwärts.«
»Meinst du, er ist gefallen? Der Kante zu nahe gekommen und abgerutscht?« Am anderen Ende der Leitung herrscht langes Schweigen. »Was denkst du, Boss?«
»Dass es noch eine bessere Aufnahme von dem geben muss, was heute Morgen passiert ist. Diese YouTube-Frau. Haben wir die schon gefunden? Kannst du …« Sie verstummt. »Es ist schon spät, vergiss es.«
Jamie wirft einen Blick auf seine Armbanduhr. Fünf nach acht. »Schon in Ordnung. Was brauchst du?«
»Kannst du unseren Zeugenaufruf durchgehen? Nachsehen, ob sie sich gemeldet hat?«
»Kein Problem.«
»Und Jamie, wie geht’s …«
Er legt auf. Es ist zwar nie eine gute Idee, seinen Boss abzuwürgen, aber er weiß schon, was sie gerade fragen wollte. Wie geht’s dir? Alles in Ordnung?
Fragen, auf die er nicht gern antwortet.
Jamie beendet das Gespräch mit Stan, bedankt sich höflich bei dessen Frau und fährt nach Hause. Über die Freisprechanlage tätigt er noch ein paar Anrufe und spricht schließlich mit dem Notrufdienst des National Health Service, wo man ihm bestätigt, dass sich ein paar Leute auf den Zeugenaufruf gemeldet haben. Sogar jemand mit Handy-Aufnahmen. Und ja, es sei alles auf dem Server.
Jamie kommt nach Hause, hebt die Briefe auf dem Fußabstreifer auf, wirft den Schlüssel auf den Tisch und fährt seinen Laptop hoch. Während er wartet, sieht er rasch die Post durch. Alles an Dr Romilly Cole oder Mr A. Bishop adressiert – nichts für ihn. Beim Anblick ihrer Namen wünscht er sich, sie wären hier. Freunde, mit denen er sprechen könnte. Über den Fall. Über alles. Doch stattdessen ist er allein, in einem Haus, das nicht ihm gehört. Nacht für Nacht lauscht er den vorbeifahrenden Autos, seinen eigenen erschöpften Atemzügen.
Es macht ihm nichts aus zu arbeiten. Cara tut zwar ihr Möglichstes, damit die Fälle nicht ihre Freizeit auffressen, aber ihm macht es nichts aus. Was soll er sonst schon tun? Ein paar Bier trinken und Fußball schauen, bis er auf dem Sofa einschläft? Nur, um dann um zwei Uhr morgens aufzuwachen, eiskalt, mit trockenem Mund und dem Kopf voll von ihr?
So tut er wenigstens etwas Nützliches.
Der Laptop ist zum Leben erwacht, und er klickt diverse Ordner durch, um die richtige Fallnummer zu finden. Schließlich findet er sie: hastig eingetippte Zeugenaussagen, voller Übertreibungen. Schnell überfliegt er sie. Nichts Neues. Leute, die nach ihren fünf Minuten Ruhm suchen, verzweifelt darauf aus, zu erzählen, dass sie ganz in der Nähe dieses Typen waren, der auf den Gleisen gestorben ist.
Er macht weiter, klickt auf ein Video. Das ist es: eine junge Frau, vorn mittig im Bild, mit glänzenden, angemalten Lippen und strahlenden, comicartigen Augen, die ganz aufgeregt darüber spricht, wohin sie unterwegs ist. »Der Zug nach London geht soooooo früh.« Sie zieht das Wort nervig in die Länge, ihre Aufregung irritiert ihn. Er stellt das Video stumm und versucht, sie zu ignorieren.
Und da ist er. Genau wie der Bahnhofsvorsteher es beschrieben hat, ist Colin Jefferies aufgebracht, panisch. Hinter der selbstvergessenen jungen Frau fährt sich das Opfer ungestüm durch die Haare und schlingt dann die Arme eng um den Körper. Einige rempeln ihn an, es wird geschubst und gedrängelt, der Bahnsteig ist rappelvoll. Jamie sieht zu, wie die Menge enger zusammenrückt, hinter die gelbe Linie, dann macht er den Ton wieder an und hört die Ansage zu dem durchfahrenden Güterzug aus den Lautsprechern. Aber Colin hört sie nicht, bemerkt sie gar nicht.
Dann geht alles so schnell, dass Jamie zurückspulen muss. Für einen Sekundenbruchteil schaut Colin direkt in die Kamera. Aber seine Augen sind glasig, sein Blick von Todesangst und Verwirrung getrübt. Er macht einen Schritt zurück – gerade dann, als der verschwommene Umriss des Güterzugs in den Bahnhof rast.
Jamie zuckt zurück, obwohl man in der Aufnahme nicht wirklich etwas sieht. Die beschränkt sich auf die Vorderseite des Zugs, die Räder, die Gleise. Die Umstehenden reagieren nur langsam. Schreckenslaute, schrille Schreie, Hände vor Mündern, Schock. Das Handy wird ruckartig bewegt, das Video verwackelt, dann ist es zu Ende.
Für einen Augenblick starrt Jamie den schwarzen Bildschirm an. Colin Jefferies wollte nicht sterben. Er ist nicht gesprungen. Das hier ist der Beweis. Er ist gefallen.
Kate
Ein Körper ohne Gehirn ist nichts als eine Hülle. Ein Gefäß. Ohne Seele. Ohne gesunden Verstand, ohne Gefühle, ohne Liebe. Nichts, was ihn noch zum Menschen macht.
Als Kate in der Tür zum Schlafzimmer ihrer Mutter steht, hängt sie diesen Gedanken nach. Sie sieht ihr beim Schlafen zu, ein sanftes Rasseln, jedes Mal, wenn sich ihre Brust hebt und senkt. Das kommt jetzt öfter vor, seit die Dosis erhöht wurde. Achten Sie auf Liegegeschwüre, hatte die Frau vom Pflegedienst gesagt. Halten Sie sie warm und trocken. Baden Sie sie regelmäßig.
Für sie sagt es sich so leicht.
Sie muss schließlich nicht mit drei Stunden Schlaf pro Nacht überleben, wird nicht ununterbrochen aufgeschreckt von der eigenen Mutter, die verwirrt aufwacht. Nach ihrem verstorbenen Mann oder ihrer eigenen Mutter ruft. Und Stunden braucht, um wieder in den leichten Schlaf zu finden.
Sie dreht schließlich nicht jeden Penny dreimal um. Lebt nicht von Sozialhilfe, da sie nicht arbeiten kann. Kauft nicht von den Regalen mit den gelben Schildern. Lässt keine Mahlzeiten aus, um dieses zugige Haus warm zu halten.
Und sie macht sich auch keine Sorgen um ihre Gesundheit. Um ihren Abstieg ins Vergessen.
Sie dachte, die Pflegerin käme heute. Montagnachmittag, wie immer. Aber es ist niemand aufgetaucht, und als sie angerufen hat, sagte die Pflegerin: »Nein, Kate. Sie haben mir doch eine Mail geschrieben. Sie haben mich auf Mittwoch verlegt.«
Erst wurde Kate wütend, dann entschuldigte sie sich. Sie konnte sich nicht daran erinnern, eine Mail geschrieben zu haben. Sie wollte sich in ihren Account einloggen, aber das Passwort stimmte nicht. Hatte sie das auch vergessen? Sie hatte nicht die Kraft, es zurückzusetzen. Die Pflegerin musste recht haben. Oder?
Letzte Woche hat sie den Arzt wieder angerufen. Wurde für eine Stunde in die Warteschleife durchgestellt, dann gab sie auf. Der NHS ist überlastet, das hatte sie am eigenen Leib erfahren, als sie wegen ihrer Mutter nach Hilfe fragte. Wartelisten, keine Betten verfügbar. Keine Unterstützung für häusliche Pflege, tut uns leid.
Aber wozu soll ein Arzttermin überhaupt gut sein? Sie weiß doch, was los ist, egal was die Tests sagen, was die Hirnscans gezeigt haben. Sie braucht keinen müden Hausarzt, der sie über die Brille hinweg ansieht. Und glaubt, dass sie noch so eine von diesen hysterischen Frauen ist.
Sie weiß es.
Ihre Mutter hat Kate, auf die sie sich verlassen kann. Seit zehn Jahren pflegt Kate sie jetzt, Tag und Nacht. Sie hat ihren Job verloren. Sie geht nie aus. Was ist das für ein Leben?
Vorhin hat sie den Gang zu Tesco gewagt. Zum zweiten Mal in zwei Tagen – das erste Mal gestern, mehrere Kilometer zu Fuß nach Hause, die Einkaufstüten schnitten ihr in die Hände, während sie sich durch den strömenden Regen schleppte. Sie stand im Flur, und das Wasser tropfte vom Mantel, aus den Haaren und bildete eine Pfütze auf der Fußmatte. Ihre Stiefel waren durchnässt und kalt, ihre Schultern und ihr Kragen feucht, wo der Regen unter die Kapuze geronnen war.
Und sie hatte nichts als Verzweiflung gefühlt. Eine schmerzvolle Traurigkeit, die ihre Seele verschlang, sie so erschöpfte, dass sie sich kaum mehr bewegen konnte.
Das Auto ist weg. Verschwunden, seit gestern. Sie hätte schwören können, dass sie es gleich rechts vom Eingang geparkt hatte. Der dritte Parkplatz, wie immer. Doch als sie zurückkam, ihren Einkaufswagen vor sich herschob, war da nichts. Sie hatte die Reihe entlanggesehen. Den Schlüssel aus der Handtasche geholt und auf den Knopf gedrückt, nach dem orange aufblitzenden Licht Ausschau gehalten, aber nichts.
Sie überquerte den Parkplatz. Ging zuerst genervt im Kreis, was sich dann zu einem panischen Stampfen entwickelte, an den Reihen von parkenden Autos vorbei, auf und ab, während Angstschweiß unter ihren Achseln zu prickeln begann.
»Alles in Ordnung, Liebes?«, hatte ein älterer Herr sie gefragt. Von der Last der Jahre vornübergebeugt, Leberflecke auf dem Schädel. Eine sanfte Besorgnis, die sie fast zum Weinen gebracht hätte, so frustriert war sie.
»Ich kann mein Auto nicht mehr finden«, antwortete sie.
Er kicherte. »Das passiert mir ständig.« Er tippt sich an die Schläfe. »Ein Zeichen von Altersschwäche. Aber dafür sind Sie noch ein bisschen zu jung, Liebes.«
Mit einem letzten freundlichen Lächeln ließ er sie stehen, versteinert, während sich seine Worte in ihr Hirn gruben.
Dafür sind Sie noch ein bisschen zu jung.
Darüber denkt sie jetzt nach. Ihre Mutter war nicht zu jung dafür. Ihre Mutter, vollgepumpt mit Medikamenten, die oben in diesem Bett vor sich hinsiecht. Liegt wohl in der Familie, was? Und das verschwundene Auto, der verschobene Termin, das vergessene Passwort – das ist noch nicht alles, was Kate aufgefallen ist.
Sie geht in ein Zimmer und vergisst, warum sie es betreten hat. Sie erinnert sich falsch an Namen, Daten. Geburtstage, die einst in ihr Gedächtnis gemeißelt waren, sind jetzt verschwunden in einem Nebel aus Verständnislosigkeit. Dinge gehen verloren. Schlüssel. Ihr Geldbeutel. Und tauchen dann an den absurdesten Orten wieder auf. Sie hatte vergessen, neue Rezepte für Mum zu bestellen, konnte sich nicht mehr daran erinnern, ob sie ihr die Medikamente verabreicht hatte oder nicht. Kleine, belanglose Momente, aber zusammengenommen doch etwas mehr.
Er hatte recht. Ihr Freund, der Einzige, der ihr zuhört. Er hatte gesagt, dass es passieren würde. Jetzt hat es sie auch erwischt.
Heute Nachmittag hat sie dann aufgegeben. Wieder ist sie die Parkreihen abgelaufen, ohne Erfolg, und nach Hause gegangen. Dann ein beschämter Anruf bei der Polizei, um das Auto als gestohlen zu melden. Vielleicht.
»Vielleicht?«, hat die Frau in der Leitung des Polizeirufs gefragt. »Ist es denn jetzt gestohlen worden oder nicht?«
»Ich finde es nicht mehr«, hat Kate zugegeben, wobei ihre Stimme zu einem Flüstern schrumpfte.
Trotz der Skepsis am anderen Ende der Leitung hat man die Einzelheiten aufgenommen. Und nun denkt sie träge über das Abendessen nach. Sie öffnet den Kühlschrank – und darin liegen die Schlüssel für die Hintertür. Die sie vor einer Woche verloren hat.
Kate weiß, warum.
Es ist ein schleichender Prozess. Ihr Hirn, das langsam verkommt. Wie lange wird es dauern? Bis sie auch noch vergisst, sich zu waschen, zu essen, das Gas abzudrehen? Bis sie keinen einfachen Anweisungen mehr folgen kann. Bis ihr Leben zu einem Nebel wird. Einer Hülle.