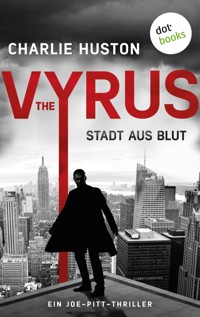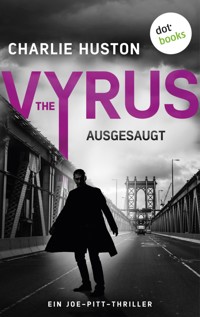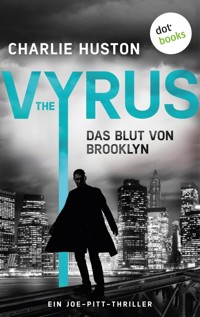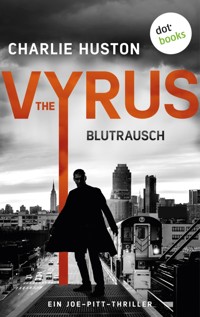
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Joe-Pitt-Thriller
- Sprache: Deutsch
Im Dunkeln lauert der Tod: Der nervenaufreibende Thriller »The Vyrus: Blutrausch« von Bestseller-Autor Charlie Huston jetzt als eBook bei dotbooks. Wenn Blut mehr wert ist als ein Menschenleben … Privatdetektiv Joe Pitt ist restlos abgebrannt: Er hat weder Geld noch Blut – die wichtigste Währung in der nächtlichen Halbwelt Manhattans, seit ein bösartiger Virus die Millionenstadt heimgesucht hat. Seine Not treibt ihn dazu, alles zu riskieren – und einen gefährlichen Job anzunehmen: Für die »Society«, einen der großen Klans, die die New Yorker Unterwelt regieren, soll er die Quelle einer neuartigen Droge ausfindig machen, die Tag für Tag unzählige Menschenleben fordert. Doch der Weg nach Harlem, wo er Antworten vermutet, führt ihn durch das Gebiet der mächtigen »Koalition« – und zwischen den Klans herrscht ein erbitterter Machtkampf … »Schnell, hart, schnörkellos, aber ungeheuer atmosphärisch. Die Pulp-Fiction-Variante von Bram Stokers ›Dracula‹.« Stern Jetzt als eBook kaufen und genießen: »True Detective« meets »The Walking Dead« – der abgründige Thriller »The Vyrus: Blutrausch« von Charlie Huston, der spektakuläre zweite Band in seiner Reihe um den Privatermittler Joe Pitt, in der alle Bände unabhängig voneinander gelesen werden können. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn Blut mehr wert ist als ein Menschenleben … Privatdetektiv Joe Pitt ist restlos abgebrannt: Er hat weder Geld noch Blut – die wichtigste Währung in der nächtlichen Halbwelt Manhattans, seit ein bösartiger Virus die Millionenstadt heimgesucht hat. Seine Not treibt ihn dazu, alles zu riskieren – und einen gefährlichen Job anzunehmen: Für die »Society«, einen der großen Klans, die die New Yorker Unterwelt regieren, soll er die Quelle einer neuartigen Droge ausfindig machen, die Tag für Tag unzählige Menschenleben fordert. Doch der Weg nach Harlem, wo er Antworten vermutet, führt ihn durch das Gebiet der mächtigen »Koalition« – und zwischen den Klans herrscht ein erbitterter Machtkampf …
»Schnell, hart, schnörkellos, aber ungeheuer atmosphärisch. Die Pulp-Fiction-Variante von Bram Stokers ›Dracula‹.« Stern
Über den Autor:
Charlie Huston wurde 1968 in Oakland, Kalifornien geboren. Nach einem Theaterstudium zog er nach New York, wo er als Schauspieler und Barkeeper arbeitete, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Seine »Vyrus«-Reihe, für die er unter anderem mit dem wichtigsten amerikanischem Krimipreis, dem Edgar-Award, nominiert wurde, erzählt den Überlebenskampf von Privatermittler Joe Pitt in der New Yorker Unterwelt. Charlie Huston lebt mit seiner Frau, einer bekannten Schauspielerin, in Los Angeles.
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine packende Serie um den New Yorker Privatermittler Joe Pitt:
»The Vyrus: Stadt aus Blut«
»The Vyrus: Blutrausch«
»The Vyrus: Das Blut von Brooklyn«
»The Vyrus: Bis zum letzten Tropfen«
»The Vyrus: Ausgesaugt«
Außerdem bei dotbooks erschienen ist sein Thriller »Killing Game«.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2006 unter dem Originaltitel »No Dominion« bei Ballantine Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Blutrausch« bei Heyne.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2006 by Charles Huston
This edition published by arrangement with Ballantine Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2008 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Geobor, Prasert Wongchindawest, oneinchpunch
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-533-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »The Vyrus 2« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Charlie Huston
The Vyrus:Blutrausch
Ein Joe-Pitt-Thriller
Aus dem Amerikanischen von Kristof Kurz
dotbooks.
Für Bob Wilkins
und die Creature Features immer freitagabends.
Danke, dass ihr mich so lange wach gehalten und mich zu Tode erschreckt habt.
Kapitel 1
Das Glas bricht.
Was mich nicht besonders wundert. Eher überrascht mich, dass es nicht vorher schon zu Bruch gegangen ist, als der zuckende Irre mich dagegengeschmettert hat. Nicht, dass das so außergewöhnlich für diesen Laden wäre. Im ersten Jahr nach der Eröffnung mussten sie gleich mehrfach das Schaufenster ersetzen. Schließlich fanden die Betreiber wohl, es wäre auf lange Sicht billiger, in Sicherheitsglas zu investieren. So mussten sie die Scheibe nicht nach jeder Schlägerei erneuern. An sich ein ganz vernünftiger Gedanke. Ich will mich auch nicht beschweren. Ohne diese brillante Idee würde ich jetzt auf dem Bordstein liegen, meine schöne Lederjacke wäre in Streifen geschnitten und mein Gesicht mit einem interessanten neuen Muster überzogen. Aber jetzt bricht das Glas doch. Ganz ohne Zweifel, es bricht. Warum ich mir da so sicher bin? Weil der Irre gerade mein Gesicht mit aller Kraft dagegenpresst. Die große Frage lautet, ob die Scheibe aus einem Sicherheitsglas ist, das in tausend winzige Stücke zerbröselt, oder aus einem, das in große Scherben zersplittert. Winzige Stückchen wären gut, große Scherben weniger. Es knackt, und vor meinen Augen erscheinen klitzekleine Sprünge.
Okay, es ist wohl an der Zeit, dass ich mir weniger Gedanken über das Glas mache und mehr über den Irren, der mir gerade im Nacken sitzt. Von den Barkeepern oder den Gästen kann ich keine Hilfe erwarten. Nicht, nachdem sie mit angesehen haben, wie der Kerl den Rausschmeißer mit einem Billardqueue verprügelt hat. Und leider ist auch mein Freund und Helfer, die Polizei, nirgendwo zu sehen. Nicht, dass ich besonders scharf darauf wäre, den Cops in die Arme zu laufen. Nein, ich komme schon alleine klar. Es ist ja weiß Gott nicht das erste Mal, dass ich mich in so einer Situation befinde. Ich wünschte nur, der Irre wäre auf PCP. Wenn es lediglich PCP wäre, könnte ich leicht mit ihm fertig werden. Aber der? Der Kerl verlangt nicht nur Eleganz und Stil, sondern auch ein kleines bisschen Fingerspitzengefühl.
Er presst mein Gesicht noch fester gegen die große Glasscheibe. Die Leute, die draußen an der Bar vorbeigehen, zucken zusammen, als sie meine platt gedrückte Visage sehen. Das Glas knackt erneut, die Sprünge werden noch einen Millimeter breiter. Der Spinner hört nicht auf, aus vollem Hals irgendwelchen Irrsinn zu brüllen. Er kreischt so laut, dass er fast Boxcar Willie aus der Jukebox übertönt.
You load sixteen tons and what do you get?
Another day older, and deeper in debt.
Genau so ist es, verdammt.
Er wird stinksauer, weil es ihm nicht gelingt, meinen Kopf durch die verdammte Scheibe zu rammen, was er anscheinend wirklich gerne tun würde. Er holt aus, aber bevor er mein Gesicht ein weiteres Mal gegen das Glas schmettern kann, habe ich schon einen Schritt nach rechts gemacht und meinen Arm aus seinem Griff befreit. Ich zucke vor Schmerz zusammen, als er mir ein Haarbüschel ausreißt. Trotzdem trete ich ihm mit dem rechten Fuß in seine linke Kniekehle und ramme den Ellenbogen in seinen Nacken. Mit dem Kopf voraus schleudere ich ihn durch die Glasscheibe. Die Zuschauer auf dem Gehweg springen zur Seite, als er auf dem Asphalt landet. Ich folge ihm durch das Loch in der Scheibe, vorbei an den messerscharfen, großen Scherben.
Er kam aus dem Klo und rastete aus.
Vorher hatte ich den wild zuckenden Spinner gar nicht bemerkt. Warum auch? Ich war ja nicht bei der Arbeit. Mich interessierte nichts als der Schnaps in meinem Glas, die Zigarette in meinem Mundwinkel, der Billardtisch und das Mädchen neben mir. Das Mädchen interessierte mich ganz besonders. So ein Mädchen zieht in einem Schuppen wie diesem unweigerlich alle Männerblicke auf sich. Neben einem Mädchen wie Evie bin ich so gut wie unsichtbar. Schuld daran ist ihr volles rotes Haar, ihr von vielen Nacht- und Wochenendschichten hinter dem Tresen gestählter Körper und ihr Lächeln. Sie ist der Typ Frau, den die Kerle gerne anstarren, ohne den Mut aufzubringen, Kontakt aufzunehmen. Schade aber auch. Sie verpassen nämlich das Beste. Sie verpassen, wie cool sie ist, wie schlau und unkompliziert. Wie dem auch sei, mit einem Mädchen wie Evie an deiner Seite verwandelst du dich sofort in eine Art Schatten. Du bist einfach nur das glückliche Arschloch, das den Platz mit der besten Aussicht ergattert hat.
Es ist eine kalte Nacht. Evie trägt eine Lederhose und ihre alte, enge Thermoweste, auf deren Vorderseite das Jack-Daniel’s-Logo gestickt ist. Heute Nacht klebt sie förmlich an meiner Hüfte. Jeder Kerl in dem verdammten Schuppen wünscht sich, mit mir den Platz zu tauschen. Kein Wunder, dass ich den Spinner nicht sofort gerochen habe.
Normalerweise hätte ich ihn schon längst gewittert. Garantiert. Schließlich riecht er genau wie ich, nur anders. Aber ich war mit dem ganzen Early Times, den ich gekippt, den vielen Luckies, die ich geraucht habe, und nicht zuletzt mit Evie, die sich an mich schmiegte, mehr als ausreichend in Anspruch genommen. Trotzdem konnte er noch nicht allzu lange hier drin gewesen sein. Ganz gleich, wie abgelenkt ich war, früher oder später hätte ich ihn gerochen. Es hätte ja auch nicht unbedingt gleich Ärger geben müssen. Wir hätten uns ein Weilchen angestarrt, uns wie zwei große Hunde beschnuppert, wären aber nicht gleich aufeinander losgegangen. Zumindest nicht hier in aller Öffentlichkeit. So läuft das nämlich normalerweise nicht. Jedenfalls hatte ich mir meine Billardkugel gerade so richtig schön zurechtgelegt, um mit einem gewagten Stoß auch noch den Rest abzuräumen, als er aus dem Klo stürzt und durchdreht.
Er war sicher nicht der übliche Nullachtfünfzehn-Junkie, der sich auf dem Klo einen Schuss verpasst und dann voll zugedröhnt durch die Gegend stolpert. Der Spinner kam aus dem Scheißhaus galoppiert wie der gottverdammte tasmanische Teufel. Er zuckte in Krämpfen, wirbelte mit den Armen, trat nach allem, was in seiner Nähe war und schmiss Tische und Leute um, völlig durchgeknallt. Keiner wollte ihm in die Quere kommen, während er mit Schaum vor dem Mund den wilden Mann spielte. Der Rausschmeißer, eigentlich ein ganz netter Kerl namens Gears, kam rüber und versuchte, vernünftig mit ihm zu reden.
‒ Ganz ruhig, Mann, ganz ruhig. Komm runter. Bist anscheinend auf einem richtig üblen Trip, aber keine Angst, wir sind ja da. Ich hab schon den Krankenwagen alarmiert, die bringen dich in die Intensivstation und spülen die ganze Scheiße aus dir raus. Jetzt beruhig dich erst mal.
Gears sprach ganz sanft und ging langsam mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu. Er hätte genauso gut versuchen können, einen tollwütigen Hund zu besänftigen. Der Spinner hielt kurz inne, dann ging er auf Gears los. Er ließ seinen Arm wie einen Knüppel kreisen. Und er war verdammt schnell. Gears hatte Glück, er fiel auf den Hintern, und der Arm zischte an ihm vorbei und krachte in die aus massiven Holzbrettern bestehende Lehne einer Sitzbank. Einige der Bretter sind glatt durchgebrochen.
Dann flippt der Spinner wieder aus. Die Leute bringen sich so gut es geht in Sicherheit und beobachten ihn ängstlich. Inzwischen hat er auch meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Gears rappelt sich wieder auf, murmelt irgendwas von verschissenem PCP, reißt eins der verbogenen Queues aus dem Regal an der Wand und geht auf den Spinner los. Mittlerweile habe ich seinen Gestank in der Nase und weiß, der Typ ist ganz bestimmt nicht auf PCP. Pech für Gears. Ich weiß nicht, was der Kerl eingeschmissen hat, aber eins ist sicher, er ist verdammt gefährlich.
Gears wartet, bis der Typ ihm den Rücken zukehrt, und zieht ihm dann mit einem satten Knall das Queue über den Schädel. Aber bevor sich Gears so richtig darüber freuen oder zu einem weiteren Schlag ausholen kann, hat sich der Typ schon umgedreht, Gears das Queue abgenommen und ihm die Füße unter dem Hintern weggetreten. Er ist jetzt voll damit beschäftigt, herauszufinden, ob man ein Billardqueue zu Kleinholz verarbeiten kann, indem man es jemandem ins Gesicht schlägt. So langsam wird es Zeit für meinen Einsatz. Nicht, dass Gears mein bester Kumpel wäre. Außer seinem Namen weiß ich eigentlich kaum was über ihn. Ich grüße ihn eben, wenn ich hier bin. Aber der Spinner ist völlig außer Kontrolle, und die Show, die er abzieht, ist ganz schlecht fürs Geschäft. Wenn ich mich nicht um ihn kümmere, werden es die Cops tun. Und dann wird die ganze Situation ziemlich schnell ungemütlich. Nichts ist schlimmer als Bullen, die einen Typen voll Kugeln pumpen, während der Typ sich einfach weigert zu sterben. Natürlich werden Gears, die Behörden und die Presse behaupten, dass das PCP daran schuld war. Trotzdem könnten die falschen Leute von der Sache Wind bekommen und anfangen, herumzuschnüffeln. Leute, die ich hier nicht haben will. Nicht in meinem Viertel. Also stürze ich mich auf den Typen. Vielleicht kann ich ihn auf den Boden werfen, in den Schwitzkasten nehmen und hier rausschaffen. Danach muss ich mir irgendeine Geschichte einfallen lassen, die ich den Gästen erzähle. Vielleicht, dass ich ihn kenne und mich um ihn kümmern werde. Jedenfalls muss ich ihn von hier wegschaffen, bevor die Cops auftauchen, an einen sicheren Ort bringen, wo ich ihn loswerden kann, bevor er noch mal so eine Show abzieht. Das ist der Plan. Leider schüttelt der Irre mich einfach von seinem Rücken und schleudert mich gegen die Fensterscheibe. Als ich entgegen seinen Erwartungen davon abpralle, statt hindurchzukrachen, packt er mich an den Haaren und versucht, meinen Schädel durch das Glas zu stoßen. Aber ich habe Glück. Trotz seiner Schnelligkeit und Kraft ist er ein lausiger Kämpfer.
Sobald er auf dem Gehweg liegt, kann ich das tun, was ich eigentlich schon in der Bar mit ihm vorhatte: Ich ramme meine Knie in seinen Rücken, presse ihn gegen den dreckigen Asphalt, lege einen Arm um seinen Hals und drücke zu. Ich unterbreche die Sauerstoffzufuhr so lange, bis er endlich einschläft. Vorher schlägt er natürlich wie wild um sich. Ich muss so richtig fest zupacken, damit er mich nicht abwirft, aber sobald ich ihn erst einmal im Schwitzkasten habe, klammere ich mich an ihn wie eine Klette. Als er schön schläfrig und umgänglich ist, werfe ich ihn mir über die Schulter und deute auf eine der Bedienungen, die zusieht, um das Ende der ganzen Geschichte nicht zu verpassen.
‒ Ruf mir ein Taxi, ja?
‒ Der Krankenwagen ist schon unterwegs.
‒ Die sollen sich um Gears kümmern. Ich kenn den Typen hier. Den bring ich jetzt zu seinem Bewährungshelfer. Hoffe, dass er eines Tages endlich mit dem Scheiß aufhört.
‒ Was ist mit den Cops? Und mit der Fensterscheibe?
‒ Jetzt mal halblang. Ich hab euch schon den Typen vom Hals geschafft. Also komm mir nicht so.
‒ Schon gut.
Sie hält ein Taxi an.
Der Taxifahrer sieht nicht besonders glücklich aus, als ich mit dem blutüberströmten Kerl einsteige. Aber er merkt schnell, dass ich nicht in der Stimmung für lange Diskussionen bin, und reicht mir einen schmutzigen Lappen, den ich auf das Gesicht des Spinners lege. Bevor wir wegfahren, kommt Evie angelaufen und reicht mir meine Zigaretten und das Zippo durchs Fenster.
‒ Soll ich mitkommen?
‒ Ich schaff das schon.
‒ Treffen wir uns später bei dir?
‒ Ja. Ich werd nicht länger als eine halbe Stunde brauchen. Geht’s dir gut?
‒ Lass uns jetzt nicht darüber reden.
‒ Sorry. Tut mir leid, das Ganze.
‒ Ist schon okay. Keiner kann behaupten, du wüsstest nicht, wie man einem Mädchen einen schönen Abend bereitet, Joe.
Im Taxi droht der Spinner wieder aufzuwachen. Also drücke ich seine Luftröhre zu und schicke ihn zurück ins Reich der Träume, bevor er mir noch mehr Ärger machen kann. Das Taxi fährt mich zu den Baruch-Sozialbauten direkt unterhalb der Houston. Die liegen zwar außerhalb der Zone, in der ich mich sicher fühlen kann, andererseits erhebt niemand Anspruch auf diese Gegend. Der ideale Platz, um schnell mal jemanden verschwinden zu lassen. Ich schleppe den Irren auf die Fußgängerbrücke, die den FDR in Richtung East-River-Park überquert. Es ist zwei Uhr nachts an einem Dienstag. Die Autos dröhnen unter mir vorbei, aber die Flutlichtanlage der Sportplätze im Park wurde schon vor Stunden abgeschaltet. Glücklicherweise kann ich im Dunkeln ziemlich gut sehen. Es ist zu kalt, als dass irgendwelche Penner draußen schlafen könnten. Auf der anderen Seite des Parks kann ich schemenhaft ein Junkiepärchen erkennen, das auf einer Bank sitzt und den Fluss betrachtet. Am Ende der Betontreppe, die zum Park hinunterführt, halte ich kurz inne.
Der Spinner lebt noch. Er lebt und stinkt nach Blut. Blut ‒ ich würde mir ja gerne einen Liter oder zwei abzapfen und damit den rapide schwindenden Vorrat in meinem Kühlschrank auffüllen. Aber dieses Blut wird mir nicht viel nützen. Im Gegenteil. Mir würde speiübel, und dann würde ich sterben. Das hat mir der Geruch verraten, den ich gerade im Doc Holiday’s in der Nase hatte. Es ist der Geruch des Vyrus, derselbe Geruch, der auch an mir klebt.
Trotzdem, so knapp, wie ich im Moment dran bin, beschließe ich, noch mal an ihm zu schnuppern. Nur zur Sicherheit. Zum Teufel, vielleicht habe ich mich ja geirrt. Vielleicht ist der Spinner gar kein Vampyr, sondern wirklich nur auf PCP. Ich inhaliere tief. Pech gehabt. Er ist genauso beschissen dran wie ich. Aber irgendwas an seinem Geruch ist merkwürdig. Wahrscheinlich liegt es an dem Zeug, das er sich im Klo reingezogen hat. Ein Wunder, dass ich es rieche. Da das Vyrus sofort alles neutralisiert, was in den Blutkreislauf gelangt, muss es verdammt harter Stoff gewesen sein. Würde mich schon interessieren, was er da genommen hat. Wäre bestimmt nett, das Zeug selbst mal auszuprobieren, einfach nur so zur Entspannung. Himmel, schließlich habe ich eine ganze Flasche Bourbon so gut wie ausgetrunken und bin nicht mal angeheitert. Der Spinner zappelt in meinen Armen. Zeit, sich um ihn zu kümmern.
Ich breche ihm das Genick, schubse ihn kräftig und beobachte, wie er die Treppe runterfällt. Anders als bei normalen Menschen wird ihn ein gebrochenes Genick nicht auf der Stelle töten. Bricht man einem normalen Menschen das Genick, wird die Medulla Oblongata zerstört und damit die Nervenverbindung zwischen Hirn und Körper gekappt. Alle autonomen Körperfunktionen wie das Atmen der Lunge oder der Herzschlag setzen sofort aus. Der Vyrus hingegen programmiert den Körper, den er befällt, sozusagen um. Zum Beispiel reichert er das Blut extrem mit Sauerstoff an. Es gibt noch eine Reihe weiterer Dinge, aber da blicke ich nicht so recht durch. Jedenfalls kann der Spinner nicht mehr aufstehen, aber er hat noch genügend Sauerstoff im Hirn, um die nächsten Minuten bewusst mitzukriegen. Er kann von Glück sagen, dass er high ist.
Ich stecke mir eine Zigarette zwischen die Lippen, zünde sie an und gehe über die Brücke zurück. Ich muss bis zur Avenue B latschen, um ein Taxi zu bekommen, aber trotzdem bin ich nur ein paar Minuten nach der vereinbarten Zeit zu Hause.
Kapitel 2
Wir können nicht lange ausschlafen.
Evie arbeitet hinter der Theke. Für gewöhnlich kriecht sie also erst bei Sonnenaufgang ins Bett. Und selbst wenn sie nicht arbeitet, kann sie selten vor dem Morgengrauen einschlafen. Ich bin ebenfalls eine Nachteule, aber aus anderen Gründen. Trotzdem stehen wir am nächsten Tag ziemlich früh auf. Früh für unsere Verhältnisse zumindest, also so gegen Nachmittag. Evie hat einen Termin.
Ich greife nach meinen Zigaretten, während sie unter der Decke hervorkrabbelt.
‒ Was hast du heute vor?
‒ Meine Virenbelastung wird getestet.
‒ Ach ja, stimmt.
Ich sitze rauchend auf der Bettkante und beobachte Evie, die sich im Badezimmer den Mund ausspült und Zahnpastaschaum ins Waschbecken spuckt.
‒ Ist es schlimmer geworden?
‒ Nö. Mir ist schlecht, ich muss kotzen. Das Übliche.
‒ Okay.
Sie kniet sich vor ihre große schwarze Ledertasche und dreht mir den Rücken zu. Sie trägt ein Höschen und ein altes Doppelrippunterhemd von mir. Ich betrachte ihren Hintern, während sie in ihrer Tasche herumkramt.
‒ Wie viel hast du gestern getrunken?
Sie kramt weiter in ihrer Tasche.
‒ Weniger als du. Viel weniger.
‒ Das heißt gar nichts.
‒ Ich weiß.
Sie zieht ein Fläschchen mit Tabletten aus der Tasche und fischt eine Kapsel heraus. Dann holt sie eine Schachtel hervor und nimmt daraus zwei weitere Tabletten. Sie stopft sie in ihren Mund und hält mir die Hand hin. Ich gebe ihr das Wasserglas vom Nachttisch, und sie spült die Pillen hinunter.
‒ Sollst du das Kaletra nicht zum Essen nehmen?
Sie quetscht sich in die enge Lederhose, die sie auch letzte Nacht anhatte.
‒ Hab keinen Hunger.
‒ Wie meinst du das?
Sie zieht sich das Unterhemd über den Kopf. Ich starre auf ihre sommersprossenübersäten Brüste, bis sie sie mit dem Jack-Daniel’s-T-Shirt verdeckt.
‒ So wie ich’s sag. Keinen Hunger.
‒ Im Sinne von einfach kein Hunger oder im Sinne von das ist eine der Nebenwirkungen?
Sie steht vor dem Spiegel auf der Rückseite der Schranktür und fängt an, eine Bürste durch ihr Haar zu ziehen.
‒ Keinen Hunger im Sinne von: Ich hab’ im Moment keinen verdammten Scheißhunger. Okay?
‒ Klar. Okay.
Ich stehe auf und schließe die Badezimmertür hinter mir. Was ich im Spiegel sehe, ist kein schöner Anblick. Ich spritze mir Wasser ins Gesicht und betätige unnötigerweise die Klospülung. Dann lege ich mich wieder aufs Bett und nehme noch eine Zigarette aus der Packung. Evie hat sich das Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Sie schlüpft in ihre große, schwarze Motorradjacke, die nur aus Reißverschlüssen und Schnallen besteht. Ich zünde die Zigarette an.
‒ Bist du warm genug angezogen?
Sie hebt eine Hand.
‒ Es reicht, Joe.
‒ Ich frag ja nur.
‒ Und ich sage, es reicht. Ich weiß, dass du dir Sorgen um mich machst. Das ist toll, und ich weiß es echt zu schätzen. Mir ist klar, dass das für dich nicht selbstverständlich ist. Aber im Moment wäre ich froh, wenn du einfach aufhören würdest, mir auf den Scheißwecker zu gehen.
Sie beugt sich zu mir herunter und gibt mir einen Kuss. Dann nimmt sie ihre Tasche und geht die Treppe zum Erdgeschoss hoch.
‒ Pass auf dich auf, Baby.
Böser Fehler. Sie bleibt auf der Treppe stehen, lässt den Kopf sinken, atmet hörbar aus und dreht sich zu mir um.
‒ Joe, ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen. Und zwar auf meine Art. Das heißt, ich genehmige mir ein paar Drinks, wenn es mir passt, ohne mich um meinen Blutzucker zu kümmern. Und das heißt auch, dass ich mich nicht dazu zwingen werde, etwas zu essen, wenn ich die gottverdammten Pillen nehme. Ist das klar? Hast du das verstanden? Wenn nicht, weißt du ja, was du mich kannst. Keine Verpflichtungen, Joe. Das ist doch dein Motto. Du warst nicht da, als ich krank wurde, und ich erwarte auch nicht, dass du mich bis zum Ende begleitest. Aber wenn du in der Zwischenzeit an meinem Leben teilnehmen oder es sogar mit bestimmen willst, dann musst du mich erst mal an deinem Leben teilnehmen lassen. Bis dahin hör mit dem Scheißgenörgel auf. Dafür hab ich meine Mutter. Ich kann gut darauf verzichten, dass mein verdammter Freund auch noch damit anfängt.
Sie stampft die Treppe hoch und knallt beim Rausgehen lautstark die Tür zu.
Ich lege mich zurück aufs Bett und nehme einen tiefen Zug. Als ich den Rauch gegen die Decke blase, muss ich lächeln. So bin ich eben. Ich liebe es, wenn sie mich ihren Freund nennt. Und das tut sie nur, wenn sie richtig sauer ist.
Ich weiß, das klingt krank. Ich gehe meiner HIV-positiven Freundin so lange auf die Nerven, bis sie angepisst genug ist, um zu vergessen, dass wir eigentlich kein Paar sind und mich ihren Freund nennt. Andererseits ist unsere ganze Beziehung krank, angefangen mit der Tatsache, dass wir keinen Sex haben. Das macht ihr ganz schön zu schaffen. Dass wir zusammen sind, ohne miteinander zu vögeln, ist eine schwere Last für sie. Ich kann das verstehen. Dafür braucht man keinen Doktortitel in Quantenphysik. Sie hat einfach Angst, mich anzustecken. Kondome, Femidom ‒ nichts davon ist ihr sicher genug, um über Knutschereien, Kuscheln und einen Handjob hinauszugehen. Leider darf ich ihr nicht erzählen, dass sie mich niemals infizieren könnte. Niemand kann das. Es gibt weiß Gott keinen Erreger auf dieser schönen Erde, der mir noch was anhaben könnte. Dafür ist es zu spät. Ich bin bereits so krank, wie man es nur sein kann. So ziemlich jedenfalls. Nachdem sich das Vyrus in meinem System eingenistet hatte, wurde ich immun gegen alles andere. Jedes normale Virus, jedes Bakterium, das auch nur versucht, an meine Tür zu klopfen, bekommt vom Vyrus einen richtig saftigen Arschtritt verpasst.
Ich kann gut ohne Sex leben. Okay, das war jetzt gelogen. Eigentlich finde ich die Tatsache, dass wir keinen Sex haben, ziemlich unerträglich. Schon als ich Evie heute Morgen beim Anziehen beobachtet habe, wäre ich fast die Wände hochgegangen. Aber ich komme klar. Muss ich ja. Nicht wegen ihrer Krankheit, sondern wegen meiner. Ich weiß nicht, ob sich das Vyrus beim Sex überträgt, aber das Risiko will ich nicht eingehen. Nicht, wenn es bedeutet, dass ich Evie mit einem Organismus infiziere, der ihr Blut kolonisiert und gnadenlos alles rausfiltert, was es brauchen kann. Ein Organismus, der immer hungrig ist. Der immer mehr will. Wenn dein Blut nichts mehr hergibt, schickt er dich auf die Jagd. Und jagen wirst du, Sportsfreund. Und wie du jagen wirst. Die Alternative dazu? Es fühlt sich an, als würden deine Eingeweide kochen. Du krümmst dich vor Schmerzen. Dagegen ist alles, was Evie in den nächsten Jahren bevorsteht, Kinderkram. So ist das nun mal.
Dass das Vyrus sie von dem HIV heilen würde, spielt keine Rolle. Dass sie so lange leben könnte, wie sie wollte, wenn sie nur das Vyrus füttert, ebenfalls nicht. Wir könnten immer zusammen sein und nach Herzenslust vögeln. Auch egal. Das alles ist nicht wichtig. Denn so etwas erzählt man nicht der Frau, die man liebt. Man stellt einen geliebten Menschen nicht vor eine so schwere Entscheidung. Man muss Manns genug sein, sie für ihn zu treffen.
So, jetzt weiß jeder Bescheid, was ich bin. Oder besser gesagt, was ich nicht bin.
Zugegeben, unsere Beziehung ist wirklich krank. Insofern passt sie perfekt zum Rest meines Lebens. Aber wessen Leben ist schon ein Zuckerschlecken?
Evie weiß nichts von alledem. Genau genommen weiß sie nicht die Bohne über mich. Wir sind seit drei Jahren zusammen, und ich habe noch immer Geheimnisse vor ihr. Das ist ein wunder Punkt in unserer Beziehung. Sie hat keine Ahnung, aber sie ist neugierig. Und dazu hat sie weiß Gott allen Grund. Zum Beispiel: Warum habe ich zwei Apartments gemietet, eins im Hochparterre und eins im Souterrain darunter? Warum habe ich die Tür der Souterrainwohnung vernagelt und eine Klappe in der unteren Hälfte angebracht, durch die ich im Notfall verschwinden kann? Warum ist die kleine Wendeltreppe, die vom Wohnzimmer der Parterrewohnung ins Souterrain führt, unter einer verborgenen Falltür versteckt? Und warum, um alles in der Welt, wohne ich in der winzigen Souterrainwohnung, wo das einzige Fenster zugemauert ist, und nicht in der geräumigen Wohnung darüber? Sie hat mir zumindest abgekauft, dass es wegen meiner Arbeit ist, dass ich mir ein paar Feinde gemacht habe. Aber sie würde natürlich gern erfahren, was ich denn eigentlich arbeite. Sie weiß, dass ich im Viertel so etwas wie der Mann fürs Grobe bin. Ich treibe Schulden ein, mache ein bisschen Detektivarbeit, solche Sachen eben. Aber das erklärt immer noch nicht meinen Sicherheitsfimmel, den Geheimraum, die vielen Schlösser an der Tür und die Alarmanlage. Aber was bleibt mir übrig? Ich kann ihr ja schlecht von den Van Helsings erzählen, die ganz heiß drauf sind, einen wie mich vor die Flinte zu kriegen. Selbstgerechte Arschlöcher, die dich mit Weihwasser vollspritzen und einen Pflock durch dein Herz jagen wollen. Das Weihwasser macht mir nichts aus, der Pflock jedoch schon. Scheiße, ein Pflock durchs Herz würde ja wohl jeden ins Jenseits befördern. Dabei wäre so etwas gar nicht nötig. Ein paar Kugeln täten’s auch. Wie gesagt, das kann ich ihr nicht erzählen. Natürlich glaubt sie mir den Scheiß nicht von wegen, ichhab Feinde, Baby. Wahrscheinlich vermutet sie, dass ich deale.
Drogen würden vieles erklären. Meinen Sicherheitswahn. Meine tief sitzende, alles umfassende Paranoia. Warum ich keinen normalen Job habe. Und nicht zuletzt den Minikühlschrank mit Vorhängeschloss, der in meinem Kleiderschrank steht. Vermutlich ist sie inzwischen der festen Überzeugung, dass sie da drin eine ganze Palette exotischer Pharmaprodukte finden würde, die man ganz bestimmt nicht bei jedem dahergelaufenen Wald-und-Wiesen-Dealer um die Ecke kaufen kann. Mein Stoff ist ja auch wirklich da drin, insofern vermutet sie richtig. Nur wird keiner high davon, es sei denn, er ist so gestrickt wie ich. Eineinhalb Liter Blut eines gesunden Menschen, gemischt mit den notwendigen gerinnungshemmenden Mittelchen. Eineinhalb Liter. Drei Liter weniger als meine absolute Minimalreserve. Beim Gedanken daran wird mir ganz anders.
Mit Drogen hätte Evie kein Problem. Aber Menschenblut? Da würde sie richtig ausflippen.
Schon seltsam, dass für sie eine meiner absonderlichsten Eigenheiten am einfachsten zu erklären ist. Warum ich tagsüber nie vor die Tür gehe? Urticaria Solaris. Sonnenallergie. Wenn ich an die Sonne gehe, wirft meine Haut Blasen und ist nicht mehr in der Lage, meine Körpertemperatur zu regulieren. Dann werde ich bewusstlos und Schlimmeres. Das hat sie geschluckt. Warum auch nicht? Sie hat im Internet darüber gelesen. Außerdem ist es ja von der Wahrheit gar nicht so weit entfernt. Ich habe wirklich eine Sonnenallergie. Aber eine Dosis UVA hätte nicht nur einen Ausschlag und eine Ohnmacht zur Folge. O nein. Das Vyrus würde verrückt spielen. Tumore würden meinen Körper als Tummelfeld benutzen. Knochenkrebs, Magenkrebs, Zungenkrebs, Hirnkrebs, Prostatakrebs, Hautkrebs ‒ ich würde mir jeden nur erdenklichen Krebs einfangen. Scheiße, wahrscheinlich sogar Augenkrebs. Sie würden ein Wettrennen veranstalten, wer mich als Erstes um die Ecke bringt. Könnte so etwa fünfzehn Minuten dauern. Außer natürlich, es ist ein wirklich sonniger Tag. Dann wäre in wenigen Minuten nichts als ein großer Haufen Krebszellen übrig. Biopsieergebnis: Ein riesiger Tumor mit ein paar Zähnen drin.
Ich habe es noch nie mit eigenen Augen gesehen. Aber die Geschichten, die ich gehört habe, reichen, um auf einen Strandurlaub zu verzichten. Deswegen bleibe ich tagsüber lieber zu Hause.
Irgendwie muss ich die Zeit totschlagen.
Ich dusche und rasiere mich. Dann gucke ich meine DVDs durch und schaue mir Fluchtpunkt San Francisco an. Ich gehe nach oben und finde ein paar Reste des kubanischen Essens, das ich mir irgendwann mal von gegenüber geholt habe. Ich höre Musik und versuche, ein Buch zu lesen. Und die ganze Zeit über denke ich an die letzten eineinhalb Liter und dass ich dringend mehr davon brauche.
Vor vier Tagen habe ich zum letzten Mal Blut getrunken. Deswegen hat mir der zappelnde Spinner letzte Nacht auch so hart zusetzen können. In guten Zeiten trinke ich jeden zweiten Tag einen halben Liter. Das hält mich fit.
Vier Tage? Kein Wunder, dass ich so reizbar bin. Ich muss heute unbedingt einen Beutel trinken, wenn ich nicht jedem gleich an die Gurgel gehen will, bildlich gesprochen natürlich. Vielleicht komme ich auch mit einem halben Beutel klar.
Außerdem frage ich mich, was bei Evies Arztbesuch herausgekommen ist. Sie hat mich nicht angerufen, was aber nach unserem kleinen Zoff kein Wunder ist. Ich muss wohl bei ihr in der Bar vorbeischauen, wenn ich das Neueste erfahren will. Und das wiederum heißt, dass ich mindestens einen halben Liter brauche, damit ich nicht die Nerven verliere, wenn ich sie treffe. Ich will keinen weiteren Stress mit ihr. Nicht mit dem einzigen Menschen auf der Welt, der mir wirklich etwas bedeutet.
So gegen halb fünf öffne ich den Kleiderschrank. Ich fummle an dem Zahlenschloss herum. Früher hatte ich ein Schloss mit Schlüssel, bis ich einmal den Schlüssel verlor. Das war mitten am helllichten Tag, also konnte ich nicht einfach losspazieren und mir einen Bolzenschneider besorgen. Ich war nahe daran, das verdammte Ding aufzubeißen, bis ich irgendwann mein Hirn einschaltete und mich an den Hammer unter der Spüle erinnerte. Damit konnte ich das Schloss aufbrechen. So ist das, wenn man Hunger hat. Da fallen einem die einfachsten Sachen nicht mehr ein. Jetzt habe ich dieses Zahlenschloss. Gott sei mir gnädig, wenn ich eines Tages die Kombination vergesse.
Ich öffne den Kühlschrank und fühle mich dabei wie ein Spielsüchtiger, der zum vierten oder fünften Mal seinen Wettschein kontrolliert, ob er statt auf die Schindmähre, die als Letzte durchs Ziel gekommen ist, nicht doch auf das Siegerpferd gesetzt hat. Ich weiß genau, was im Kühlschrank liegt, aber vielleicht, vielleicht habe ich mir ja irgendwie Nachschub besorgt und kann mich nur nicht mehr dran erinnern. Ein paar Liter, die ich einfach übersehen habe, weil sie ganz hinten liegen oder so. Ich öffne den Kühlschrank. Pech gehabt. Aufs falsche Pferd gesetzt.
Mit einem Skalpell, das ebenfalls im Kühlschrank liegt, bohre ich ein kleines Loch in einen der drei Plastikbeutel und schließe meine Lippen darum. Dann drücke ich auf den Beutel, und ein dünner Strahl kalten Bluts spritzt in meinen Mund. Warm schmeckt es besser. Bei etwa 37 Grad Celsius ist es wirklich köstlich. Aber gut gekühlt ist es auch nicht zu verachten. Ich versuche, es in kleinen Schlucken kultiviert zu genießen, aber wem will ich hier eigentlich was vormachen? Also lege ich den Kopf in den Nacken und bohre ein weiteres Loch in den Beutel. Das Blut strömt in einem Rutsch meine Kehle hinunter. Vorsichtig schneide ich den Beutel auf und lecke ihn sauber. Jetzt fühle ich mich wieder gut. Lebendig.
Das Blut hält mich am Leben. Das Vyrus braucht ab und zu was Frisches, über das es herfallen kann. Das verhindert, dass es mein eigenes Blut angreift und die kleinen Blutproduzenten in meinen Knochen völlig leer saugt. Solange das Vyrus gesund und munter ist, bemächtigt es sich nicht meines Hirns, um auf der Suche nach etwas Essbarem lauter falsche Schalter umzulegen. Es hält mich am Leben. Wenn man das als Leben bezeichnen will.
Als ich fertig bin, stecke ich den leeren Beutel in eine der roten Sondermülltüten, die ich ebenfalls im Kühlschrank aufbewahre.
Was das Schöne am Winter ist? Die Sonne geht früh unter. Herrlich. Das und die vielen bewölkten Tage machen den Winter zu meiner Lieblingsjahreszeit. Ich ziehe einen Pullover über, schnüre meine Stiefel, schnappe mir meine Jacke, meine Schlüssel und ein bisschen Kleingeld vom Schreibtisch. Dann zähle ich einen kleinen Stapel Banknoten ab. Hundert Mäuse. Ich habe noch tausend in meiner Schuhspitze versteckt, aber die sind nur für Notfälle. Außerdem würde es nicht mal reichen, um die Miete zu bezahlen, mit der ich sowieso schon zwei Monate im Rückstand bin. Blut ist nicht das Einzige, was langsam knapp wird.
Die Art der Bezahlung ist abhängig davon, für wen ich arbeite. Entweder Blut oder Geld. Leider hatte ich schon eine ganze Weile keinen Job mehr. Blut könnte ich schon irgendwo auftreiben. Hier einen halben Liter, da einen halben Liter. Mit dem Geld ist es kniffliger. Angenommen, ich schlage einen Typen nieder, schleife ihn in eine Seitenstraße und zapfe ihn an. Mit einem Liter komme ich leicht davon. Aber seine Brieftasche kann ich vergessen, die ist höchstwahrscheinlich leer. Die Typen mit der dicken Kohle sind die letzten, mit denen ich mich anlegen will. Die würden sofort Zeter und Mordio schreien. Außerdem will ich nicht, dass einer von denen nach dem Aufwachen die Einstichstellen in seinem Arm entdeckt und seinen Arzt fragt, was zum Teufel das wohl sein könnte. Und jemanden auszurauben, ohne ihn anzuzapfen, wäre ziemlich dämlich. Ohne Blut lohnt sich die Mühe nicht. Tja, Geld ist Geld, aber Blut ist Blut.
Ein echter Raubüberfall kommt nicht infrage. Soll ich mich mit einer Knarre in einen Schnapsladen stellen? Irgendwo einbrechen? Ich würde überall Spuren hinterlassen. Die Cops würden eine Akte anlegen und mich in ihre Datenbank aufnehmen. Ich darf auf keinen Fall auf dem Radar der Cops erscheinen. In einer Gefängniszelle gibt’s keine zugemauerten Fenster. Und bei der Essensausgabe wohl auch kein Blut. Eine Woche, und ich wäre verhungert oder von der Sonne gegrillt.
Also brauche ich einen anständigen Auftrag. Ein dickes Ding, das sich in beide Richtungen auszahlt, anders als der Kleinscheiß, mit dem ich mich jetzt schon seit einem Jahr mehr schlecht als recht durchschlage. So lange ist die Koalition jetzt schon stocksauer auf mich. Früher habe ich für sie die Drecksarbeit erledigt. Irgendwie war mir nie bewusst, wie sehr ich auf ihre Almosen angewiesen war. Und jetzt ist es für Reue zu spät.
Zum tausendsten Mal überlege ich, ob ich sie nicht anrufen soll. Ich müsste Dexter Predo nur eingestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich kann alles wieder ausbügeln, Mister Predo, und jawohl, ich tue alles, was Sie wollen. Aber der Griff zum Telefon unterbleibt auch diesmal.
Scheiß auf diese Arschlöcher.
Kapitel 3
Ich verlasse meine Bude und spaziere runter zur Avenue A. Am Kiosk an der Ecke kaufe ich mir eine Schachtel Luckies und ein Bier. Ich überquere die Avenue, erspähe eine freie Bank im Tompkins Square Park. Dort trinke ich mein Bier, rauche und lasse mir alles noch mal durch den Kopf gehen. Mein Problem ist, ich brauche einen Job.
Normalerweise lebe ich von Mundpropaganda. Das Dumme ist nur, dass in letzter Zeit nicht viel über mich geredet wird. Kein anständiger Bürger beauftragt mich, seinen verschollenen, nichtsnutzigen Vater aufzuspüren. Kein Unabhängiger, den ich für einen der kleineren Clans aus ihrem Revier beseitigen darf. Alles, was ich habe, ist ein Rausschmeißerjob im Niagara, und gelegentlich drehe ich für einen Kredithai ein paar Arme um. Drecksarbeit. Beschissene Koalition. Vielleicht hätte ich damals doch nicht so hart mit ihr umspringen sollen. Beiß niemals die Hand, die dich füttert.
Die Koalition ist die einzige Chance für mich, einen richtig fetten Auftrag an Land zu ziehen. Blöderweise lassen sie es einen immer so richtig spüren, dass man nur Bittsteller ist. Da kann man schon mal aus der Haut fahren, wenn man sich überlegt, dass sie der einzige Clan sind, der die Macht und die Ressourcen besitzt, jemandem regelmäßig ein paar Tausender und literweise Blut zukommen zu lassen. Predo? Der hasst mich. Das passiert, wenn man sich mit dem Geheimdienstchef der Koalition anlegt und seine Pläne nach Strich und Faden durchkreuzt. Er will deinen Kopf. Er legt eine Akte mit geheimen Informationen über dich an.
Ich trinke mein Bier aus, werfe die leere Dose in einen Mülleimer und stehe auf. Die Koalition ist der einzige Clan, der mich auf Dauer beschäftigen könnte. Aber es gibt schließlich noch andere Clans, und man weiß ja nie, ob die nicht auch ein bisschen Drecksarbeit zu erledigen haben. Ich habe mich lange aus dem ganzen Spiel herausgehalten, aber der eine Liter im Kühlschrank ist Grund genug, in den sauren Apfel zu beißen. Also gehe ich nach Osten in Richtung Avenue C und dem Hauptquartier der Society. Ein verdammt saurer Apfel ist das.
‒ Hey, Hurley.
‒ Joe.
‒ In letzter Zeit ein gutes Buch gelesen?
‒ Leck mich.
‒ Ja, das hat mir auch gefallen.
Es sieht zwar aus wie ein stinknormales Mietshaus in Alphabet City, ist es aber nicht. Es ist eine Festung. Ich weiß nicht genau, welche Sicherheitsmaßnahmen sie noch getroffen haben oder wie viele Partisanen darin verschanzt sind, aber Hurley ist eigentlich alles, was sie brauchen. Er lehnt vor mir an dem bedauernswerten Türrahmen. Wenn er sich zu heftig bewegt, könnte das ganze Gebäude in sich Zusammenstürzen.
‒ Brauchst du was, Joe?
‒ Ist Terry da?
‒ Jep.
Wir stehen uns am Hauseingang gegenüber, und er verstellt mir den Weg. Ich will rein. Aber nicht so dringend, dass ich mich dafür mit Hurley anlegen würde. Der Kerl ist schon seit der Prohibition unterwegs. Man will sich gar nicht vorstellen, wie abgebrüht man sein muss, um so lange durchzuhalten. Hurley macht keine Anstalten, sich zu bewegen. Er könnte die ganze Nacht hier stehen und sich nicht einen Millimeter von der Stelle rühren. Nicht, dass er so eine Art zenmäßige Engelsgeduld hätte. Er ist einfach zu bescheuert, um sich zu langweilen.
‒ Glaubst du, ich könnte mal mit ihm reden?
‒ Hast du ’nen Termin?
‒ Einen Termin?
‒ Jep.
‒ Seit wann braucht man denn bei Terry einen Termin?
Jemand tritt hinter Hurley aus dem Schatten.
‒ Seit ich für die Sicherheit zuständig bin.
Ich mustere ihn von oben bis unten.
‒ Abend, Tom. Sieht aus, als hättest du endlich die Beförderung bekommen, die du so dringend wolltest.
‒ Keine Scheißbeförderung, Arschloch. Die Society ist keine verfickte Firma. Sie ist ein Kollektiv. Ich wurde demokratisch auf diesen Posten gewählt.
‒ Na klar. Wie du meinst. Hat wohl gar nichts damit zu tun, dass Terry dich Protegiert hat.
Er will schon auf mich losgehen, reißt sich aber im letzten Moment zusammen.
‒ Okay, okay. Du kannst meinetwegen denken, was du willst, Pitt. Ist mir egal. Und weißt du, wieso?
‒ Nein. Bitte, bitte, erzähl’s mir.
‒ Weil du nur ein dummer kleiner Arsch bist, der draußen steht und rein will. Und alles, was ich tun muss, um dich loszuwerden, ist Folgendes.
Er schlägt mir die Tür vor der Nase zu.
Scheiße, so leicht wird er mich nicht los.
Ich drücke auf alle Klingelknöpfe gleichzeitig. Es dauert ungefähr eine Minute, bis sich die Tür wieder öffnet.
‒ Hör mit dem Scheiß auf, Pitt!
Ich nehme meine Hand von der Klingel.
‒ Hi Tom! Ist Terry da?
‒ Du hast keinen Scheißtermin. Kein Termin, kein Terry. Er wirft die Tür zu. Ich klingle. Er reißt sie wieder auf.
‒ Hi Tom! Ist Terry da?
‒ Hurley, schaff mir diesen Kerl vom Hals.
Hurley kommt langsam auf mich zu.
‒ Kein’ Schritt weiter, Pitt.
‒ Hey, Hurl, das reimt sich ja.
Er deutet auf die Treppenstufen.
‒ Willst du da runtergehen oder lieber runterfallen?
Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und spähe über seine Schulter hinweg nach Tom.
‒ Angenommen, ich möchte einen Termin ausmachen. Was muss ich tun?
Tom lächelt.
‒ So einer wie du? Einer von Terrys alten Kumpels?
‒ Genau. So einer wie ich.
‒ Tja, ich würde sagen, du kriegst einen Termin, wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Schreib’s dir in deinen Terminkalender.
‒ Das ist aber noch lange hin.
‒ Hurley.
Hurley dreht sich um und wirft einen Blick hinter Tom.
‒ Ja, Terry?
‒ Was ist denn los?
‒ Joe hier will reinkommen.
‒ Und warum steht der gute Mann dann noch da draußen?
‒ Hat kein’ Termin.
‒ Ist schon okay. Lass ihn rein.
Tom wirbelt herum, dass seine Dreadlocks nur so durch die Gegend fliegen.
‒ Was soll der Scheiß? Er hat keinen Termin.
‒ Kein Problem, Tom. Eigentlich hab ich im Moment nicht so viel zu tun. Bleib locker.
‒ Darum geht’s ja nicht. Aber ich muss jeden gründlich überprüfen.
‒ Klar. Trotzdem müssen wir flexibel bleiben.
‒ Aber die Sicherheit…
‒ Klar, Sicherheit ist wichtig. Aber das ist doch Joe. Wir kennen doch alle Joe.
Ich hebe die Hand.
‒ Hey, Terry, ich will keinen Stress machen. Gib mir einfach einen Termin. Kein Problem.
‒ Nein, nein. Komm rein.
‒ Sicher?
Ich gehe auf die Tür zu. Hurley tritt zur Seite, und Tom stellt sich mir in den Weg.
‒ Ich bin hier für die Sicherheit zuständig. Und dieses Arschloch hier wurde nicht überprüft.
Terry nimmt seine John-Lennon-Brille ab und putzt sie sich mit seinem Monterey-Festival-T-Shirt.
‒ Ja, schon klar, Sicherheit und alles, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine gemeinnützige Organisation sind. Sicherheit ist wichtig, aber wir müssen auch an die Bedürfnisse der Gemeinschaft denken. Wo kommen wir denn da hin? Joe ist Teil unserer Gemeinschaft. Also, drück mal ein Auge zu und lass den Mann rein.
‒ Scheiße. Bestimmt nicht. Ich bin ordnungsgemäß gewählt worden und nehme meine Aufgabe ernst. Es gibt Grenzen. Kein Termin, kein Gespräch. Besonders nicht für so ein Sicherheitsrisiko wie den hier.
Terry setzt die Brille wieder auf.
‒ Grenzen. Oha. Grenzen. Klar, hab ich vergessen. Du und Joe, ihr könnt nicht so gut miteinander. Ihr habt da, na ja, ein paar ungelöste Konflikte. Aber ist schon in Ordnung. Pass mal auf. Warum gehst du nicht los und kontrollierst den Sektor? Nimm Hurley mit.
‒ Was?
‒ Du weißt schon, zieh los und check mal die Umgebung. Sieh zu, dass alles sicher ist und so.
‒ Meine Aufgabe ist ...
‒ Tom, geh jetzt los und check die gottverdammte Umgebung. Hör auf, dich wie ein Scheißnazi aufzuführen.
Tom öffnet und schließt den Mund ein paarmal, schaut von mir zu Terry und dann wieder zu mir.
‒ Du stehst auf der Liste, Pitt. Und zwar ganz oben.
Er stürmt die Treppen runter, wobei er nicht vergisst, mich dabei mit der Schulter anzurempeln.
‒ Was für ’ne Liste?
‒ Leck mich, Schwanzlutscher. Hurley, komm mit.
‒ Führst du jetzt Buch, wie oft du dich zum Vollidioten gemacht hast?
‒ LECK MICH!
Er stampft die Straße hinunter. Hurley folgt ihm in angemessener Entfernung.
Ich wende mich Terry zu.
‒ Bist du sicher, dass du die beiden alleine losziehen lassen solltest?
‒ Er ist schon in Ordnung, Joe. Er erledigt seinen Job gut. Meistens ist er auch ganz umgänglich, außer, du bist in seiner Nähe. Dann wird er immer ziemlich aufbrausend.
‒ Komisch, anders kenn ich ihn gar nicht.
‒ Glaubst du, da gibt’s einen Zusammenhang?
‒ Hab nicht die leiseste Ahnung.
Er lächelt.
‒ Aha. Na gut. Du wolltest mich sprechen?
‒ Ja.
‒ Dann komm mal rein. Ich mach mir gerade einen Chai-Tee.
‒ So ein Glück.
‒ Die Sache ist die, Joe. Ich dachte, ich würde dich jetzt öfter sehen. Nach unserem letzten Treffen meinte ich, so etwas wie eine Neuausrichtung unserer Beziehung gespürt zu haben. Etwas von dem Vertrauen, von den positiven Schwingungen, die wir mal miteinander geteilt haben.
‒ Wie in den guten alten Zeiten, meinst du?
Er schnuppert an dem Gebräu aus Zweigen und anderem Unkraut, das er auf dem Herd stehen hat.
‒ Ja, die guten alten Zeiten sind wohl endgültig vorbei. Aber ich dachte, wir hätten so etwas wie ein Übereinkommen am Laufen. Etwas, auf das man aufbauen kann. Und dann lässt du dich überhaupt nicht mehr blicken. Warum nicht, Joe?
‒ Gute Frage, Terry. Vielleicht, weil ich dich nicht leiden kann?
Er lacht und schüttet das Gebräu aus dem Topf durch ein Sieb in eine Tasse.
‒ Tja, das wäre wohl eine Erklärung. Willst du wirklich keinen Tee? Sehr entspannend und die Basis einer gepflegten Konversation.
‒ Ich will keine gepflegte Konversation.
‒ Und das, Joe, ist sehr schade. Wirklich schade.
Mit der Tasse in der Hand durchquert er die armselige Küche und setzt sich auf den Stuhl neben mir.
‒ Also, mein Freund. Was gibt’s?
‒ Ich brauch einen Job.
Man kann durchaus sagen, dass Terry mir das Leben gerettet hat.