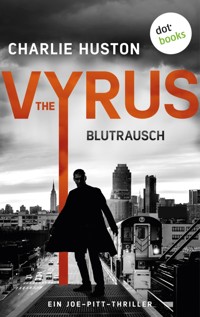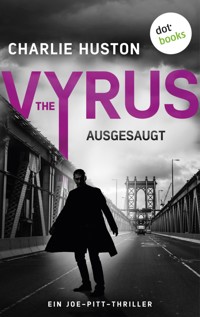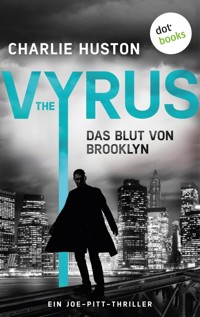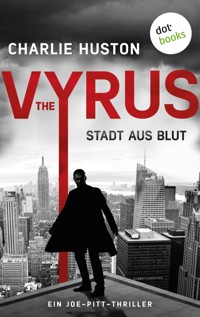
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Joe-Pitt-Thriller
- Sprache: Deutsch
Die Nacht ist tödlich: Der nervenaufreibende Thriller »The Vyrus: Stadt aus Blut« von Bestseller-Autor Charlie Huston jetzt als eBook bei dotbooks. Wer in den Abgrund blickt … Seit sich Privatermittler Joe Pitt mit der bösartigen Krankheit infiziert hat, die in der nächtlichen Halbwelt Manhattans wütet, lebt er ein Schattendasein: Als Einzelgänger ist es ihm bisher gelungen sich den großen Klans zu verweigern, die New York unter sich aufgeteilt haben, muss aber ihre Drecksjobs erledigen, um zu überleben. Doch ein grausamer Fund auf einem verlassenen Grundstück ändert alles: die Leichen von vier Junkies, ihre Körper bestialisch zugerichtet, einer der Schädel aufgebrochen wie eine reife Frucht. Wider besseren Wissens beginnt Joe die Strippenzieher hinter den Morden zu suchen – und legt sich so mit der »Koalition« an, dem ältesten und mächtigsten Klan der New Yorker Unterwelt. Ein erbitterter Überlebenskampf nimmt seinen Lauf … Rasant, dreckig und so unfassbar spannend, dass man nicht aufhören kann zu lesen: »So blutig wie brillant – von einem der herausragenden Thrillerautoren des 21. Jahrhunderts!« Washington Post Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abgründige Thriller »The Vyrus: Stadt aus Blut« von Charlie Huston – der spektakuläre erste Band in seiner Reihe um den Privatermittler Joe Pitt. »True Detective« meets »The Walking Dead«! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wer in den Abgrund blickt … Seit sich Privatermittler Joe Pitt mit der bösartigen Krankheit infiziert hat, die in der nächtlichen Halbwelt Manhattans wütet, lebt er ein Schattendasein: Als Einzelgänger ist es ihm bisher gelungen sich den großen Klans verweigert, die New York unter sich aufgeteilt haben, muss aber ihre Drecksjobs erledigen, um zu überleben. Doch ein grausamer Fund auf einem verlassenen Grundstück ändert alles: die Leichen von vier Junkies, ihre Körper bestialisch zugerichtet, einer der Schädel aufgebrochen wie eine reife Frucht. Wider besseren Wissens beginnt Joe die Strippenzieher hinter den Morden zu suchen – und legt sich so mit der »Koalition« an, dem ältesten und mächtigsten Klan der New Yorker Unterwelt. Ein erbitterter Überlebenskampf nimmt seinen Lauf …
Rasant, dreckig und so unfassbar spannend, dass man nicht aufhören kann zu lesen: »So blutig wie brillant – von einem der herausragenden Thrillerautoren des 21. Jahrhunderts!« Washington Post
Über den Autor:
Charlie Huston wurde 1968 in Oakland, Kalifornien geboren. Nach einem Theaterstudium zog er nach New York, wo er als Schauspieler und Barkeeper arbeitete, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Seine »Vyrus«-Reihe, für die er unter anderem mit dem wichtigsten amerikanischem Krimipreis, dem Edgar-Award, nominiert wurde, erzählt den Überlebenskampf von Privatermittler Joe Pitt in der New Yorker Unterwelt. Charlie Huston lebt mit seiner Frau, einer bekannten Schauspielerin, in Los Angeles.
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine packende Serie um den New Yorker Privatermittler Joe Pitt:
»The Vyrus: Stadt aus Blut«
»The Vyrus: Blutrausch«
»The Vyrus: Das Blut von Brooklyn«
»The Vyrus: Bis zum letzten Tropfen«
»The Vyrus: Ausgesaugt«
Außerdem bei dotbooks erschienen ist sein Thriller »Killing Game«.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2005 unter dem Originaltitel »Already Dead« bei Ballantine Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2007 unter dem Titel »Stadt aus Blut« bei Heyne
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2005 by Charles Huston
This edition published by arrangement with Ballantine Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2007 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Geobor, dibrova, jamesteohart
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-532-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »The Vyrus 1« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Charlie Huston
The Vyrus:Stadt aus Blut
Ein Joe-Pitt-Thriller
Aus dem Amerikanischen von Kristof Kurz
dotbooks.
Dieses Buch ist für Casey Allen, Stephen Bond, Steve Gardner, Chip Harder, Eugene Rominger, Bob Stear und alle anderen merkwürdigen und brillanten Leute, mit denen ich in Kellerlöchern und Kneipen abhing und mir seltsame Welten ausdachte.
Kapitel 1
Ich kann sie riechen, noch bevor ich sie sehe. Die noch halbwegs durchblicken, beschmieren sich mit Puder, Parfüm und Ölen. Im Endstadium stolpern sie dann stinkend durch die Gegend. Nur die ganz Schlauen kommen auf die Idee, sich zu duschen. Auf lange Sicht hilft ihnen das natürlich auch nichts. Sie sterben sowieso. Eigentlich sind sie schon tot.
Die, nach denen ich suche, blicken also noch halbwegs durch. Sie ziehen eine Wolke aus Chanel Nr. 5, Old Spice oder sonst was hinter sich her ‒ für gewöhnliche Nasen nicht mal allzu aufdringlich. Ich schließe meine Augen und ziehe die Luft ein. Es könnten ja wirklich nur ein paar von diesen Idioten aus Jersey oder Long Island sein. Aber mein Instinkt behält recht. Unter dem ganzen Parfüm liegt ein kaum merklicher, süßlicher Geruch. Der Gestank von etwas, das noch nicht lange tot ist und gerade erst angefangen hat zu verwesen. Ich habe sie gefunden, da bin ich mir sicher. Fast hundertprozentig. Es laufen ja nicht viele von diesen Dingern herum. Noch nicht. Ich schlendere die Avenue A entlang und bleibe dann an der Kreuzung zur St. Marks direkt vor Ninos Pizzeria stehen.
Mit dem Ring an meinem Mittelfinger klopfe ich auf die Theke. Einer der neapolitanischen Kellner kommt zu mir rüber.
‒ Ja?
‒ Gibt’s was Frisches?
Er schaut mich verständnislos an.
‒ Welche Pizza ist am frischesten?
‒ Tomate und Knoblauch.
‒ Auf keinen Fall Scheißknoblauch. Was ist mit Broccoli? Wie lange liegt die hier schon rum?
Er zuckt mit den Schultern.
‒ Also gut, gib mir ein Stück. Aber nicht zu heiß. Ich hab keine Lust, mir den Gaumen zu verbrennen.
Er schneidet mir ein Stück ab und schiebt es zum Aufwärmen in den Ofen. Tomatenpizza mit Knoblauch hätte ich schon auch essen können. Es ist nicht so, dass der Knoblauch mir schaden würde. Aber ich mag das Zeug einfach nicht.
Während ich an der Theke warte, mustere ich die anderen Gäste. Das übliche Freitagabendpublikum: zwei Studenten von der NYU, ein paar Gammler und Hausbesetzer, zwei Yuppies auf einer Abenteuerreise ins East Village, ein paar Hip-Hopper, alle betrunken. Und diejenigen, nach denen ich suche. Sie stehen zu dritt um einen der hinteren Tische. Eine Gruftietante der alten Schule und zwei spindeldürre Typen mit unglaublich hohen Wangenknochen. Typische Modejunkies, die in irgendwelchen Löchern leben, aber auf jeder Szeneparty willkommen sind, weil sie Heroin verticken. Genau die Art von Arschlöchern, die mir noch gefehlt hat.
‒ Einmal Broccoli.
Der Neapolitaner bringt mir meine Pizza, und ich gebe ihm drei Dollar. Gruftie und die Junkies sehen den beiden Studenten hinterher, die aus dem Laden stolpern. Ungefähr eine Minute lang warten sie vor ihrem unberührten Essen, dann folgen sie ihnen. Ich bestreue mein Stück mit roten Paprikaflocken, nehme einen großen Bissen und verbrenne mir prompt den Mund. Der Pizzamann kommt mit meinem Wechselgeld zurück. Ich schlucke, und der geschmolzene Käse versengt mir die Kehle.
‒ Ich hab doch gesagt, nicht zu heiß.
Er zuckt mit den Achseln. Der Typ macht den ganzen Tag nichts anderes, als Pizzastücke in den Ofen zu schmeißen und sie wieder rauszuholen. Nicht zu heiß? Da hätte ich genauso gut Coq au vin bestellen können. Ich nehme die 50 Cent Wechselgeld, lasse mein Pizzastück auf die Theke fallen und folge Gruftie und den Junkies. War sowieso Scheißknoblauch in der Pizzasoße.
Die Studenten haben die Straße überquert, um die Abkürzung durch den Tompkins Square Park zu nehmen, bevor ihn die Bullen um Mitternacht dichtmachen. Das Trio folgt ihnen in einigen Metern Abstand. Gerade erreichen sie den alten Steinbrunnen, in den die Worte Glaube, Hoffnung, Mäßigung, Barmherzigkeit eingemeißelt sind. Auf der anderen Seite des Parks biegen die Studenten östlich in die Neunte Straße ein. Mitten durch Alphabet City. Na toll.
Der Block zwischen Avenue B und C ist menschenverlassenes Niemandsland. Bis auf die Studenten, ihre Verfolger und mich.
Gruftie und die Junkies beschleunigen ihre Schritte. Ich schlendere einfach weiter. So schnell können sie gar nicht verschwinden, als dass ich es nicht bemerken würde. Bei dem, was sie vorhaben, brauchen sie ein ungestörtes Plätzchen. Dort sollen sie es sich in aller Ruhe gemütlich machen und sich in Sicherheit wiegen. Dann bin ich am Zug.
Sie sind jetzt direkt hinter den Studenten. Unter einer kaputten Straßenlampe teilen sie sich auf und kreisen die beiden ein. Ein Handgemenge, Geschrei, und plötzlich sind alle verschwunden. Fuck.
Ich renne hinterher und blicke mich um. Links von mir steht ein verlassenes Gebäude. Es war mal eine Schule, dann ein puertoricanisches Gemeindezentrum. Jetzt ist es nur ein verfallenes Loch.
Ich folge ihrem Geruch über die Treppen und durch einen kleinen Innenhof bis zu einer mit Graffiti verschmierten Doppeltür. Sie war jahrelang mit einer Kette versperrt, die heute Nacht jedoch schlaff an einem aufgesägten Vorhängeschloss hängt. Sieht danach aus, als hätten sie diesen Platz gezielt ausgewählt. Dann sind sie wohl doch noch nicht so bescheuert, wie ich dachte.
Vorsichtig öffne ich die Tür und spähe hinein. Nach etwa zehn Metern zweigt zu beiden Seiten ein Gang ab. Die Dunkelheit stört mich nicht. Im Gegenteil. Ich schlüpfe durch die Tür, schließe sie hinter mir und ziehe Luft durch die Nase. Es riecht, als sei das hier schon eine ganze Weile ihr Quartier. Der erste Schrei gibt mir die Richtung vor: an der Abzweigung rechts und durch die geöffnete Tür eines Klassenzimmers.
Einer der Studenten liegt mit dem Gesicht auf dem Boden. Gruftie kniet auf seinem Rücken und hat ihm bereits ihr Messer in den Nacken gerammt. Jetzt versucht sie, die Klinge in seinen Schädel zu treiben, um ihn aufzubrechen. Die Junkietypen stehen dabei und warten wie die Kinder auf die Weihnachtsbescherung.
Der andere Student kauert in der Ecke. Wie üblich in solchen Situationen hat er sich vor Angst bepisst. Er rollt wild mit den Augen und kreischt, als würde er gleich vor Angst sterben. Ich hasse dieses Geräusch.
Ein Knirschen.
Das Mädchen hat das Messer da, wo sie es haben will, und dreht heftig am Griff. Der Schädel des toten Studenten springt auf. Sie greift mit beiden Händen in den Spalt, stemmt ihn mit aller Gewalt auseinander und öffnet den Kopf wie eine reife Frucht. Wie einen verdammten Granatapfel. Als sie Brocken von Gehirnmasse herausschaufelt, kommen die Junkies gierig näher. Für den Studenten kommt jede Hilfe zu spät, also warte ich ab und beobachte sie, während sie essen. Das Gewimmer des anderen Studenten wird noch eine Oktave höher. An die Arbeit.
Nach drei lautlosen Schritten erreiche ich den ersten. Ich nehme ihn in den Schwitzkasten, presse meine rechte Hand auf sein Gesicht und packe mit der Linken seinen Hinterkopf. Mit einem heftigen Ruck drehe ich seinen Schädel im Uhrzeigersinn. Ich fühle, wie sein Rückenmark zerreißt und lasse ihn fallen. Noch bevor er auf dem Boden landet, habe ich schon den Zweiten an den Haaren. Das Mädchen richtet sich auf und kommt mit dem Messer auf mich zu. Ein Schlag gegen die Kehle schickt den Junkie zu Boden. Was ihn nicht umbringt, mir aber etwas Zeit verschafft. Gruftie schwingt das Messer in hohem Bogen, und die Spitze der Klinge schlitzt mir die Stirn auf. Blut läuft mir in die Augen.
Wer auch immer sie war, bevor sie gebissen wurde: Sie konnte einigermaßen mit einem Messer umgehen und hat es noch nicht völlig verlernt. Sie zieht sich zurück und wartet, bis ihr Kumpel sich wieder aufgerappelt hat, damit sie mich gemeinsam in die Zange nehmen können. Hinter dem leblosen Blick ihrer Augen scheint noch ein bisschen Verstand zu lauern. Jedenfalls genug, um Pizza zu bestellen, die Studenten als Beute auszumachen und ein Schloss aufzusägen. Aber nicht genug, um mir gefährlich werden zu können ‒ sofern mir kein Fehler unterläuft. Als ich auf sie losgehe, stößt sie mit dem Messer nach mir. Ich packe die Klinge.
Ihr Blick wandert von mir zu meiner Hand. Meine Finger halten das Messer fest umschlossen, obwohl zwischen ihnen Blut hindurchsickert. Für einen Augenblick erhellt sich das trübe Licht in ihren Augen etwas. Ihr wird bewusst: Sie ist im Arsch. Ich entwinde ihr das Messer, werfe es in die Luft und fange es am Griff wieder auf. Sie will wegrennen. Ich packe ihre Lederjacke, ramme ihr das Messer ins Genick und durchtrenne ihr Rückenmark. Anschließend lasse ich ihren erschlafften Körper fallen. Denn inzwischen hat sich der Junkie wieder aufgerappelt. Ich trete ihn zu Boden, setze meinen Stiefel auf seine Kehle und verlagere mein Gewicht, bis ich sein Genick brechen höre.
Dann gehe ich in die Hocke und wische meine Hände an seinem Hemd ab. Mein Blut ist längst geronnen und die Wunden an Hand und Stirn schließen sich bereits. Ich untersuche die Leichen. Einem fehlen ein paar Zähne und sein Zahnfleisch ist mit Verletzungen übersät. Anscheinend hat er in einen Schädel gebissen. Möglicherweise in den des Vollidioten von vor ein paar Tagen. Der mit dem Loch im Kopf, der mich auf ihre Spur gebracht hat.
Beide Junkies haben kleine Bisswunden im Genick. Ich vergleiche Radius und Größe der Zahnspuren mit dem Gebiss des Mädchens. Könnte passen. Wahrscheinlich hat sie die beiden mit dem Bakterium infiziert. So was passiert manchmal. Nach einer Infektion greifen die Bakterien sofort das Gehirn an und reduzieren ihr Opfer auf seinen Fresstrieb. In seltenen Fällen jedoch schaffen die Betreffenden es vorher, andere zu infizieren. Sie beißen zu, ohne die ganze Mahlzeit zu verputzen. Warum sie das tun, weiß niemand. Eher zartbesaitete Menschen würden wahrscheinlich sagen: weil sie einsam sind. Aber das ist Unsinn. Das Bakterium zwingt sie dazu, damit es sich weiter verbreiten kann. Hier ist der verfluchte Darwin am Werk ‒ mehr nicht.
Ich betrachte den Nacken des Mädchens. Sie hat die anderen angesteckt, aber von wem hat sie es? Das Messer hat die Bisswunde beschädigt, aber sie ist eindeutig zu sehen. Sie wirkt größer als die anderen und auch irgendwie brutaler. Bei genauerem Hinsehen kann man überall auf ihrem Nacken Bissspuren erkennen. Der verdammte Überträger konnte sich wohl nicht entscheiden, ob er sie infizieren oder auffressen wollte. Mir egal. Was mir jedoch nicht gleichgültig sein kann, ist die Tatsache, dass meine Arbeit noch nicht beendet ist. Irgendwo da draußen läuft ein Überträger frei herum. Als ich gerade aufstehen will, bemerke ich etwas. Einen bestimmten Geruch. Dann bewegt sich hinter mir etwas.
Der andere Student. Den hätte ich fast vergessen. Er kratzt vor Angst an der Wand, als wolle er sich durchgraben. Ich will ihm gerade eins überziehen, als er mir die Arbeit abnimmt und von selbst ohnmächtig wird. Bei ihm finde ich keine Bisswunden. Ich habe Blut verloren, die Pizza nicht gegessen und bin ziemlich hungrig. Deswegen krame ich mein Werkzeug heraus und hänge den Jungen an die Nadel. Das ist sonst nicht meine Art. Aber ich will ja nur einen halben Liter. Höchstens einen ganzen.
Am nächsten Morgen weckt mich das Telefon. Ich weiß nicht, wer auf die verdammte Idee kommt, mich vormittags anzurufen. Der Anrufbeantworter springt an.
‒ Hier spricht Joe Pitt. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht.
‒ Joe, hier Philip.
Wegen Philip Sax werde ich den Hörer ganz bestimmt nicht abnehmen. Ich schließe die Augen und versuche, wieder einzuschlafen.
‒ Joe, ich hab da was für dich. Willst du nicht rangehen?
Ich drehe mich um und ziehe mir die Bettdecke über den Kopf. Wenn ich mich erinnern könnte, was ich gerade geträumt habe, würde ich an der Stelle weitermachen.
‒ Joe, ich will ja nicht nerven, aber ich nehme mal schwer an, du bist zu Hause. Wo solltest du um zehn Uhr früh sonst sein?
An Schlaf ist jetzt nicht mehr zu denken. Also nehme ich den verfluchten Hörer ab.
‒ Was willst du?
‒ Hey Joe! Warst gestern Nacht schwer beschäftigt, was?
‒ Ja, war arbeiten. Und?
‒ Du hast es bis in die Nachrichten geschafft. Wollte ich nur mal gesagt haben.
Scheiße.
‒ Die Zeitungsfritzen?
‒ NY1 News.
Scheiß NY1. Scheiß Kabelfernsehen. In dieser Stadt kann man sich nicht mal am Sack kratzen, ohne dass man es am nächsten Tag im Fernsehen sieht.
‒ Wie schlimm ist es?
‒ Ähm … Bestialischer vierfacher Mord.
‒ Scheiße.
‒ Hört sich für mich nach schlampiger Arbeit an.
‒ Na ja, hatte nicht viele Optionen.
‒ Klar, klar. Was war denn los?
‒ Hirnfresser. Hinter denen bin ich schon die ganze Zeit her.
‒ Zombies?
‒ Genau. Ich hasse die verfluchten Dinger.
‒ Hast du alle erwischt?
‒ Es gibt einen Überträger.
‒ Einen Überträger? Verfluchte Zombies, was, Joe?
‒ Ja.
Ich lege auf.
Klar hätte ich die Leichen nicht einfach so rumliegen lassen dürfen. Aber ich dachte eben, sie würden erst mal unentdeckt bleiben. Heute Nacht hätte ich dann alles aufgeräumt. Jetzt wird die Gegend vor Bullen nur so wimmeln. Aber das ist noch meine geringste Sorge. Das Telefon klingelt wieder, und diesmal weiß ich verdammt genau, wer dran ist.
Kapitel 2
Uptown. Sie wollen mich in Uptown sehen. Jetzt sofort. Am helllichten Tag. Also muss ich meine Maskerade Überwerfen.
Im Winter ist es relativ unkompliziert. Man muss sich lediglich von Kopf bis Fuß vermummen, komplett mit Skimaske und Sonnenbrille. Das ist zwar nicht besonders bequem, aber einfach und unauffällig. Doch zu dieser Jahreszeit? Wenn ich nur schon in der U-Bahn wäre. Die vier Straßen bis zur Station, und die gleiche Strecke noch mal, um in Uptown bis zu ihrer Eingangstür zu gelangen ‒ das macht mir eine Heidenangst.
Ich kenne einen Typen, der eine weiße Lieferantenuniform, weiße Latexhandschuhe und einen weißen Cowboyhut mit breiter Krempe trägt. Sein Gesicht reibt er mit Zinkoxid ein. Das schützt ihn ziemlich gut vor Sonnenlicht, aber dafür starren ihm selbst in Manhattan die Leute hinterher. Ich für meinen Teil verlasse mich auf meinen Burnus.
Ich trage den Burnus über meinen Stiefeln, den weiten Hosen und dem Hemd. Der Turban ist das Schwierigste, weil ich mir nie merken kann, wie er gewickelt wird. Als ich ihn schließlich einigermaßen hinbekommen habe und nicht mehr befürchten muss, dass er mir vom Kopf rutscht, ziehe ich mir weiße Baumwollhandschuhe über, verberge mein Gesicht hinter einem Schleier, setze eine Sonnenbrille auf und wage mich nach draußen. Natürlich zieht dieser Aufzug auch Aufmerksamkeit auf sich, aber was soll’s ‒ wenigstens kann keiner mein Gesicht erkennen.
Wirkliche Sorgen macht mir die Frage, wie ich den Weg zur Haltestelle an der Kreuzung First und 14th Avenue möglichst schnell zurücklegen kann. Obwohl der weiße Stoff das Sonnenlicht reflektiert und es nur vier Scheißblocks sind, brennen mir die kurzwelligen UV-Strahlen ein Loch in den Pelz. Das ist überhaupt nicht mit den Schnittwunden von gestern Nacht zu vergleichen, die heute schon wieder verheilt sind. Sonnenlicht brennt wie die Hölle und noch Tage später schmerzt es unerträglich. Was passiert, wenn die Sonnenstrahlen auf meine nackte Haut fallen? Drücken wir es mal so aus: Ich passe verflucht gut auf, dass das nicht vorkommt. Also gehe ich schnell und denke dabei an Aloe und Eiswasser, während meine Haut langsam geröstet wird und mir hinter der Sonnenbrille die Tränen in die Augen steigen. Schließlich erreiche ich die U-Bahn-Station und eile die Treppe zum drückend heißen, aber zum Glück dunklen Bahnsteig hinunter.
Uptown will mir eine Lektion erteilen. Sie hätten mir genauso gut am Telefon den Arsch aufreißen oder zumindest bis Sonnenuntergang warten können. Doch sie wollen mich leiden sehen. Sie wollen, dass ich mich tief bücke und die Strafe für meine Schlamperei entgegennehme. Der wahre Grund für den ganzen Mist ist jedoch, dass ich mich bis heute geweigert habe, der Koalition beizutreten. Und warum? Eben weil die Koalition genau solche Scheiße abzieht. Trotzdem ‒ in der vergangenen Nacht war ich wirklich nachlässig, und jemand wird wohl oder übel seinen Kopf dafür hinhalten müssen. Also mache ich gute Miene zum bösen Spiel, lasse mich von der Sonne grillen, halte die Koalition bei Laune und bleibe am Leben. Und warum? Weil ich nicht sterben will. Komisch, und das obwohl ich bereits tot bin.
Sie haben ein Haus an der 85th zwischen dem Madison Square Garden und der Fifth. Eine wirklich wertvolle Immobilie, eins dieser anonymen Backsteingebäude, das man auf den ersten Blick für ein Konsulat oder die sehr diskrete Praxis eines Schönheitschirurgen halten könnte. Das Guggenheim und die Met liegen auch gleich um die Ecke. Schon aufgrund dieser Adresse weiß man, woran man ist. Die Bewohner sind reich, steinalt, mächtig und haben viel Sinn für Tradition, leider jedoch nicht den geringsten für Humor.
Drei Stufen führen mich zur Messingklingel. Eine Kamera beobachtet mich, während ich läute.
‒ Ja, bitte?
‒ Pitt.
‒ Wer?
‒ Joe Pitt. Ich habe einen Termin.
Ich ducke mich in den schmalen Schatten des Eingangs.
‒ Mr. Pitt? Könnten Sie bitte Ihr Gesicht der Kamera zeigen?
‒ Ist das Ihr Ernst?
‒ Mr. Pitt, ich muss Ihre Identität zweifelsfrei feststellen.
Das ist Absicht, Teil eines überaus perfiden Plans. Mit der einen Hand ziehe ich den schützenden Turban zurück, mit der anderen nehme ich den Schleier ab. Die Sonne verbrennt meine Wangen und mein Kinn. In den nächsten Tagen werde ich aussehen wie ein gekochter Hummer.
‒ Vielen Dank, Mr. Pitt.
Der Türöffner summt, und ich betrete das Foyer. Überall edles Holz und gedämpfte Farben. Das Arschloch, das mein Gesicht sehen wollte, sitzt hinter einem Rezeptionsschalter. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mich für einigermaßen gut gebaut gehalten. Falsch. Der Typ ist ein Schrank von einem Mann, neben dem ich richtig mickrig wirke. Er verlässt den Schalter und baut sich vor mir auf.
‒ Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, Mr. Pitt. Darf ich Ihnen Ihre Sachen abnehmen?
Er hängt den Burnus samt Turban an eine Garderobe. Ich betrachte mein Gesicht in dem großen Spiegel, der neben der Eingangstür hängt. Ja, ich kann mich im Spiegel sehen ‒ Überraschung. Das Tageslicht hat mir einen leichten Sonnenbrand verpasst. Wo ich den Schleier abgenommen habe, löst sich die Haut in weißen Schuppen, was Scheiße noch mal wehtut. Mr. Steroid kommt zurück und blickt mir forschend ins Gesicht.
‒ Hm. Wollen Sie vielleicht etwas Wundsalbe?
Ich starre ihn einfach an.
‒ Was ist mit Ihrem Vorgänger passiert?
‒ Bitte?
‒ Der Typ, der mich kannte. Der mein Gesicht nicht in der Kamera sehen wollte.
‒ Ach, der.
Der Kerl setzt sich wieder hinter die Rezeption. Jetzt können wir immerhin auf Augenhöhe miteinander reden.
‒ Er wurde hingerichtet.
Tja ‒ wenigstens redet er Klartext und beschönigt nichts. Seinem Vorgänger wurde weder gekündigt noch ging er in beiderseitigem Einvernehmen. Er hat’s vermasselt, und deswegen haben wir ihn nach draußen geschleppt, an Händen und Füßen auf den Boden genagelt und gewartet, bis die Sonne aufging, die ihn innerhalb von zwanzig Sekunden erledigt hat. Todesursache: Hautkrebs. Woher ich weiß, dass es sich genauso abgespielt hat? Wie gesagt, sie haben viel Sinn für Tradition. Und sie tun, was diese ihnen vorschreibt.
‒ Schade. Ich mochte ihn.
Der Riese glotzt mich nur an.
‒ Kann ich jetzt zu meinem Meeting? Nicht, dass ich es eilig hätte, aber es ist so ein herrlicher Tag und ich will das schöne Wetter genießen.
Der Riese hebt den Telefonhörer ab und drückt auf einen Knopf.
‒ Ja, er ist hier. Ja, habe ich. Vielen Dank.
Er legt den Hörer sanft auf den Apparat und deutet auf eine Tür am anderen Ende des Foyers.
‒ Einfach die Treppe hoch und dann gleich rechts.
‒ Danke.
Ich mache mich auf den Weg zur Tür, und er drückt einen weiteren Knopf, der sie für mich öffnet. Im Türrahmen drehe ich mich noch einmal um.
‒ Wer will mich überhaupt sehen?
‒ Mr. Predo wartet auf Sie, Mr. Pitt. Einfach die Treppe hoch und dann gleich rechts.
‒ Danke.
Ich lasse die Tür hinter mir zufallen. Dexter Predo. Scheiße. Predo ist Leiter der Geheimpolizei der Koalition und außerdem Parteivorsitzender. Predo hält die Disziplin aufrecht. Er entscheidet, wer mit Nägeln in Händen und Füßen in der Sonne schmort.
Im Treppenhaus hängen die Porträts verdienter Koalitionsmitglieder quer durch die Jahrhunderte. Im zweiten Stock ist ein Foto des gegenwärtigen Koalitionssekretariats angebracht. Es besteht aus zwölf Mitgliedern und einem Premierminister. In Wahrheit handelt es sich jedoch größtenteils um dieselben Typen, die auch auf den Ölbildern zu sehen sind. Das Sekretariat ist nicht gerade für häufigen Personalwechsel bekannt. Dexter Predos Bild ist nirgendwo zu sehen. Er zieht es vor, sich im Hintergrund zu halten.
Es gibt noch drei weitere Stockwerke, die ich jedoch noch nie betreten habe. Darauf bin ich auch nicht besonders scharf. Die oberen Stockwerke sind den Mitgliedern der Koalition vorbehalten. Insofern ist es schon eine Ehre für mich, nicht im Keller empfangen zu werden. Ich klopfe an die erste Tür zu meiner Rechten.
‒ Herein.
Predos Büro ist so bescheiden wie nur möglich gehalten. Natürlich sind alle seine kleinen Kunstgegenstände unbezahlbar, aber selbst wenn die Jalousien nicht geschlossen wären, hätte er keine besonders beeindruckende Aussicht auf den Park. Er zieht einen Ordner aus einem Aktenschrank. Dreimal darf ich raten, wessen Akte es ist.
‒ Pitt.
‒ Mr. Predo.
‒ Bitte kommen Sie herein. Nehmen Sie Platz.
Ich könnte beim besten Willen nicht sagen, wie alt Predo wirklich ist. Er sieht aus wie fünfundzwanzig, war aber schon lange vor meiner Geburt im Geschäft. Er blickt von der Akte auf, bemerkt, dass ich noch immer stehe, und deutet auf einen Stuhl vor seinem Schreibtisch.
‒ Setzen Sie sich, Pitt, setzen Sie sich. Machen Sie es sich gemütlich.
Ich setze mich, aber gemütlich ist es nicht. Was nicht nur daran liegt, dass der Stuhl viel zu klein ist. Predo bleibt stehen und blättert weiter in der Akte.
‒ War eine harte Sache letzte Nacht, oder?
‒ Ja.
‒ Sie hatten nicht die Möglichkeit, den Schaden zu begrenzen?
‒ Hatte ich nicht.
‒ Sie hätten sich die Zeit nehmen sollen, die Beweise zu vernichten.
Ich starre für einen Augenblick auf meinen Schoß. Er tippt mit dem Aktendeckel gegen den Schrank, um mich aus meinen Gedanken zu reißen.
‒ Wieso haben Sie die Beweise nicht vernichtet?
‒ Es passierte mitten in einem Wohnviertel, Mr. Predo. Wenn ich die Schule angezündet hätte, hätte es auch die umliegenden Häuser erwischt. Bird und die Society wären sofort über mich hergefallen. Außerdem war eins der Opfer noch am Leben.
‒ Terry Bird und sein Gesindel haben mir gar nichts zu sagen. Und was den Studenten angeht: Das ist genau der Beweis, von dem ich spreche, Pitt.
Mir fällt auf, dass ich immer noch meine weißen Baumwollhandschuhe trage. Ich ziehe sie aus. Von den Schnittwunden an meiner linken Hand sind inzwischen nur noch dünne weiße Narben geblieben. Bis zum Abend werden sie völlig verschwunden sein. Predo verliert langsam die Geduld.
‒ Abgesehen davon hätten Sie etwas inszenieren können. Einen Mord mit anschließendem Selbstmord vielleicht.
‒ Und wer hätte in dem Fall der Selbstmörder sein sollen, wenn ich fragen darf? Einer von den Typen, denen ich das Genick gebrochen habe, das Mädchen mit dem Messer im Hirn oder der Student mit dem kaputten Schädel?
Predo schließt den Aktenschrank und stellt sich hinter seinen Schreibtisch.
‒ Die eigentliche Frage ist ja wohl, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Warum haben Sie dieses Ungeziefer nicht auf weniger spektakuläre Art eliminiert?
‒ Ein Studentenhirn hatten sie schon verdrückt. Hätte ich warten sollen, bis sie auch noch das zweite verschlungen haben? Ich musste die Dinger angreifen, solange sie noch beim Fressen waren. Sie haben sich verteidigt, und die ganze Sache ist mir ein wenig aus dem Ruder gelaufen. Aber gut, nächstes Mal sollen Sie den anderen Studenten haben.
‒ Aus dem Ruder gelaufen ist genau der passende Ausdruck, Pitt. Ja, die Sache ist Ihnen tatsächlich aus dem Ruder gelaufen, und sie droht sogar, es noch mehr zu tun. Die Polizei hat sich eingeschaltet, und, was noch schlimmer ist, die Presse. Blutige Morde mit einem Beigeschmack von Satanismus und Übernatürlichem ‒ da kann die Meute einfach nicht widerstehen. Das dürfen wir nicht zulassen, Pitt. Wir müssen die ganze Sache vertuschen, bevor sie noch höhere Wellen schlägt. Genau diese Art von Ärger wollen wir vermeiden. Deswegen haben wir Sie engagiert. Deshalb tolerieren wir Ihre Unabhängigkeit. Stimmt es, dass es einen Überträger gibt? Und dass es Ihnen nicht gelungen ist, ihn auszuschalten?
Philip, das Arschloch. Hätte ich mir gleich denken können. Der Vollidiot ruft ja nicht einfach aus reiner Nächstenliebe an.
‒ Ich werde mich heute Nacht darum kümmern.
‒ Und wie gedenken Sie das anzustellen, Pitt? Inzwischen wimmelt es dort nur so von Polizisten, Reportern und anderen Neugierigen.
‒ Ich kümmere mich darum.
Predo starrt mich an. Er wirft die Akte auf den Schreibtisch und setzt sich.
‒ Das müssen Sie auch. Heute Nacht und keinen Tag später.
Ich warte.
‒ Wir haben immerhin schon einen Sündenbock.
‒ Aber es gab einen Zeugen. Wie wollen Sie ihn von seiner Aussage abbringen?
‒ Das müssen wir gar nicht, Pitt. Der Zeuge ist unser Sündenbock.
Ich schließe die Augen.
‒ Der junge Mann, dem Sie das Leben gerettet haben, wird uns seinerseits einen Gefallen erweisen: Er wird für diese schreckliche Bluttat den Kopf hinhalten. Natürlich nicht freiwillig. Die von uns fingierten Beweise werden ihn noch im Laufe des Tages als Hauptverdächtigen dastehen lassen. Aber damit dieser Plan aufgeht, darf es keine weiteren Zwischenfälle mehr geben.
Ich öffne meine Augen wieder und schaue ihn an. Er hebt den Zeigefinger.
‒ Zeigen Sie uns, was Sie können, Pitt, und worin Ihr Wert für die Koalition besteht. Seien Sie nützlich und erregen Sie keinen Verdacht. Eliminieren Sie den Überträger.
Ich stehe auf.
‒ Ich bin mehr als nur nützlich. Ich halte mein Viertel sauber und beseitige den ganzen Mist, mit dem sich die Clans nicht die Hände schmutzig machen wollen. Also, solange Sie keinen anderen Idioten gefunden haben, der sich jenseits der 14th um Ihren Scheiß kümmert, würde ich sagen: Bleiben Sie mir vom Leib.
Ich gehe zur Tür.
‒ Das werden wir. Aber auf eines können Sie sich verlassen, Pitt: Dass wir Ihr kleines Missgeschick von gestern Abend vertuschen mussten, hat seinen Preis.
‒ Sicher doch, alles hat seinen Preis.
Ich öffne die Tür.
‒ Pitt? Da wäre noch etwas.
Ohne mich umzudrehen bleibe ich in der Tür stehen.
‒ Wie ich erfahren habe, wurde der Student zur Ader gelassen. Jemand hat ihm Blut abgezapft. Reichlich merkwürdig für einen Zombie, finden Sie nicht?
Ich stehe einfach nur da.
‒ Wissen Sie noch, was Ihre Mutter Ihnen beigebracht hat? Immer brav deinen Teller leer essen.
Ich verlasse das Büro und schließe die Tür hinter mir.
Natürlich hat er recht. Den Typen erst anzuzapfen und dann noch am Leben zu lassen war ganz schön bescheuert. Genauso gut hätte ich ein Schild aufstellen können: FUTTERSTELLE FÜR VAMPYRE ‒ KOMMT UND TÖTET UNS. Natürlich denken die meisten Leute, die von solchen Sachen hören, dass es sich um die Taten eines durchgeknallten Freaks handelt. Aber es gibt auch ein paar da draußen, die ganz genau wissen, woher der Wind weht. Und die wollen wir auf keinen Fall aufscheuchen. Deshalb ist es auch so schwierig, in mein Apartment zu gelangen.
Ich wohne in der 10th Avenue zwischen der First und der A. Nachdem ich einen Code eingetippt habe, um von der Straße aus in die Eingangshalle zu gelangen, muss ich eine weitere Tür zum Treppenflur des Gebäudes aufschließen. Der Eingang zu meiner Wohnung befindet sich gleich auf der linken Seite. Er sieht ganz normal aus, besteht aber aus einer massiven Stahltür, die ich mal irgendwo aufgegabelt habe. Ich musste den Türrahmen mit Querträgern verstärken, damit er ihr Gewicht aushält. Aber den Aufwand war es wert. Wenn jemand in meine Wohnung eindringen will, wäre der einfachste Weg wohl durch die Wand.
Ich öffne die drei Schlösser, alle in der richtigen Reihenfolge, sonst wird ein Alarm ausgelöst. Dann schließe ich die Tür hinter mir, sperre sie ab und gebe einen fünfstelligen Zahlencode in ein kleines Tastenfeld ein, um die Alarmanlage erneut zu aktivieren. Den Alarm kann niemand hören, weder die Nachbarn noch die Polizei. Ich auch nicht. Nur der Piepser, den ich unterwegs ständig bei mir trage, würde anfangen zu vibrieren. Wäre ich zu Hause, würde ich einfach abwarten, den Einbrecher töten und sein Blut trinken. Das ist meine Art, so ein Problem zu lösen.
Durch einen kurzen Flur gelangt man ins Wohnzimmer. Den Burnus werfe ich auf die Couch. Ich will duschen, tue das aber nicht im Badezimmer zu meiner Linken. Stattdessen bücke ich mich an einer bestimmten Stelle im Wohnzimmer, hebe ein Holzbrett aus dem Parkett und ziehe an dem Stahlring, der darunter versteckt ist. Ein große Klappe im Boden öffnet sich, unter der eine kleine Wendeltreppe einen Stock tiefer führt. Ich gehe hinunter und schließe sie wieder über mir.
Jetzt bin ich in einem Kellerappartement, das ich unter anderem Namen angemietet habe. Und hier wohne ich wirklich. Ich habe ein Bett, ein Badezimmer, einen Minikühlschrank, eine Kochplatte, einen Computer, Stereoanlage, Fernsehgerät und DVD-Player. Die Wohnungstür hier unten ist nicht ganz so ausgetüftelt. Ich habe sie lediglich fest an den Türrahmen genagelt und in der unteren Hälfte eine Klappe angebracht. Sollte jemand in die obere Wohnung eindringen, mit dem ich mich lieber nicht anlegen will, dann schlüpfe ich durch die Klappe hinaus. Das kleine Fenster auf Straßenhöhe habe ich vermauert, damit sich kein Möchtegern-Van-Helsing einschleichen und mich grillen kann, während ich schlafe.
Ich lasse mir ein Bad ein. Während das Wasser läuft, verschaffe ich mir einen Überblick über meine Vorräte. Sie sind in einem weiteren Kühlschrank, der mit einem Vorhängeschloss gesichert ist: Noch ungefähr sechs Liter, mit eingerechnet das, was ich mir letzte Nacht besorgt habe. Kein schlechter Vorrat, mehr als genug für einen Monat. Aber wie jeder erfahrene Junkie versuche ich immer eine eiserne Reserve für Notzeiten im Haus zu haben. Eigentlich bräuchte ich im Moment nichts, weil mich ja letzte Nacht der Student versorgt hat. Aber es würde helfen, die Verbrennungen schneller zu heilen, außerdem kann ich es mir ja leisten. Also nehme ich einen der Halbliter-Plastikbeutel und setze mich in die mit kaltem Wasser gefüllte Wanne.
Mein ganzer Körper ist dunkelrosa, fast rot. Mein Gesicht hat die Farbe eines Feuerwehrautos und die Haut löst sich ab. Ich nehme einen Schluck Blut, und mein Körper entspannt sich. Ich fühle, wie es meine Kehle hinabrinnt und das Adrenalin kribbelnd durch meine Adern fährt. Das Vyrus, das mich zu dem gemacht hat, was ich bin, kolonisiert sofort das frische Blut. Meine Schmerzen lassen augenblicklich nach, und ich kann fast mit bloßem Auge erkennen, wie die Verbrennungen verheilen. Ich schließe die Augen, schlürfe das Blut, denke an die Zombies und überlege mir, wie ich diesen ganzen Schlamassel zügig wieder bereinigen kann.
Ich bin nicht wirklich scharf drauf, Zombies zu killen. Um Himmels willen. Aber bevor ihre Körper endgültig verrottet sind, hat man nur Ärger mit ihnen. Es wäre keine gute Idee, sie einfach frei rumlaufen zu lassen, damit sie Aufmerksamkeit auf sich lenken. Letzte Woche hatte ich zum ersten Mal den Verdacht, dass ein Überträger unterwegs sein könnte.
Kurz nach Sonnenuntergang sitze ich im Tompkins-Park, rauche eine und genieße den drückend heißen Sommerabend. Ich mache genau den Scheiß, den normale Leute so machen. Ich hatte keinen Job, keine Botengänge für die Koalition oder die Society zu erledigen, und auch nicht das Bedürfnis, für jemand den guten Samariter zu spielen. Ich habe also nichts Besseres zu tun, als eine meiner Luckies zu rauchen und mir zu überlegen, ob ich mir vom Eiswagen gegenüber eine Portion holen soll. Da torkelt der Penner an mir vorüber. Er stinkt erbärmlich, aber das ist ja nichts Besonderes. Alle Penner stinken, und die meisten sind noch dazu Junkies, Freaks und nicht gerade sicher auf den Beinen. Aber was mich stutzig macht, ist das blutige Loch, das jemand in seinen Hinterkopf genagt hat.
Ich springe auf, lege meinen Arm um die Schulter des Penners und führe ihn in eine dunkle Ecke des Parks. Sein Kopf bewegt sich ruckartig hin und her. Er fletscht die Zähne, als wolle er mir die Rübe abbeißen. Aber das, was von seinem Hirn übrig ist, reicht höchstens dazu, ihn noch ein paar Tage auf den Beinen zu halten. Mir wird er nicht mehr gefährlich werden. Sobald wir weit genug von den Hundebesitzern und Basketballspielern entfernt sind, setze ich ihn auf eine Bank und untersuche seinen Hinterkopf. Wer auch immer ihn geöffnet hat, ging nicht gerade zimperlich vor. Es sieht nicht so aus, als hätte er irgendein Werkzeug benutzt. Höchstens einen Stein. In der Öffnung stecken sogar noch ein paar Zähne.
Zombies fressen Hirne. Das ist ihre Raison d’Etre, das, was sie am Laufen hält. Oder, besser gesagt, damit halten sie das Bakterium am Leben, das sie immer weiter und weiter antreibt.
Sie ernähren sich auf zwei unterschiedliche Arten: Bei der klassischen Methode fressen sie das Hirn und alles, was sonst noch lecker aussieht, und lassen eine Leiche zurück. Das ist nicht so schlimm. Zombies haben sowieso ein kurzes Verfallsdatum. Das Bakterium zersetzt ihren Körper in Windeseile. Der durchschnittliche Zombie frisst ein paar Leute und verfault. Er hält nicht länger als ein paar Wochen durch. Der schlimmere Fall tritt dann ein, wenn ein Zombie bei seiner Mahlzeit gestört wird und sein Opfer mit genug Hirnmasse zurücklässt, sodass es umherlaufen und Ärger machen kann. Wie der Typ hier vor mir. Ein wandelnder Essensrest. Aber manchmal hat man es auch mit einem Überträger zu tun, einem Zombie, der sein Opfer nur beißt, aber nicht auffrisst. Warum er das tut? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Um Angst und Schrecken zu verbreiten? Um die Zombiejäger zu verwirren? Weil er Gesellschaft haben will? Vielleicht, um noch mehr Zombies zu schaffen? Aber wen interessiert’s? Himmelarsch, es sind Zombies, und wenn sie irgendwo auftauchen, muss man sie schleunigst vernichten. Sonst richten sie nur Schaden an, hinterlassen überall eine Riesensauerei und ziehen unnötige Aufmerksamkeit auf sich. Und das Letzte, was wir wollen, ist das Interesse der Öffentlichkeit. Und mit wir meine ich dabei nicht die Untoten und Verdammten. Ich meine die Vampyre, Leute wie mich, die mit dem Vyrus infiziert sind. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich habe also diesen halb aufgefressenen Penner vor mir. Könnte auf einen Überträger hindeuten, könnte aber auch nur ein normaler Zombie gewesen sein, der seine Beute hat entkommen lassen. Wie dem auch sei, der Typ wird noch eine Weile durch die Gegend spazieren, bis er verfault oder jemand die klaffende Wunde in seinem Kopf bemerkt, die ja nicht gerade unauffällig ist. Ich habe also zwei Möglichkeiten. Die Wunde ist frisch, sehr frisch sogar. Mit ein bisschen Aufwand könnte ich die Duftspur des Penners zurückverfolgen, bis ich auf die des Überträgers stoße, den Bastard aufspüren und die Sache sofort erledigen. Oder ich nehme mir die Zeit und werde erst den Clown hier los, bevor er Aufsehen erregt. Ich entscheide mich schließlich für die zweite Variante, weil es die klügere zu sein scheint. Immer hübsch eins nach dem anderen. Ich tue einfach das, was mir am naheliegendsten erscheint.
In der Tasche des Penners finde ich ein dreckiges Kopftuch und wickle es ihm um den Schädel. Dann ziehe ich ihn hoch, lege erneut meinen Arm um ihn und führe ihn in Richtung Osten. Ich schwanke etwas, so als wären wir zwei Saufkumpane, die an einem Dienstagabend einen kleinen Spaziergang machen. Wir gehen den ganzen Weg bis zum East River Park. Dort setze ich ihn auf eine Bank am Flussufer und hole ein paar Steine aus dem Gebüsch hinter uns.
Bald wird es dunkel sein. Die Leute joggen oder fahren mit dem Fahrrad oder auf Rollerblades vorbei, auf ihrem Weg nach Hause. Der Penner macht ein paar Versuche, sich einen von ihnen zu schnappen, aber seine motorischen Fähigkeiten reichen nicht mehr für diese durchtrainierte Beute.
Es ist fast rührend zu beobachten, wie der arme Trottel schnattert und sabbert, während er zuckend nach den nylonbekleideten Gestalten schnappt, die an ihm vorbeirauschen. Fast möchte ich einem der Yuppies ein Bein stellen, um seinen Gesichtsausdruck zu beobachten, während der Clown auf seinen Rücken springt und in seinen Skalp beißt. Aber da spricht nur der Reaktionär in mir ‒ die Scheißyuppies ruinieren eben mein Viertel.
Ich nehme die Steine, trage sie zur Bank zurück und fülle die Taschen des Penners damit. Er schnappt nach meinem Kopf und versucht, mich zu beißen. Ich schlage seine Hände beiseite und drücke ihn gegen die Bank wie ein zappeliges Kind, das man für die Schule anziehen will. Bald darauf sind seine Taschen mit Steinen gefüllt. Ich ziehe ihn auf die Beine und führe ihn zum Geländer, das den Gehweg vom Fluss trennt. Wir stehen da, als würden wir die Aussicht auf Queens und das Domino-Sugar-Firmenschild genießen. Als kein Jogger mehr in Sichtweite ist, umschlinge ich seine Taille, lehne mich nach vorne und befördere ihn mit einem kleinen Hüftschwung über das Geländer. Mit einem lauten Platschen fällt er ins Wasser. Ob er noch ein Geräusch von sich gibt, bevor ihn die Steine nach unten ziehen, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Hat er etwas gefühlt? Geriet er in Panik, als das Wasser seine Lungen füllte? Vielleicht. Ich kriege keine Sonderprämie für humanes Töten. Ich habe getan, was getan werden musste. Als er nicht wieder auftaucht, überquere ich die Fußgängerbrücke über den FDR und nehme mir ein Taxi zurück zum Tompkins-Park. Die Duftspur des Penners führte von dort zu einer kleinen öffentlichen Grünanlage nähe der 12th, wo ich sie dann aber inmitten der Blumen, Pflanzen, Kinder und Familien verlor.
Wie dem auch sei: So bin ich in diese Scheiße geraten. Indem ich lediglich versucht habe, das Naheliegendste zu tun.
Kapitel 3
Nachdem ich aus Uptown zurück bin und mein Bad genommen habe, strecke ich mich auf dem Bett aus, um den verlorenen Schlaf nachzuholen. Aber der Sonnenbrand und der Anschiss, den ich gerade von Predo bekommen habe, lassen mir keine Ruhe. Es gibt so viele von Predos Sorte: meine Pflegeeltern, die Typen vom Jugendamt, die Bullen. Alles nur Arschlöcher, die darauf versessen sind, einen in die Schranken zu verweisen. Und was mache ich? Jedes Mal, wenn mir einer dieser Ärsche sagt, ich soll mich hinsetzen, den Mund halten oder sonst was tun oder lassen, platzt mir einfach der Kragen und ich rede mich noch tiefer in die Scheiße.
Apropos Predo: Offensichtlich wusste er bereits von dem Überträger; und zwar früh genug, um ein paar Leute loszuschicken, die die ganze Sache für ihn hinbiegen sollten. Und da fällt mir Philip ein. Im Halbschlaf habe ich mich verplappert und ihm vom Überträger erzählt. Warum hat er mich überhaupt angerufen? Irgendwie hat er Wind davon bekommen, dass ich in der Scheiße stecke. Vielleicht ist er mir gefolgt und hat noch einen Teil der Show von gestern Nacht mitbekommen.
Philip ist ein Haufen Scheiße. Er ist ein schleimiges Frettchen, das dauernd in der Nähe der Clans oder der Unabhängigen abhängt. Das gibt ihm das Gefühl, irgendwie zu einer exklusiven Gesellschaft zu gehören. Vor dreißig Jahren wäre er den Türstehern vom Club 54 in den Arsch gekrochen. Selbstverständlich hat er weder eine offizielle Position noch irgendwelche Beziehungen. Er wäre gern infiziert, ist sogar richtig geil auf das Vyrus, aber da spielen die Clans nicht mit. Und eine der kleineren, unberechenbaren Gruppen traut er sich nicht zu fragen, dazu ist er zu feige. Wenn denen ein Renfield wie Philip über den Weg läuft, sagen sie erst klar doch, und kurz darauf findet er sich tot und ohne Blut im Fluss treibend wieder.
Von der Koalition wird er zumindest geduldet. Er ist unterwürfig und nimmt für ein bisschen Kohle jede Drecksarbeit an. Sachen, die sogar ich ablehnen würde. Wohlgemerkt, er ist kein vollendeter Renfield. Aber der einzige Grund, warum dieser spindeldürre, pillenschluckende Speed-Freak noch keine Käfer frisst, ist, dass sie für ihn immer noch zu sehr nach Essen aussehen.
Seine Verbindungen zur Koalition sind das Einzige, was mich davon abhält, ihm den Kopf abzureißen, sollte ich ihn zwischen die Finger bekommen.
Dabei ist die Koalition nicht mein einziges Problem. Bis jetzt hat sich die Society noch nicht gerührt, aber sollten Terry Bird und seine Jungs herausfinden, dass ich da mit drinstecke, ist die Kacke am Dampfen. Und früher oder später wird er es herausfinden. Terry weiß alles, was unterhalb der 14th Avenue passiert.
Nachdem die Sonne untergegangen ist, reibe ich meine Verbrennungen mit Aloe ein und ziehe mir eine saubere Jeans und ein weites schwarzes Hemd an. Dann schalte ich den Fernseher ein, und wer ist zu sehen? Der Student von letzter Nacht ‒ der, dessen Hirn nicht gefressen wurde.
Er wird von ein paar Bullen zum Gerichtssaal geführt. Presseleute stürmen von allen Seiten auf ihn ein. Sein Name ist Ali Singh. Er ist einundzwanzig Jahre alt und studiert Marketing an der NYU. Ali wird beschuldigt, ein paar der Morde von vergangener Nacht begangen zu haben. Die Polizei vermutet, dass die anderen auf das Konto seiner Opfer gehen. Ihrer Meinung nach handelt es sich um eine Art rituellen Kannibalen-Mord-Selbstmord-Pakt. In Alis Studentenbude wurden neben der Tatwaffe mit seinen Fingerabdrücken auch satanistisches Material und Trophäen von seinen Opfern gefunden.
Ali blickt ausdruckslos in die Kameras. Er scheint unter Drogen zu stehen. Das Blitzlicht der Fotografen leuchtet ihm direkt in die leblosen Augen.
Es wird nicht länger als zwei Wochen dauern, bis er selbst davon überzeugt ist, es getan zu haben. Nach ein paar weiteren Wochen wird die Verteidigung auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren, und Ali wird den Rest seines Lebens in der Klapse verbringen. Hätte schlimmer kommen können. Hätte auch mich erwischen können.
Ich schalte die Glotze aus und schlendere zum Niagara an der Ecke Seventh und A. Es ist neun Uhr, und der Schuppen ist leer. Die Trendsetter aus dem East Village werden frühestens in einer Stunde eintrudeln.
Hinter der Theke steht ein Typ namens Billy. Seit neun oder zehn Jahren arbeitet er in allen möglichen Bars im Village. Er hält mich für eine Art Schläger, der auf Abruf Arme verbiegt und Privatdetektivkram erledigt. Vor einiger Zeit arbeitete ich als Türsteher in einem Schuppen namens Roadhouse, und Billy stand dort hinter der Bar. So lernten wir uns kennen.
Billy kommt den Tresen entlanggeschlendert. Er sieht gut aus, Mitte dreißig, Hosen aus feinem Kammgarn, zweifarbige Slipper, ein seidenes Hawaiihemd. Sein Haar ist zurückgekämmt, und auf seinen Unterarmen trägt er Tätowierungen von Würfeln, Billardkugeln und Schönheiten im Bikini zur Schau. Und so schmierig Billy auch sein mag, gehört er bei weitem noch nicht zu den Schmierigsten, die sich bis Mitternacht in dieser Kaschemme einfinden werden.
‒ Joe! Was geht ab?
Als er mich sieht, bleibt er stehen.
‒ Verdammt! Was ist denn mit deiner Scheißfresse passiert?
‒ Solarium. Kann echt gefährlich sein.
Er blinzelt. Ein Grinsen umspielt seine Mundwinkel.
‒ Echt?
‒ Echt. Die Hersteller wollen es vertuschen, aber in Bräunungsstudios sterben jährlich fast so viele Menschen wie im Straßenverkehr.
‒ Kein Scheiß?
‒ Um ein Haar hätt’s mich erwischt, Mann.
Er betrachtet noch einmal die Verbrennungen in meinem Gesicht und nickt.
‒ Quatsch.
‒ Dann war’s die Höhensonne.
Er kneift die Augen zusammen. Ich hebe meine Rechte wie zum Schwur. Er schüttelt den Kopf.
‒ Hey, Mann, wenn du nicht willst, musst du’s nicht erzählen. Aber, hey, verarsch mich nicht.
Ich hatte schon immer Probleme damit, Billy richtig zu verstehen. Ich habe keine Ahnung, wo er herkommt. Er sagt, er wäre in Queens geboren und aufgewachsen, aber er hört sich mehr nach einem Frankokanadier an, der in Boston groß geworden ist.
Ich gebe auf und zucke nur mit den Achseln.
‒ Also gut. War ein Haushaltsunfall. Wirklich. Ich bin mit dem Kopf in der Mikrowelle eingeschlafen.
Lachend wischt er die Theke mit dem Lappen ab, der immer in seinem Gürtel steckt.
‒ Hat wohl auch dein blödes Hirn verschmort, wie? Was kann ich dir bringen?
Blut.
‒ Einen Bourbon. Was immer auf deinem Regal steht.
‒ Ein Heaven Hill, kommt sofort.
Er füllt ein Schnapsglas mit Whiskey. Ich schaue mich um. Das Niagara besteht aus dem Barraum und einem größeren Nebenzimmer, das erst geöffnet wird, wenn genügend Gäste und entsprechendes Personal da sind. Von Philip ist nichts zu sehen. Billy stellt das Glas vor mir ab.
‒ Bitteschön, Mr. Marlowe. Ein billiger Bourbon. Geht aufs Haus.
‒ Danke. Hast du Philip gesehen?
‒ Nö. Aber der kommt bestimmt noch.
‒ Wenn du ihn siehst, sag’ ihm nicht, dass ich ihn suche.
Billy nickt.
‒ Geht klar. Schuldet er dir Geld oder so was?
‒ Oder so was, ja.