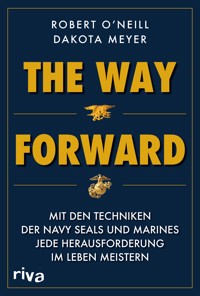
15,99 €
Mehr erfahren.
Ex-Navy-Seal Robert O'Neill wurde bekannt als der Mann, der Osama bin Laden tötete. Ex-Marine Dakota Meyer bekam zu Lebzeiten die Medal of Honor verliehen. In The Way Forward erzählen sie von ihren höchst riskanten Einsätzen in Afghanistan und im Irak – und vermitteln tiefe Einblicke in ihr unerschütterliches Mindset, das ihnen half, in Sekundenschnelle die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn es um Leben und Tod ging. Auf zutiefst inspirierende Weise verraten die beiden US-Elitesoldaten, welche mentalen Strategien sie auch nach ihrer Dienstzeit anwandten, um kritische Situationen zu überstehen und persönliche Krisen zu bewältigen. The Way Forward ist ein spannendes und aufrichtiges Militärmemoir, das zugleich offenbart, wie wir uns unseren inneren Dämonen und Ängsten stellen können und mit welchen Routinen wir alle Herausforderungen im Leben meistern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
ROBERT O’NEILL DAKOTA MEYER
THE WAY
FORWARD
ROBERT O’NEILL DAKOTA MEYER
THE WAY
FORWARD
MIT DEN TECHNIKEN DER NAVY SEALS UND MARINES JEDE HERAUSFORDERUNG IM LEBEN MEISTERN
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
1. Auflage 2023
© 2023 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2022 bei Dey Street Books unter dem Titel The Way Forward: Master Life’s Toughest Battles and Create Your Lasting Legacy. © 2022 by Robert J. O’Neill and Dakota Meyer. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Kimiko Leibnitz
Redaktion: Rainer Weber
Umschlaggestaltung: Karina Braun
Satz: Daniel Förster
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-7423-2389-7
ISBN E-Book (PDF) 978-3-7453-2142-5
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-2143-2
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter: www.m-vg.de
»Ich bin nur ein Arschloch, das für Geld noch größere Arschlöcher fertigmacht.«
Deadpool
»Es gibt eine Zeit, um nachzudenken, und eine Zeit, um zu handeln. Und das, meine Herren, ist nicht die Zeit, um nachzudenken.«
John Candy, Unsere feindlichen Nachbarn
Inhalt
Prolog
Teil Eins Vorbereitung
1 AMERICAN BOYS
2 IM VISIER
3 Finde deine Helden
4 ABSCHIED
Teil zwei Dienst
5 LEHRZEIT
6 MACH DIE AUGEN AUF
7 IN DER SCHEISSE
8 VERBINDE DICH MIT ANDEREN
9 RUHM UND EHRE
10 HEIMKEHR
11 GENESUNG
12 ERSCHAFFE DEINEN ZIRKEL
13 SEI ALLZEIT BEREIT
Danksagung
Anmerkungen
Über die Autoren
Prolog
Rob und Dakota
Die M18A1-Claymore-Mine ist ein Wunderwerk von bestechender Einfachheit. Sie ist etwa 22 Zentimeter lang, 4 Zentimeter breit und hat 4 dünne Metallbeine, die wie aufgestellte Scheren aussehen und sich zusammenklappen lassen. Oben sind eine Visierung und zwei Zündkanäle für die Sprengkapsel oder Zündschnur angebracht. Im olivgrünen Gehäuse befinden sich ungefähr 700 Stahlkugeln und ein knapp 700 Gramm schweres Stück C4-Plastiksprengstoff. Wenn eine Claymore-Mine gezündet wird, verteilen sich diese Stahlkugeln fächerförmig in alle Richtungen. Diese stählerne Explosion ist bis zu einer Distanz von 50 Metern am effektivsten, kann einen Feind aber auch in 350 Metern noch treffen. Früher oder später lernt jeder Infanterist die Handhabung dieser Mine.
Claymores wurden nach dem Zweiten Weltkrieg ins Arsenal der US-Streitkräfte aufgenommen. Sie wurden als Verteidigungswaffe gegen leichte Infanterie entwickelt, die in Wellen angriff, so wie es amerikanische GIs in Korea erlebten. Damit diese Minen detonieren können, müssen sie auf bestimmte Weise vorbereitet und gezündet werden. Das Völkerrecht erlaubt ihre Verwendung nur, wenn sie ein Soldat bedient; sie dürfen nicht automatisch ausgelöst werden, etwa durch einen Stolperdraht oder eine Druckplatte, damit Zivilisten und andere Unschuldige nicht versehentlich verstümmelt oder getötet werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Minen ist sie eine sogenannte Richtmine, das heißt, dass man mit ihr zielen kann. Hierfür gibt es eine sehr einfache Anleitung, die auf der Vorderseite in geprägten Buchstaben prangt:
Vorderseite zum Feind
Falls es nicht naheliegend sein sollte: Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Mine in die richtige Richtung zeigt. Mit ihrer Reichweite von 250 Metern will man nicht auf der falschen Seite der Claymore stehen, wenn sie hochgeht. Und so sorgt die Army mit sehr einfachen, unmissverständlichen Worten dafür, dass es praktisch unmöglich ist, einen Fehler zu machen. Fehler können trotzdem passieren. Das tun sie immer. So wurde die Claymore auf eine weitere Weise betriebssicher gemacht. Das Gehäuse ist gebogen, der Anwender ist also selbst in völliger Dunkelheit in der Lage, die Vorder- bzw. Rückseite der Mine zu identifizieren, indem er sie an seine Stirn legt und gegebenenfalls umdreht. Und falls das immer noch nicht genug sein sollte, steht auf der Rückseite des Gehäuses:
Rückseite
Die Anweisungen auf der Claymore sind im Kampfeinsatz nützlich, aber sie sind auch außerhalb des Schlachtfeldes eine einfache Lebensmaxime. Wenn man einfache Anweisungen befolgt und sich strikt an sie hält, verhindert man, dass man sich selbst oder die Menschen, die man liebt, verletzt. Man hält seine Waffe immer in die richtige Richtung. Man sorgt dafür, dass die eigene Umgebung sicher bleibt.
In ähnlicher Weise ist dieses Buch kein Handbuch der Kriegsführung oder ein Leitfaden, wie man im Gefecht einen kühlen Kopf behält. Es geht um die vielen anderen Dinge, die vor, während und nach dem Kampf passieren. Es geht darum, was erforderlich ist, um unversehrt Konflikte zu überstehen und am Leben zu bleiben. Es geht darum, ruhig und geerdet zu bleiben. Es geht darum, sich seinen Feinden zu stellen. Feinde aus Fleisch und Blut, aber auch immaterielle Feinde. Gedanken. Zweifel. Langeweile. Dinge, die man bedauert.
Es gibt einen Grund, warum die Claymore-Mine und ihre Aufschrift eine Art Fangemeinde in den Streitkräften haben und ein Credo für uns und Tausende von anderen Soldaten auf dem Schlachtfeld und jenseits davon geworden sind. Ihr Name ist Teil ihrer Mythologie; sie ist nach dem schottischen Claymore-Schwert benannt, das die Vorfahren des Entwicklers der Mine einst nutzten, um in den schottischen Highlands eine Schneise in die heranstürmenden Feinde zu schlagen. Die Mine, wie es sie heute gibt, kam mit tödlicher Effektivität in Vietnam zum Einsatz. Die Special Forces verwenden in ihren Missionen eine Mini-Version. Wir hoffen, dass dieses Buch so einfach und informativ sein wird wie jene geprägten Plastikbuchstaben. Und dass Ihnen dieses Buch, wie das Claymore-Schwert, helfen wird, die Hindernisse zu überwinden, die sich Ihnen in den Weg stellen. Wir hoffen außerdem, dass Humor eine ebenso wirksame Waffe ist und dass Sie beim Lesen das eine oder andere Mal schmunzeln werden.
Rob
Über die Jahre, in denen ich in den SEAL-Teams diente, entwickelte ich einige Perspektiven, wie man sein Leben führt, das heißt, wie man es in über 400 Missionen schafft, nicht getötet zu werden. Sie sind nicht kompliziert und leicht zu merken. Alles möglichst einfach halten. Sich an die Regeln halten. Nicht nachlässig werden. Sein Bestes geben, bis man fertig ist, und dann weitermachen und nicht zurückblicken. Sich seinem Gegner stellen. Vorderseite zum Feind.
Mein erster Kontakt mit Claymores war in der Phase »Landkriegsführung« im Basic Underwater Demolition/SEAL Training (BUD/S). Wir befassten uns im theoretischen Unterricht mit diesen Minen, mussten entsprechende Prüfungen ablegen und hatten auf der Insel San Clemente Praxiseinheiten, in denen wir inaktive Claymores verwendeten. Die Claymore-Attrappen hatten ein blaues Plastikgehäuse, wodurch sie von den echten, olivfarbenen Exemplaren leicht zu unterscheiden waren.
Bevor ich meinen Dreizack erhielt, schickten mich die Teams im Frühjahr 1997, es muss im April gewesen sein, zu einem dreizehnwöchigen Kurs namens SEAL Tactical Training oder STT. Nach drei Wochen Tauchtraining in Puerto Rico verbrachten wir den Rest der Zeit in Fort A. P. Hill in North Virginia. Der Lehrgang ging auf alle Aspekte der Landkriegsführung ein: Navigation mit Karte und Kompass, Patrouillieren, Schießtraining mit allen Waffen, die SEALs zur Verfügung stehen, sowie auch der Umgang mit Sprengstoffen. Ein Master Chief namens Frank Wagner leitete das Ganze. Er war ein Vietnam-Veteran und trug den Spitznamen »Pig« (Schwein). Ich habe keine Ahnung, warum Master Chief Wagner »Pig« genannt wurde, aber eins wusste ich: Er leitete den Ort so, wie er es beabsichtigte.
Am Anfang des Explosives/Demolition-Lehrgangs – vielleicht am ersten Tag – führte er uns in ein Klassenzimmer, in dem wir Claymores auseinanderbauen sollten. Er zeigte mit einem Schraubenzieher, wie man das Gehäuse öffnet und den Inhalt freilegt. Wir sahen uns die übereinandergeschichteten Stahlkugeln an, die Lage C4 dahinter, die Zündkanäle, die Visierung auf der Oberseite. Dann befahl er uns auf den Sprengplatz.
Der Sprengplatz war der Bereich im Fort, in dem scharfer Sprengstoff gezündet werden durfte. Einige Bereiche waren bewaldet, andere Bereiche bestanden aus offenen Feldern und Sträuchern. Er scharte in einem der offenen Bereiche 40 oder 50 Kursteilnehmer um sich. Dann griff er in seine Hosentasche und zog einen C4-Block hervor. Er teilte ihn und gab mir und einem anderen Auszubildenden jeweils eine Hälfte und ein Feuerzeug. Dann befahl er uns, die Hälften anzuzünden.
Im BUD/S hatte ich mit Claymores und C4 bereits Bekanntschaft gemacht. Eines der ersten Dinge, die man über diesen Sprengstoff erfährt, ist, dass er völlig harmlos ist, solange keine hohe und schnelle Energiefreisetzung erfolgt, beispielsweise durch eine Sprengkapsel. C4 sieht wie weiße Knetmasse aus und hat die Konsistenz von weichen Karamellbonbons – und ist in etwa genauso gefährlich, solange keine Sprengladung angebracht ist, um es zu zünden. Man kann es aufschneiden, darauf einschlagen, es fallen lassen, in jede beliebige Form bringen, und es würde nicht explodieren. Genauso weiß jeder Militärangehörige, dass nichts passiert, wenn man C4 in Brand setzt.
Und so standen mein Kamerad und ich mit dem C4 in der einen Hand und dem Feuerzeug in der anderen Hand da, als Pig Warner uns den Befehl gab, den Sprengstoff anzuzünden. Also schluckte ich einmal und drehte am Reibrad des Feuerzeugs, um auf Kommando das C4 anzuzünden.
Pig Warner schien ein völlig humorloser Zeitgenosse zu sein. Er war ein harter Brocken, und er hatte keine Hemmungen, uns Dinge zu befehlen, die vermutlich gegen jede offizielle Regel verstießen. Wir dachten nicht, dass er Sinn für Humor besaß. Wie sich herausstellen sollte, irrten wir uns gewaltig. Was er außerdem in seiner Hosentasche hatte, war nämlich ein Fernzünder, der mit einem Empfänger verbunden war, der wiederum an eine 2 Kilogramm schwere C4-Ladung angeschlossen war, die er in einer Entfernung von etwa 180 Metern hinter einer Baumgruppe versteckt hatte. Im selben Moment, als ich das C4 anzündete, drückte er den Knopf.
Die Explosion war so laut wie der Einschlag einer Artillerie-Granate. Natürlich rechnete niemand damit. Die etwas gefassteren Männer drehten ihre Köpfe einfach in Richtung der Bäume. Andere suchten das Weite, weil sie dachten, dass die Explosion vor ihren Füßen stattfand. Manche warfen sich zu Boden. Pig Warner dachte natürlich, dass diese Reaktion das Lustigste war, was er je gesehen hatte – das heißt, seitdem er der letzten Gruppe neuer SEAL-Kandidaten diesen Streich gespielt hatte. Er lachte sich kaputt und gab uns fünf Minuten, unsere angekackten Unterhosen zu wechseln und zum Sprengplatz zurückzukehren.
Dakota
Im Marine Corps gibt es eine Redewendung, ein Ethos, nach dem wir leben: »Lokalisiere den Feind, ringe ihn nieder und zerstöre ihn durch Feuerkraft und Taktik, oder wehre den feindlichen Angriff mit Feuerkraft und Nahkampf ab.« Das ist unsere Mission. Und genau dasselbe macht man mit dem Leben, so geht man mit jedem Problem, jeder Aufgabe um. Mit allem. Man weicht nicht zurück. Man stellt sich.
Nach meiner Grundausbildung auf Parris Island war meine nächste Station die School of Infantry – East am Camp Geiger in North Carolina. SOI ist ein neunwöchiger Kurs, in dem jeder Marine – vom Gewehrschützen zum MG-Schützen bis zum Panzerabwehr-Soldaten – die Grundlagen des Kämpfens lernt. Nach wochenlanger Ausbildung mit scharfer Munition, Sport und theoretischem Unterricht wird jeder Marine seinem Einsatzgebiet zugeordnet und erhält den Befehl, sich bei seiner Einheit zu melden.
Claymores gehörten zum Lehrplan der School of Infantry. Wir wissen viel über diese Waffe. Habe ich Claymores in den Händen gehalten? Natürlich. Habe ich sie aufgebaut und scharf gemacht? Natürlich. Kenne ich die Bezeichnungen ihrer einzelnen Bestandteile? Natürlich. Meine Klasse ging auf den Übungsplatz und beobachtete, wie ein Ausbilder eine solche Mine aufbaute und detonieren ließ. Bei einer praktischen Vorführung an der SOI waren Mannscheiben aufgestellt, die mit dem Gesicht zur Claymore zeigten. Die stand auf dem Boden und war auf drei Seiten von Sandsäcken umgeben. »Fire in the hole!«, brüllte der Ausbilder dreimal, was so viel wie »Lunte brennt, volle Deckung!« hieß. Als die Mine hochging, stieg eine große schwarze Rauchwolke auf, und die 700 Stahlkugeln durchlöcherten die Figuren wie ein Sieb. Feinde vernichtet.
»Vorderseite zum Feind« ist der Inbegriff für den Ansatz, den ich generell im Leben verfolge. So nahm ich es mit feindlichen Kämpfern auf dem Schlachtfeld auf, und so gehe ich generell mit dem Leben um. Ich bin niemand, der sich vor Konflikten scheut. Es ist mir wichtig, mich ihnen zu stellen, sie bei den Hörnern zu packen und nicht auszuweichen, komme was wolle.
Seit ich das Marine Corps verlassen habe, hat sich die Vorstellung von »Vorderseite zum Feind« auf andere Lebensbereiche ausgeweitet, die nichts mit Claymores zu tun haben. Ich erinnere mich zum Beispiel, wie Tim Kennedy, einer meiner engsten Freunde in Austin, mich ins Gracie Humaitá einlud, eine Kampfkunstschule, in der er Ju-Jutsu trainiert. Tim war bei den Special Forces und ist ein ehemaliger MMA-Kämpfer, und er kennt kein Pardon. Ich nahm an, ich würde ihm beim Training zusehen, einen ersten Eindruck gewinnen und beim nächsten Mal vielleicht selbst mitmachen. Doch als ich die Schule betrat, warf er mir einen Keikogi zu, einen traditionellen japanischen Trainingsanzug. »Los, zieh das an«, sagte er, »du machst heute gleich mit.«
Ich zog den Keikogi an und nahm am Unterricht teil. Ich verbrachte die nächste Stunde mehr oder weniger damit, nicht getötet zu werden. In jeder Runde landete ich fünf- oder sechsmal in einem Hebel- oder Würgegriff oder mit dem Gesicht auf der Matte, und immer wieder musste ich abklopfen, damit mein Trainingspartner mich losließ, nur um ein oder zwei Minuten später wieder in die Mangel genommen zu werden.
Mittlerweile gehe ich mit meinen Freunden in Austin oft zum Ju-Jutsu-Training. Manche von ihnen sind MMA-Kämpfer wie Tim, anderen gefällt vor allem die Fitnesskomponente, aber alle kennen den elementarsten Aspekt des Bodenkampfs und der Kampfkünste. Ich begriff die wichtigste Regel im Ju-Jutsu sehr schnell, nämlich dass man nur gewinnen kann, wenn man mit dem Gesicht zum Gegner steht. Ich war mein Leben lang ein Kämpfer, und ich kann so viel sagen: Wende dich nie von einer Sache oder Person ab, der du nicht traust, ob das nun ein Tier auf einer Farm ist oder jemand mit einem Messer oder einer Pistole. Es gibt einen guten Grund, warum Menschen, denen man vertraut, etwas sagen wie: »Ich stärke dir den Rücken.«
Der Rücken ist die empfindlichste Stelle des Menschen. In dem Augenblick, in dem ein Gegner hinter dir ist, steigt dein Risiko für eine Niederlage exponentiell. Nur wenn es aussichtlos ist, einen Kampf zu gewinnen, wenn eine Person die andere bezwungen hat, macht es Sinn, dem anderen den Rücken zuzuwenden. Weil in jenem Moment der einzige Ausweg die Flucht ist, und dann täte man gut daran, die Beine in die Hand zu nehmen und sich in Sicherheit zu bringen.
Teil Eins
Vorbereitung
1
AMERICAN BOYS
Rob
Vergiss deine Wurzeln nicht
Wenn die Heckklappe offen ist, versteht man in einem Chinook-Hubschrauber kaum sein eigenes Wort. Ein CH-47 ist ein Monstrum; es ist ein fliegender Schulbus. Und in etwa genauso bequem. Wenn die Heckklappe geschlossen und die Rampe hochgefahren ist, ist es im Innenraum ruhiger, und das Dröhnen der Rotorblätter ist so leise, dass man sich konzentrieren, nachdenken, ein leises Gespräch führen oder vielleicht sogar schlafen kann.
Wir benutzten Chinooks für unsere Nachteinsätze im Irak und in Afghanistan. Als wir zum Absetzpunkt flogen, um zu landen und zum Zielort zu marschieren, saß ich in der Regel an meinem Platz und ging in Gedanken die Mission durch. Ich dachte an die Menschen, die ich in jener Nacht töten würde, blendete die Hintergrundgeräusche aus.
Auf einem Flug 2010, bei dem ich der Jumpmaster war, der »Absetzer«, war die Tür offen, und ich konnte bei dem Krach der Rotoren meine eigenen Gedanken nicht hören. Der Wind heulte in meinen Ohren, als ich auf der Rampe kniete, mich an einem der hydraulischen Heber festhielt und zusah, wie sich die Absetzzone knapp 1000 Meter unter uns näherte. Unter mir waren nicht die messerscharfen Gipfel des Hindukusch oder die lärmenden Straßen und Basare von Dschalalabad. Vielmehr sah ich den reichsten Hügel der Welt: Butte, Montana, meine Heimatstadt.
Als der Chinook gen Norden flog, konnte ich Hügel mit Salbeisträuchern und Ponderosa-Kiefern erkennen, die sich bis in die Highland Mountains erstreckten. Ich sah erst meine Highschool und dann den Montana-Tech-Campus mit dem kastenförmigen HPER Complex, in dem ich einmal 105 Freiwürfe am Stück versenkte und Schwimmen lernte, um ein Navy SEAL zu werden.
Ich sah das vertraute Straßennetz, das Ranch-Haus meines Vaters auf dem Bittersweet Drive und den Bungalow meiner Mutter in der Nähe der East Middle School im nördlichen Teil der Stadt. Die Berkeley Pit und der türkisfarbene Bergeteich, der wie eine klaffende Wunde wirkte, erschienen im Sichtfeld, bevor wir eindrehten, die East Ridge überquerten und über Saddle Rock flogen, auf dem die weiße Statue der »Lady of the Rockies« stand und huldvoll auf die Stadt blickte.
Als wir die Stadt umkreist hatten und uns dem Flughafen näherten, wurde der Chinook langsamer. Ein Dutzend Männer standen hinter mir und warteten auf das Signal, sich von der Rampe in den Himmel über Butte zu stürzen. Irgendwo 3 Kilometer unter uns warteten meine Mutter und mein Vater und suchten nach unseren Fallschirmen. Der Pilot hatte das grüne Los-Licht angeschaltet. Ich hielt meinen Finger in die Höhe, um zu zeigen, dass noch eine Minute bis zum Sprung blieb, dann meinen Daumen und Zeigefinger für dreißig Sekunden. Als es an der Zeit war, klopfte ich gegen die Außenseiten meiner Oberschenkel wie bei einem Spiel »Stein, Schere, Papier« und reckte meinen Daumen hoch. Standby. Dann hielt ich meine Hand vor die Brust gestreckt und zeigte auf die Tür: das Signal für den Sprung. Einer nach dem anderen sprangen meine Männer von der Rampe und taumelten zur Erde, bevor sie die Endgeschwindigkeit erreichten und sich stabilisierten.
Und dann war ich an der Reihe.
–––––––––
Jeder kommt von irgendwoher, und mein Irgendwo ist Butte. Es bezeichnet sich selbst als Stadt, für mich ist es nur eine sehr kleine Stadt. Ein Bergarbeiter-Städtchen mit harten Kerlen, schätze ich. Die Bergarbeiter, die Ende des 19. Jahrhunderts dazu beitrugen, Butte aufzubauen, kamen hart auf die Welt, hatten ein hartes Leben und wenn sie nicht unter Tag nach Kohle gruben, tranken sie und prügelten sich, was das Leben für ihre Umgebung auch hart machte.
Die Stollen zogen sich durch Butte. Dort wurde vor Kurzem ein Marriott-Hotel errichtet. Ich wette, die Hotelkette ließ sich vorab ein Gutachten zur Bodenbeschaffenheit erstellen, um sicherzugehen, dass das Gebäude nicht in einem Erdloch versinken würde. Es gab in der Stadt ein Bordell namens Dumas Brothel, das mit einem Tunnel versehen war, der direkt zu einem Bergstollen führte, damit die Bergleute in ihrer Mittagspause das Etablissement aufsuchen und den Damen einen Besuch abstatten konnten. Echt verrückt.
Butte hatte in seiner Glanzphase 100 000 Einwohner und war die größte Stadt zwischen St. Louis im Osten und San Francisco im Westen. Heute ist die Bevölkerungszahl auf unter 40 000 Einwohner geschrumpft. Gold- und Silberminen machten Butte damals zum »reichsten Hügel der Erde«. Später war es Kupfer. Und es war Kupfer, nicht Gold, das Butte zu einem ihrer Wahrzeichen verhalf: die alte Anaconda-Mine im Nordwesten der Stadt, die ganz nebenbei auch zu den größten Giftmülldeponien des Landes zählt. Sie schloss 1982, aber das klaffende Loch, das zurückblieb, ist kolossal. Das Ungetüm ist 600 Meter tief und knapp 2,5 Kilometer breit.
Nachdem Anaconda geschlossen wurde, füllte sich die Mine mit giftigem Wasser. Jetzt ist sie bei nationalen Regierungsprogrammen zur Altlastensanierung auf den vorderen Rängen. Wenn Kanadagänse dort landen, verenden sie kurze Zeit später im Wasser. Es ist eine Art Touristenattraktion, und ich weiß nicht, ob das mehr über den Ort aussagt oder über die Touristen, die deswegen kommen. Als ich meine Frau Jessica ins Big Sky Ski Resort einlud, das im Osten in der Nähe von Bozeman liegt, sah sie voller Ehrfurcht auf die Berge. »Mein Gott, Montana ist schön«, sagte sie, bevor sie hinzufügte, »nicht so wie Butte.«
Man könnte aber auch sagen, dass die Minen der Stadt noch zu einem weiteren Wahrzeichen beitrugen. Mit einer persönlicheren Note. Es ist nämlich so: Butte ist die irischste Stadt in Amerika, mit Blick auf den Bevölkerungsanteil. Ernsthaft. Die meisten Bergleute kamen aus Irland und brachten aus ihrer alten Heimat den Heiligen Patrick mit.
1979 kam ein Elektriker namens Bob O’Bill auf die Idee, der Jungfrau Maria einen Schrein zu bauen, weil seine Frau an Krebs erkrankt und dem Tod nahe war. Sie wurde wieder gesund, aber er schwor sich, den Schrein trotzdem zu bauen. Statt eine etwa lebensgroße Statue in seinem Garten aufzustellen, entstand ein 30 Meter hohes Denkmal, das jetzt über der gesamten Stadt thront. Er kaufte Land am East Ridge, direkt auf der kontinentalen Wasserscheide. Das Gelände befindet sich 2,5 Kilometer über dem Meeresspiegel. Ich war etwa drei Jahre alt, als der Bau begann, und die Arbeiten wurden 1985 abgeschlossen. Die Statue ist gewaltig. Sie wird »Lady of the Rockies« genannt, und sie steht mit ausgebreiteten Armen und aufwärts zeigenden Handflächen auf dem Bergkamm. Abends wird sie mit weißem und grünem Scheinwerferlicht beleuchtet. Wenn man in der Innenstadt von Butte ist, den »Flats«, scheinen ihr alle Querstraßen zu Füßen zu liegen. Wenn ich nach oben schaute und sie sah, schien sie – vom Himmel und vom Boden stets gut sichtbar – huldvoll auf die Stadt zu blicken und die hart arbeitenden irischen Bergleute zu segnen. Was mich anging, war die ganze Welt irisch-katholisch, und sie wachte über uns. Manchmal setzte uns meine Mutter am Fuß des Berges am Startpunkt des Wanderweges ab, und wir liefen hoch. Je näher wir der Statue kamen, umso größer und imposanter wurde sie, bis wir am Saum ihrer wallenden Gewänder ankamen und an ihr hochsahen. Sie wirkte auf uns so majestätisch wie die Freiheitsstatue.
Für mich fühlte sich Butte an wie der Mittelpunkt des Universums. Die größte Sportveranstaltung fand kurz vor Weihnachten statt, wenn Butte Central gegen Butte High School Basketball spielte. Wenn man Glück hatte, konnte man über den Berg nach Bozeman oder vielleicht nach Missoula im Nordwesten fahren und sich das Spiel der Montana Grizzlies gegen die Montana State Bob Cats ansehen. Das war eine große Sache. Butte hatte nicht viel, womit es sich rühmen konnte. Immerhin kommt die Stuntlegende Evel Knievel von hier. Tatsächlich wahr.
Sowohl meine Mutter als auch mein Vater wuchsen in Butte auf. In meiner Familie gab es insgesamt vier Kinder: zwei Schwestern, meinen Bruder und mich. Ich besuchte dieselbe Highschool wie meine Eltern vor mir, Butte Central, eine katholische Privatschule. Diese bestand aus einer Jungen- und einer Mädchenschule. Mein Vater ging nach der Highschool mithilfe eines Basketball-Stipendiums an die University of Montana, und meine Mutter war in den ersten beiden Studienjahren an der Montana Tech, die ich später ebenfalls besuchte. Dann wechselte sie an die UM, um mit meinem Vater zusammen zu sein. Sie wurde Mathematiklehrerin, weil es ihr Spaß machte, Probleme zu lösen. Ich habe diese Eigenschaft von ihr geerbt. Im Kampfeinsatz geht es oft darum, Probleme zu lösen. Es geht darum, sich Zeit zu nehmen, sich zu sammeln und Lösungen zu finden.
Manche Leute denken vielleicht, dass ich in meiner Jugend ein Draufgänger gewesen sein muss. Ich war nie ein Draufgänger. Ich verprügelte niemanden in meiner Kindheit und Jugend; wahrscheinlich kassierte ich häufiger Prügel, als dass ich austeilte. In meiner Kindheit gab es keine Kampfkunst-Kurse und ruppige Footballspiele. Ich erinnere mich hauptsächlich an Späße und Gelächter. Das ist meinem Vater zu verdanken, der uns Filme wie Die Glücksritter, Des Wahnsinns fette Beute mit John Candy und ähnliche Filme schauen ließ. Für Kinder eigentlich völlig ungeeignet. Ich habe seinen Sinn für Humor geerbt. Ich wollte andere immer zum Lachen bringen und für gute Stimmung sorgen. Das ist gut für Familien. Das ist auch gut für Soldaten, und es war für meine Teams ein wichtiges Element. Mitten im Gefecht passieren in den heikelsten Situationen die lustigsten Dinge. So wie damals, als ich in Afghanistan eintraf und annahm, dass all die schrecklichen Dinge, die ich in den Nachrichten gehört hatte, stimmten: überall Selbstmordattentäter, Gefechte im Gebirge und Sprengfallen, wohin man auch sah. Als wir in den Bergen unterwegs waren, um Marcus Luttrell zu befreien, fragte ich meinen Vorgesetzten: »Was, wenn wir in ein Minenfeld geraten?« Ohne mit der Wimper zu zucken, sagte er völlig ungerührt: »Kein Problem. Dann steckst du dir eben Ohrstöpsel rein.«
In meiner Jugend fühlte sich Butte wie die Heimatstadt eines jeden Jugendlichen in Amerika an, der irgendwo an einem größeren oder spannenderen Ort sein will. Man denkt, dass jemand besser ist als man selbst, nur weil er aus Phoenix, Arizona, kommt. Oder aus Chicago. So bekommt man eine Art Minderwertigkeitskomplex.
Ich wusste immer, dass es da draußen eine andere Welt gibt. Ich musste erst meine Grundausbildung bei der U.S. Navy an den Great Lakes, Illinois, machen, um andere verängstigte Jugendliche wie mich zu sehen und zu erkennen, dass alle ziemlich gleich sind. Ich erinnere mich an zwei Jungs aus Los Angeles, die aus Watts und South Central stammten und durch ihren Militärdienst der Bandenkriminalität entkommen wollten. Ein anderer Typ aus Westchester County, New York, sagte mir, dass er seine Heimat nicht ertragen konnte. Jeder will irgendeinem Ort entfliehen.
Ich versuche, ungefähr alle zwei Monate nach Hause zu fahren. Meine Mutter und mein Vater leben noch dort, obwohl sie einvernehmlich geschieden sind, und ich muss regelmäßig zurückkehren und prüfen, ob sich mein Vater benimmt. Mein Bruder Tommy lebt auch noch dort. Er hat eine morgendliche Radiosendung für Pendler, die auf dem Weg zur Arbeit sind. Er ist in Butte stadtbekannt, weil er jeden Tag das Mittagsmenü der Schule vorliest. Es ist völlig lächerlich. Er sagt den Schülern, ob sie an jenem Tag »Beef Ole’« vorgesetzt bekommen, was nichts anderes ist als Chili mit Fritos-Chips. Er ist in Butte wahrscheinlich bekannter als ich.
–––––––––
Als ich meine Einheit 2010 für eine Trainingsmission in meine alte Heimatstadt brachte, befand sich mein Team auf dem Höhepunkt seiner Arbeitsmoral. Vor allem im XXXXXXXXXXXXX – meiner Squadron –, weil wir seit meinem Eintritt niemanden im Kampfeinsatz verloren hatten. Wir waren richtig gut drauf und hatten gerade einen Auslandseinsatz absolviert.
Als ich Trainingsausflüge für meine Squadron zusammenstellte, dachte ich mir, dass ich liebend gerne auf Staatskosten nach Hause fahren und meine Kumpels mitnehmen würde, um ihnen die Stadt zu zeigen. Und so verkaufte ich die Reise als Fallschirmübung, an der etwa ein Dutzend von uns teilnahmen. Butte liegt bereits etwa 1,5 Kilometer über dem Meeresspiegel, wenn man also in einem CH-47 sitzt, ist man bereits auf einer Höhe von 5000 Metern, und die Luft ist dünn. Wenn man springt und auf 1500 Metern landet, ist der Fallschirm richtig schnell, und man muss wissen, was man tut.
Ich kannte einen ehemaligen Air-Force-Pararescue-Mann, der in Butte der Inhaber einer Firma namens The Peak ist. Und ich wusste, dass wir möglicherweise kostenlos ein Flugzeug vom Air-Force-Stützpunkt in Great Falls bekämen. Und dann wollte ich die Regierung dazu bringen, für unsere Unterkunft und Verpflegung aufzukommen, und weil ich einen Hotelbesitzer kannte, konnte ich ein gutes Geschäft aushandeln. Die Übung sollte etwa zwei Wochen dauern.
Hier waren wir nun also, 3200 Meter über meiner Heimatstadt. Fallschirmsprünge aus großer Höhe können schwer sein, wenn man sie auf die leichte Schulter nimmt oder bequem wird. Es kann viel passieren, und man kann leicht überheblich, ungeduldig oder einfach nur vergesslich werden. Man muss genau berechnen, wie man gegen den Wind in die Absetzzone kommt, auf die korrekte Höhe steigt, um mit dem Wind zu starten, und dann die Winddrift korrigieren, damit man wenden und in den Wind gehen kann, bevor man abbremst und schließlich landet. Wenn man es vermasselt und zu schnell ist, schlägt man am Boden auf, und das bedeutet normalerweise, dass man stirbt. Wenn man sich halbwegs unter Kontrolle bekommt, schlägt man immer noch hart auf und verletzt sich schwer, wird aber überleben. Bei einem der Sprünge bohrte sich einer meiner Männer direkt vor meiner Familie in den Boden. Er landete in einer großen Staubwolke, sprang sofort auf und tat, als wäre alles in bester Ordnung, weil er von allen angestarrt wurde. Wir haben ein Sprichwort: »Wenn du eine Dummheit vorhast, dann sollte du besser ein harter Hund sein.« Als wir wieder im CH-47 saßen und in der Luft waren, sodass keine Zuschauer uns mehr sehen oder hören konnten, sah er mich schmerzverzerrt an. »Oh, das hat Scheiße wehgetan«, stöhnte er.
Als Jumpmaster stieg ich zuletzt aus. Ich konnte zuvor hören, wie die Männer in meiner Nähe lachten und sich unterhielten, und als ich an der Reihe war, stellte ich mich auf die Rampe. Wir schwebten fast direkt über dem Haus, in dem ich aufgewachsen war. Ich beobachtete die Männer unter mir, die mit dem Kopf voran in Richtung Erde schossen. Der Himmel breitete sich endlos über mir aus, und unter mir erstreckte sich Montana auf beiden Seiten der kontinentalen Wasserscheide im Osten und Westen. Ich stand auf, nachdem ich zuvor gekniet hatte, und sprang mit einem großen Satz aus dem Hubschrauber, und als der Wind mit über 190 Sachen gegen mein Gesicht schlug, sah ich, wie die Straßen und Gebäude unter mir immer näher und näher kamen, als wollte sich meine Heimatstadt beeilen, mich zu begrüßen.
Wir übten unsere Fallschirmsprünge bei Tag, und abends zogen wir los, um uns im »Maloney’s«, einer Kneipe an der North Main Street, den einen oder anderen Drink zu genehmigen. Ein großes Kleeblatt prangt auf dem Vordach über dem Eingang, und irische Fahnen hängen über der Theke. Wackelwodkas kosten einen Dollar, und die Wände und Decke der Männertoilette sind mit Nacktpostern beklebt. Nicht unbedingt politisch korrekt, aber auch nicht wirklich überraschend.
Wenn meine Jungs und ich ins »Maloney’s« gingen, war beinahe jeden Abend etwas los. Die Stammgäste sahen eine Gruppe von Fremden in ihrer Kneipe, und nach einigen Drinks suchten sie Streit. Es dauerte nicht lange, bis alle auf den Füßen waren und loslegen wollten. Aber es gibt einen Unterschied zwischen einem harten Kerl und einem technisch versierten Elitekrieger, der im Nahkampf ausgebildet ist. Wenn einer der Stammgäste anfing, einen meiner Männer zu provozieren, versuchte ich es ihm möglichst behutsam auszureden, »Tu’s nicht. Das willst du nicht.«
Wir gerieten nicht wirklich in Schlägereien. Es spielte sich eher wie folgt ab: Harte Kerle suchten Streit, und dann schlugen meine Jungs sie k. o. Rumms.
»Ich hab dich gewarnt«, pflegte ich dann zu sagen.
Einer unserer SEALs beförderte einen solchen harten Kerl ins Krankenhaus. Er erschien am nächsten Abend wieder in der Kneipe, allerdings mit einem verdrahteten Kiefer. Das Gute an Butte ist, dass man jemanden k. o. schlagen, ihm aufhelfen und anschließend mit ihm anstoßen kann. Wir genehmigten uns allerdings keinen Drink mit dem Typen mit dem gebrochenen Kiefer, weil einer seiner Kumpels maulte, dass »jemand vielleicht seine Krankenhausrechnung bezahlen sollte«, woraufhin einer meiner Kameraden in schallendes Gelächter ausbrauch und antwortete, dass »jemand vielleicht kämpfen lernen sollte«. Verstehen Sie mich nicht falsch, die Männer in Butte sind hart, und jeder hat die Möglichkeit, einen guten Schlag zu landen, falls Sie also einmal zu Besuch in der Stadt sein sollten, ist es ratsam, nicht zu überheblich zu werden.
Wir verbrachten nicht alle unsere Abende in der Kneipe. Wir waren nicht nur gekommen, um Fallschirmsprünge aus großer Höhe zu trainieren. Montana war auch eine tolle Gegend, um zu üben, wie man im Gebirge untertaucht. Oft ließen wir uns im Irak und in Afghanistan bei Einsätzen mehrere Klicks (Kilometer) weit absetzen, um zum Ziel zu marschieren, unsere Arbeit zu erledigen und dann zurückzukehren. Aber es gab auch Zeiten, in denen wir tagelang in einem Versteck in den Bergen ausharrten, um ein schwer greifbares Ziel am Arsch der Welt zu erreichen. Eine Methode, wie man sich im Gebirge in Afghanistan gut durchschlägt, ist auf Pferden oder Eseln. So vertrieben die Mudschaheddin die Russen; sie konnten im Gebirge verschwinden und sich auf Pferden fortbewegen. Die Vereinigten Staaten gaben ihnen sogar Maultiere; einige der Maultiere, die an die Mudsch gingen, stammten aus Farmen in Tennessee, die dort – nicht weit weg von meinem jetzigen Wohnort – gezüchtet wurden. Wir nahmen also an, dass wir in Montana Cowboys finden würden, die uns beibringen konnten, wie man sich zu Pferd im Hinterland zurechtfindet. Sie zeigten uns, wie man die Pferde tränkt und sich um sie kümmert, wie man seine Ausrüstung festzurrt und ein oder zwei Nächte in den Bergen verbringt.
Dafür brauchten wir natürlich die richtige Ausrüstung. Im Rahmen dieses Ausflugs meldete ich Sonderausgaben für spezielles Schuhwerk an, die tatsächlich für uns übernommen wurden. Nach unserer Ankunft marschierten wir ins Miller’s Boots and Shoes, ein bekanntes Schuhgeschäft in Butte auf der South Arizona Avenue, in fußläufiger Entfernung zum Bordell, und stattete meine Kameraden mit Cowboystiefeln aus. Vor der Reise argumentierte ich mit meinen Vorgesetzten, dass wir diese Stiefel wegen der Klapperschlangen dringend bräuchten, und meine Vorgesetzten rollten mit den Augen und sagten: »Ja, schon klar, ich weiß, was Sie tun, aber nur zu, besorgen Sie sich die Stiefel.« Der Besitzer von Miller’s schenkte mir ein Paar Ziegenlederhandschuhe als Dankeschön für das lukrative Geschäft.
Für das Packtraining suchten wir uns eine Gäste-Ranch namens Iron Wheel aus, die etwa 30 Kilometer südlich von Butte lag. Wir trafen am ersten Tag dort ein, bekamen eine üppige Mahlzeit bestehend aus Steak mit Bratensauce und Gebäck vorgesetzt und verbrachten den Rest des Tages damit zu lernen, wie man Maulesel packt und Pferde sattelt. Am Abend kehrten wir zum Hotel zurück und fuhren am nächsten Morgen gleich wieder zur Ranch. Diesmal packten wir alles zusammen, rollten unsere Rucksäcke in Zeltplanen und ritten los. Wir drangen vermutlich etwa 30 Kilometer in die Highland Mountains vor. Als wir an unserem Lagerplatz eintrafen, gaben wir den Pferden zu trinken und kochten unter dem Sternenhimmel unser Abendessen. Und dann entfachten wir ein großes Lagerfeuer, an dem wir uns wärmten, und es dauerte nicht lange, bis die Whiskyflaschen herumgereicht wurden, die wir in die Satteltaschen gepackt hatten, und wir erzählten uns »coole« Geschichten, die normalerweise anfingen mit »Da war ich also, ohne Scheiß, bis zu den Knien in leeren Hülsen und Handgranatenstiften«, oder: »Damals in der Ausbildung, als BUD/S noch anstrengend war …« und so weiter. Jede Geschichte endete damit, dass wir darüber lachten, wie krass wir drauf waren. Und dann stiegen wir in unsere Schlafsäcke, legten Nalgene-Flaschen mit heißem Wasser auf die Füße, damit sie warm blieben, und schliefen ein. Wir nannten Zeltlager »TACBIVs«, was ein SEAL-Kürzel für »taktisches Biwak« ist. Ich dachte mir diesen Begriff aus; vielen herzlichen Dank auch.
Nach zwei Wochen war es an der Zeit, Abschied zu nehmen. Zum Abschluss der Reise fanden wir uns für einige Drinks an einem Ort namens »Metals Sports Bar and Grill« ein, der sich in einem ehemaligen Bankgebäude befindet. In der Bank hatte man den alten Tresorraum in einen Speiseraum verwandelt, und die 32 Tonnen schwere Tresortür dient jetzt dazu, die Privatsphäre der Gäste zu wahren. Wo früher die Schließfächer standen, ist jetzt ein Weinkeller.
Es ist ein Familienrestaurant, deswegen trafen wir dort an jenem Abend keine harten Kerle. Aber als wir gerade gehen wollten, kam ein Polizist aus Butte, der in der Bar war, herüber, um mir die Hand zu geben und einen Waffenstillstand für all die Kneipenschlägereien anzunehmen, die meine Jungs in den letzten beiden Wochen verursacht hatten.
»Hey, wissen Sie, wir sind wirklich froh, dass Sie gekommen sind«, sagte der Polizist, als er meine Hand drückte. »Und wir sind wirklich froh, dass Sie jetzt auch wieder gehen.«
Dakota
Tinker Bell darf nicht sterben
Eine dünne Schneedecke lag über Atlanta, als im Dezember 2009 mein Flugzeug landete. Es hatte Tage gedauert, um von Afghanistan nach Hause zu kommen, ich musste in fremden Flughäfen lange auf meine Anschlussflüge warten und döste, wenn ich in der Luft war, bevor mein Flug endlich in Hartsfield-Jackson eintraf. Ich war erschöpft, mein Körper war noch acht Zeitzonen weit weg. Völlig benebelt ging ich vom Gate zur Gepäckausgabe, wartete auf meine Tasche und ging durch den Zoll, bevor ich den langen Flur im Terminal überquerte und den Schildern zum Ausgang folgte.
Als ich die Sicherheitsschleuse passiert hatte, bot sich mir eine anrührende Szene mit wartenden Familien, die Luftballons und Plakate mit der Aufschrift »Willkommen zu Hause!« hochhielten, amerikanische Fahnen schwenkten und durch mich hindurch auf die automatische Tür starrten, weil sie auf ihre Söhne warteten, die aus dem Krieg heimkehrten. Aufgeregte Ehefrauen, Kinder und Großeltern standen hinter der Absperrung, strahlten voller Vorfreude und hielten ihre Kameras und Handys bereit, um Fotos von ihren Soldaten in Uniform zu knipsen. Niemand von ihnen nahm mich wahr, niemand hielt ein handgemaltes Schild, auf dem mein Name stand. Ich ging so schnell wie möglich an der Menschenmenge vorbei, hinein in die Welt von zollfreien Luxusartikeln, Burger King und blinkender Weihnachtsdeko. Und ich fragte mich, was zum Teufel geschehen war, dass ich hier völlig allein gelandet war.
Als ich sechs Monate zuvor in Afghanistan eintraf, flog ich mit meiner Einheit nach Bagram. Ich hatte immer angenommen, dass wir gemeinsam zurückkehren würden und der Terminal dann voller Familien wäre, die uns zujubelten. Wir konnten in eine bessere, sichere Welt zurückkehren. Der Krieg wäre dann hinter mir. Unsere Arbeit wäre erledigt. Stattdessen war ich allein gekommen und hatte den Rest meiner Einheit zurückgelassen. Ich hatte im Ganjgal-Tal so ziemlich alles verloren, was mir wichtig gewesen war. Meine ganze Welt stand auf dem Kopf, und ich hatte keine Ahnung, wie die Zukunft aussehen würde.
Ich ging schnell an den wiedervereinten Familien vorbei, um zu sehen, wann mein Anschlussflug nach Kentucky ging. Immerhin war ich bald zu Hause bei meinem Vater, Big Mike. Atlanta sollte nur ein kurzer Aufenthalt sein, ein letzter Zwischenstopp, bevor ich wieder in Louisville sein würde. Aber als ich auf die Abflugmonitore sah, musste ich feststellen, dass der Flug nach Louisville wegen des Schneefalls gestrichen worden war. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich saß in Atlanta fest.
Ich hätte den Schnee aussitzen und den nächsten Flug nehmen können. Stattdessen rief ich meinen Vater an und bat ihn darum, mich abzuholen. Die Fahrt von Kentucky dauert fünf Stunden oder länger, aber er stieg sofort in den Trailblazer und fuhr nach Süden, um mich abzuholen.
Es schneite noch, als er in meinem Trailblazer vor dem Flughafengebäude hielt. Ich sagte ihm, dass ich selbst nach Columbia fahren wollte. Er sagte okay. Ich setzte mich ans Steuer und fuhr auf dem verschneiten Highway in Richtung Norden.
Ich bretterte im Schnee nach Kentucky. Ich war die letzten sechs Monate in Afghanistan gefahren, und ich hätte nicht sagen können, wann ich das letzte Mal auf einer amerikanischen Straße in einem zivilen Fahrzeug unterwegs gewesen war. Ich fuhr mitten auf dem Highway, so schnell ich konnte, als würde ich immer noch vor den Granaten im Ganjgal-Tal fliehen, während sich Big Mike an alles klammerte, woran er sich festhalten konnte.
Big Mike lässt sich nicht leicht aus der Fassung bringen. Doch als wir durch Georgia und Tennessee weiter nach Norden rasten, sagte er schließlich etwas wie Ko, du bist nicht mehr in Afghanistan und versuchte mich dazu zu bringen, langsamer zu fahren. Er lag nicht falsch. Ich war nicht mehr in Afghanistan. Aber er hatte auch nicht völlig recht.
–––––––––
Wenn es jemanden gab, auf den ich mich verlassen konnte und der mich sicher abholen würde, wenn ich aus Afghanistan zurückkam, war es Big Mike. Ohne ihn wüsste ich nicht, wo ich heute wäre. Er war immer für mich da, wenn meine Welt zerbrach, und er nahm mich auf, damit ich gemeinsam mit ihm auf seiner Farm leben konnte. Er gab meinem Leben Bedeutung, er gab mir durch die harte Arbeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang eine Struktur und legte großen Wert darauf, dass seine Tiere gefüttert und versorgt waren, die Gatter verschlossen waren und alles dort war, wo es hingehörte.
Ich kenne meinen biologischen Vater nicht. Ich weiß nicht, was mit ihm geschah oder wie er heißt. Nach seiner Trennung von meiner Mutter heiratete sie Big Mike, und obwohl ich nicht sein Junge war, adoptierte er mich, als ich noch ein Baby war. Big Mike und meine Mutter blieben nicht lange zusammen und ließen sich scheiden, bevor ich mich erinnern kann. Als ich klein war, lebte ich vor allem bei meiner Mutter und meinem verrückten Stiefvater, der zum Glück nur selten in der Stadt war. Ich erinnere mich nicht genau daran, wie die Beziehung meines Stiefvaters zu meiner Mutter war, aber ich weiß, dass sie alles andere als gut war. Viel Gebrüll, Polizisten, die gerufen wurden, Streit unter Alkoholeinfluss, Streit ohne Alkoholeinfluss. Es war immer etwas los. Ich erzählte meinem Grandpa, was zu Hause los war, und er kam, um zu intervenieren, was meine Mutter nur wütender machte. Aber ich war froh, wenn mein Grandpa aufkreuzte. Eine meiner frühesten Erinnerungen war nicht von Weihnachten oder einem Geburtstag oder meinem ersten Hundewelpen; es war die Erinnerung an einen bewaffneten Einbrecher, der aus dem Nichts in unserem Apartment erschien. Ich erinnere mich kaum daran; ich muss etwa vier Jahre alt gewesen sein. Mein Stiefvater war auf Montage und nicht in der Stadt, und an jenem Abend waren nur meine Mutter und ich zu Hause, als jemand ein Fenster einschlug und in unser Apartment eindrang.
Ich erinnere mich nur bruchstückhaft an diesen Vorfall, aber ich weiß noch, dass meine Mutter Todesangst hatte. Danach schlief sie jede Nacht auf dem Sofa, mit einer Schusswaffe, die griffbereit auf dem Boden lag.
Ich muss meiner Mutter Anerkennung zollen. Sie konnte zwar keinen Job länger behalten und wusste auch nicht, wie man ein Kind erzieht, aber sie arbeitete und sorgte dafür, dass ich materiell versorgt war. Wir litten nie Hunger und hatten immer ein Dach über dem Kopf. Sie war 16 oder 17 Jahre alt, als sie mich bekam. Wenn Sie vielleicht ein paar Jahre mehr Zeit gehabt hätte, um erwachsen zu werden und sich auf ihre eigene Entwicklung zu konzentrieren, hätte sie vielleicht nicht so viele schlechte Entscheidungen in ihrem Leben getroffen. Ich schätze, man könnte sagen, dass ich auf gewisse Weise an allem schuld war. Ich sage das nicht, weil ich Schuldgefühle habe. Ich sage das, weil es genau diese Empathie ist, diese uns miteinander verbindet.
Ich konnte dem ganzen Chaos entfliehen, als ich zu Big Mike zog. Weil er wegen der Adoption das gemeinsame Sorgerecht hatte, brachte er mich jeden Mittwoch auf seine Farm, jedes zweite Wochenende und jeden Sommer, was für mich immer die beste Zeit des Jahres war. Wenn Big Mike in die Einfahrt fuhr und ich in seinen Wagen stieg, konnte er sicher ahnen, wie schwer es für mich zu Hause war, weil ich immer bettelte, ob ich nicht bei ihm leben könnte. Er sagte nie etwas Negatives über meine Mutter, aber er versicherte mir immer, dass er alle Hebel in Bewegung setzen würde, um meinen Wunsch zu erfüllen, sobald ich 13 Jahre alt war; in Kentucky kann man in diesem Alter entscheiden, bei welchem Elternteil man leben will.
In dem Sommer, als ich elf Jahre alt wurde, saß ich am Küchentisch meiner Großeltern, als das Telefon klingelte. Mein Grandpa Dwight saß am einen Ende des Tisches und meine Grandma Jean am anderen, mit dem Fernseher hinter ihr, der gerade lief – es war vermutlich Chris Allen in den Nachrichten auf Channel 13. Grandpa ging ans Telefon. »Lisa ist dran«, sagte er. Meine Mutter. Big Mike ging mit dem Telefon ins andere Zimmer, was er sonst nie tat.
Als Big Mike zurückkam, sagte er: »Das war deine Mutter.«
»Was wollte sie?«, fragte ich.
»Wie würde es dir gefallen, wenn du ab sofort nur noch bei mir leben würdest?«, fragte er.
Ich konnte es nicht glauben. »Meinst du das ernst? Das wäre prima!«, rief ich.
Er überließ mir die Entscheidung, und ich sagte Ja. Sehr energisch. Und damit war die Sache erledigt. Das war das letzte Gespräch über dieses Thema. Ich sah meine Mutter erst nach über einem Jahr wieder. Ich kannte die Umstände nicht, die sie zu ihrem Weggang veranlassten, und sie waren mir auch egal.
–––––––––
Ich treffe seit meinem zehnten Lebensjahr Entscheidungen über Leben und Tod. Als ich anfing, bei Big Mike zu leben, änderte sich alles. Davor war es nur ein Gewirr aus anderen Wohnungen, anderen Betten, anderem Chaos. Ich hatte keine Kontrolle über mein Leben. Aber nach jenem Abend im Esszimmer hatte alles eine Ordnung. Und ich war dafür verantwortlich, diese Ordnung zu wahren.
Big Mikes Farm befand sich knapp 100 Kilometer nördlich von der Grenze zu Tennessee, an einer Straße, die einen Wald säumt und sich in Tabakfeldern verläuft, die in einer großen Senke am Russell Creek liegen. Die Farm ist etwa 140 Hektar groß. Etwa 2 bis 4 Hektar wurden für den Anbau von Tabak genutzt, bis Philip Morris uns aufkaufte. Wir hatten auch 120 Rinder. Ich baute um 2012 mein eigenes Haus dort, nicht unweit von dem Ort, an dem ich aufwuchs. Direkt daneben baute ich für Big Mike, den ich Dad nannte, eine Werkstatt. Jeder in meiner Familie bewirtschaftet Felder, und alle liegen in einem Umkreis von nur wenigen Kilometern am Highway 532. Wenn man von der Straße meines Vaters abbiegt und auf der 532 nach Westen fährt, stößt man nach etwa 1,5 Kilometern auf die Myers Road. Wenn man dort abbiegt, fährt man geradewegs auf die Farm meiner Großeltern zu. Ich lief vom Haus meines Vaters dorthin, indem ich dem Fluss folgte, bis er in ihren Feldern herauskam. Wenn man weitere 1,5 Kilometer auf dem Highway 532 fährt, gelangt man nach einer Kurve auf die Farm meines Onkels und meiner Tante. Ich fuhr mit unserem Quad oft dorthin. Manchmal nahm ich auch den Truck meines Vaters.
Big Mike arbeitete 80, vielleicht 90 Stunden in der Woche. Er arbeitete bei Southern States, einer landwirtschaftlichen Genossenschaft, und nach der Arbeit kam er nach Hause, um sich um seine Farm zu kümmern. Bevor ich jeden Tag zur Schule ging, musste ich einige Aufgaben erledigen. So war das nun einmal: Ich musste mich ums Vieh kümmern und den Kälbern die Flasche geben. Und meine Arbeit musste erledigt sein, bevor der Schulbus um 6.30 Uhr eintraf. Ich konnte etwas früher aufstehen, meine Arbeit erledigen und mich vor der Schule duschen, oder ich konnte verschlafen, die Dusche ausfallen lassen und den ganzen Tag in der Schule stinken.
So läuft es nun einmal auf einer Farm. Es gibt eine systematische Ordnung, weil alle Tiere auf dich angewiesen sind. Sie sind darauf angewiesen, dass du am Morgen kommst und ihnen einen Eimer Futter hinstellst. Sie sind darauf angewiesen, dass du das Scheunentor hinter dir schließt, damit sie es warm haben und nicht krank werden. Und wenn du etwas vergisst oder schlampig wirst, können sie sterben. Auf der Farm lernte ich das, was ich am besten kann – mich um Dinge kümmern.
Diese Gleichung hat zwei Seiten. Es gibt den einen Teil, bei dem man Verantwortung übernimmt und sich um diese Tiere kümmert. Ich nenne das den Leben-Teil, als wäre jede Farm das Kinderbuch Wilbur und Charlotte. Aber auf der anderen Seite – und davon will niemand etwas hören – muss man die schwere Entscheidung treffen, wann und ob Tiere weiterleben dürfen. Mastrinder müssen geschlachtet werden. Manchmal müssen Tiere eingeschläfert werden. Leben und Tod. Das klingt wie eine große Verantwortung für einen zehnjährigen Jungen, aber für mich gehörte das zum Alltag. Jeder, der auf einer Farm aufgewachsen ist, kennt das.
Es gibt noch etwas, das Kinder, die auf einer Farm aufgewachsen sind, kennen: 4-H, die internationale Organisation für Kinder und Jugendliche. Obwohl wir eine Tabak- und Rinderfarm besaßen, hatten wir auch einige Holstein-Rinder, und ich führte sie im Rahmen des 4-H-Jugendprogramms vor. Wenn man eine Ehrenschleife erhielt, bedeutete es, dass man das beste Kalb der Stadt hatte, und ich war wirklich heiß auf diese Ehrenschleife. Durch 4-H lernte ich zum erste Mal Verantwortung und Disziplin.
Mein Zögling war eine Schönheit namens Tinker Bell. Ich kümmerte mich das ganze Jahr um sie, jeden Tag, nur damit ich sie den Preisrichtern vorführen und einmal im Jahr diese Ehrenschleife gewinnen konnte. Aber es war mehr als das. Ich liebte diese Kuh. Jeden Morgen, wenn ich meine Arbeit erledigte, redete ich mit ihr, damit sie meine Stimme kannte. Um sie bei Laune zu halten, gab ich ihr Pfirsiche und Dr-Pepper-Limonade. Manchmal ritt ich auf ihr wie auf einem Pferd.
Ich hörte mit den Shows auf, als ich etwa 15 Jahre alt war, und wir ließen sie auf der Weide grasen. Sie war nicht alt, aber ich hatte einfach keine Zeit und Lust mehr auf die Vorführungen, deshalb wurde sie eine ganz normale alte Kuh. Meine Angehörigen machten Witze darüber, dass sie wirklich einen angenehmen Ruhestand verbrachte – keine Shows mehr, keine Auftritte, nur endlose grüne Weiden, als wäre sie im Rinderhimmel. Als sie schwanger wurde, warteten wir auf das Kalb. Es war ihr erster Nachwuchs.
Als ich eines Tages von der Schule nach Hause kam, wusste ich, dass etwas nicht in Ordnung war. Kühe sind Gewohnheitsstiere, und sie war nicht dort, wo sie normalerweise stand. Es war Frühling, bevor es unerträglich heiß wurde. Ich werde nie vergessen, wie stark es regnete, als ich loszog, um sie zu suchen.
Ich fand sie auf dem Feld hinter der Scheune, sie lag auf der Seite. Sie war in den Wehen, und das Kalb schaffte es nicht heraus. Es hatte sich im Mutterleib gedreht, und Tinker war schwach und entkräftet. Ich wusste, dass ich einen Tierarzt rufen musste. Er kannte uns gut und kam sofort. Er warf einen Blick auf sie und wusste, dass das Kalb die Geburt nicht überleben würde.
Die einzige Frage war, ob es eine Möglichkeit gab, Tinker zu retten. Sie hatte mit dem Kalb schon so lange in dieser Position verharrt, dass sie praktisch gelähmt war. Der Tierarzt sagte ohne Umschweife: Es ist völlig ausgeschlossen, dass sie es schaffen wird; du wirst sie einschläfern müssen. Mein Vater gab ihm recht.
Aber ich wollte sie um jeden Preis retten. Als ich im Regen in dem verdammt schlammigen Feld saß und Tinker einfach nur daliegen sah, wusste ich, was ich tun wollte. Vielleicht war ich in jenem Augenblick von Selbstmitleid ergriffen, weil ich mich an all die vielen Augenblicke mit ihr erinnerte, an all die Ehrenschleifen, die wir gewonnen hatten, aber ich beschloss an Ort und Stelle, dass ich sie auf keinen Fall sterben lassen würde.
Und so machte mein Vater im strömenden Regen eine Abmachung mit mir. Er willigte ein, dass wir versuchen wollten, sie zu retten, aber dass ihr Leben ausschließlich von mir abhängig war. Mein Dad machte das sehr klar. Sie war meine Verantwortung.
»Du wirst dich um sie kümmern«, sagte er.
»Natürlich, natürlich«, sagte ich. »Für meine Kuh mache ich alles.«
Für Kühe wie Tinker Bell gibt es ein Hilfsmittel namens »Beckenklammer«. Es ist eine Metallklammer, die sich nach unten schieben lässt und sich um das Becken der Kuh schließt. Man kann sie zum Beispiel an der Stalldecke fixieren, wodurch die Kuh entlastet wird und aufstehen kann. Es war so, als wäre sie unter Traktion in einem Krankenhausbett. Sie war nicht in der Lage, eigenständig aufzustehen, sich zu bewegen oder zu grasen.
Es dauerte einige Tage, bis die Beckenklammer eintraf, und in der Zwischenzeit war es unmöglich, sie aufs Feld zu bringen. Ich baute aus Heuballen Stützen für sie, die ich links und rechts neben ihr aufstellte, damit sie nicht umkippte. Ich schlug Zaunpfosten in die Erde, die ich mit einer Plane umspannte, um sie wie mit einem Zelt vor dem Wetter zu schützen.
Es regnete drei Tage pausenlos. Es war ein jämmerliches Unterfangen. Immer wenn ich aufs Feld ging, versank ich bis zu den Waden im Schlamm. Ich musste jeden Morgen vor der Schule hinaus, um ihr Futter und Wasser zu geben. Und dann musste ich mich waschen und zum Schulbus rennen, bevor ich wieder nach Hause kam und alles wieder von vorn losging.
Nach einigen Tagen kam die Beckenklammer endlich. Wir setzten sie ein und benutzten eine Kette, um sie mithilfe des Traktors aufzurichten. Mit dem Bagger, der ihre Hinterbeine hielt, konnten wir Tinker, die dem Traktor hinterherstolperte, langsam in die Scheune führen. Am Anfang konnte sie überhaupt nicht stehen. Jeden Morgen und jeden Abend hob ich sie mithilfe des Traktors hoch, um sie aufzurichten.
So ging es etwa zwei Monate weiter. Es entwickelten sich alle möglichen Probleme: Sie bekam Mastitis, eine Entzündung des Euters, weil wir sie nicht melken konnten. Sie kippte um, und wir mussten sie wieder auf die Beine stellen. Sie fing an, kurze Strecken zu gehen, fiel dann aber um und konnte nicht wieder aufstehen. Es war ein Albtraum. Ich begann darüber nachzudenken, ob es für uns alle nicht einfacher wäre, sie zu erschießen.
Eines Tages kam ich von der Schule nach Hause und war stinksauer, ich weiß auch nicht mehr warum. Statt Dampf abzulassen wie andere Gleichaltrige, musste ich mich um Tinker kümmern. Sie hatte die Scheune verlassen und war natürlich wieder gestürzt. Sie konnte wieder nicht aufstehen.
»Mir reicht’s. Ich hab die Schnauze voll«, sagte ich. Ich rief meinen Vater an und sagte ihm, dass ich es leid war, mich mit ihr herumzuärgern. Von ihm bekam ich kein Mitleid; er hatte mir gesagt, dass sie meine Verantwortung war. Aber ich hatte einen Punkt erreicht, an dem ich wusste, dass er recht hat. Ich konnte sie nicht noch jahrelang so pflegen.
Ich schnappte mir mein Gewehr, stieg auf mein Quad mit der .30-30 Winchester auf dem Schoß, startete den Motor und raste an die Sturzstelle, die etwa 200 Meter von der Scheune entfernt war. Ich dachte daran, wie ich all die Zeit in diese Kuh investiert hatte, wie wichtig sie mir war und dass ich schlussendlich doch versagt hatte.
Ich wollte dem Elend ein Ende setzen. Ich wollte ihr eine Kugel in den Kopf jagen, sie mit dem Traktor wegbringen und in den Wald fahren, wo sie verrotten konnte.
Als ich mit dem Quad über das Feld bretterte – mit Rädern, die über das unebene Gelände holperten, und meinem Gewehr, das auf meinen Oberschenkeln hüpfte –, fuhr ich zur ihr und bremste scharf ab, sodass ich nur wenige Zentimeter neben ihr zum Halten kam.
Das ist jetzt die Stelle in der Geschichte, bei der Sie wahrscheinlich die Hände vor die Augen schlagen und so etwas sagen wie Oh nein, der Vollidiot erschießt gleich seine Lieblingskuh Tinker Bell. Was für ein kaltblütiges Arschloch. Nach all der Mühe. Um Himmels willen, was für ein blöder Sack.
Nun ja, nicht ganz. Ich erzählte Ihnen ja gerade, dass ich mit dem Quad zu Tinker Bell fuhr und so scharf abbremste, dass ich direkt neben ihr zum Stehen kam. Was ich Ihnen nicht erzählte: Die verdammte Kuh erschrak so sehr, dass sie aufsprang und über die Weide rannte, als wäre alles in bester Ordnung. Ich saß mit offenem Mund und Gewehr auf dem Schoß auf dem Quad und beobachtete, wie die schmutzstarrende dumme Kuh über das Feld rannte. Ich würde ja gerne behaupten, dass ich sie geheilt habe, dass meine liebevolle Fürsorge sie wieder auf die Beine gebracht hat, aber wissen Sie, was ich denke? Ich denke, dass sie mich die ganze Zeit zum Narren gehalten hat.
Ich musste mein Gewehr nie benutzen. Tinker bekam später noch ein Kalb – vielleicht mehrere – und starb viele Jahre später in hohem Alter. Ich war sehr erleichtert, dass ich meine Lieblingskuh nicht erschießen musste.
Ich habe immer noch die 4-H-Ehrenschleifen; sie sind im Haus meines Vaters, wo sie schon immer waren, seit Tinker sie auf der Messe gewann. Sie gehören zu mir und meinem Lebensweg. Ich verbrachte nicht zwei Monate meines Lebens damit, diese Kuh zu retten, weil ich ein besserer Mensch werden wollte. Ich setzte mich so für sie ein, weil ich mehr als alles andere Angst davor hatte, nicht der Mensch zu sein, der ich sein musste, um jemandem zu helfen, der auf mich angewiesen war. Das ist immer noch meine größte Angst. Bis heute habe ich immer ein Erste-Hilfe-Set in meinem Truck, damit ich jemandem, der in einen Unfall geraten ist, sofort helfen kann. Ich könnte sonst nicht mit mir im Reinen sein.
Ich sehe meine Mutter noch ab und zu. Wir verbringen nicht viel Zeit zusammen, aber wenn ich nach Kentucky komme und mit einem Freund zum Abendessen in einem Restaurant verabredet bin, stelle ich gelegentlich fest, dass sie auch dort ist und in einem anderen Bereich sitzt.
Sie hatte ein hartes Leben, und das hat sie verändert. 2019 lud ich meine Angehörigen und Freunde zu einem großen Osteressen nach Hause ein. Wir waren um die 15 Personen. Ich hatte auch meine Mutter eingeladen. Alle tranken und unterhielten sich, und meine Mutter spielte mit meinen Töchtern, Sailor Grace und Atlee. Mein Vater war mit seinem besten Freund dort, Mike Allen, und gönnte sich einen Drink.
Nachdem meine Mutter gegangen war, fragte Mike Allen meinen Vater: »Wer war die Frau, die mit den Kindern gespielt hat?«
Und mein Vater sagte: »Verdammt, ich habe keine Ahnung.« Alle im Raum brachen in Gelächter aus und zogen meinen Vater auf: »Du weißt nicht einmal, wer deine Exfrau ist?«, riefen sie.
Die Sache ist, dass mein Vater ein tolles Gedächtnis hat – das können Sie mir glauben, weil er sich an jeden Mist erinnert, den ich im Laufe der Jahre verbockt habe –, aber er erkannte sie wirklich nicht. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Ich mache auch ihr keinen Vorwurf. Meine Mutter brachte mich in dieses Leben und wird immer ein Teil meiner Welt sein, auch wenn ich manchmal nicht merke, dass sie da ist.
2
IM VISIER
Rob
Schieße nie aus einem fahrenden Wagen
Es war immer noch dunkel, als Onkel Jack und Cousin Cory in die Einfahrt zum Haus meines Vaters bogen, und Dad packte das .30-06-Gewehr in den Kofferraum von Jacks altem, verbeultem Datsun. Es war ein früher Sonntagmorgen im Oktober 1988, und in Montana war es der erste Tag der Gabelbock-Jagdsaison. Dieser Präriebewohner ist auch als »amerikanische Antilope« bekannt, kurz »Antilope«. Meine Schwestern und mein Bruder Tom hatten bei der Vorstellung, auf die Jagd zu gehen, laut aufgestöhnt, und deshalb schliefen sie noch tief und fest im Haus meiner Mutter, die in derselben Straße wohnte, als wir das Haus meines Vaters um 5.30 Uhr verließen. Ich quetschte mich neben Cory auf den Rücksitz des Zweitürers. Nachdem Dad den Rücksitz wieder zurückklappte und einstieg, fuhr Chuck wieder aus der Einfahrt und durch die verlassenen Straßen von Butte.





























