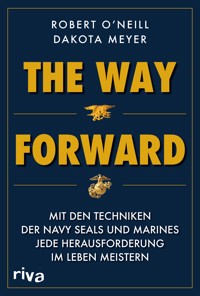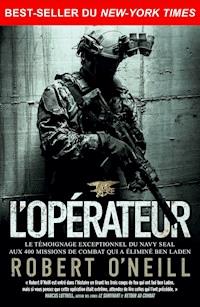15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Riva
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Ich habe Osama bin Laden getötet!« Abbottabad, Pakistan. Es ist der 2. Mai 2011. Zehn Jahre nach 9/11. Ein bewaffneter Navy SEAL stürmt in das Zimmer. Er hat den al-Qaida-Anführer direkt im Visier, zielt auf seinen Kopf. Dann drückt er ab. Robert O'Neill ist der Mann, der Amerikas Staatsfeind Nr. 1 getötet hat. In seiner Autobiografie beschreibt er detailliert, wie seine Kameraden und er vorgegangen sind und wie die letzten Sekunden im Leben des Terroristenführers aussahen. 16 Jahre lang hat er für sein Vaterland gekämpft. Die lange Ausbildung und das harte Training haben ihn geformt. Eindrücklich erzählt er, wie es sich anfühlt, einen Kameraden nach dem anderen zu verlieren und sich nie sicher zu sein, ob man Frau und Kinder jemals wieder sehen wird. Der Operator ist das Zeugnis eines außergewöhnlichen Menschen und gewährt einen faszinierenden Einblick in eine Mission, die einen der wichtigsten Siege im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus markiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
3. Auflage 2025
© 2017 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89 80799 München Tel.: 089 651285-0
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2017 bei Scribner, einem Imprint von Simon & Schuster, Inc., unter dem Titel The Operator. Firing the Shots That Killed Osama bin Laden and My Years as a SEAL Team Warrior. German Translation Copyright © 2017 by Robert J. O’Neill LLC. All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Dr. Kimiko Leibnitz
Redaktion: Matthias Michel
Umschlaggestaltung: Greg Mollica, Laura Osswald
Satz: inpunkt[w]o, Haiger (www.inpunktwo.de)
ISBN Print 978-3-7423-0389-9
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95971-913-1
Den Opfern des 11. Septembers und ihren Familien,
An den Leser: Der Autor hat einzelne Textstellen in diesem Buch geschwärzt, um den
Inhalt
Anmerkung des Autors
Zeittafel
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Kapitel Dreiundzwanzig
Danksagungen
Anmerkung des Autors
In den vergangenen vierzig Jahren gab es viele Dinge, für die ich dankbar bin, darunter die Unterstützung meiner wunderbaren Eltern und das Geschenk meiner besonderen Töchter. Aber nur als Mitglied von SEAL Team XXX erfuhr ich, wie tief Freundschaft sein kann. Mit den Schwadronen XXX XXXXX XXXXX wurde mir ein Vertrauen zuteil, das alles übertrifft, was meiner Meinung nach im Zivilleben möglich ist. Wenn man in einer stockdunklen Nacht am anderen Ende der Welt in ein Haus eindringt, in dem Terroristen mit Sturmgewehren lauern, hat man nur seine SEAL-Brüder – und sonst niemanden.
Lange Zeit rang ich mit dem Gedanken, ob ich überhaupt ein Buch über meine vierhundert Einsätze als SEAL schreiben sollte. Ich wollte nicht, dass es in dem Buch nur um mich geht. Wenn das alles wäre, hätte ich die Geschichte nicht zu Papier gebracht. Würde ich beschreiben können, wie schwer es mir fiel, meine SEAL-Brüder zu verlassen? Schildern, wie es ist, Teil eines Teams zu sein, das durch Tausende von eingeübten Wiederholungen wie ein lebender Organismus funktioniert und perfekt als Einheit handelt? Erklären, dass wir alle erfolgreich sind, wenn ein Mann erfolgreich ist?
Das sind die Fragen, die mir schlaflose Nächte bereiteten.
Wenn SEALs ihr Leben aufs Spiel setzen, um ihrem Land zu dienen, läuft das manchmal im Hintergrund ab, doch manchmal stehen sie auch im Rampenlicht. Niemals ist es nur ein SEAL, der eine Geisel zu ihren Angehörigen zurückbringt. Niemals ist es nur ein SEAL, der eine Stadt von ihren Peinigern befreit. Niemals ist es nur ein SEAL, der einen Mann hinter feindlichen Linien rettet. Niemals ist es nur ein SEAL, der den meistgesuchten Terroristen der Welt tötet.
Wenn die Waffe losgeht, ist es so, als hätten wir alle abgedrückt. Ich beschloss schließlich, dieses Buch zu schreiben, um den Lesern diese Tatsache zu vermitteln. Manche Leute sind der Meinung, dass das, was SEALs tun, vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden sollte. Aber ein Teil von dem, was mich als übermütiger junger Mann zum BUD/S-Lehrgang zog, waren die Bücher, die ich über diese faszinierende militärische Organisation gelesen hatte. Meine bescheidene Hoffnung ist, dass mehr als nur eine Handvoll junger Männer – und Frauen (früher oder später wird auch diese Bastion fallen!) – das vorliegende Buch lesen und, wenn sie fertig sind, entschlossen zur Seite legen, um all die schweren Dinge zu tun, mit denen sie sich den SEAL-Dreizack verdienen werden. Und ich hoffe auch, dass der Rest von Ihnen, die dieses Buch lesen, den Einsatz der SEALs überall auf der Welt zu schätzen wissen – Männer, die auch jetzt noch Leib und Leben riskieren, damit unser Land sicher ist.
Indem ich diese Geschichte erzähle, verlasse ich mich auf meine Erinnerung, um die Worte des Mutes, der Verzweiflung und, ja, auch des derben Humors wiederzugeben, die ich im Laufe von Hunderten von Einsätzen gehört habe. Ich habe mein Bestes getan, um die Dialoge und Ereignisse so genau wie möglich wiederzugeben; falls sich Fehler eingeschlichen haben sollten, bin allein ich dafür verantwortlich. Zur Wahrung der nationalen Sicherheit und Privatsphäre sind in diesem Buch die folgenden Namen Pseudonyme: Kris, Nicole, Cole Sterling, Jonny Savio, Tracy Longmire, Matthew Parris, Mack, Eric Roth, Cruz, Leo, Ralph, Decker, Adam, Harp und Karen.
Zeittafel
10. April 1976: Robert »Rob« O’Neill kommt in Butte, Montana, auf die Welt
Herbst 1988: Erlegt seinen ersten Hirsch auf einem Jagdausflug mit seinem Vater
Sommer 1995: Beitritt in die US Navy
Dezember 1996: Abschluss des BUD/S – die härteste militärische Ausbildung der Welt
Sommer 1998: Erste Auslandsverwendung mit SEAL Team Two
März 2004: Wird Mitglied der XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Juni 2005: Beteiligung an der Suche nach Marcus Luttrell, dem »Lone Survivor«
Januar 2006: Erster Todesschuss in einem Kampfeinsatz im Irak
Sommer 2008: Erster Silver Star für Tapferkeit in Afghanistan
April 2009: Beteiligung an der Rettung von Kapitän Richard Phillips aus den Händen somalischer Piraten
Mai 2011: Tötet den meistgesuchten Terroristen der Welt, Osama bin Laden
August 2012: Nach über vierhundert Kampfeinsätzen und über zweiundfünfzig Auszeichnungen ehrenhafte Entlassung aus der US Navy
Kapitel Eins
Ich schulde meine Laufbahn als Navy SEAL einem Mädchen. Da bin ich nicht der erste und sicher auch nicht der Letzte.
Sie war jünger als ich, brünett, sah aus wie ein Supermodel, konnte gut tanzen und besaß – der Schlüssel zu meinem Herzen – einen guten Sinn für Humor. Als ich sie zum ersten Mal küssen wollte, schloss ich meine Augen zu früh, und ich hörte sie sagen: »Äh, was soll das werden?«
»Ich küsse dich gleich.«
»Bevor du mit mir ausgehst, sicher nicht«, sagte sie.
»Also gut. Gehst du morgen mit mir aus?«
»Hol mich um sieben Uhr ab«, sagte sie, küsste mich innig – auf jeden Fall besser, als ich verdient hatte – und verschwand ins Haus.
Am nächsten Abend holte ich sie um Punkt sieben ab und fuhr sie, spendabel wie ich war, zu Taco Bell. Sie aß eine große Portion Nachos und drei weiche Tacos Supreme.
Sie war ein hübsches Mädchen mit einer tadellosen Figur und dem Appetit eines Holzfällers. Ich hatte keine Ahnung vom Leben, aber ich glaubte, ich sei verliebt.
Als ich die Highschool in Butte, Montana, abschloss – dieselbe Schule, die schon mein Großvater und mein Vater besucht hatten – und mich dort an der Montana Tech einschrieb, ging dieses Mädchen immer noch zur Schule. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, das besagt: Wenn man aufs College geht, hat man keine Freundin, die noch an der Highschool ist. Also ließ ich mich immer seltener bei ihr blicken, obwohl ich trotzdem hin und wieder an sie denken musste. Sie lebte ihr Leben an der Highschool, traf sich mit Freunden und ging tanzen, was Jugendliche eben so tun. Aber ich wollte beides, meinen Spaß und sie in der Hinterhand. So gingen mehrere Wochen ins Land, bis ich schließlich durchdrehte, als ich erfuhr, dass sie den Tag mit einem Jungen aus der Highschool verbracht hatte. Nachdem ich mir ordentlich Mut angetrunken hatte, fuhr ich zu ihr nach Hause, um sie zur Rede zu stellen, und blamierte mich sehr schnell in Grund und Boden.
Ihr Vater, ein bulliger Italoamerikaner mit dunklen Haaren, dichtem Schnurrbart und kantigem Kinn, war ein stadtbekanntes Raubein. Er besaß eine Firma für die Errichtung und Beförderung von Fertighäusern. Ich war mir sicher, dass er kein Problem damit haben würde, auch mich vor die Tür zu befördern. Aber er hatte Mitleid. Statt mich k. o. zu schlagen, was mehr als gerechtfertigt gewesen wäre, packte er mich und schob mich entschlossen zur Tür hinaus.
Diese Güte löste so etwas wie eine außerkörperliche Erfahrung aus. Als er seinen eisernen Griff um meinen Ellbogen lockerte und mich in die Nacht stieß, war es so, als sähe ich mich selbst als Außenstehender. Und was ich sah, gefiel mir nicht. Wenn ich so weitermachte wie bisher, würde alles mit der Zeit nur schlimmer werden. Ich würde einer jener Männer werden, die für immer in Butte blieben und über einem Bier darüber jammerten, dass früher alles besser war.
Mir war also klar: Ich musste gehen.
Ich war noch sehr unerfahren, aber ich dachte, dass man Butte nur verließ, um dem Militär beizutreten. Obwohl ich diese Option nie zuvor in Betracht gezogen hatte, stand in jenem Augenblick mein Entschluss fest. Die Zukunft, die Vorsehung, oder was auch immer, nahm ihren Lauf.
Heute würde man vielleicht sagen, dass ich ein »freilaufendes Kind« war. Am Samstagmorgen war ich nach dem Frühstück gleich draußen und kam erst wieder, wenn die Straßenbeleuchtung anging. Wir Kinder zogen in Gruppen durch die Straßen. Wir überfielen uns gegenseitig mit Spielzeugpistolen und spielten Ninja, sprangen von Dächern und trieben allerhand Unsinn, den ich meinen Kindern natürlich untersagen würde. Wir gingen in die Butte Plaza Mall und sahen uns dort Rambo im Kino an. Das war ziemlich cool. Jeder wollte der Held sein, der die Schurken mit seinem M60 ins Jenseits befördert. Aber für mich war das alles Fantasie, nicht realer als die immer realistischer wirkenden Ego-Shooter, die ich mit meinen Freunden zockte. Das Militär spielte in meinem Leben nie wirklich eine große Rolle. Ich hatte nicht vor, Soldat zu werden, deshalb dachte ich auch nicht wirklich darüber nach. Ich wollte nur spielen, Tarnkleidung tragen und so tun, als würde ich meine Freunde erschießen.
Auf den ersten Blick scheint Butte kein besonders idyllischer, kinderfreundlicher Ort zu sein. Die Stadt ist eine Bergarbeitersiedlung, die ihre besten Jahre Anfang des 20. Jahrhunderts hatte, als jede Gewehrpatrone, die während des Ersten Weltkriegs über den großen Teich verschifft wurde, aus Kupfer war – das hauptsächlich in Butte gefördert wurde. Das Bevölkerungswachstum war 1920 auf einem Höchststand, als die Stadt 100.000 Einwohner zählte, doch als ich auf die Welt kam, war sie bereits um zwei Drittel geschrumpft. Die Wohnviertel wuchsen praktisch direkt neben den Tagebaugruben, und die gesamte Stadt war auf einem Plateau errichtet, das neben der größten Grube stand, Berkeley Pit – eine gewaltige, außer Betrieb gesetzte, offene Kupfermine, die anderthalb Kilometer breit und fünfhundert Meter tief war. Zwischen ihrer Eröffnung im Jahre 1955 und ihrer Schließung am Tag der Erde 1982 waren ihren Tiefen eine Milliarde Tonnen Erz und Gestein entrissen worden. Nachdem die Grubenpumpen zum letzten Mal ausgeschaltet worden waren, stieg das Grundwasser langsam an, wodurch Säuren und Schwermetalle aus der klaffenden Wunde in der Erde nach oben sickerten. Das Wasser, das sich in der Grube sammelte, war so giftig, dass es jede Gans, die auf die dumme Idee kam, dort zu landen, sofort umbrachte.
Aber ich richtete meine Aufmerksamkeit auf andere Dinge in Butte, speziell auf die Metallringe, die drei Meter über dem Turnhallenboden hingen, wie auf die Hirsche, Elche und Gabelböcke, die in den unberührten Rocky Mountains lebten, die auf der anderen Seite der Stadt wie ein zu Stein gewordener Tsunami emporragten.
Mein Vater, der Sohn eines Minenarbeiters, war Aktienhändler und meine Mutter Mathematiklehrerin (ich hatte sie dreimal als Lehrerin – in der siebten und achten Klasse und dann wieder in der Highschool). Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich sechs oder sieben Jahre alt war. Für mich war es völlig normal, getrennt lebende Eltern zu haben. Ich erinnere mich nicht daran, dass es jemals anders gewesen wäre. Mein Vater war nie weit weg und immer da, wenn wir ihn brauchten, aber normalerweise besuchten meine Geschwister und ich ihn an jedem zweiten Wochenende. Das war für uns in Ordnung; alle unsere Freunde wohnten nicht weit weg von dem Haus, in dem wir Kinder mit unserer Mutter lebten, und wir spielten an den Wochenenden vor allem draußen: Verstecken, Fangen, Krieg, Ninjas, oder wir kletterten und sprangen vom Dach. Wir spielten immer gemeinsam, nur nicht beim Klettern oder Springen. Kris, meine ältere Schwester, wollte nichts davon wissen. Aber ich konnte meine drei Jahre jüngere Schwester Kelley zum Mitmachen überreden. Sie wollte um jeden Preis zur Clique gehören. Also gingen wir aufs Dach und sprangen herunter. Heute würde ich meinem Sohn eine Standpauke halten, wenn er einen solchen Unfug machen würde, aber als Kind dachte ich nicht an die möglichen Gefahren. Es machte einfach nur Spaß. Kelley war jahrelang meine beste Freundin; ich brachte sie sogar dazu, einen Vertrag zu unterschreiben, der sie dazu verpflichtete, meine Teamkollegin im Football zu sein, das wir immer auf dem Rasen vor der Kirche spielten. Sie war ein verdammt guter Receiver und auch später am College eine tolle Sportlerin.
Mein älterer Bruder Tom war ein absoluter Vollidiot, und das änderte sich erst, als er in die Highschool kam. Dann legte sich bei ihm ein Schalter um und er wurde grandios. Oder vielleicht hörte ich einfach auf, eine Nervensäge zu sein. Keine Ahnung. Irgendetwas geschah und er wurde nicht nur der lustigste Mensch, den ich kannte, sondern auch ein hervorragender All-State-Crossläufer. Er brachte sich selbst das Gitarrespielen bei und seine erste Band hieß The Fake IDs. So jung waren wir damals. Er spielt auch heute noch und hat seine eigene Morgensendung bei einem lokalen Radiosender.
Kris war immer die Vernünftigste von uns, obwohl meine Mutter sicher widersprechen würde. Vielleicht waren sie sich einfach zu ähnlich, und manchmal flogen zwischen den beiden so richtig die Fetzen. Kris war mir gegenüber immer wohlwollend, umgänglich und hatte die beste Lache, die ich je gehört habe. Sie war sehr gewissenhaft, schrieb immer Einsen und war sanftmütig – wenn sie mir nicht gerade den Hintern versohlte, was ich mir bis zum ersten Jahr der Highschool gefallen ließ … ich weiß nicht mehr genau, vielleicht sogar länger.
In meiner Kindheit pflegten meine Mutter und mein Vater einen kooperativen, freundschaftlichen Umgang. Falls sie Probleme hatten, ließen sie es sich nicht anmerken. Die Trennung war für meine Eltern eine gute Sache. Meine Mutter arbeitete an der Junior Highschool, die direkt neben der Highschool lag, das heißt, sie konnte uns in die Schule bringen und wieder nach Hause fahren. Sie war gerne Mutter, aber sie nahm sich jedes zweite Wochenende frei, um mit ihren durchgeknallten, lustigen und zugegebenermaßen ziemlich aufreizenden Freundinnen Lynn und Sue die Stadt unsicher zu machen. Ich erinnere mich, wie sie bei uns am Küchentisch saßen, Daiquiris tranken und sich darüber unterhielten, was Samstagabend los gewesen war. Das war für meine zarten Knabenohren zu viel. Ich war im Zimmer nebenan und musste mich aus dem Haus schleichen, weil ich die Einzelheiten nicht ertragen konnte. Meine erste verdeckte Operation.
Wir verbrachten jene Wochenenden gerne mit unserem Vater. Er war ein typischer Junggeselle, aber das fiel uns zu der Zeit nicht auf. Wir hätten aber darauf kommen können, weil unser erster Stopp am Freitag immer bei Buttreys war, einem Supermarkt. Wir mussten Essen kaufen, weil ansonsten nichts im Haus gewesen wäre! Er ging meist essen. Also schoben wir den Einkaufswagen durch die Gänge und packten alles ein, was wir brauchten, meist war es Junk Food – und dann legten wir auch großen Wert darauf, die Zutaten für Dads »Berühmtes Frühstück« mitzunehmen. Seine Rühreier waren und sind immer noch legendär. Käse, Mayo, Butter, Basilikum und einige weitere Geheimzutaten. Einmal vergaßen wir die Milch, die er durch Kaffeeweißer mit Amaretto-Geschmack ersetzte. Probieren Sie das bloß nicht aus! Diese Wochenenden ließen wir immer bei Opa Tom und Oma Audrey ausklingen. Sie kochte wie eine Weltmeisterin; alles, was man sich vorstellen konnte. Und hier lernte ich auch Dads Spezialität: Kartoffelberg an Soßensee!
In meinen Teenagerjahren entwickelten mein Vater und ich eine außergewöhnlich enge Vater-Sohn-Beziehung und wir wurden mehr so etwas wie beste Freunde. Das fing an, als meine Mutter von dem »Hügel« – wo alle meine Freunde lebten – in die Innenstadt zog, nicht weit von der Berkeley Pit, wo ich niemanden kannte. Ich suchte nach einer Alternative zu meinen Ninja-Abenteuern, als ich auf ein Video stieß – Come Fly with Me mit Michael Jordan. Ich war sofort fasziniert. Der Film fängt damit an, wie Jordan in einer leeren Turnhalle Körbe wirft. Seine Erzählerstimme sagt: »Ich konnte nicht damit aufhören. Ich habe jeden Tag das Gefühl, besser werden zu müssen.« Und dann gab es natürlich zahlreiche Szenen, in denen Air Jordan durch die Luft schwebt und Verteidiger ausspielt, als ob es sie fast nicht gäbe.
Ich war beeindruckt, inspiriert. Ich war nicht der größte, attraktivste, klügste oder sportlichste Jugendliche, aber irgendetwas faszinierte mich an der Besessenheit, immer besser werden zu wollen. Zurückblickend denke ich, dass dieser Wesenszug schon immer ein Teil von mir war. Mein Lieblingsfach in der Schule war Englisch und mein Lieblingsbuch war Der alte Mann und das Meer. Mir gefiel, wie der alte Fischer Santiago in den epischen Willenskampf mit dem riesigen Fisch gezogen wird. Seine Hände sind vom Festhalten der Angel aufgerissen, er ist so hungrig, dass er Stücke des rohen Köders isst, er hat nicht geschlafen, seine Muskeln krampfen, als er in seinem schäbigen kleinen Boot sitzt, aber er würde lieber sterben als aufzugeben. Diese Einstellung sprach mich an.
In Butte, Montana, würde zwar kein riesiger Marlin anbeißen, aber ich konnte immerhin Michael Jordan nacheifern. Neben unserem neuen Haus war gleich eine Schule, die Greeley Elementary, die einen Basketballring im Außenbereich hatte. Also bat ich meine Mutter darum, mir einen Basketball zu kaufen, was sie auch tat. Ich ging jeden Tag dorthin und spielte für mich, oft stundenlang, um zu sehen, wie viele Freiwürfe ich erzielen konnte, wie meine Korbleger waren, wie geschickt ich nach links oder rechts dribbeln konnte. Mein Vater, der damals um die vierzig Jahre alt war, hatte als Student in der Mannschaft der Universität von Montana gespielt. Er erfuhr von meinem neuen Hobby und sagte: »Hey, willst du lernen, wie man richtig spielt?«
Wir gingen in einen Sportverein in der Innenstadt von Butte. Ich warf meine Körbe an der Grundschule, dann holte er mich ab und wir fuhren zu dem Club. Ich verbrachte vier Stunden täglich, sieben Tage in der Woche, mit einem Basketball, den ich entweder in den Händen hielt oder warf. Als ich in die Schulmannschaft kam, übte ich in der Saison mit meinen Teamkollegen, und wenn die Saison vorbei war, fing das private Training mit meinem Vater an. Er holte mich nach der Schule ab und fuhr mich zur Turnhalle. Wir übten zwei oder drei Stunden am Stück; Dribbeln, Spielzüge, Mann gegen Mann – wilde, lustige Spiele. Er versuchte mir alles beizubringen, was er wusste, Finten und kleine Tricks, wie man seinen Gegner ins Leere laufen lässt.
Als wir völlig erschöpft waren, sagte mein Vater: »Wir dürfen erst gehen, wenn einer von uns zwanzig Freiwürfe am Stück schafft.« Er provozierte mich – ich ließ mich aus dem Konzept bringen, wenn er es schaffte, dass ich meine Füße auch nur einen Zentimeter von der Linie wegbewegte –, und ich warf so lange, bis ich verfehlte. Dann war er an der Reihe. Beim ersten Mal dauerte es etwa zwanzig Minuten, bis einer von uns zwanzig Körbe am Stück schaffte. Dann gingen wir in ein Restaurant, um Steaks zu essen und zu feiern. Am nächsten Tag sagte mein Vater: »Wir dürfen erst gehen, wenn einer von uns zwanzig Freiwürfe schafft, aber ein Steak gibt es erst nach fünfundzwanzig Treffern in Folge.« Sobald wir die fünfundzwanzig Freiwürfe versenkt hatten, stieg die Zahl auf dreißig, fünfunddreißig, vierzig. Am Schluss waren es siebzig Freiwürfe in Folge, um uns unser Abendessen zu verdienen, und wir erzielten sie fast immer. Ich glaube, der Rekord meines Vaters sind neunzig Treffer. Mein Rekord liegt immer noch bei einhundertfünf. Wir machten eine Menge Freiwürfe.
Als ich zwölf Jahre alt war, ließ sich mein Vater von seiner zweiten Frau scheiden, und mein Onkel Jack, sein Bruder, überredete ihn, an den Wochenenden auf die Jagd zu gehen, um ihn auf andere Gedanken zu bringen. Selbstverständlich war ich mit von der Partie. Wir fuhren in Jacks Nissan auf den Berg. Wir wussten am Anfang nicht genau, was wir taten. Es gibt dort weite Ebenen mit herrlichen Tieren, die blitzschnell auftauchen und wieder verschwinden – Gabelböcke sind so ziemlich die schnellsten Tiere in Nordamerika. Kerle in Pick-ups und Geländewagen folgten ihnen und schossen wild in alle Richtungen. Wenn ich so etwas heute als für die Sicherheit am Schießstand ausgebildeter Range Officer der Naval Special Warfare Development Group mitbekommen würde, würde ich sofort sehen, wie wahnsinnig gefährlich diese Methode ist. Aber es war atemberaubend spannend und schließlich wurden wir richtig gut darin; wir gingen bergauf und suchten uns entlegene Gebiete, die man mit einem Pick-up nicht erreichen konnte – wir kannten einen Ort, an den sich die Tiere vor dem Morgengrauen zurückzogen. Man postierte sich gegen den Wind und ließ sie herankommen, man überraschte sie also. Die Tiere waren es gewohnt, verfolgt zu werden; einen Überfall erwarteten sie nicht.
Das erste Tier, das ich erlegte, war ein Maultierhirsch, ein großer Hirschbock. Ich erinnere mich, wie wir im Dunkeln die unwegsamen Schotterwege entlangfuhren, bis ans Ende des Tals marschierten und uns bei Sonnenaufgang müde an den Aufstieg machten. Nach etwa einer Stunde waren wir auf dem Berg, der in ein heufarbenes Tal abfiel. Dort hofften wir auf Hirsche zu stoßen. Es gab keine. Wir warteten eine Weile und nach einer Weile schwand die Enttäuschung, keinen Jagderfolg gehabt zu haben. Es war Spätherbst, kalt, aber nicht eisig, hier und da bedeckten kleine Flecken Schnee die Erde und ich dachte mir: Nichtübel,beiTagesanbruchaufdemBergzusitzen,nurmeinVaterundich,alsobdiesermalerischeOrtnuraufunsgewartethätte.
Schließlich wurden wir hungrig. Als wir gegen Mittag wieder vom Berg stiegen, sprangen aus dem Unterholz eine Hirschkuh und ein Hirschbock auf eine Lichtung, die etwa einhundert Meter links von uns war. Beim Gehen machten wir ein Geräusch, das der Bock nicht kannte. Er erstarrte mitten auf der Lichtung. Mein Vater stand vor mir in der Schusslinie. Er warf sich zu Boden und sagte »Tu’s!« Ich hatte großes Glück und dachte nicht darüber nach, was ich tat. Ich wusste, dass ich nicht zögern durfte und schießen musste. Jetzt. Ich ging mit meiner .300 Winchester Magnum in den Anschlag und sah kaum durchs Zielfernrohr, als ich schon abdrückte. Mein Vater riet mir immer, auf die Brust zu zielen, knapp hinter die Schulter. Man sollte versuchen, die Lunge zu treffen, damit das Tier sofort stirbt. Ich schoss zu hoch. Die Kugel zertrümmerte die Wirbelsäule. Treffer. Der Bock brach tot zusammen. Wir näherten uns dem Tier vorsichtig. Große Böcke sind hinterlistig und stellen sich manchmal tot. Man muss also aufpassen, dass sie nicht plötzlich hochspringen und zutreten. Ich hob meinen Fuß und stieß ihn an. Sein Gesäß zuckte leicht, aber ansonsten blieb er reglos. Ich machte einen weiteren Schritt auf seinen großen, geweihbewehrten Kopf, hob den Lauf meines Gewehrs – dieselbe Art von Gewehr, das ich später als Scharfschütze bei den SEALs benutzen würde – und sah in seine ausdruckslosen Augen. Er war tot.
Ich empfand diese Erfahrung als surreal. Das Tier sah noch genauso aus wie einen Augenblick zuvor, als es noch quicklebendig war: mit schöner Farbzeichnung und edlem Geweih. Aber es war tot, und ich war dafür verantwortlich. Ich spürte einen Anflug von Bedauern. Ein schönes Tier war wegen mir jetzt tot. Aber ich war auch stolz. Das war Montana. Hirsche waren Jagdwild. Jeder ging auf die Jagd. Jetzt gehörte ich zum Club.
In den folgenden Jagdsaisons war das Bedauern verflogen. Bald wurde es jeden Montag zu einem beliebten Gesprächsthema an der Junior High. »X und Y haben einen Hirsch erlegt.« Der Jackpot war ein Elchbulle. Es schien so, als würde es immer jemanden geben, dessen sagenumwobener Onkel oder Vater einen »Sechsender« erlegt hatte. (Wir im Westen zählen anders – man zählt nur eine Seite des Geweihs, nicht beide. Ein »Sechsender« ist also eigentlich ein Zwölfender.) Das ist ein großes, flinkes und schwer zu fassendes Tier. Es kann ein Stockmaß von ein Meter fünfzig haben und fast vierhundert Kilogramm wiegen. Niemand hatte es bisher geschafft, einen solchen Bullen zu erlegen. Manche Jäger hatten noch nicht einmal einen zu Gesicht bekommen.
Als ich das große Glück hatte, vor meinem achtzehnten Lebensjahr einen solchen Elchbullen zu sehen und zu erlegen, empfand ich nichts als Stolz.
________________
Im Herbst des Jahres 1994, das Jahr in dem ich achtzehn Jahre alt wurde, stellte mich mein Vater dem ersten SEAL vor, den ich jemals kennenlernte. Er hieß Jim und ich war sofort von ihm beeindruckt. Er war nicht so groß, wie ich mir einen Navy SEAL vorstellte – viele Leute glauben, dass alle SEALs Hünen sind –, aber er war in hervorragender körperlicher Verfassung. Seiner akkurat gestutzten Frisur und seinem Verhalten merkte man an, dass er beim Militär war. Zuerst fielen mir aber seine positive Einstellung und Ausstrahlung auf. Dann bemerkte ich noch, dass er immer seinen Sicherheitsgurt anlegte. Hier war also ein harter Navy SEAL, der vor nichts auf der Welt Angst hatte, aber genauso auf die Verkehrssicherheit bedacht war wie meine Großmutter. Er war noch nie zuvor in Montana gewesen, dachte sich aber: Waffen, Berge, wie schwer kann es schon werden? Er stellte sich der Herausforderung, wie SEALs es für gewöhnlich tun – er ließ sich von jemandem im Hinterland absetzen und blieb dann drei Tage dort. Er ging auf die Pirsch und suchte überall, stöberte aber keinen einzigen Hirsch auf. Ich bekam das mit und sagte ihm, »So macht man das nicht. Ich kenne einen guten Ort.« Der Marsch ging über knapp anderthalb Kilometer, aber es ging steil bergauf und es war immer noch stockdunkel. Normalerweise ging ich den Aufstieg langsam an und machte Pausen, um zu Atem zu kommen. Gegen Ende fühlte sich jeder Atemzug wie Sandpapier auf meiner Lunge an, aber ich dachte mir: DerTypisteinSEAL.Ichkannmichnichtvorihmblamieren.Ichmussweiter,keinePausen.
Er blieb mir die ganze Zeit dicht auf den Fersen.
Als wir oben ankamen, stießen wir sofort auf eine Elchherde – etwa vierzig Tiere genau an der Stelle, die ich zuvor beschrieben hatte. Wir erwischten keines, aber als wir wieder abstiegen, sagte Jim: »Du solltest dir überlegen, zu den SEALs zu gehen, so wie du im Dunkeln den Berg hinaufgerannt bist.«
Ich war geschmeichelt, zog diese Option aber nicht ernsthaft in Betracht.
Bis mich der Vater meiner Exfreundin etwas unsanft aus dem Haus beförderte.
Den Sommer nach meinem Highschool-Abschluss verbrachte ich damit, zwölf Stunden täglich, vier Tage in der Woche, in einer Kupfermine Bruchstein auf ein großes Fließband zu schaufeln, in fast völliger Dunkelheit, die nur durch das Licht meiner beiden kleinen Helmlampen durchschnitten wurde. Ich dachte, dass das ein gutes Krafttraining für meinen schmächtigen Oberkörper sei, und so war es auch. Aber ich hatte nicht berücksichtigt, wie es ist, stundenlang Steinstaub einzuatmen oder über die Geschichten nachzudenken, die ich von Arbeitern gehört hatte, die versehentlich auf das Fließband gefallen und zu Hackfleisch verarbeitet worden waren. Meine Nachtschicht als Pizzabote war im Vergleich dazu der reinste Urlaub.
Ich dachte kurz darüber nach, die Stadt zu verlassen und ein weiter entferntes College zu besuchen, obwohl meine Vorstellung von »weiter entfernt« die Universität von Montana in Missoula war, die keine zwei Stunden Autofahrt von Butte entfernt war. Als ich mich entscheiden musste, fehlte mir einfach der Ehrgeiz. Oder vielleicht auch der Mut. Wenn man in einer Kleinstadt in Montana aufgewachsen ist, hat man das ungute Gefühl, dass man in der großen, bösen Welt da draußen genauso leicht zu Hackfleisch verarbeitet wird wie bei einem Arbeitsunfall in der Kupfermine. Montana Tech war die sichere Alternative. Ich hatte dort außerdem eine bessere Chance, ins Basketballteam aufgenommen zu werden. Ich war an der Highschool ein guter Spieler gewesen, aber mit meiner Körpergröße von 185 Zentimetern war ich nicht groß genug, um auf dem College wirklich Eindruck zu machen. Mein Plan war, mir in der zweiten Mannschaft die Sporen zu verdienen und mich in die erste Mannschaft hochzuarbeiten. Das ging gut. Ich hatte eine tolle Zeit und war topfit. Körperlich. Geistig, na ja, da musste ich an das Mädchen denken.
Heute weiß ich, dass noch viel mehr dahintersteckte. Ich hatte mein erstes Jahr College-Basketball gerade hinter mir und fühlte mich ausgebrannt. Nicht mit dem Spiel an sich, sondern damit, dass es immer nur um Training, Training, Lernen und Training ging. Diese Eintönigkeit hätte mir vermutlich nichts ausgemacht, wenn ich noch mit meiner Freundin zusammen gewesen wäre. Ich schien nicht über sie hinwegzukommen und sie war immer noch in der Stadt – ich konnte ihr also jederzeit über den Weg laufen. Ich wusste, dass ich nicht jeden Abend auf einem Barhocker im Maloney’s landen wollte, um meinen Kummer in Alkohol zu ertränken. Ich konnte mir allerdings schon vorstellen, dass ich mich daran gewöhnen konnte. Deshalb war es an der Zeit, etwas dagegen zu unternehmen.
Ich dachte zuerst an Ben und Jim, zwei ältere Jungs, die ich schon mein ganzes Leben gekannt hatte. Sie waren den US Marines beigetreten und hatten die Grundausbildung abgeschlossen, als ich noch an der Highschool war. Wenn sie Urlaub hatten und zu Hause waren, strahlten sie ein unglaubliches Selbstbewusstsein aus, mit ihren polierten Stiefeln und makellosen Uniformen, die perfekt gebügelt waren. Mit den Bügelfalten hätte man vermutlich Käse schneiden können. Ich erinnere mich, wie ich dachte: Diese Jungs können jeden in der Stadt fertigmachen.
Ich wollte so sein wie sie.
Ich dachte nicht einmal an die Möglichkeit, in ein Gefecht zu geraten oder getötet zu werden. In meinem ersten Jahr an der Highschool sah ich Jungs, die nach dem Schulabschluss zum Militär gingen und noch einmal zurückkamen, um sich von den Lehrern zu verabschieden, bevor sie am Zweiten Golfkrieg teilnahmen. Ich war damals vierzehn Jahre alt und dachte, dass im Irak bestimmt so viele amerikanische Soldaten sterben würden wie in Vietnam. Dann sah ich den Krieg auf CNN … Kindergeburtstag. Als ich damals darüber nachdachte, mich zu verpflichten, befanden wir uns außerdem nicht im Krieg, und es sah auch nicht danach aus, als würde es in absehbarer Zeit einen geben. Ich dachte, dass es cool wäre, eine Uniform zu tragen und beim Marschieren im Chor zu singen.
Abgesehen davon wäre ich ja nur einige Jahre fort … und dann würde ich wieder im Maloney’s sitzen – nur dass ich die anderen Stammgäste mit einigen Kriegsgeschichten beeindrucken konnte.
Eines Tages im April 1995 wollte ich die Rekrutierungsstelle der Marines besuchen, aber der Anwerber war nicht da. Mir fiel ein witziger lustiger Spruch meiner beiden Freunde ein, die nun Marines waren: »Das Marine Corps ist eine Abteilung der Navy. Die Männerabteilung nämlich.« Und deshalb überlegte ich mir, in das Büro der Navy zu gehen. Der Navy-Anwerber würde mir schon sagen können, wo ich den fehlenden Marine finden konnte.
Der Navy-Anwerber war körperlich eher unscheinbar, aber sehr klug. Einige Jahre später hätte ich es sofort erkannt: Er trug Khakihosen und hatte Ankerabzeichen auf dem Revers. Er war also ein Navy Chief. Ganz gleich, was manche sagen mögen – Chiefs halten in der Navy das Rad am Laufen. Sie tun das mit Weitsicht, Hingabe und Erfahrung. Sie können auch harte Hunde sein. Dieser Chief musste seine Quote erfüllen und das ist in Butte, Montana, keine leichte Aufgabe. Vor allem, wenn das eigene Büro direkt neben dem der Marines liegt.
Mit einem skeptischen Blick musterte er mich: »Warum wollen Sie ein Marine werden?«
»Weil Marines die besten Scharfschützen der Welt haben. Ich will Scharfschütze werden, weil ich mit der Jagd aufgewachsen bin.«
Er nickte: »Da sind Sie hier goldrichtig. Wir haben auch in der Navy Scharfschützen. Sie müssen nur ein Navy SEAL werden.«
Damals konnte ich nicht einmal richtig schwimmen. Aber ich dachte mir: »Hey, ich bin zwar naiv, aber der Typ weiß, wovon er spricht. Was hätte er davon, mich anzulügen?«
Und es war auch keine direkte Lüge. Zumindest nicht genau. Es war eher so, dass er einige Details wegließ. Es war in etwa genauso wahrscheinlich für einen Jugendlichen aus einer Minenarbeiterstadt, ein SEAL zu werden, wie für diesen Anwerber, zum Admiral befördert zu werden. Also unterschrieb ich beinahe völlig ahnungslos über der gestrichelten Linie. Es war ein zurückgestellter Beitritt, das heißt, dass ich sechs Monate Zeit hatte, bevor ich die Grundausbildung antreten musste.
Was eine gute Sache war. Ich konnte mich zwar über Wasser halten, aber nicht schwimmen. Ich hatte niemals einen Klimmzug auch nur versucht. Laut der Broschüre, die praktischerweise meinen Anmeldeunterlagen beigefügt war, musste ich im Eignungstest mindestens acht Klimmzüge schaffen, wenn ich überhaupt am SEAL-Lehrgang teilnehmen wollte. Und das nach fünfhundert Metern Schwimmen, zweiundvierzig Liegestützen und fünfzig Sit-ups. Und vor dem Lauf, versteht sich.
Ich beschloss, meine Arbeit am Fließband an den Nagel zu hängen und meine Zeit voll und ganz der Vorbereitung auf den SEAL-Eignungstest zu widmen.
Monatelang hatte ich Steine geschaufelt und war stärker geworden. Wie schwer konnte das alles schon sein? Ich rannte motiviert in einen Park, der in der Nähe unseres Hauses lag und in dem eine rostige alte Klimmzugstange stand, um zu sehen, wie viele Klimmzüge ich über die acht Pflichtwiederholungen hinaus machen konnte. Ich sprang mühelos hoch, packte selbstbewusst die Metallstange und zog. Eins!
Die Schwerkraft riss meine Arme in die Streckung. Ich musste meine ganze Willenskraft aufbringen, um die Stange nicht loszulassen. Mein Gehirn gab meinem Bizeps den verzweifelten Befehl, sich anzuspannen und den Körper wieder hochzuziehen. Aber mein Bizeps antwortete mit: »Leck mich!«
Die Worte, an die ich dachte, waren so klar und deutlich, als hätte ich sie laut ausgesprochen. »Oh Gott, das ist echt anstrengend. Ich muss besser werden!«
Aber mein Optimismus hatte sich noch nicht ganz in Wohlgefallen aufgelöst. Das sollte sich schnell ändern. Kurz danach ging ich ins Schwimmbad meines alten Colleges – ich hatte zum Glück noch meinen Studentenausweis. Ich dachte, dass ich mit schnellen tausend Metern anfangen würde, also vierzig Bahnen. Nach der zweiten Bahn brannten meine Arme und meine Beine fühlten sich an, als würden sie gleich krampfen. Ich konnte mich kaum aus dem Becken hieven.
Okay, das war peinlich. Aber ich hatte die Flinte noch nicht ins Korn geworfen. Ich trainierte jeden Tag. Eines Tages hatte ich das Glück, im Schwimmbad einem alten Schulfreund zu begegnen, der sich gerade darauf vorbereitete, die nächsten vier Jahre an der Universität von Notre Dame zu schwimmen. Als er sah, wie ich durchs Wasser pflügte, fragte er: »Was machst du denn hier?«
»Ich bin gerade der Navy beigetreten«, sagte ich. »Ich werde den SEAL-Kurs machen. Ich habe gehört, die schwimmen da eine Meile am Tag.«
Er sah mich an und schüttelte den Kopf. »Alter, du hast keine Ahnung, worauf du dich da eingelassen hast. Es besteht eine tausendprozentige Wahrscheinlichkeit, dass du durchfällst. Geh wieder ins Becken.«
Er zeigte mir einige Schwimmtechniken und ich setzte alles daran, sie zu beherrschen. Mein Stiefvater montierte mir im Keller meiner Mutter eine Klimmzugstange. Ich ging dorthin, legte UseYourIllusionI und II von Guns N’ Roses ein, drehte die Lautstärke voll auf und riss einen Klimmzug nach dem anderen herunter.
Mir kam erst später in den Sinn, dass der Albumtitel treffend war, denn um mich zu motivieren, stellte ich mir vor – obwohl die Wahrscheinlichkeit verschwindend gering war –, dass ich ein SEAL werden konnte. Ich fing an, etwas Wichtiges zu begreifen: Wenn man besser darin werden will, Klimmzüge zu machen, muss man mehr Klimmzüge machen. So einfach ist das. Und genau das tat ich.
Ich hatte den großen Vorteil, dass ich schon immer ein guter Läufer gewesen war. Ich hatte eine feste Laufroute, eine gerade Strecke, die vom Haus meiner Mutter an den Häusern meines besten Freundes und meines Cousins vorbei zu einer Ampel führte, die genau eine Meile entfernt war. Ich wollte die Strecke immer unter sechs Minuten laufen. An der Ampel atmete ich dreißig Sekunden durch und rannte dann zurück.
Das tat ich jeden Morgen, sieben Tage in der Woche. Ich stand auf und ging ins Schwimmbad, um einige Stunden zu schwimmen, kehrte nach Hause zurück, aß mein Frühstück, machte meine Klimmzüge und ging dann laufen. Sechs Monate lang war das mein Alltag. Abends lieferte ich Pizza aus. Es war eine schöne Zeit. Und ich wurde stärker.
________________
Am Sonntag, dem 28. Januar 1996, traf ich in der Einberufungszentrale von Butte ein, um meinen Militärdienst anzutreten. Aber es gab ein Problem.
Meine Anmeldung bei der Navy lag schon eine Weile zurück und ich hatte fast vergessen, dass ich in dem Wust von Unterlagen und Formularen angekreuzt hatte, dass ich in der Vergangenheit Marihuana konsumiert hatte. Ich hatte das Zeug nur wenige Male ausprobiert, und um ehrlich zu sein, machte mir das Kiffen nicht einmal besonders großen Spaß, aber ich wurde von der Navy als Sünder hingestellt, der Buße tun musste. Wenn ich mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit zurückreisen und meinem jüngeren Ich von damals einen Rat geben könnte, würde ich sagen: »Mach locker, Kumpel. Du hast das letzte Mal vor etwa einem Jahr gekifft; also alles kein Problem. Sag nichts. Damit ersparst du uns allen eine Menge Zeit und Ärger. Pinkel in den Becher, unterschreib die verdammten Unterlagen – und stürzen wir uns ins Abenteuer.«
Aber ich hatte diesen Rat nicht. Also musste ich ein langes und unangenehmes Gespräch mit einem Mann führen, der mir als »Der Kommandant« vorgestellt wurde, und ich musste ihm hoch und heilig versprechen, dass ich mir eigenhändig die Leber aus dem Leib schneiden und roh verspeisen würde, bevor ich jemals wieder das Teufelszeug anfassen würde. Ich bin sicher, dass auch er etwas Besseres zu tun hatte, als einem achtzehnjährigen Jugendlichen aus Butte eine Moralpredigt zu halten. Beispielsweise selbst Gras zu rauchen. Auf jeden Fall brachten wir es hinter uns und ich durfte der Navy beitreten.
Ich habe immer noch ein Foto von mir, wie ich den Eid ablege, dieses Land gegen alle Feinde im In- und Ausland zu verteidigen. Ich trug ein knallrotes T-Shirt, sehr stilvoll für einen solchen feierlichen Anlass.
Aus irgendeinem Grund hatte die Navy für mich ein Hotelzimmer in der Nähe der Einberufungszentrale reserviert. Ich wurde am nächsten Tag zum Flughafen gebracht. Womöglich wollte man mich im Auge behalten und sichergehen, dass ich keine kalten Füße bekam. Es war das erste Mal, dass ich alleine eine Nacht in einem Hotelzimmer verbrachte. Ich saß in dem kleinen, kargen Zimmer, mit meinem Seesack auf dem Bett neben mir, und dachte mir: Warum muss ich die letzte Nacht in dieser Stadt hier verbringen, wenn ich doch auch zu Hause schlafen könnte?
An jenem Abend schaute ich mir zusammen mit meiner Familie und meinem besten Freund den Super Bowl XXX an, in dem die Steelers eine Niederlage gegen die Cowboys kassierten. Am nächsten Morgen fuhr die ganze Truppe mit mir zum Bert-Mooney-Airport von Butte, um mich zu verabschieden. Ich war erleichtert, als ich feststellte, dass ein anderer Rekrut mit mir im Flugzeug war. Er hieß Tracy Longmire, hatte in meinem alten College in der Footballmannschaft gespielt und war einer jener harten Kerle, die sowohl in der Offense als auch Defense eingesetzt wurden. So sah er auch aus: groß und grimmig, mit kahl geschorenem Kopf und stechendem Blick. Aber er war ein netter Kerl. Er strahlte von Anfang an Ruhe und Ausgeglichenheit aus. Obwohl er nur zwei Jahre älter war als ich, wirkte er weise, bescheiden – obwohl er sich mir als naivem Jugendlichen gegenüber deutlich überlegener hätte geben können – und gab mir viele gute Tipps. Er machte den Eindruck, als hätte er alles schon erlebt, und ich war froh, dass er da war. Als wir gemeinsam zum Flugzeug gingen, warf ich meiner Familie einen letzten Blick zu. Niemand sagte etwas, sie beobachteten mich nur, wie ich mich Schritt für Schritt von ihnen entfernte. Schließlich lehnte sich mein Bruder Tom nach vorne und rief: »Viel Glück, Rob!« Ich werde das nie vergessen. Er dachte sich bestimmt: Viel Glück, die Stadt zu verlassen und deinen eigenen Weg zu gehen.
Niemand von uns hätte sich seinerzeit vorstellen, ausmalen oder sogar träumen können, dass ich fünfzehn Jahre später im zweiten Stock eines streng geheimen Gebäudekomplexes in einem Land, das mir als Jugendlichem kein Begriff war, einen Wahnsinnigen stellen würde, den meistgesuchten Mann der Welt, und die Menschen in Washington D.C. und New York deswegen auf den Straßen jubeln würden. Viel Glück, Rob, wirklich. Du kannst es brauchen.
Kapitel Zwei
Tracy und ich verließen das Flugzeug in Chicago und stiegen in einen Bus mit künftigen Matrosen, die alle zur Navy gegangen waren, um SEALs zu werden … außer Tracy, der eine Karriere als Feuerwehrmann anstrebte. Er hätte vermutlich in dem ganzen verdammten Bus den besten SEAL abgegeben.
Als ich den Gesprächen der Rekruten zuhörte, erfuhr ich, dass 99 Prozent von ihnen SEALs werden wollten. Sie hatten alle Bücher darüber gelesen und meinten genau zu wissen, wie man ein SEAL wird, und das gaben sie auch lautstark von sich. Die meisten Jungs stemmten im Bankdrücken zweihundertzwanzig Kilogramm. Zumindest behaupteten sie das. Weit und breit war kein Kraftraum da, also musste man diese Behauptung stehen lassen. Ich hörte mehr als nur einen jungen Mann sagen, dass er sich absolut sicher sei, dass er das berühmt-berüchtigte Auswahlverfahren bestehen und zu den SEAL gehen würde. Was am schlimmsten daran war: Ich glaubte das auch noch. Ich dachte, dass ich mich mit meinem eigenen Fitnessprogramm gut vorbereitet hätte, aber jetzt machte ich gerade die Bekanntschaft mit Jungs, die aus der Großstadt kamen, mehr wussten als ich und eindeutig besser vorbereitet waren.
Ich fing an mich zu fragen: Warum habe ich mir überhaupt die Mühe gemacht? Ich komme aus Butte, Montana. Ich bin nicht so stark oder so gut vorbereitet wie die Jungs aus Denver oder Seattle oder woher auch immer. �
In dem Alter erkennt man nicht, dass dieses großspurige Gehabe hundertprozentiger Schwachsinn ist. Es ist leicht, der Herde zu folgen, sich auf den Boden zu werfen und aufzugeben. Sich hinzulegen und einfach zu sterben. Aus Scham im Erdboden zu versinken und es damit gut sein zu lassen.
Es stellt sich dann heraus, dass es genau das ist, wonach die SEAL-Anwerber Ausschau halten. Sie wollen den Mann, der die widrigen Bedingungen erkennt, versteht, warum seine Kameraden aufgeben und trotzdem entschlossen sagt: »Nein. Damit gebe ich mich nicht zufrieden; ich folge nicht dem Status quo. Ich habe keine Angst, ich bleibe gelassen. Ich mache weiter und will wissen, was als Nächstes kommt.«
Ich brauchte allerdings eine Weile, bis ich das erkannte. Die Jungs im Bus hatten Angst, ich hatte Angst. Tracy war nervös, aber bei ihm war es eher Neugier, nicht Angst.
Nach unserer Ankunft am Check-in-Center an der Naval Station Great Lakes, Illinois, wurden wir sofort von den Recruit Division Commanders (RDC) angebrüllt. Das sind die Ausbilder in der Grundausbildung. Sie waren gut und ließen keine Gelegenheit aus, uns klarzumachen, dass wir nichts weiter als kleine stinkende Maden waren, aber um ehrlich zu sein, ich hatte schon so oft Full Metal Jacket und andere Kriegsfilme gesehen, dass ich keine allzu große Angst vor ihnen hatte. Damit keine Missverständnisse aufkommen: Ich hatte allerhöchsten Respekt vor ihnen und sie waren absolute Profis … es war nur so, dass Gunny Highway, Gunny Foley oder Gunny Hartman nicht aufkreuzten.
Und trotzdem … ich saß in einem Bus voller Fremder und beobachtete, wie fiese Kerle in Matrosenmützen die Insassen wahllos anbrüllten. Ich dachte mir: Oh Gott, ich habe eine schreckliche Entscheidung getroffen. Ich kann nicht glauben, dass ich mich darauf eingelassen habe.
Für einen typischen weißen Kleinstadtjungen wie mich war die Grundausbildung wie die düstere Spelunke im ersten Star-Wars-Film. Jeder sprach seltsam (nur ich nicht). Es gab typische Südstaatler – ich lachte mich kaputt, wenn sie das Wort »Feldflasche« in den Mund nahmen. Es gab deutliche Dialektunterschiede zwischen West Virginia, South Carolina und Texas. Wir hatten auch einige Leute aus den Philippinen da, von denen ein Mann sogar kein einziges Wort Englisch sprach, sie unterhielten sich untereinander auf Tagalog oder Filipino. Sie hätten genauso gut Wookiee sprechen können, ich hätte keinen Unterschied gemerkt. Die beiden Typen aus Brooklyn waren fast genauso schwer zu verstehen. Es waren auch mehrere Schwarze da, die aus verschiedenen Teilen des Landes kamen. Der Typ aus Mississippi war vermutlich der netteste Kerl in der Kompanie und weltbewandert – eine Art James Bond aus den Südstaaten. Es gab auch einige Kameraden aus den Großstadt-Ghettos. Sehr coole Jungs, die zum Militär wollten, um eine Zeit lang ihrem Umfeld zu entfliehen. Wir alle hatten eine Gemeinsamkeit: Worauf zum Teufel habe ich mich da nur eingelassen?
Durch die Filme war ich davon ausgegangen, dass die Grundausbildung aus endlosen Liegestützen im Schlamm und ewigen Dauerläufen bestand, sofern man nicht gerade unter Stacheldraht hindurchrobben musste. Aber die Navy-Grundausbildung ist ganz anders. Wir verbrachten unsere Tage im Klassenzimmer, lernten die Verhaltensweisen und Gepflogenheiten der Navy kennen und ließen uns anbrüllen. Außerdem mussten wir putzen und zusammenlegen – Kleidung, Bettlaken, Fahnen und überhaupt alles, was sich in irgendeiner Weise zusammenlegen ließ. Zusammenlegen spielt in der Navy eine große Rolle. Matrosen leben in beengten Verhältnissen. Deshalb mussten wir wissen, wie wir unsere Sachen kompakt und klein falten konnten. Es war erstaunlich, wie viele Dinge wir zusammenlegten. Ich lege meine Handtücher heute noch so zusammen, wie ich es dort gelernt habe.
Es gab eine coole Woche, in der wir lernten, wie man Brände löscht und welche verschiedenen Arten von Feuer es gibt. Typischer Navy-Kram, aber ich fand es toll. Ich liebte die Bräuche der Navy. Ich benutze immer noch gerne den Ausdruck »Schiffskamerad«. Ich liebe das Wort. Ich könnte mir vorstellen, eine Bar zu eröffnen und sie »Zum Schiffskamerad« zu nennen. Alle Türsteher müssten jeden Satz mit diesem Wort beenden. Wenn sie also einen Betrunkenen hinauswerfen, würden sie dann etwas sagen wie »Verschwinde aus dem Schiffskamerad … Schiffskamerad!«
Aber meist legten wir irgendwelche Sachen zusammen, und wenn wir nicht gerade lernten, wie man Sachen zusammenlegt, lernten wir, wie man marschiert. Tatsächlich dauert es Wochen, bis Rekruten richtig gehen können. Und Gehen war so ziemlich unsere einzige körperliche Betätigung. Wir durften kein Krafttraining machen. Ich hatte sechs Monate damit zugebracht, für den SEAL-Test in Form zu kommen, und jetzt aßen wir ungesundes Essen, saßen den ganzen Tag im Klassenzimmer herum und legten alles zusammen, was uns in die Finger kam. »Wir werden fett«, sagte ich zu jedem, der mir über den Weg lief. »Wir gehen in die Breite. Wir laufen nicht. Wir machen gar nichts. Und alles, was wir essen, schwimmt in Bratensoße.«
Ich wollte unbedingt den SEAL-Eignungstest ablegen, bevor ich mich in einen Fettkloß verwandelte. Die Tests fanden immer dienstags und donnerstags statt. Ich hatte mich für den ersten Termin angemeldet. Das war ein großer Fehler. Es war zufällig der Tag, an dem wir geimpft wurden. Die Navy ist bekannt dafür, ihren Matrosen Tausende von Impfungen zu verpassen. Ich wachte am nächsten Morgen auf und fühlte mich elend, war mit Beulen und blauen Flecken übersät, meine Zunge war pelzig und auf die doppelte Größe angeschwollen. Ich zwang mich aufzustehen, konnte mich aber kaum auf den Beinen halten. Ich hatte starke Zweifel, dass ich auch nur einen Klimmzug schaffte – die acht Wiederholungen, die man machen musste, um zu bestehen, schienen in weiter Ferne.
Das Zähneputzen an jenem Morgen war eine echte Herausforderung. Der Test schien praktisch unmöglich zu sein: zwanzig Bahnen (fünfhundert Meter) schwimmen, zehn Minuten Pause; zweiundvierzig Liegestütze, zwei Minuten Pause; fünfzig Sit-ups, zwei Minuten Pause; die gefürchteten acht Klimmzüge; zehn Minuten Pause; zweieinhalb Kilometer in elfeinhalb Minuten laufen. Mit Stiefeln.
Ich schleppte mich in die große Schwimmhalle, in der zwischenzeitlich eine Tribüne aufgebaut worden war. Eine große SEAL-Fahne hing an der Wand. Das SEAL-Abzeichen ist ein Adler (der unsere Fähigkeit darstellt, aus der Luft anzugreifen), der auf einem Anker sitzt (schließlich gehören wir der Marine an) und den Dreizack Neptuns in einer Klaue hält (weil wir es auf dem Meer ordentlich krachen lassen) und eine Perkussionspistole in der anderen Klaue (ein dezenter Hinweis darauf, dass wir es auch an Land ordentlich krachen lassen können). Mit dem Adler sollte man sich also nicht anlegen.
Ich stolperte auf die Tribüne und nahm ziemlich weit oben Platz. Ein SEAL erschien unten, um sich die neuen Rekruten anzusehen. Er trug eine blaue Badehose mit dem »SEAL Team Three«-Abzeichen darauf, sonst nichts. Das Einzige, was noch auffälliger war als meine schreckliche Entscheidung, der Navy beizutreten, waren die durchtrainierten, wie aus Stein gemeißelten Bauchmuskeln des Mannes. Er ging an der Tribüne vorbei, sah uns an, steuerte den Turm an, stieg selbstbewusst hinauf, sprang so kunstvoll ins Wasser, dass Greg Louganis sich ehrfurchtsvoll verneigt hätte, und tauchte präzise und kompakt ins Wasser ein. Mit formvollendeten, kraftvollen Zügen schwamm er davon, schwang sich mühelos aus dem Becken und verwand in die Umkleidekabine, ohne sich noch einmal umzusehen, als ob er genau wusste, dass niemand von uns einen zweiten Blick verdient hätte.
Ich sah auf die fünfhundert kahl geschorenen Köpfe der Rekruten, die auf der Bestuhlung vor mir Platz genommen hatten. Sie drehten sich gleichzeitig zu einem zweiten SEAL um, der am Beckenrand stand und Prüfungshinweise gab. Ich kam mir plötzlich ziemlich dumm vor. Jeder dieser fünfhundert Möchtegern-Helden dachte, dass er ein SEAL werden konnte, so wie praktisch jeder andere Mann, der zur Navy ging. In welcher Weise setzte ich mich von ihnen ab?
Die einzige kluge Entscheidung, die ich traf, als ich mich bei der Navy verpflichtete – und das auch nur, weil mein Freund, der Marine, mich dazu gedrängt hatte –, war, darauf zu bestehen, dass der Anwerber den schriftlichen Vermerk machte, dass ich drei Versuche hatte, den SEAL-Eignungstest zu bestehen. Das war mein Glück.
Irgendwie bestand ich das Schwimmen. Aber sobald ich mit den Liegestützen anfing, die absolut perfekt sein mussten, weil sie sonst für ungültig erklärt wurden, wusste ich, dass ich die zweiundvierzig Wiederholungen nicht schaffen würde. Ich war der Versager, der ich nicht sein wollte. Ich hatte nichts vorzuweisen.
Bis auf … die unterschriebene Zusage, dass ich noch zwei weitere Versuche hatte. Am Donnerstag hatte mein Körper das Gift abgebaut, das man mir am Montag gespritzt hatte, und ich fühlte mich auf der Tribüne am Schwimmbecken wie ein neuer Mensch. Ich war wieder der beharrliche junge Mann, der sechs Monate damit zugebracht hatte, sich auf diesen Augenblick vorzubereiten. Wie sich herausstellte, war ich einer der wenigen Rekruten, die sich überhaupt vorbereitet hatten. Das war mein erster kleiner Ausblick auf die Wahrheit, die mir in den nächsten Jahren immer wieder vor Augen geführt werden sollte: Vorbereitung ist alles.
Wir durchliefen das 500-Meter-Schwimmen in verschiedenen Ausscheidungsrunden. Von den fünfhundert Rekruten war ich nur einer von zehn Mann, die weiterkamen.
Wir hatten zehn Minuten Pause, um uns anzuziehen, dann ging es mit den Liegestützen weiter. In dieser Runde schieden zwei weitere Rekruten aus. Der Rest kam weiter. Die letzte Testrunde – jede dieser Übungen heißt aus gutem Grund »Evolution« – war der 2,5-Kilometer-Lauf in Kampfstiefeln. Wir mussten die Strecke in unter elfeinhalb Minuten schaffen. Es schieden vier weitere Rekruten aus.
Fünfhundert Mann, die alle überzeugt gewesen waren, dass sie das Zeug zum SEAL hatten, und übrig blieben vier. Und das war nur die Eignungsprüfung, mit der man sich für den achtundzwanzig Wochen dauernden SEAL-Lehrgang qualifizierte – Basic Underwater Demolition/SEAL (BUD/S) –, der die Eignungsprüfung aussehen lässt, als würde man an einem schattigen Plätzchen in einer Hängematte liegen und Piña Coladas schlürfen.
Aber ich war hoch motiviert. Jetzt wusste ich, dass ich auf jeden Fall ins BUD/S kommen würde. Allein der Gedanke beflügelte mich: Ich konnte nach Coronado gehen – einen Navy-Stützpunkt auf einer Halbinsel an der San Diego Bay, die neben dem liegt, was in Reiseprospekten als »anheimelnder, sonniger Erholungsort« bezeichnet wird. Badestrände, Bräute und Bier – und ich mittendrin, in der grünen Uniform eines SEAL-Rekruten.
________________
Nachdem ich mich verpflichtet hatte, habe ich mir alle möglichen SEAL-Filme angesehen und jedes Buch gelesen, das ich in die Finger bekam. Ich erfuhr, dass SEAL kein Verweis auf die Robbe (englisch: seal) ist, sondern für »SEa, Air, Land« steht. Man wollte aber sicher einen Bezug zu dem stromlinienförmigen und flinken Tier herstellen, weil das E von »Sea« berücksichtigt wurde. Eigentlich müsste es SAL heißen, klingt aber nicht so griffig.
Die SEAL-Teams entwickelten sich aus den Navy-Einheiten der Froschmänner im Zweiten Weltkrieg, die speziell für die Aufklärung und Sprengung von Zielen unter Wasser ausgebildet worden waren. Sie hatten die Aufgabe, die besten Routen für Landeoperationen zu finden und Hindernisse zu zerstören, die den Invasionstruppen möglicherweise im Weg waren. Im Koreakrieg arbeiteten die UDTs – Underwater Demolition Teams – so unauffällig und effektiv, dass sich ihre Rolle ausweitete und sie auch Einsätze an Land hatten, bei denen sie feindliche Eisenbahntunnel und -brücken sprengten. Einer der damaligen UDT-Offiziere, Lt. Ted Fielding, gab die berühmte Erklärung ab, dass dieser erweiterte Aufgabenbereich darauf zurückzuführen sei, dass »wir dazu bereit waren, das zu tun, was niemand sonst tun konnte oder wollte«.
Die Navy erkannte, dass sich die Kriegsführung änderte. Aus diesem Grund beschloss sie 1961, aus den UDTs Guerilla- und Konterguerilla-Einheiten zu machen, deren Einsatzbereich nun nicht mehr nur auf Wasser und Strände beschränkt war. Damals kamen SEa, Air und Land hinzu. Die ersten beiden SEAL-Teams entstanden 1962. Team One war in Coronado stationiert, Team Two in Virginia Beach. SEALs haben seither in jedem militärischen Konflikt und Krieg mit amerikanischer Beteiligung eine tragende Rolle gespielt.
»Sie müssen Ihre Wurzeln kennen, meine Herren!«, ist eine typische Redewendung, die wir benutzen: Man muss wissen, woher man kommt. Ich erinnere mich daran, wie ich vor einigen Jahren einmal an einem SEAL-Treffen in Virginia Beach teilnahm und einem Froschmann über den Weg lief, der eine Baseballkappe für Weltkriegsveteranen trug. Dafür, dass er schon über neunzig Jahre alt war, sah er noch recht fit aus. Ich wollte klug wirken und fragte ihn: »Wann war Ihre Höllenwoche?«
»Am 6. Juni 1944«, antwortete er.
Ich erwiderte: »1944 gab es noch gar kein BUD/S«, und dachte, dass ich ziemlich clever war.
»Das war auf Omaha Beach, Junge. Kenne deine Wurzeln.«
Und jetzt würde ich ein Teil davon werden.
Oder zumindest hatte ich die Aussicht darauf, sofern ich die Wiederholung des BUD/S-Test nicht vermasselte. Mir fiel bei meinem ersten Versuch etwas auf: Es gab im Beckenbereich Telefone, und bei all den Navy-Leuten, die sich auf die Prüflinge konzentrierten, konnte ich mich davonschleichen und meine Familie anrufen, wozu ich in der Grundausbildung selten kam. Ich wollte auch möglichst fit bleiben, um die besten Voraussetzungen für Coronado zu haben, und Kleidung zusammenlegen und Marschieren waren nicht unbedingt die besten Maßnahmen. Also waren ständige Wiederholungen des bereits bestandenen Tests die beste Gelegenheit, um mehr trainieren zu können.
Jeden Dienstag und Donnerstag ging ich in die Schwimmhalle und nahm an dem Test teil, machte alle Übungen und rief zu Hause an. Das war ein guter Deal, sofern ich jedes Mal aufs Neue bestand. Wenn ich nämlich patzte, einen schlechten Tag hatte oder auch nur eine Wiederholung für ungültig erklärt wurde, würde ich meine Reise an den Strand von Coronado nicht antreten dürfen. Ich muss den Test wohl an die zehn Mal gemacht haben und zum Glück verbesserten sich meine Ergebnisse mit jeder Wiederholung.
Einer meiner besten Freunde in der Grundausbildung war Matthew Parris. Ich traf ihn am ersten Tag in den Unterkünften, wo wir in Kompanien zu jeweils etwa siebzig Rekruten aufgeteilt wurden. Matthew und ich waren in derselben Kompanie. Ich sah von Anfang an zu ihm auf, weil er sich bereits wie ein echter Soldat verhielt. Er war so militärisch eingestellt, dass er das Abzeichen eines Drill Sergeant mit der Aufschrift »This We’ll Defend« als Tätowierung auf der Brust trug. Das war nicht weiter verwunderlich, weil er ein Drill Sergeant in der Army gewesen war, der beschlossen hatte, bei der Navy wieder ganz unten anzufangen, weil er … Sie ahnen es, ein SEAL werden wollte.
Als seine Dienstzeit in der Army zu Ende war, marschierte er in das Rekrutierungsbüro der Navy – ganz in Schwarz, mit polierten Kampfstiefeln, Stirnband und allem, was dazugehört, im Versuch, möglichst hart auszusehen – und erklärte dem Anwerber: »Machen Sie aus mir einen SEAL.« Der Anwerber sah ihn nur spöttisch an. »Sie? Wohl kaum«, meinte er.
Matthew gab gerne an, aber er war auch ein lustiger Kerl, selbst wenn der Scherz auf seine Kosten ging. Matthew fiel bei seinem ersten Versuch des BUD/S-Eignungstests durch, an dem Tag, an dem ich bestand. Ich war nächste Woche wieder da und machte den Test zur Übung erneut und diesmal schafften wir ihn beide. Trotz ihres zuvor großspurigen Gehabes nahmen nur etwa ein halbes Dutzend Männer in unserer Kompanie an dem Test teil und nur wir beide bestanden ihn. Ich feierte mit Matthew seinen Erfolg und wir wurden sofort gute Freunde. Wir trainierten oft noch gemeinsam, als die Lichter ausgeschaltet worden und die Ausbilder gegangen waren. Wir machten Klimmzüge an Treppen, Sit-ups am Boden und Dips zwischen zwei Waschbecken. Es gab Zeiten, in denen wir im Laufe eines Tages über tausend Liegestütze machten.
Als die Grundausbildung zu Ende ging, steckten wir unsere kahlgeschorenen Köpfe zusammen und beschlossen, für die erforderliche Zusatzqualifikation die Aircrew Survival Equipmentman School in Millington, Tennessee, zu besuchen. Aus dem sperrigen Namen hätte man es nicht unbedingt ableiten können, aber in diesem Kurs lernte man, wie man Fallschirme packt, wozu auch Nähen gehört. Schließt man diese Ausbildung erfolgreich ab, gilt man fortan unter seinen Kameraden als »Nähnutte«. Matthew und ich waren der Navy nicht beigetreten, um Nähnutten zu werden. Wir wollten zu den SEALs gehen. Aber wir belegten den Kurs, weil er der kürzeste war. Das brachte uns am schnellsten nach Coronado und dann war es uns egal, wie man uns nannte.
Es stellte sich schließlich heraus, dass die Aircrew Survival Equipmentman School ziemlich cool war. Ich hatte eine neue Koje (»Bett« für alle Landratten), einen größeren Spind und ein Schwimmbecken in der Nähe, das Matthew und ich jeden Tag benutzten. Und ich wollte wirklich lernen, wie man näht. Ein schwarzer Marine Staff Sergeant, ein Hüne, brachte es mir bei. Ich dachte, dass es gut möglich war, dass er der härteste Mann der Welt war. Diese Ausbildung war meine erste Erfahrung mit dem US Marine Corps und dieser Typ hätte auf einem Werbeposter abgebildet sein können. Die Ärmel seiner Feldbluse waren genau bis zur Mitte des Oberarms hochgerollt, sodass man seinen gewaltigen Bizeps sehen konnte. Bis heute weiß ich nicht, wie er es geschafft hat, seine Arme durch die Ärmel zu zwängen. Seine Hosenbeine schlossen perfekt am Schaft der spiegelblank polierten Stiefel ab. Bestimmt futterte er Stacheldraht und furzte Napalm. Seine Nackenmuskeln waren so gewaltig, dass es beinahe so aussah, als hätte er gar keinen Hals, und ich bin mir absolut sicher, dass er vor rein gar nichts Angst hatte. Einmal redete ihn Matthew mit »Sergeant« an, was in der Army durchaus gebräuchlich ist. Aber nicht im Marine Corps. Da heißt es Staff Sergeant. »Oh Gott, du bist so was von im Arsch«, flüsterte einer der Marines, als er das hörte. Matthew hatte wirklich die Hosen voll, als der Staff Sergeant seinen gewaltigen Kiefer anspannte und ihn mit bebenden Nasenflügeln in Grund und Boden starrte. Er sagte nichts. Das musste er auch nicht. Der Mann war ein Tier!
Ich werde niemals vergessen, wie er mir zeigte, wie man Faden auf eine Spule wickelt – etwas, das meine Oma vielleicht getan hätte.
An unserem ersten freien Wochenende fuhren Matthew und ich nach Memphis, wo wir uns ein Hotelzimmer teilten und die Beale Street unsicher machten. Ich erinnere mich, wie ich mich betrunken auf eine Bank setzte, die neben einigen Restaurants stand. Wir hatten Hochprozentiges getrunken. Matthew saß neben mir und hielt seinen Kopf in den Händen. Einige Kellner von einem benachbarten Restaurant, die gerade Pause hatten und herumstanden, lachten sich darüber kaputt, wie fertig wir aussahen.
Ich hörte, wie einer der Männer zu dem anderen sagte: »… und dabei sitzen sie nur herum.«
Matthew nahm das als Stichwort, um zu würgen und sich auf seine Schuhe zu erbrechen.
Kellner Nr. 2: »Oh, lecker.«