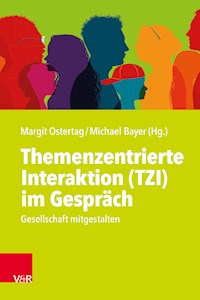
Themenzentrierte Interaktion (TZI) im Gespräch E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Als eine Theorie und Praxis der Verständigung kann die Themenzentrierte Interaktion (TZI) zu einer solidarischen und menschenwürdigen Gestaltung unseres zwischenmenschlichen, gesellschaftlichen und globalen Zusammenlebens beitragen. Der vorliegende Band greift das kritische Potenzial der Themenzentrierten Interaktion auf und bringt sie ins Gespräch – sowohl in gesellschaftliche als auch in wissenschaftliche Diskurse. Acht Autor:innen beleuchten pädagogische, soziologische, philosophische, ethische, politik- und sprachwissenschaftliche Perspektiven auf verschiedenste Themen wie antidiskriminierender Sprachgebrauch, Nachhaltigkeit und kritischer Konsum.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Margit Ostertag/Michael Bayer (Hg.)
Themenzentrierte Interaktion (TZI) im Gespräch
Gesellschaft mitgestalten
Vandenhoeck & Ruprecht
Mit 5 Abbildungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: melitas/shutterstock.com
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-99376-8
Inhalt
MICHAEL BAYER UND MARGIT OSTERTAG
Themenzentrierte Interaktion heute.Ein Prolog
1ZUR EINFÜHRUNG
MARGIT OSTERTAG
Themenzentrierte Interaktion als Theorie und Praxis der Verständigung.Mit Hoffnung leben in einer konfliktreichen Welt
2THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND PERSPEKTIVEN
MARGIT OSTERTAG
Bildungstheoretische Zugänge zur Themenzentrierten Interaktion.Eine Pädagogik der Verständigung
MARGIT OSTERTAG UND MICHAEL BAYER
Resonanzräume gestalten mit Themenzentrierter Interaktion.
Reflexionen zur Verbindung der Ansätze von Ruth C. Cohn und Hartmut Rosa
MICHAEL BAYER UND MARGIT OSTERTAG
Perspektiven der empirischen Bildungsforschung auf die Themenzentrierte Interaktion.Eine kritische Diskussion
3THEMENZENTRIERTE INTERAKTION IN WISSENSCHAFTLICHEN UND GESELLSCHAFTLICHEN DISKURSEN
KRISTINA BERGLER
Lebenslanges Lernen wird lebendig.Begründung einer ethischen Erweiterung Lebenslangen Lernens auf Basis der Themenzentrierten Interaktion
ANDREA NICKEL-SCHWÄBISCH
Die Themenzentrierte Interaktion im Gespräch mit der anthropologischen Grundlegung Martin Bubers.Impulse für eine von Entfremdung und Resonanzarmut geprägte Zeit
INA VON SECKENDORFF
»Ich sehe was, was Du nicht siehst!«Was ein antidiskriminierender Sprachgebrauch mit der Themenzentrierten Interaktion zu tun hat
UWE KRANENPOHL
Woran uns die Themenzentrierte Interaktion politisch erinnern kann.Möglichkeiten und Grenzen ihrer politischen Wirksamkeit
JULIA RAAB
Bewusstheit und Verantwortlichkeit leben.Eine Verknüpfung von Theorie und Praxis intentionaler Gemeinschaften mit der Themenzentrierten Interaktion
LEOPOLD WANNINGER
Störung Konsum?Mit Themenzentrierter Interaktion vom kritischen Konsum zum lebensdienlichen Wirtschaften
Verzeichnis der Autor*innen
MICHAEL BAYER UND MARGIT OSTERTAG
Themenzentrierte Interaktion heute
Ein Prolog
Die Themenzentrierte Interaktion (TZI) wurde in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts von Ruth C. Cohn (1912–2010) im Kontext der humanistischen Psychologie in den USA entwickelt. Kennzeichnend für die TZI als praxisorientierte Handlungstheorie ist ein dynamisches Zusammenwirken von Person- und Aufgabenorientierung. In der Gestaltung von Lebens-, Lern- und Arbeitssituationen werden die beteiligten Personen und die anstehenden Aufgaben als gleichermaßen wichtig wahr- und ernstgenommen, was wesentlich zu einem achtsamen und verständigungsorientierten Miteinander beiträgt. Den werteorientierten Kern der TZI zeichnet eine Vision aus, welche die Mitwirkung an der Gestaltung einer solidarischen und humanen Gesellschaft zu einem zentralen Merkmal dieses Ansatzes macht. Anwendung findet die TZI heute in vielfältigen Bereichen von Lehre, Leitung und Beratung: (Fach-) Schulen, Hochschulen, Fort- und Weiterbildung, Leitung von Gruppen, Teams, Organisationen oder auch ehrenamtlichen Initiativen, Beratung, Supervision, Coaching usw.
Die der TZI eingeschriebene Orientierung, an einer veränderten gesellschaftlichen Praxis mitzuarbeiten, ist auch die visionäre Grundlage von TZI-Ausbildungen. Als erstes Ausbildungsinstitut wurde 1966 das Workshop Institute for Living Learning (WILL) in New York gegründet. Seit 2002 verantwortet das Ruth Cohn Institute for TCI international (RCI-international) alle anerkannten Ausbildungen in Themenzentrierter Interaktion.1
Idee und Umsetzung dieses Buchprojekts sind das Ergebnis intensiver Gespräche und Diskussionen zwischen den beiden Herausgeber*innen, die aus einer Einstellung heraus geführt wurden, die immer auch zugibt – wie es Karl Popper ausgedrückt hat – »daß ich mich irren kann, daß du recht haben kannst und daß wir zusammen vielleicht der Wahrheit auf die Spur kommen werden« (1980, S. 276). Der Buchtitel »Themenzentrierte Interaktion (TZI) im Gespräch. Gesellschaft mitgestalten« integriert drei Anliegen, die mit dem vorliegenden Herausgeber*innenband verbunden sind:
1.Bis heute gibt es sehr unterschiedliche Lesarten der TZI. Die hier beteiligten Autor*innen vereint ein gesellschaftskritischesVerständnis der TZI, wie es auch Ruth C. Cohn selbst verschiedentlich herausgestellt hat, so zum Beispiel in einem Gespräch mit Hilarion Petzold: »Du hast völlig recht, die Rezeption der Leute war unpolitisch. Aber ich betone es hier noch einmal, daß für mich von Anfang an das Politische und das Soziale im Vordergrund standen« (Cohn, 1985, S. 268). In einer solchen Perspektive ist die TZI nicht lediglich als ein praktischer Ansatz zum Leiten von Gruppen zu verstehen, sondern vielmehr als ein auf gesellschaftliche Zusammenhänge abzielender Beitrag zur bewussten, verantwortlichen und humanen Gestaltung menschlichen Zusammenlebens.
2.Eine solche kritische Perspektive der TZI auf gesellschaftliche und politische Dimensionen gilt es immer wieder neu in die jeweilige Gegenwart sowie in konkrete Kontexte und Fragestellungen hinein zu übersetzen, also die »TZI heute« immer wieder neu zu entwickeln und zu verwirklichen. In diesem Sinn lässt sich in Anlehnung an ein Zitat von Paulo Freire formulieren: Die TZI muss »stets neu gefunden und geschaffen werden entsprechend den Erfordernissen – den pädagogischen und politischen Erfordernissen – der jeweils spezifischen Situation« (2007, S. 130).
Verstanden als eine Theorie und Praxis der Verständigung (siehe Ostertag, Teil 1 in diesem Band) kann die TZI in zahlreichen gesellschaftlichen Situationen und Herausforderungen der Gegenwart als werteorientierte Handlungstheorie herangezogen werden – was die Betonung der politischen Dimension und den oben genannten Gedanken der jeweils notwendigen, aktuellen »Übersetzung« zusammenführt.
3.Auszuloten sind darüber hinaus Anschlussmöglichkeiten zu anderen wissenschaftlichen Ansätzen und Disziplinen, um mit diesen in einen Dialog zu treten, der beide Seiten inspirieren kann. Mit der TZI von Beginn an eng verbunden waren die Wissenschaften Psychologie und Pädagogik. Als ausgebildete Psychoanalytikerin hat Ruth C. Cohn mit der TZI sehr bewusst den klassischen therapeutischen Rahmen überschritten, im Kontext der humanistischen Psychologie die TZI entwickelt und sich der pädagogischen Praxis zugewandt. Über viele Jahre überwiegend auf Praxis fokussiert, hat sie sich in späteren Jahren zunehmend auch für wissenschaftliche Fragen interessiert. In Verbindung mit den fachspezifischen Hintergründen der beteiligten Autor*innen kommen in diesem Band insbesondere pädagogische, soziologische, philosophische, ethische, politik- und sprachwissenschaftliche Bezüge in den Blick, was eine wechselseitige Perspektivenerweiterung ermöglicht – und gerne als Einladung zu weiteren wissenschaftlichen Diskussionen verstanden werden darf.
Den Ausgangspunkt des Bandes bildet im ersten Teil »Zur Einführung« ein grundlegender Beitrag (Ostertag) zur TZI als Theorie und Praxis der Verständigung. Er umfasst zum einen eine systematische Einführung in die TZI; zum anderen skizziert er, wie sie für aktuelle gesellschaftliche Fragen bedeutsam werden kann. Darüber hinaus trägt er zu einer wissenschaftlichen Fundierung und Verortung der TZI bei, indem er erste Bezüge zu psychologischen (Carl Rogers), philosophischen (Martin Buber), soziologischen (Hartmut Rosa) und pädagogischen (Paulo Freire) Ansätzen entwickelt.
In den weiteren Beiträgen werden die Grundlagen der TZI als bekannt vorausgesetzt, d. h., die einzelnen Beiträge führen nicht jeweils erneut in die TZI ein. Jeder Beitrag nimmt dennoch insoweit auf die TZI erläuternd Bezug, dass er auch für sich stehen kann. Allen Beiträgen ist zur ersten Orientierung jeweils eine Zusammenfassung vorangestellt.
In den drei Beiträgen des zweiten Teiles werden »Theoretische Grundlagen und Perspektiven« untersucht und reflektiert. Für eine wissenschaftliche Weiterentwicklung der TZI erweisen sich insbesondere pädagogische und soziologische Bezugstheorien als bedeutsam. So wird zunächst die TZI als eine Pädagogik der Verständigung konturiert (Ostertag). Mit der Resonanztheorie von Hartmut Rosa wird anschließend eine Verbindung zwischen TZI und Soziologie näher entfaltet (Ostertag u. Bayer). Eine Erörterung von Möglichkeiten und Grenzen empirischer Forschungszugänge zur TZI schließt dieses Kapitel sodann ab (Bayer u. Ostertag).
Im dritten Teil wird eine breitere Verortung der »TZI in wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskursen« unternommen und in den folgenden sechs Beiträgen entfaltet:
Kristina Bergler greift in ihren Ausführungen den pädagogischen Diskurs auf. Sie fokussiert das in der aktuellen Bildungsdiskussion prominent vertretene Thema Lebenslanges Lernen und arbeitet den funktionalistischen Kern dieses bildungspolitischen Programms heraus. Der damit einhergehenden wirtschaftsorientierten Instrumentalisierung von Lernprozessen setzt sie einen ethisch fundierten Lernbegriff entgegen, den sie aus dem Ansatz der TZI gewinnt und mit den demokratiefördernden Zielsetzungen Lebenslangen Lernens verbindet.
Andrea Nickel-Schwäbisch untersucht in ihrem Beitrag anthropologische Begründungzusammenhänge. Sie reflektiert den Ansatz der TZI aus einer von Martin Bubers Dialogphilosophie sowie Hartmut Rosas Resonanztheorie inspirierten Perspektive und beleuchtet Gemeinsamkeiten der Ansätze hinsichtlich ihrer zeitdiagnostischen Befunde. Den immer weitreichenderen Entfremdungserfahrungen des modernen Subjekts kann die TZI entgegenwirken, indem sie verständigungsorientierte Resonanzräume eröffnet.
Ina von Seckendorff verbindet in ihrer Argumentationslinie sprachwissenschaftliche Positionen mit den werteorientierten Grundlagen der TZI. Vor diesem Hintergrund diskutiert sie die Notwendigkeit eines antidiskriminierenden Sprachgebrauchs und zeigt auf, dass Gerechtigkeit in der Welt stets und zugleich Gerechtigkeit in der Sprache benötigt, da wir mit Sprache nicht nur Welt beschreiben, sondern diese immer auch in einer spezifischen Weise konstruieren.
Uwe Kranenpohl wendet sich der TZI aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive zu und geht der Frage nach, inwiefern die TZI politisch wirksam werden bzw. – noch konkreter – ob und wie sie zum Erfolg einer pluralistischen Demokratie beitragen kann. Er sieht ihren möglichen Anteil nicht auf der Makroebene politischer Entscheidungsprozesse, sondern vielmehr auf der Mikroebene individuellen politischen Handelns – und hier insbesondere in der Einübung eines demokratischen Ethos, das bei den Bürger*innen einer pluralistischen Gesellschaft notwendigerweise vorauszusetzen ist.
Julia Raab interessiert sich für die praktischen Implikationen der TZI hinsichtlich eines bewussten und verantwortlichen Zusammenlebens am Beispiel intentionaler Gemeinschaften. Diese lassen sich aus einer TZI-Perspektive heraus auch als Lern- und Lebenskontexte verstehen, in denen ein Ausbalancieren von Autonomie und Zugehörigkeit im täglichen Miteinander konsequent verwirklicht wird. Beide, die Praxis der gelebten Gemeinschaft sowie die TZI in ihrer praxisorientierten Perspektive, können hierbei voneinander lernen.
Leopold Wanninger setzt sich in seinem, den Band abschließenden, Gedankengang mit den sozialen und ökologischen Folgen von Konsum auseinander. Aus der Perspektive der Postwachstumstheorie konturiert er Konsum als eine mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem unmittelbar verknüpfte Herausforderung. Mit Hilfe des Ansatzes einer integrativen Wirtschaftsethik und in Verknüpfung mit dem Vier-Faktoren-Modell der TZI erarbeitet er Vorschläge für eine gemeinwohlorientierte Weiterentwicklung aktuellen Konsumgeschehens.
Alle Beiträge verbindet die Idee, die TZI in ihrem wertegeleiteten, verständigungsorientierten Potenzial sichtbar zu machen, und zwar sowohl für wissenschaftliche Fragestellungen als auch für gesellschaftliche Herausforderungen. Wir wünschen uns eine breite Leser*innenschaft, die diese Denkanstöße in jeweils eigene Kontexte übersetzt und diskursiv weiterentwickelt.
Literatur
Cohn, R. C. (1985). Über die Bedeutung des Politischen und Kosmischen für mein Denken – Ein Gespräch. Integrative Therapie, 11 (3–4), 264–272.
Freire, P. (2007). Bildung und Hoffnung. Münster: Waxmann.
Popper, K. R. (1980). Die offene Gesellschaft und ihre Feinde II (6. Auflage). Tübingen: A. Francke.
________________________
1https://www.ruth-cohn-institute.org/ueber-uns.html (Zugriff am 22.02.2022)
1Zur Einführung
MARGIT OSTERTAG
Themenzentrierte Interaktion als Theorie und Praxis der Verständigung
Mit Hoffnung leben in einer konfliktreichen Welt1
»Hoffnung ist eben nicht Optimismus.
Es ist nicht die Überzeugung,
daß etwas gut ausgeht,
sondern die Gewißheit,
daß etwas Sinn hat –
ohne Rücksicht darauf,
wie es ausgeht.«
Václav Havel
Zusammenfassung: Die Idee von Hoffnung, wie sie in dem Zitat von Václav Havel (1987, S. 220) zum Ausdruck kommt, lässt sich unmittelbar mit der Themenzentrierten Interaktion (TZI) verbinden. In ihrem Kern ist die TZI von der Vision getragen, an der Gestaltung einer humaneren Welt mitzuwirken. In diesem Sinn kann sie als eine Theorie und Praxis der Verständigung begriffen werden. Vielfältige gesellschaftliche Konflikte sowie globale Krisen stellen uns gegenwärtig vor existenzielle Herausforderungen. Mit ihrer spezifischen Verbindung von Person- und Aufgabenorientierung kann die TZI Menschen darin unterstützen, Räume für humane Entwicklungsperspektiven zu öffnen und dafür notwendige Transformationsprozesse mitanzustoßen. Ausgehend von den theoretischen Grundlagen der TZI werden in diesem Beitrag zudem Verbindungslinien zu psychologischen (Carl Rogers), philosophischen (Martin Buber), soziologischen (Hartmut Rosa) sowie pädagogischen (Paulo Freire) Ansätzen skizziert und damit weiterführende wissenschaftliche Bezüge aufgezeigt. Es wird deutlich, dass mit TZI gestaltete Verständigungsprozesse über die beteiligten Individuen in die Gesellschaft hinein wirksam werden können.
1Verständigungsprozesse gestalten in einer von Ambivalenzen geprägten Welt
Die gesellschaftliche Situation, in der wir seit Ende des 20. Jahrhunderts leben, ist von Individualisierung und Pluralisierung gekennzeichnet, wie es Ulrich Beck (1986) in seinem Buch »Risikogesellschaft« eindrücklich beschrieben hat. Die individuelle Freiheit und Autonomie, den eigenen Lebensweg selbstbestimmt zu gestalten, äußert sich für jede und jeden Einzelne*n zugleich in einer individuellen Verantwortlichkeit, die auch belastend sein kann (Bayer u. Ostertag, 2019, S. 141 ff.). Mit seinem Begriff der »Weltrisikogesellschaft« und am Beispiel des Klimawandels macht Beck (2007) deutlich, dass es heute nicht nur um »Risiken« für das individuelle Leben geht, sondern dass »unberechenbare Risiken und hergestellte Unsicherheiten« (S. 341) die gesamte Menschheit betreffen.
So stehen wir gegenwärtig vor gewaltigen Herausforderungen, die nicht mehr nur individuell, sondern in globaler Perspektive existenzbedrohend sind. Nicht zuletzt im Zuge des technischen Fortschritts, dem große Errungenschaften für das menschliche Leben zu verdanken sind, produzieren wir Menschen ökologische Krisen, soziale Probleme und ethische Fragen, die mit den gängigen Denkmustern nicht mehr zu beantworten bzw. zu bewältigen sind.
In den großen wie den kleinen Herausforderungen menschlichen Lebens und Zusammenlebens ist die gesamte Menschheit und ist gleichzeitig individuell jeder einzelne Mensch mit Fragen und Situationen konfrontiert, in denen es keine eindeutigen und klaren Lösungen mehr gibt, sondern jede mögliche Antwort in sich ambivalent ist. Jede und jeder Einzelne ist unausweichlich verstrickt in komplexe Zusammenhänge von globaler sozialer Ungerechtigkeit, denen nicht zu entkommen ist. Das Aushalten solcher Widersprüchlichkeiten kennzeichnet Spannungsfelder, in denen Menschen sich heute bewegen bzw. stellt eine existenzielle Anforderung moderner Lebenszusammenhänge dar.
Um mit diesen Ambivalenzen umgehen zu lernen, bedarf es tiefgreifender zwischenmenschlicher Verständigungsprozesse, von denen dann auch Impulse in Richtung notwendiger gesellschaftlicher Veränderungen ausgehen können. Die Widersprüchlichkeiten lassen sich dadurch nicht etwa grundsätzlich auflösen. Das gemeinsame Bewusstsein um diese Ambivalenzen kann jedoch aus einer resignativen Lähmung heraus- und in werteorientierte Verständigungsrespektive Entscheidungsprozesse hineinführen. Es ist (überlebens-) notwendig, dass wir uns darauf einlassen, gemeinsam um solidarische Antworten auf existenzielle ökologische Krisen wie auch auf globale Fragen von sozialer Ungleichheit zu ringen.
Die TZI wurde von Ruth C. Cohn im Kontext der Humanistischen Psychologie entwickelt – als »Kompaß eines humaneren Lebens in einer humaneren Welt« (Matzdorf u. Cohn, 1992, S. 41, Herv. i. O.). Die Dimension der Verständigung ist ihr von Beginn an eingeschrieben und mit einer explizit formulierten Wertorientierung sowie einem politischen Anliegen verbunden. In ihrer Verbreitung wurde und wird die TZI gelegentlich reduziert auf ein Konzept, um Gruppen und Teams zu leiten. In Reaktion darauf hebt Ruth C. Cohn in einem Gespräch mit Hilarion Petzold hervor: »Du hast völlig recht, die Rezeption der Leute war unpolitisch. Aber ich betone es hier noch einmal, daß für mich von Anfang an das Politische und das Soziale im Vordergrund standen« (Cohn, 1985, S. 268). Die in diesem Beitrag entwickelten Überlegungen folgen dieser politischen Lesart der TZI. So verstanden, kann sie einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die aktuellen Herausforderungen der Gegenwart anzunehmen und anzugehen. Maßgeblich ist hierbei nicht zuletzt ihre einzigartige Verbindung von Person- und Aufgabenorientierung.
Im weiteren Gedankengang werden zunächst die Grundlagen der TZI erläutert (Abschnitt 2). Auf dieser systematischen Basis gilt im Anschluss die Aufmerksamkeit der Frage, wie mit Hilfe der TZI Verständigungsprozesse initiiert werden können (Abschnitt 3). Dabei liegt der Fokus zunächst auf personenzentrierten Entwicklungsräumen (Abschnitt 3.1) sowie daran anknüpfend auf themenzentrierten Verständigungsprozessen (Abschnitt 3.2). Für beide Perspektiven sind Verbindungslinien der TZI zu weiteren wissenschaftlichen Theorien bedeutsam – insbesondere und namentlich zu den Ansätzen von Carl Rogers, Martin Buber, Hartmut Rosa und Paulo Freire. Der Ausblick (Abschnitt 4) ermutigt zu kleinen, konkreten, hoffnungsvollen Schritten, auch und gerade angesichts von Krisen, die existenziell beunruhigend und bedrohlich sind.
2Grundlagen der TZI
Die weiteren Überlegungen nehmen zunächst den Entstehungskontext der TZI sowie die sogenannten Axiome als das »philosophisch-theoretische und ethisch-soziale Fundament« (Matzdorf u. Cohn, 1992, S. 47) der TZI in den Blick. Im Anschluss liegt der Fokus auf verschiedenen Elementen, die die TZI als Handlungstheorie zur Verfügung stellt und nutzt.
2.1TZI – eine humanistische Antwort auf den Nationalsozialismus
Die Entwicklung der TZI ist unmittelbar mit dem Leben ihrer Begründerin verbunden. Einige biografische Hinweise können insofern das Verständnis der TZI erleichtern und zudem die Bedeutung ihrer politischen Dimension unterstreichen2: Als Jüdin in Berlin geboren, emigrierte Ruth C. Cohn (1912–2010) bereits 1933 in die Schweiz und von dort 1941 in die USA. Das noch in Deutschland begonnene Studium der Psychologie setzte sie in der Schweiz fort und absolvierte gleichzeitig eine Ausbildung zur Psychotherapeutin (Löhmer u. Standhardt, 1992). Eigene Erfahrungen in der Zeit des Nationalsozialismus waren der Anlass ihrer Suche nach »etwas (…), was wir mitten im Grauen der Welt tun können, ihm etwas entgegenzusetzen – kleine Schritte, kleine winzige Richtungsänderungen« (Ockel u. Cohn, 1992, S. 178). Mit ihrem Suchprozess wurde sie in den USA Teil der therapeutischen Bewegung, aus der die Humanistische Psychologie hervorging. Inspiriert von Begegnungen mit Kollegen wie Fritz Perls und Carl Rogers (Farau u. Cohn, 1984, S. 289 ff.) entwickelte sie die TZI, deren Menschenbild und Wertorientierung in den sogenannten »Axiomen« zum Ausdruck kommt. Die drei Axiome werden als »existentiell-anthropologisch«, »philosophisch-ethisch« und »pragmatisch-politisch« (Matzdorf u. Cohn, 1992, S. 55 ff.) bezeichnet:
»1.Der Mensch ist eine psycho-biologische Einheit und ein Teil des Universums. Er ist darum gleicherweise autonom und interdependent. Die Autonomie des einzelnen ist um so größer, je mehr er sich seiner Interdependenz mit allen und allem bewußt wird. […]
2.Ehrfurcht gebührt allem Lebendigen und seinem Wachstum. Respekt vor dem Wachstum bedingt bewertende Entscheidungen. Das Humane ist wertvoll, Inhumanes ist wertbedrohend. […]
3.Freie Entscheidung geschieht innerhalb bedingender innerer und äußerer Grenzen; Erweiterung dieser Grenzen ist möglich« (Farau u. Cohn, 1984, S. 357 f., Herv. i. O.).
Mit dem Begriff der »psycho-biologischen Einheit« hebt das erste Axiom zunächst die Verbindung von Gedanken, Gefühlen, Erleben und Handeln, mithin die Ganzheitlichkeit des Menschen hervor. Mit der Polarität von Autonomie und Interdependenz wird sodann die anthropologische Grundannahme formuliert, dass Menschen einerseits eigenständig handeln können und andererseits gleichzeitig stets mit anderen verbunden sowie auf andere und anderes bezogen sind. Jeder Mensch verdankt sich in seinem Gewordensein der Beziehung zu anderen Menschen und zur Welt. Mit den Begriffen »universelle[…] Interdependenz« und »Allverbundenheit« (Cohn, 1975, S. 120, Herv. i. O.) ist dabei auch die Dimension eines spirituellen Eingebundenseins in ein großes Ganzes angesprochen.
Das Bewusstsein, auf existenzielle Weise mit allen und allem verbunden zu sein, ist Anlass wie auch Begründung dafür, achtsam und verantwortlich mit anderen und anderem umzugehen, wie es im zweiten Axiom formuliert ist. Ruth C. Cohn geht davon aus, dass jeder Mensch ein Bedürfnis hat, sich mit seinen Fähigkeiten und Gaben zu entfalten – und: dass jeder Mensch ursprünglich, tief in seinem Inneren, ein Gespür dafür hat, was wertvoll ist (Farau u. Cohn, 1984, S. 469). Diese Orientierung am Humanen eröffnet Entwicklungsräume für alle Beteiligten. Letztlich geht es dabei nicht ausschließlich um Menschen, sondern um alles Lebendige.
In ihrem konkreten Handeln – so das dritte Axiom – bewegen sich Menschen immer in der Polarität von Freiheit und Grenzen. Es können innere oder äußere Begrenzungen sein, die uns einschränken. Manchmal sind nur kleine Schritte realisierbar, jedoch: In jeder Situation ist es möglich, aus einer vermeintlichen Ohnmacht in ein aktives Handeln zu kommen und damit Verantwortung für die konkrete Situation und für das eigene Leben zu übernehmen: »Ich bin weder allmächtig noch ohnmächtig; ich bin partiell mächtig« (Cohn, 1993, S. 171).
Die TZI umfasst verschiedene Elemente, die dazu beitragen, diese in den Axiomen grundgelegte Wertorientierung im Handeln konkret werden zu lassen.
2.2Handlungsorientierung und -konzepte der TZI
Ausgehend von ihrer langjährigen Tätigkeit als Psychotherapeutin hatte Ruth C. Cohn die Vision, mit der TZI nicht nur einzelne Klient*innen zu erreichen. Vielmehr wollte sie mit der TZI als »einer Pädagogik für alle« (Cohn, 1975) die individuell heilsamen Erfahrungen aus dem therapeutischen Kontext allen Menschen zugänglich machen und damit »pädagogische und politische Breitenwirkung« (Matzdorf u. Cohn, 1992, S. 42) erzielen. Mit der pointierten Formulierung »Die Couch war zu klein« (Cohn, 1975, S. 7) hat sie diese Idee einprägsam zum Ausdruck gebracht und ihr gesellschaftskritisches Anliegen verdeutlicht.
Einige der Handlungsansätze der TZI sind insofern als Handlungsorientierung für alle Menschen zu verstehen, so zum Beispiel ihre beiden Postulate und ihre Kommunikationsregeln. Daneben gibt es stärker methodisch orientierte Handlungskonzepte, die insbesondere von jenen Menschen genutzt werden können, die für die Gestaltung von sozialen Situationen und Prozessen verantwortlich sind, also beispielsweise Lehrende in Schulen, Fach- und Hochschulen wie auch in Fort- und Weiterbildung oder Personen, die Gruppen, Teams, Organisationen oder auch Initiativen leiten. Zu diesen Elementen zählen das Vier-Faktoren-Modell und die Dynamische Balance, das Leiten mit Themen und Strukturen sowie das Partizipierende Leiten.
Die weiteren Ausführungen folgen der oben genannten Systematik und nehmen zunächst als grundsätzlichere Handlungsorientierung die beiden Postulate sowie die Kommunikationsregeln in den Blick.
2.2.1Postulate
Das Chairpersonpostulat fordert zu Bewusstheit auf, Bewusstheit im Wahrnehmen, Entscheiden, Handeln und Verantworten:
»Sei dein eigener Chairman/Chairwoman,sei die Chairperson deiner selbst.
Dies bedeutet:
▶Sei dir deiner inneren Gegebenheiten und deiner Umwelt bewußt.
▶Nimm jede Situation als Angebot für deine Entscheidung. Nimm und gib, wie du es verantwortlich für dich selbst und andere willst« (Farau u. Cohn, 1984, S. 358 f., Herv. i. O.).
Die TZI will Menschen ermutigen und darin unterstützen, sich selbst und andere bewusst wahrzunehmen sowie in Konsequenz Verantwortung für das eigene Leben und Mitverantwortung für das – gesellschaftliche – Zusammenleben zu übernehmen. Diese Bewusstheit zeigt sich in einem hohen Maß an Reflexion und Selbstreflexion.
Das Störungspostulat knüpft an den Gedanken der Ganzheitlichkeit an und lädt dazu ein, sich und andere mit allen Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen achtsam wahr- und ernst zu nehmen: »Beachte Hindernisse auf deinem Weg, deine eigenen und die von anderen. Störungen haben Vorrang (ohne ihre Lösung wird Wachstum erschwert oder verhindert)« (Cohn, 1975, S. 121).
Um sich gemeinsam einer Aufgabe zuwenden zu können, braucht es die Beteiligung aller als ganze Personen. Mit dem Begriff der Störung bezeichnet Ruth C. Cohn alles, was Menschen daran hindert, sich auf einen gemeinsamen Prozess einzulassen oder ihre Aufmerksamkeit abzieht. Eine solche Störung wird nicht negativ bewertet, sondern kann als Lern- und Entwicklungschance aufgegriffen werden (Ostertag, 2012).
Zu betonen ist, dass es sich beim Störungspostulat nicht ausschließlich um ein (gruppen-) didaktisches Element der TZI handelt, sondern Ruth C. Cohn darüber hinaus auf einen politischen, gesellschaftskritischen Horizont abzielt und dringenden Handlungsbedarf in den Dimensionen von Frieden, Soziale Gerechtigkeit und Ökologie sieht. »Wenn wir uns nicht stören lassen von der großen Störung im Weltbereich von Not und Inhumanität, kann diese Störung sich verselbständigen und zur letzten Störung aller werden« (Ockel u. Cohn, 1992, S. 205).
2.2.2Kommunikationskultur
Ebenso wie die beiden Postulate trägt auch eine humanistische Kommunikationskultur zur Verwirklichung der in den Axiomen beschriebenen Werthaltung bei – mit dem Ziel, in sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhängen (mehr) Menschlichkeit zu leben. Ruth C. Cohn hat einige Kommunikationsregeln (Matzdorf u. Cohn, 1992, S. 76 ff.) formuliert, die jedoch keinesfalls dogmatisch anzuwenden sind, sondern situationsbezogen und wertegebunden als Orientierung dienen. Eine der Kommunikationsregeln, die in unmittelbarer Verbindung zum Chairpersonpostulat steht, sei stellvertretend genannt:
»Sei authentisch und selektiv in deinen Kommunikationen.Mache dir bewußt, was du denkst, fühlst und glaubst,und überdenke vorher, was du sagst und tust«
(Matzdorf u. Cohn, 1992, S. 76, Herv. i. O.).
Wichtig für ein menschliches Miteinander ist, dass die Menschen sich mit ihrer inneren Beteiligung auch nach außen authentisch zeigen, sich dabei aber nicht wahllos öffnen müssen, sondern auswählen, was sie in den gemeinsamen Prozess einbringen wollen. Die von Ruth C. Cohn angestrebte Kommunikationskultur hat eine große Nähe zur Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg (2016) und dessen Bestreben, eine »Sprache des Friedens [zu] sprechen – in einer konfliktreichen Welt« (Rosenberg, 2006).
Im Anschluss an die Erörterung der beiden Postulate und der humanistischen Kommunikationskultur gilt die Aufmerksamkeit nun jenen Handlungskonzepten, die von Lehrenden und Leitenden methodisch aufgegriffen werden können: Vier-Faktoren-Modell und Dynamische Balance, Leiten mit Themen und Strukturen sowie Partizipierendes Leiten.
2.2.3Vier-Faktoren-Modell und Dynamische Balance
In ihrer jahrelangen Arbeit mit unterschiedlichsten Gruppen hat Ruth C. Cohn kontinuierlich eruiert und systematisch reflektiert, welche Einflussgrößen dazu beitragen, dass Menschen in einer Weise miteinander lernen und arbeiten, die sowohl der Entwicklung der einzelnen Individuen als auch der gemeinsamen Aufgabe zuträglich ist. Dabei hat sie vier entscheidende Einflussfaktoren identifiziert und im Vier-Faktoren-Modell der TZI (siehe Abbildung 1) miteinander verbunden.
Abbildung 1: Das Vier-Faktoren-Modell (eigene Darstellung nach Matzdorf u. Cohn, 1992, S. 70)
Das ES bezeichnet das Sachanliegen, den Anlass, weshalb Menschen in einer sozialen Situation zusammenkommen. Das ICH steht für alle beteiligten Personen – inklusive der Leitung – mit ihren individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Lebensgeschichten. Das WIR beschreibt nicht ein emotional aufgeladenes Wir-Gefühl, sondern die Kommunikation und Interaktion zwischen den verschiedenen ICHs. Dazu gehören Nähe und Distanz ebenso wie Vertrauen und Misstrauen. Beim GLOBE handelt es sich um den bedingenden Kontext, womit räumliche und zeitliche Rahmenbedingungen ebenso gemeint sind wie gesellschaftliche Gegebenheiten und Ereignisse, die auf die jeweilige Situation einwirken.
Das Vier-Faktoren-Modell hat zunächst einen beschreibenden Charakter bezüglich der vier Dimensionen ES, ICH, WIR und GLOBE, die in der TZI als gleich wichtig und gleichwertig angesehen werden. Für leitende und lehrende Personen gilt es, soziale Situationen so zu gestalten, dass jeder dieser vier Faktoren gleichermaßen berücksichtigt wird. Im Sinne der sogenannten Dynamischen Balance ist darauf zu achten, dass sich im Verlauf eines Lern- oder Arbeitsprozesses dieses Gleichgewicht immer wieder neu einstellen kann. Ein wichtiges didaktisch-methodisches Element, um in dieser Weise dynamisch zwischen den Faktoren zu balancieren, ist das Leiten mit Themen und Strukturen.
2.2.4Leiten mit Themen und Strukturen
Ein wesentlicher Teil von Leitungsverantwortung und -handeln besteht im Sinne der TZI darin, Themen und Strukturen zu setzen. Beim Leiten mit Themen handelt es sich zudem um ein Alleinstellungsmerkmal der TZI. In der Alltagssprache wird der Begriff Thema oftmals synonym verwendet mit Begriffen wie Inhalt oder Aufgabe. Im Kontext der TZI hat der Begriff eine spezifischere Bedeutung: Die TZI versucht, über Themen eine Brücke zu schlagen zwischen den anstehenden Sachaufgaben und den beteiligten Menschen. Diese besondere Verbindung von Person- und Aufgabenorientierung ermöglicht, dass »aus beziehungslosen und ›toten‹ Sachverhalten […] menschenbezogene ›Themen‹« (Kroeger, 1992, S. 113) entstehen können. Aus einer differenzierten Wahrnehmung der Beteiligten (ICH), ihrer Kommunikation (WIR), dem sachlichen Anliegen (ES) und dem bedingenden Kontext (GLOBE) entwickeln Leitende und Lehrende ein Thema, das einen Raum eröffnet, in dem jede und jeder Einzelne einen individuellen Zugang zur gemeinsamen Sachaufgabe finden kann.
Beispielhaft genannt sei eine Seminarreihe für junge Erwachsene in einer Berufsförderungsmaßnahme, die sich inhaltlich mit Prüfungsangst auseinandersetzt und mit dem Thema »Fuck you Prüfung – mein Weg, sie zu meistern« ausgeschrieben wurde (Raab, 2019). Dieses Thema war für mehrere Teilnehmende ein Türöffner für die Bereitschaft, am Seminar teilzunehmen. Die Formulierung »Fuck you Prüfung« greift die Lebenswelt und Sprache der Teilnehmenden auf. Mitschwingen darf in der Resonanz auf diese Formulierung der Ärger und Frust über bisherige schulische Erfahrungen und Misserfolge. Mit der Formulierung »mein Weg, sie zu meistern« wird zugleich eine ressourcenorientierte Perspektive eingenommen und eröffnet. So kann die TZI in unterschiedlichsten Kontexten beispiels- weise der Sozialen Arbeit Adressat*innen ermutigen, sich in ihren individuellen Stärken wahrzunehmen und selbstbewusst für eigene Anliegen einzustehen. Gegebenenfalls können in diesem Zusammenhang auch gesellschaftliche Gegebenheiten und Mechanismen in den Blick genommen werden, die zu sozialer Benachteiligung führen.
Auch der Begriff Struktur wird in der TZI in einer spezifischen Weise verwendet (Klein, 2017, S. 87 f.). Letztlich umfasst er alles, womit eine verantwortliche Person einen Lern-, Arbeits- oder Verständigungsprozess gestaltet – von den Räumlichkeiten über die Zeitstruktur bis hin zu den konkreten Arbeits- und Sozialformen. Unter Arbeitsformen werden methodische Vorgehensweisen verstanden, beispielsweise Blitzlicht, Diskussion oder Zukunftswerkstatt. Sozialformen beschreiben die Konstellationen, in denen gearbeitet wird, wie zum Beispiel Einzelreflexion, Gruppenarbeiten oder Plenum. All diese Strukturen dienen letztlich der Verwirklichung der in den Axiomen beschriebenen Werthaltung. Bei der Auswahl geeigneter Strukturen orientiert sich die verantwortliche Person an den beteiligten Menschen und ihrer Kommunikation respektive Interaktion, an den anstehenden Themen, am Kontext und am Prozessverlauf.
2.2.5Partizipierendes Leiten
Das Konzept des Partizipierenden Leitens führt von den speziellen Aufgaben einer Leitung konsequenterweise zurück zum Person-Sein von Leitung. Hier zeigt und ereignet sich eine weitere Variante der Verbindung von Person- und Aufgabenorientierung. Denn – so betont Ruth C. Cohn – auch Leitende oder Lehrende sind »in erster Linie Teilnehmer, also Menschen mit eigenen Interessen, Vorlieben, Gedanken und Gefühlen, und erst in zweiter Linie Gruppenleiter mit einer speziellen Funktion. Diese Funktion besteht primär darin, die dynamische Balance zwischen Ich–Wir–Es und deren Zusammenhang mit dem Globe zu beachten« (Farau u. Cohn, 1984, S. 368 f.). An anderer Stelle verwendet sie das Bild eines »ersten Geigers in einem Orchester ohne Dirigenten« (Cohn, 1975, S. 58). Gelingende Zusammenarbeit setzt in ihrem Verständnis voraus, dass Leitung sich nicht abstinent ver- beziehungsweise enthält, sondern als Person innerlich beteiligt und in den Prozess involviert ist.
Anhand ihrer eigenen Erfahrungen im sogenannten Gegenübertragungsworkshop (Farau u. Cohn, 1984, S. 265 f.) beschreibt Ruth C. Cohn sehr eindrücklich eine Situation, in der ihr Mut, sich als Leitung mit eigenen Fragen und Unsicherheiten zu zeigen, eine überaus öffnende und entwicklungsförderliche Wirkung auf alle Beteiligten hatte. Im Bewusstsein ihrer besonderen Funktion und Rolle bringt sich Leitung selektiv-authentisch in den gemeinsamen Prozess ein. In ihrer Art und Weise zu kommunizieren und als Chairperson Selbst- und Mitverantwortung zu übernehmen, kann sie als Modell Teilnehmende ermutigen, sich ebenfalls mit den eigenen Gefühlen, Bedürfnissen, Gedanken und Fragen einzubringen. In diesem Sinne ermöglicht Partizipierendes Leiten Augenhöhe und Begegnung von Mensch zu Mensch, auch in primär aufgabenorientierten Kontexten.
3Verständigungsprozesse gestalten mit TZI
In den vorangegangenen Ausführungen zur TZI wurde verschiedentlich die einzigartige Verbindung von Person- und Aufgabenorientierung angesprochen. Das Potenzial für Verständigung, das die TZI allgemein in menschliches Zusammenleben wie auch speziell in die aktuelle gesellschaftliche Situation einbringen kann, geht nicht zuletzt aus dieser besonderen Verbindung hervor. Anliegen der TZI ist es, sowohl – personenzentriert – Entwicklungsräume für Individuen zu eröffnen als auch – aufgabenorientiert – dazu beizutragen, dass Menschen sich in Verständigungsprozessen jener Fragen und Themen annehmen, die privat, beruflich oder gesellschaftlich einer gemeinsamen Bearbeitung bedürfen. Beide Dimensionen werden im Folgenden differenziert betrachtet.
3.1Personenzentrierte »Gedeihräume« entwickeln
Die weiteren Überlegungen stellen zunächst mit der Idee eines heilsamen Klimas eine Verbindung der TZI mit dem Personenzentrierten Ansatz von Carl Rogers her, bringen dann den Gedanken der Grundbedürfnisse nach Irene Klein ins Spiel und wenden sich schließlich dem Begriff und der Dimension der Begegnung zu.
3.1.1Heilsames Klima
Im Kontext der Humanistischen Psychologie hatte Ruth C. Cohn die entwicklungsförderliche Wirkung von Therapie- und Encountergruppen intensiv erlebt. TZI ist mit der Idee verbunden, dieses heilsame Klima in sachorientierte Lern- und Arbeitskontexte zu übertragen und als »heilende Erfahrungen lebendigen Lernens« (Matzdorf u. Cohn, 1992, S. 40) für alle Menschen erfahrbar zu machen. Ihre Freundin Helga Herrmann hat in diesem Zusammenhang den Begriff der »Gedeihräume« geprägt, der die Idee des inneren Wachstums bildhaft aufnimmt. Ziel ist es, Lebens-, Lern- und Arbeitssituationen so zu gestalten, dass Menschen sich in ihrem individuellen Geworden-Sein einbringen und ganzheitlich weiterentwickeln können.





























