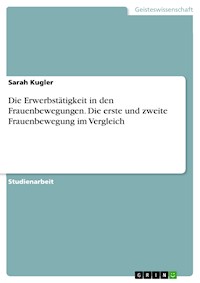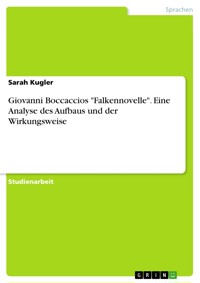Theodor Fontane als Theaterkritiker. Analyse seiner Auseinandersetzung mit den Lessing-Aufführungen E-Book
Sarah Kugler
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,3, Universität Potsdam (Historisches Institut), Veranstaltung: Abschlussarbeit, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Fragen, wie Fontane als Theaterkritiker gearbeitet hat und welche Aspekte ihm in seiner Auseinandersetzungen mit den Bühnenaufführungen besonders wichtig waren. Diese beiden Aspekte werden in zwei Schritten bearbeitet. Dabei werden zum einen die kulturhistorischen Voraussetzungen zusammengetragen und systematisiert. Zum anderen werden Fontanes Auffassungen von Theater am Beispiel der Rezensionen zu Lessingaufführungen analysiert. Methodisch folgt die Arbeit im Hauptteil einer literaturwissenschaftlichen Textanalyse, die in eine kulturhistorische Untersuchung eingebettet ist. Der erste Teil der Arbeit widmet sich dementsprechend dem kulturellen Umfeld Fontanes in Berlin, genauer der Theater- und Zeitungslandschaft. Dabei wird zunächst kurz dargestellt, welche Zeitungen in Berlin im 19. Jahrhundert vertreten waren, welche Stellung diese einnahmen und für welche Fontane gearbeitet hat. Da Fontane als Theaterkritiker für die Vossische Zeitung tätig war, wird diese ausführlich in Bezug auf Entwicklung und Bedeutung beschrieben. Darüber hinaus soll Fontanes Beziehung zu ihr analysiert werden, die über die des angestellten Kritikers hinausgeht. An die Darstellung der Berliner Presse schließt sich ein Exkurs über die Theaterlandschaft an, wobei das Königliche Schauspielhaus sowie die Freie Bühne detaillierter betrachtet werden sollen. Im zweiten Teil folgt zunächst ein Abriss über Fontanes Zeit als Theaterkritiker, wobei der Schwerpunkt auf seinem Selbstverständnis als Kritiker liegt. Dabei wird dargelegt, wie Fontane sich selbst gesehen hat, wie er mit Kritik umgegangen ist und in welcher Beziehung er zu seinem Beruf sowie dem Theatermilieu stand. Anschließend folgt die Analyse seiner Kritiken zu Lessing-Aufführungen am Königlichen Schauspielhaus, bei der auch Bezüge zu anderen Kritiken Fontanes hergestellt werden, um seine Auffassungen über das Theater besser verdeutlichen zu können. Die vorliegenden Texte werden auf Struktur und Stilistik untersucht. Die Auseinandersetzung mit den Darstellern wird einen großen Raum einnehmen, da Fontane an diesen beispielhaft alle ihm wichtigen Aspekte abhandelt. So stellt er daran allgemein seine Vorstellung von guter Schauspielkunst dar und äußert sich konkret zu bestimmten Figuren und wie diese dargestellt werden sollten. Er beurteilt Maske sowie Kostüm und übt Kritik an Lessings Texten. Mit welchen Mitteln er diese Aspekte herausarbeitet, soll in der Analyse gezeigt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Themenbegründung
1.2 Fragestellung, Aufbau und Methodik der Arbeit
1.3 Quellenlage und Forschungsstand
2 Die Kulturszene im Berlin des 19. Jahrhundert
2.1 Fontane und die Presselandschaft
2.1.1 Die Vossische Zeitung
2.1.2 Fontane und die Vossische Zeitung
2.2 Berlin als Theaterstadt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert
2.2.1 Das Königliche Schauspielhaus am Gendarmenmarkt
2.2.2 Die Freie Bühne
3 „Der Herr hat heut’ Kritik.“
3.1 Fontane und sein Selbstverständnis als Kritiker
3.2 Eine Analyse zu Fontanes Lessing-Kritiken
3.2.1 Aufbau und Struktur
3.2.2 Fontanes Anforderungen an die Darsteller und seine Figureninterpretation
3.2.3 Kritik an Lessings Texten
3.3 Eine „heikle Frage“ – Fontanes Äußerungen zu Nathan der Weise
4 Zusammenfassung und Ausblick
5 Literaturverzeichnis
6 Anhang
1 Einleitung
1.1 Themenbegründung
Der unnatürlichen Geschraubtheit Gottscheds mußte, nach einem ewigen Gesetz, der schöne, noch unerreicht gebliebene Realismus Lessings folgen, und der blühende Unsinn, der […] sich aus verlogener Sentimentalität und gedankenlosem Bilderwust entwickelt hatte, mußte als notwendige Reaktion eine Periode ehrlichen Gefühls und gesunden Menschenverstandes nach sich ziehen, von der wir kühn behaupten: sie ist da.[1]
So schreibt Theodor Fontane in seinen Ausführungen über Unsere Lyrische und Epische Poesie seit 1848 aus dem Jahre 1853. Damals verdiente er sein tägliches Brot mit verschiedensten journalistischen Arbeiten, eine Tätigkeit, die vierzig Jahre lang seine hauptberufliche sein sollte. Als er Anfang der 50er Jahre die oben stehenden Zeilen schrieb, war ihm noch nicht bewusst, dass er knapp zwanzig Jahre später in die Fußstapfen des hier erwähnten Gotthold Ephraim Lessings treten sollte. Denn genauso wie er arbeitete Fontane für die Vossische Zeitung in Berlin, für die er insgesamt zwanzig Jahre lang Theaterkritiken über Aufführungen des Königlichen Schauspielhauses verfasste. In den entstandenen Texten äußert er sich nicht nur abneigend oder wohlgesonnen gegen die einzelnen Inszenierungen, sondern setzt sich auch damit auseinander, wie Theater sein soll und was ein gutes Stück ausmacht. Somit lässt sich auch hier ein Zusammenhang zu Lessing herstellen, der mit seiner Hamburgischen Dramaturgie ein Standardwerk der Theatertheorie geschaffen hat. Es liegt also nahe, eine Parallele zwischen diesen beiden Dichtern zu ziehen, die
[f]ührte man heute eine Umfrage durch, welche der überkommenden Dokumente über das Theater früherer Jahrhunderte für die gegenwertige Praxis von größter Bedeutung sind […] ganz gewiß […] immer wieder auftauchen[…][2]
würde. Die Schriften entstanden mit einem Abstand von über hundert Jahren und unter jeweils anderen Bedingungen. Als Lessing 1767 als Dramaturg nach Hamburg ging, setzte er große Hoffnungen in das Deutsche Nationaltheater in Bezug auf die Bekämpfung feudaler Bevormundung. Er wollte ein Theater schaffen, das dem Volk gehören sollte, ein Theater, in dem es seine eigenen Ideen und ein eigenes Selbstverständnis unterbringen konnten.[3] Dabei ging es ihm vor allem um Natürlichkeit, gemischte Charaktere und Katharsis. Das französische Theater lehnte er ab, das englische hingegen machte er zu seinem Leitbild.[4] Zu Fontanes Kritikerzeit hatte – trotz der größtenteils noch adlig besetzten politischen Herrschaftspositionen – das Bürgertum die ökonomische wie kulturelle Macht inne. Das kritische „kulturräsonierende“ Publikum der Aufklärung hatte sich inzwischen zum „kulturkonsumierenden“ Publikum der Gründerjahre gewandelt.[5] Die Ideale, nach denen Lessing seine Dramatik hatte ausrichten wollen, waren vergessen.[6] Umso interessanter ist es, dass man ähnliche Vorstellungen etwa hundert Jahre später bei Fontane findet. Wie sich nachweisen lässt, geht es ihm um eine ausgewogene Balance zwischen Kunst und Natur, um eine Wahrhaftigkeit der Darsteller sowie der Stücke, Aspekte, die schon Lessing wichtig waren.[7] Dass Fontane Lessings Schriften kannte, ist belegt.[8] Ob sich darunter auch die Hamburgische Dramaturgie befand, ist zwar nicht bewiesen, man kann jedoch an Hand Fontanes Äußerungen darauf schließen.[9] So merkt er in seinen Berichten Die Londoner Theater. Insonderheit mit Rücksicht auf Shakespeare in einer Fußnote an: „Die unsrigen schreien kaum je, und wenn es geschieht, mit Anstand, mit Maß. Trotz Lessing geb’ ich […] dem englischen Naturschrei unbedingt den Vorzug.“[10] Es ist anzunehmen, dass sich das „trotz Lessing“ auf die Ausführungen desselben zum englischen Theater in der Hamburgischen Dramaturgie bezieht.[11] Ähnlich wie Lessing war Fontane immer auf der Suche nach dem Konzept der Wahrhaftigkeit im Theater, die er vor allem im Konzept der Freien Bühne fand, in deren Mittelpunkt
die Kunst stehen [soll], die neue Kunst, die die Wahrheit anschaut und das gegenwärtige Dasein. […] Wahrheit und Wahrheit, Wahrheit auf jedem Lebenspfade ist es, die auch wir erstreben und fordern.[12]
Für Autoren wie beispielsweise Hugo Bürger, der „nur ein Organ für die Wirkung, nicht für die Wahrheit [hat]“[13], hatte er wenig Verständnis. Die vorliegende Arbeit stellt eine Verbindung zwischen den beiden Dichtern her, indem sie Fontanes Theaterkritiken zu Lessing-Aufführungen im Königlichen Schauspielhaus untersucht. Dabei sei vorweggenommen, dass die zu untersuchenden Texte sich nicht auf das vollständige dramatische Werk Lessings beziehen können, da von 1870 bis 1889 im Königlichen Schauspielhaus lediglich Minna von Barnhelm, Emilia Galotti und Nathan der Weise gespielt wurden. Am meisten Raum nimmt die Emilia ein, die Fontane in fünfzehn Kritiken bespricht, gefolgt von der Minna mit acht und dem Nathan mit lediglich drei Kritiken. Interessant ist dabei, dass Fontane schon Anfang der 1850er Jahre, während seiner Zeit in England, eine Aufführung des Deutschen Theaters in London von Emilia Galotti sieht und eine Kritik verfasst, die am 24. Juni 1852 in der Preußischen (Adler-) Zeitung erscheint. Neben Schiller und Shakespeare ist Lessing also einer der ersten Theaterautoren, die ihn in seiner Tätigkeit als Kritiker beschäftigen. Alle drei gehören auch zu den Autoren, deren Bühnenwerke bis heute gespielt werden sind, denn viele der von Fontane kritisierten Stücke sind heute vergessen und tauchen nicht mehr im Kanon der Theaterspielpläne auf. Während die Kritiken über Schiller- und Shakespeareaufführungen in der Fontane-Forschung bereits Beachtung fanden (u.a. Freydank 2001; Grawe 1997), wurden die Kritiken zu Lessings Stücken bisher immer nur am Rande betrachtet. Lediglich die Texte zu Aufführungen von Nathan der Weise wurden vereinzelt in Untersuchungen zu Fontanes Einstellung zum Judentum herangezogen (Goldammer 1993; Fleischer 1998). Dabei lässt sich beispielhaft an den Lessing-Kritiken nicht nur Fontanes Verständnis von Theater zeigen, sondern auch seine ambivalente Einstellung zu dem Dichter selbst, den er auf der einen Seite bewundert und doch wieder wegen seiner Toleranzideen kritisiert. Gerade dieser Aspekt hat nichts an Aktualität eingebüßt, da Lessings Idee von der Gleichstellung aller Religionen bis heute nicht funktioniert. Anschläge von radikalen Islamisten, wie auf die Garissa University in Kenia oder die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris zeigen, dass einige Menschen ihre Vorstellung von Religion noch immer über die aller anderen stellen. Die daraus hervorgehende Angst ist in Teilen der Bevölkerung so stark, dass sie sich in Hass gegen alles Fremde umwandelt. Es wird vergessen, dass nicht jeder Muslim ein Terrorist, nicht jeder Fremde ein Krimineller ist. Organisationen wie PEGIDA seien als nur ein Beispiel für diese Denkweise genannt. Zu Fontanes Zeit richtete sich dieser Fremdenhass in bestimmten Kreisen gegen alles Jüdische. Dabei war es gleichgültig, ob die Betroffenen ihre Religion ausübten oder ob sie konvertiert waren. Sie blieben ähnlich stigmatisiert wie Muslime nach dem Anschlag am 11. September 2001 oder die Flüchtlinge aus aller Welt, die in Deutschland eine neue Zukunft suchen. Kaum weniger aktuell, wenn auch nicht so brisant, sind Fontanes Vorstellungen von Dramaturgie und der darstellerischen Leistung der Schauspieler. Häufig verlieren sich moderne Inszenierungen in medialen Affekten, anstatt die Aktualität von Stücken herauszuarbeiten. Gerade im Potsdamer Theater lässt sich außerdem eine Tendenz erkennen, die Darsteller jedes Gefühl nur noch schreien und nicht mehr ausleben zu lassen. Fontanes ehrliche Kritiken können mit ihrem literarischen Stil somit nicht nur für heutige Kritiker, sondern auch Dramaturgen und Regisseure beispielhaft wirken.
1.2 Fragestellung, Aufbau und Methodik der Arbeit
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Fragen, wie Fontane als Theaterkritiker gearbeitet hat und welche Aspekte ihm in seiner Auseinandersetzungen mit den Bühnenaufführungen besonders wichtig waren. Diese beiden Aspekte werden in zwei Schritten bearbeitet. Dabei werden zum einen die kulturhistorischen Voraussetzungen zusammengetragen und systematisiert. Zum anderen werden Fontanes Auffassungen von Theater am Beispiel der Rezensionen zu Lessingaufführungen analysiert. Methodisch folgt die Arbeit im Hauptteil einer literaturwissenschaftlichen Textanalyse, die in eine kulturhistorische Untersuchung eingebettet ist.
Der erste Teil der Arbeit widmet sich dementsprechend dem kulturellen Umfeld Fontanes in Berlin, genauer der Theater- und Zeitungslandschaft. Dabei wird zunächst kurz dargestellt, welche Zeitungen in Berlin im 19. Jahrhundert vertreten waren, welche Stellung diese einnahmen und für welche Fontane gearbeitet hat. Da Fontane als Theaterkritiker für die Vossische Zeitung tätig war, wird diese ausführlich in Bezug auf Entwicklung und Bedeutung beschrieben. Darüber hinaus soll Fontanes Beziehung zu ihr analysiert werden, die über die des angestellten Kritikers hinausgeht. An die Darstellung der Berliner Presse schließt sich ein Exkurs über die Theaterlandschaft an, wobei das Königliche Schauspielhaus sowie die Freie Bühne detaillierter betrachtet werden sollen. Ersteres ist von besonderer Bedeutung, weil Fontane dort zwanzig Jahre lang die aufgeführten Stücke rezensiert hat. Die Freie Bühne ist für Fontanes Kritikerzeit wichtig, weil er in ihrer Bewegung die Kunst und die Wahrheit des Theaters vereint sah. Die konträren Besprechungen mehrerer Kritiker zur Uraufführung von Gerhart Hauptmanns Vor Sonnenaufgang zeugten von einer großen Debatte im damaligen Theaterkreis, bei der sich Fontane auf die Seite Hauptmanns stellte und damit richtungsweisend für die naturalistische Bewegung war. Zudem bilden die Kritiken zu Aufführungen der Freien Bühne den Abschluss seiner Kritikertätigkeit und markieren somit einen wichtigen Punkt in Fontanes Kritikerdasein. Seine Kritiken über Aufführungen des Französischen Theaters in Berlin werden, genauso wie das Theater selbst, in der vorliegenden Arbeit nur kurz erwähnt, da dahingehende ausführliche Erläuterungen deren Rahmen sprengen beziehungsweise zu weit vom Themenschwerpunkt abweichen würden.
Im zweiten Teil folgt zunächst ein Abriss über Fontanes Zeit als Theaterkritiker, wobei der Schwerpunkt auf seinem Selbstverständnis als Kritiker liegt. Dabei wird dargelegt, wie Fontane sich selbst gesehen hat, wie er mit Kritik umgegangen ist und in welcher Beziehung er zu seinem Beruf sowie dem Theatermilieu stand. Anschließend folgt die Analyse seiner Kritiken zu Lessing-Aufführungen am Königlichen Schauspielhaus, bei der auch Bezüge zu anderen Kritiken Fontanes hergestellt werden, um seine Auffassungen über das Theater besser verdeutlichen zu können. Die vorliegenden Texte werden auf Struktur und Stilistik untersucht. Die Auseinandersetzung mit den Darstellern wird einen großen Raum einnehmen, da Fontane an diesen beispielhaft alle ihm wichtigen Aspekte abhandelt. So stellt er daran allgemein seine Vorstellung von guter Schauspielkunst dar und äußert sich konkret zu bestimmten Figuren und wie diese dargestellt werden sollten. Er beurteilt Maske sowie Kostüm und übt Kritik an Lessings Texten. Mit welchen Mitteln er diese Aspekte herausarbeitet, soll in der Analyse gezeigt werden.
Einen besonderen Aspekt in der Textuntersuchung stellen die Kritiken zu Aufführungen von Lessings Nathan der Weise dar, an denen sich Fontanes ambivalentes Verhältnis zu dem Dichter zeigen lässt. Insbesondere die Haltung Fontanes zur Ringparabel soll herausgearbeitet werden, zu der er sich auch in mehreren Briefen äußert. Unterschiede zwischen seinen öffentlichen Äußerungen in den Kritiken und den privaten in den Briefen müssen gedeutet werden.
Die Arbeit beschränkt sich auf Fontanes Äußerungen zu Lessings Nathan, die in enger Verbindung mit seiner insgesamt ambivalenten Haltung zum Judentum stehen. Dieser große Themenkomplex soll nur soweit angerissen werden, wie er zum Verständnis notwendig ist, da eine umfassende Beschäftigung mit dem Thema eine eigenständige Arbeit erfordern würde. Im abschließenden Kapitel sollen die Ergebnisse noch einmal zusammengetragen und ein kurzer Ausblick gegeben werden.
1.3 Quellenlage und Forschungsstand
Als Grundlage dienten in erster Linie Fontanes Theaterkritiken in der Edition der Nymphenburger Ausgabe (Fontane 1964; Fontane 1964a; Fontane 1967), in der als einzige alle Theaterkritiken ohne Kürzungen abgedruckt sind. Durch den thematischen Schwerpunkt sind vor allem die Texte zu Aufführungen von Lessing-Stücken wichtig. Außerdem wurden weitere Kritiken, seine Briefe, vornehmlich in der Hanser Briefausgabe (Fontane 1976; Fontane 1979; Fontane 1980; Fontane 1982; Fontane 1988), seine Tagebucheinträge (Fontane 1995; Fontane 1995a), gedruckt in der Großen Brandenburger Ausgabe, sowie seine autobiographischen Texte (Fontane 1973) herangezogen.
Um Fontanes Ansichten in Bezug auf Lessings Ringparabel zu erläutern, wurden außerdem zwei bisher unveröffentlichte Briefe[14] analysiert, die sich im Bestand des Theodor-Fontane-Archivs Potsdam befinden. Sie geben Aufschluss darüber, dass der Schriftsteller sich in seinen Korrespondenzen häufiger als bisher angenommen zu Lessing geäußert hat.