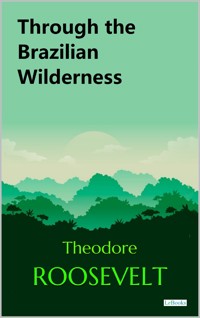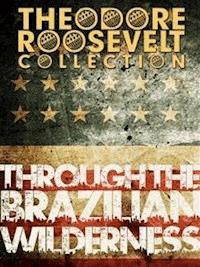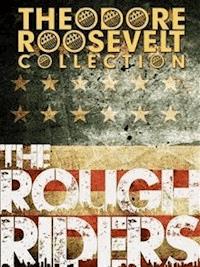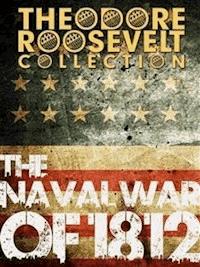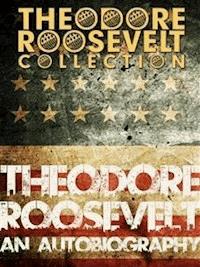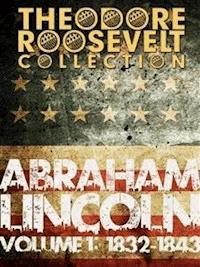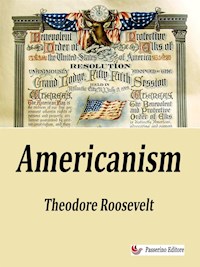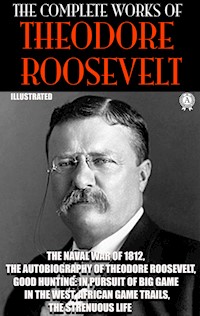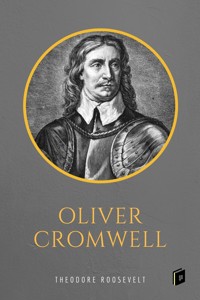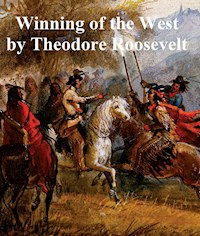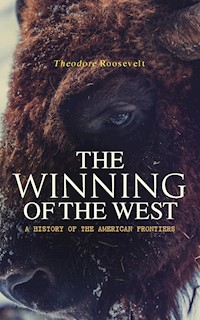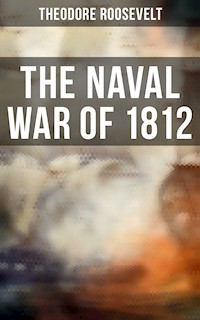1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In "Die Autobiographie" entfaltet Theodore Roosevelt die facettenreiche Erzählung seines Lebens, geprägt von politischem Engagement, persönlichem Mut und unermüdlichem Streben nach Fortschritt. Mit einem lebendigen, oft autobiographisch inspirierten Stil gewährt er Einblicke in die Herausforderungen und Triumphe, die seine Zeit als Präsident der Vereinigten Staaten prägten. Der Text ist nicht nur eine Chronik seiner politischen Errungenschaften, sondern auch eine Reflexion über die Werte der amerikanischen Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wobei er Themen wie Nationalbewusstsein, Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit eindringlich behandelt. Außerdem etabliert er sich als ein Symbol der progressiven Bewegung jener Zeit, was den historischen Kontext zusätzlich bereichert. Theodore Roosevelt, als fünfter amerikanischer Präsident und der erste, der das Amt im 20. Jahrhundert ausübte, war eine schillernde Figur der amerikanischen Geschichte. Sein unerschütterlicher Idealismus und seine vielfältigen Erfahrungen als Rancher, Naturwissenschaftler und Autor flossen in diese Autobiographie ein. Roosevelt, ein Mann der Taten, prägte die USA durch Reformen und eine neue nationalistische Vision, die sich in seiner Schrift stark widerspiegelt, und bis heute relevant bleibt. "Die Autobiographie" ist ein unverzichtbares Werk für jeden Interessierten an der amerikanischen Geschichte oder der politischen Theorie. Roosevelts eindringliche Reflexionen und Erlebnisse sind nicht nur von historischer Bedeutung, sondern bieten auch wertvolle Lehren für gegenwärtige und zukünftige Generationen über Führung und den gerechten Umgang mit Macht. Es empfiehlt sich, dieses Buch nicht nur als historische Quelle, sondern auch als Quelle der Inspiration zu betrachten. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Theodore Roosevelt: Die Autobiographie
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
Natürlich gibt es Kapitel meiner Autobiografie, die ich jetzt nicht schreiben kann.
Mir scheint, dass es für eine Nation ebenso wie für einen Menschen am wichtigsten ist, auf der lebenswichtigen Notwendigkeit zu bestehen, bestimmte Eigenschaften zu kombinieren, die für sich genommen zwar weit verbreitet, aber leider auch nutzlos sind. Praktische Effizienz ist weit verbreitet, und hoher Idealismus ist keine Seltenheit; notwendig ist die Kombination, und diese Kombination ist selten. Friedensliebe ist weit verbreitet unter schwachen, kurzsichtigen, ängstlichen und faulen Menschen; Mut findet man hingegen bei vielen Menschen mit schlechtem Charakter und schlechtem Temperament. Keine dieser Eigenschaften allein ist von Nutzen. Gerechtigkeit unter den Völkern der Menschheit und die Hebung der Menschheit können nur von starken und mutigen Menschen erreicht werden, die mit Weisheit den Frieden lieben, aber die Gerechtigkeit mehr lieben als den Frieden. Angesichts der immensen Komplexität der modernen sozialen und industriellen Verhältnisse ist es notwendig, die kollektive Kraft von uns allen frei und ohne zu zögern einzusetzen; und doch wird jede Ausübung kollektiver Macht niemals etwas nützen, wenn der Durchschnittsmensch nicht sein Gefühl für persönliche Pflicht, Initiative und Verantwortung bewahrt. Es ist notwendig, alle Tugenden zu entwickeln, die ihren Wirkungsbereich im Staat haben; aber diese Tugenden sind wie Staub in einer windigen Straße, wenn ihnen nicht die starken und zärtlichen Tugenden eines Familienlebens zugrunde liegen, das auf der Liebe eines Mannes zu einer Frau und auf ihrer freudigen und furchtlosen Annahme ihrer gemeinsamen Verpflichtung gegenüber den Kindern, die ihnen gehören, beruht. Es muss ein ausgeprägter Pflichtsinn vorhanden sein, der mit Lebensfreude einhergeht; es muss Scham empfunden werden bei dem Gedanken, sich vor der harten Arbeit der Welt zu drücken, und gleichzeitig Freude an der vielfältigen Schönheit des Lebens. Mit feuriger Seele und stählernem Charakter müssen wir so handeln, wie es unser kühlstes Urteilsvermögen uns gebietet. Wir müssen den Übeltätern gegenüber die größtmögliche Nächstenliebe üben, die mit einem unerbittlichen Kampf gegen das Unrecht vereinbar ist. Wir müssen anderen gegenüber gerecht und großzügig sein, und doch müssen wir erkennen, dass es eine Schande und eine Schandtat ist, Unterdrückung nicht mit hoch erhobenem Haupt und bereitwilliger Hand zu widerstehen. Sanftmut und Zärtlichkeit müssen mit unerschrockenem Mut und der entschlossenen Bereitschaft zu Arbeit, Entbehrung und Gefahr einhergehen. Alle für jeden und jeder für alle ist ein gutes Motto, aber nur unter der Bedingung, dass jeder mit aller Kraft daran arbeitet, sich selbst zu versorgen, um anderen nicht zur Last zu fallen.
Wir in den großen modernen Demokratien müssen unermüdlich danach streben, unsere Länder zu Orten zu machen, an denen ein armer Mann, der hart arbeitet, ein angenehmes und ehrliches Leben führen kann und an denen ein reicher Mann nicht unehrlich oder in fauler Pflichtvermeidung leben kann; und doch müssen wir den reichen und den armen Mann nach demselben Maßstab beurteilen, der auf dem Verhalten und nicht auf der Kaste beruht, und wir müssen mit derselben strengen Härte die gemeine und boshafte Neid, der einen Menschen hasst und ausplündert, weil er wohlhabend ist, und die brutale und selbstsüchtige Arroganz, die auf den Menschen herabblickt und ihn ausbeutet, dem das Leben hart behandelt hat, missbilligen.
THEODORE ROOSEVELT.
SAGAMORE HILL, 1. Oktober 1913.
KAPITEL I
KINDHEIT UND JUGEND
Mein Großvater väterlicherseits war fast rein niederländischer Abstammung. Als er jung war, sprach er noch etwas Niederländisch, und Niederländisch wurde zuletzt in den Gottesdiensten der Niederländisch-Reformierten Kirche in New York verwendet, als er noch ein kleiner Junge war.
Um 1644 kam sein Vorfahr Klaes Martensen van Roosevelt als „Siedler” nach New Amsterdam – so hieß damals ein Einwanderer, der im 17. Jahrhundert in der Zwischendeck eines Segelschiffs statt im Zwischendeck eines Dampfers im 19. Jahrhundert ankam. Von da an wurden sieben Generationen von Vater zu Sohn auf Manhattan geboren.
Die Vorfahren meines Vaters väterlicherseits stammten aus Holland, mit Ausnahme eines Waldron, einem Radmacher, der zu den Pilgern gehörte, die in Holland blieben, als die anderen nach Massachusetts auswanderten, und der dann die niederländischen Abenteurer nach New Amsterdam begleitete. Die Mutter meines Vaters stammte aus Pennsylvania. Ihre Vorfahren waren mit William Penn nach Pennsylvania gekommen, einige sogar auf demselben Schiff wie er; sie waren typische Einwanderer dieser Zeit und dieses Ortes. Unter ihnen waren walisische und englische Quäker, ein Ire – mit einem keltischen Namen, aber offenbar kein Quäker – und friedliebende Deutsche, die zu den Gründern von Germantown gehörten, nachdem sie aus ihrer Heimat im Rheinland vertrieben worden waren, als die Armeen Ludwigs XIV. die Pfalz verwüsteten. und darüber hinaus Vertreter eines keineswegs friedlichen Volkes, der schottisch-irischen Einwanderer, die etwas später, zu Beginn des 18. Jahrhunderts, nach Pennsylvania kamen. Meine Großmutter war eine Frau von einzigartiger Liebenswürdigkeit und Stärke, die tragende Säule in den Beziehungen zu ihrem Mann und ihren Söhnen. Obwohl sie selbst keine Niederländerin war, brachte sie mir das einzige Niederländische bei, das ich je gelernt habe, ein Kinderlied, dessen erste Zeile lautete: „Trippe troppa tronjes“. Ich habe mir das immer gemerkt, und als ich in Ostafrika war, stellte sich heraus, dass es eine Verbindung zwischen mir und den Buren-Siedlern herstellte, von denen nicht wenige es kannten, obwohl sie anfangs immer Schwierigkeiten hatten, meine Aussprache zu verstehen – was mich nicht wunderte. Es war interessant, diese Männer zu treffen, deren Vorfahren etwa zur gleichen Zeit wie meine Vorfahren vor zweieinhalb Jahrhunderten nach Amerika ausgewandert waren, und festzustellen, dass die Nachkommen der beiden Auswanderergruppen ihren Kindern zumindest teilweise noch dieselben Kinderlieder vorsangen.
Über meinen Urgroßvater Roosevelt und sein Familienleben vor über einem Jahrhundert weiß ich nur wenig mehr als das, was in einigen seiner Bücher steht, die mir überliefert wurden – den „Letters of Junius“, einer Biografie von John Paul Jones, und „Life of Washington“ von Chief Justice Marshall. Sie scheinen darauf hinzudeuten, dass seine Bibliothek weniger interessant war als die des Urgroßvaters meiner Frau zur gleichen Zeit, die sicherlich Bände wie die Originalausgabe der Edinburgh Review enthielt, denn wir haben sie jetzt in unseren eigenen Bücherregalen. Meine lebhafteste Kindheitserinnerung an meinen Großvater Roosevelt ist nicht etwas, das ich gesehen habe, sondern eine Geschichte, die mir über ihn erzählt wurde. In seiner Kindheit war der Sonntag für kleine calvinistische Kinder niederländischer Abstammung ein ebenso trostloser Tag, als wären sie puritanischer, schottischer oder französischer Hugenottenabstammung – und ich spreche als jemand, der stolz auf seine holländischen, hugenottischen und puritanischen Vorfahren ist und stolz darauf, dass das Blut des strengen puritanischen Geistlichen Jonathan Edwards in den Adern seiner Kinder fließt. An einem Sommernachmittag, nachdem er zum zweiten Mal an diesem Tag eine ungewöhnlich lange niederländisch-reformierte Predigt gehört hatte, rannte mein Großvater, ein kleiner Junge, nach Hause, bevor sich die Gemeinde aufgelöst hatte, und stieß auf eine Gruppe Schweine, die damals frei in den Straßen von New York herumliefen. Er sprang sofort auf einen großen Eber, der nicht weniger schnell davonrannte und ihn mit voller Geschwindigkeit mitten durch die empörte Gemeinde trug.
Übrigens zeigt eines der Roosevelt-Dokumente, die mir überliefert sind, wie sich bestimmte Aspekte des öffentlichen Lebens seit der Zeit verändert haben, die Pessimisten als „die früheren und besseren Tage der Republik” bezeichnen. Der alte Isaac Roosevelt war Mitglied eines Rechnungsprüfungsausschusses, der kurz nach dem Ende der Revolution den folgenden Gesetzentwurf verabschiedete:
Stell dir vor, der Gouverneur von New York würde heute eine solche Rechnung für eine solche Bewirtung des französischen Botschafters und des Präsidenten der Vereinigten Staaten vorlegen! Falstaffs Ansicht über das richtige Verhältnis zwischen Wein und Brot wird durch das Verhältnis zwischen der Anzahl der Bowls Punsch und den Flaschen Portwein, Madeira und Bier, die konsumiert wurden, sowie dem „Kaffee für acht Herren” bestätigt – offenbar die einzigen, die bis zu diesem Zeitpunkt des Abendessens durchhielten. Besonders bewundernswert ist die nonchalante Art, in der, offensichtlich als Folge des Konsums der besagten Flaschen Wein und Bowls Punsch, acht Kristallkaraffen und sechzig Weingläser zerbrochen wurden.
Während der Revolution standen einige meiner Vorfahren, sowohl aus dem Norden als auch aus dem Süden, in der Armee, ohne sich besonders hervorzutun, und andere leisteten ähnliche Dienste im Kontinentalkongress oder in verschiedenen lokalen Legislativen. Zu dieser Zeit waren die meisten, die im Norden lebten, Kaufleute, und diejenigen, die im Süden lebten, Plantagenbesitzer.
Die Familie meiner Mutter stammte überwiegend aus Schottland, aber auch aus hugenottischen und englischen Verhältnissen. Sie war Georgierin, ihre Familie war vor der Revolution aus South Carolina nach Georgia gekommen. Der ursprüngliche Bulloch war ein Junge aus der Nähe von Glasgow, der vor ein paar Jahrhunderten hierher kam, so wie Hunderttausende bedürftige, unternehmungslustige Schotten in den folgenden zweihundert Jahren in alle Teile der Welt gingen. Der Urgroßvater meiner Mutter, Archibald Bulloch, war der erste „Präsident” Georgias während der Revolution. Mein Großvater, ihr Vater, verbrachte die Winter in Savannah und die Sommer in Roswell, im Hochland von Georgia in der Nähe von Atlanta, wo er schließlich seinen ständigen Wohnsitz nahm. Er reiste mit seiner Familie und ihrem Hab und Gut in seiner eigenen Kutsche dorthin, gefolgt von einem Gepäckwagen. Ich habe Roswell erst gesehen, als ich Präsident war, aber meine Mutter hat mir so viel über den Ort erzählt, dass ich, als ich ihn sah, das Gefühl hatte, jeden Winkel zu kennen und dass er von den Geistern aller Männer und Frauen heimgesucht wurde, die dort gelebt hatten. Ich meine damit nicht nur meine eigene Familie, sondern auch die Sklaven. Meine Mutter und ihre Schwester, meine Tante, erzählten uns Kindern alle möglichen Geschichten über die Sklaven. Eine der faszinierendsten handelte von einem sehr alten Schwarzen namens Bear Bob, weil er in den frühen Tagen der Besiedlung von einem schwarzen Bären teilweise skalpiert worden war. Dann war da noch Mom' Grace, die eine Zeit lang die Krankenschwester meiner Mutter gewesen war und die ich für tot gehalten hatte, die mich aber, als ich nach Roswell kam, sehr respektvoll begrüßte und offenbar noch viele Jahre zu leben hatte. Die beiden Hauptfiguren des Dramas, das uns immer wieder erzählt wurde, waren Daddy Luke, der Negeraufseher, und seine Frau Mom' Charlotte. Ich habe weder Daddy Luke noch Mom' Charlotte jemals gesehen, aber als meine Mutter starb, wurde mir die Verantwortung für sie übertragen. Nach Kriegsende weigerten sie sich entschieden, sich befreien zu lassen oder den Ort zu verlassen. Das Einzige, was sie von uns wollten, war genug Geld pro Jahr, um ein neues „Critter“ zu kaufen, also ein Maultier. Mit einem gewissen Mangel an Einfallsreichtum wurde jedes Jahr zu Weihnachten gemeldet, dass das Maultier gestorben oder zumindest so gebrechlich geworden sei, dass es einen Nachfolger brauche – eine feierliche Lüge, die weder täuschte noch täuschen sollte, aber als Maßstab für die Größe des Weihnachtsgeschenks diente.
Das Haus meines Großvaters mütterlicherseits lag auf dem Weg von Shermans Marsch zum Meer, und so ziemlich alles, was darin transportabel war, wurde von den Jungs in Blau mitgenommen, darunter auch die meisten Bücher aus der Bibliothek. Als ich Präsident war, wurden die Fakten über meine Vorfahren veröffentlicht, und ein ehemaliger Soldat aus Shermans Armee schickte mir eines der Bücher mit dem Namen meines Großvaters zurück. Es war eine kleine Ausgabe der Gedichte von „Mr. Gray“ – eine Ausgabe aus dem 18. Jahrhundert, gedruckt in Glasgow.
Am 27. Oktober 1858 wurde ich in der East Twentieth Straße 28 in New York City geboren, in dem Haus, in dem wir lebten, als meine beiden Schwestern, mein Bruder und ich noch kleine Kinder waren. Es war im typischen Stil New Yorks eingerichtet, wie George William Curtis ihn in den Potiphar Papers beschrieben hat. Die schwarzen Haartuchmöbel im Esszimmer kratzten an den nackten Beinen der Kinder, wenn sie darauf saßen. Der mittlere Raum war eine Bibliothek mit Tischen, Stühlen und Bücherregalen von düsterer Ehrbarkeit. Er hatte keine Fenster und war daher nur nachts nutzbar. Der vordere Raum, das Wohnzimmer, erschien uns Kindern als ein Raum von großer Pracht, war aber nur am Sonntagabend oder zu seltenen Anlässen, wenn Partys stattfanden, für den allgemeinen Gebrauch geöffnet. Das sonntägliche Familientreffen war das Highlight eines Tages, den wir Kinder ansonsten nicht genossen – vor allem, weil wir alle saubere Kleidung tragen und ordentlich sein mussten. Ich erinnere mich noch gut an die Dekoration des Wohnzimmers, darunter den Gasleuchter mit vielen geschliffenen Glasprismen. Diese Prismen erschienen mir besonders prächtig. Eines fiel eines Tages herunter, und ich schnappte es mir schnell und versteckte es. Mehrere Tage lang genoss ich heimlich meinen Schatz, wobei meine Freude immer mit der Angst vermischt war, entdeckt und des Diebstahls überführt zu werden. Auf einer Seite war eine Schweizer Holzschnitzerei, die einen sehr großen Jäger auf einem winzigen Berg und eine Herde Gämsen zeigte, die im Verhältnis zum Jäger und zum Berg viel zu klein waren. Das hat uns immer fasziniert, aber wir hatten große Angst um ein kleines Gämsenkitz, dass der Jäger es entdecken und töten könnte. Auf einem Stück Malachit war auch ein russischer Muzyk abgebildet, der einen vergoldeten Schlitten zog. Jemand erwähnte in meiner Gegenwart, dass Malachit ein wertvoller Marmor sei. Das prägte sich mir ein, dass er genauso wertvoll sei wie Diamanten. Ich betrachtete diesen Muzyk als ein unschätzbares Kunstwerk, und erst als ich schon mittleren Alters war, wurde mir klar, dass ich mich geirrt hatte.
Ab und zu wurden wir Kinder zum Haus unseres Großvaters mitgenommen, einem für das damalige New York großen Haus an der Ecke Fourteenth Straße und Broadway, gegenüber dem Union Square. Im Inneren gab es einen großen Saal, der bis zum Dach reichte, mit einem schwarz-weißen Mosaikboden und einer Wendeltreppe, die an den Seiten des Saals vom obersten Stockwerk bis nach unten führte. Wir Kinder bewunderten sowohl den Mosaikboden als auch die Wendeltreppe. Ich glaube, mit der Wendeltreppe hatten wir recht, aber beim Mosaikboden bin ich mir nicht so sicher.
Die Sommer verbrachten wir auf dem Land, mal hier, mal dort. Wir Kinder liebten das Land natürlich über alles. Wir mochten die Stadt nicht. Wir konnten es immer kaum erwarten, bis es Frühling wurde und wir aufs Land fahren konnten, und waren sehr traurig, wenn die Familie im Spätherbst wieder in die Stadt zurückzog. Auf dem Land hatten wir natürlich alle möglichen Haustiere – Katzen, Hunde, Kaninchen, einen Waschbären und ein fuchsfarbenes Shetlandpony namens General Grant. Als meine jüngere Schwester zum ersten Mal vom echten General Grant hörte, war sie übrigens sehr beeindruckt von dem Zufall, dass jemand ihm denselben Namen wie dem Pony gegeben hatte. (Dreißig Jahre später hatten meine eigenen Kinder ihr Pony Grant.) Auf dem Land liefen wir Kinder die meiste Zeit barfuß, und die Jahreszeiten vergingen in einem Reigen ununterbrochener und spannender Vergnügungen – wir beaufsichtigten die Heuernte und die Ernte, pflückten Äpfel, erfolgreich Frösche und erfolglos Waldmurmeltiere jagten, Hickory-Nüsse und Kastanien sammelten, um sie an geduldige Eltern zu verkaufen, Wigwams im Wald bauten und manchmal allzu realistisch Indianer spielten, indem wir uns (und nebenbei auch unsere Kleidung) großzügig mit Pokeweed-Saft beschmierten. Thanksgiving war ein beliebter Feiertag, aber er konnte Weihnachten bei weitem nicht das Wasser reichen. Weihnachten war ein Anlass für buchstäblich rasende Freude. Am Abend hängten wir unsere Strümpfe auf – oder besser gesagt, die größten Strümpfe, die wir uns von den Erwachsenen ausleihen konnten – und vor Tagesanbruch strömten wir herein, um sie auf dem Bett meiner Eltern zu öffnen; die größeren Geschenke wurden sortiert, die für jedes Kind auf einen eigenen Tisch im Wohnzimmer gelegt, dessen Türen nach dem Frühstück weit geöffnet wurden. Ich habe nie jemanden gekannt, der so schöne Weihnachten hatte wie ich, und in der nächsten Generation habe ich versucht, sie für meine eigenen Kinder genau so zu gestalten.
Mein Vater, Theodore Roosevelt, war der beste Mann, den ich je kannte. Er verband Kraft und Mut mit Sanftmut, Zärtlichkeit und großer Selbstlosigkeit. Er duldete bei uns Kindern keine Selbstsucht oder Grausamkeit, Faulheit, Feigheit oder Unaufrichtigkeit. Als wir älter wurden, machte er uns klar, dass für Jungen und Mädchen dieselben Maßstäbe für ein sauberes Leben gelten; dass das, was bei einer Frau falsch war, bei einem Mann nicht richtig sein konnte. Mit großer Liebe und Geduld, mit tiefem Verständnis und Rücksichtnahme verband er seine Forderung nach Disziplin. Er hat mich nur einmal körperlich bestraft, aber er war der einzige Mann, vor dem ich jemals wirklich Angst hatte. Ich meine nicht, dass diese Angst unberechtigt war, denn er war vollkommen gerecht, und wir Kinder verehrten ihn. Abends warteten wir in der Bibliothek, bis wir seinen Schlüssel in der Tür der Eingangshalle klappern hörten, und dann rannten wir hinaus, um ihn zu begrüßen; und wir drängten uns in sein Zimmer, während er sich anzog, um dort zu bleiben, solange es uns erlaubt war, und untersuchten eifrig alles, was aus seinen Taschen kam und als attraktive Neuheit angesehen werden konnte. Jedes Kind hat verschiedene Details in Erinnerung, die ihm wichtig sind. Die Kleinigkeiten, die er in einer kleinen Schachtel auf seinem Frisiertisch aufbewahrte, nannten wir Kinder immer „Schätze“. Das Wort und einige der Kleinigkeiten selbst wurden an die nächste Generation weitergegeben. Meine eigenen Kinder kamen immer in mein Zimmer, wenn ich mich anzog, und die Kleinigkeiten, die sich nach und nach in der „Ditty-Box” – einem Geschenk eines Matrosen – ansammelten, lösten immer begeisterte Freude aus. Bei feierlichen Anlässen bekam jedes Kind ein Schmuckstück „ganz für sich allein“. Meine Kinder hatten übrigens eine Freude, an die ich mich selbst nicht erinnern kann. Wenn ich vom Ausreiten zurückkam, zog das Kind, das mir den Stiefelknecht brachte, sofort die Stiefel an und stampfte mit einem herrlichen Gefühl der Verbundenheit mit dem Siebenmeilen-Jack durch das Zimmer.
Der Vorfall, von dem ich erzählt habe, passierte, als ich vier Jahre alt war. Ich habe meine ältere Schwester in den Arm gebissen. Ich kann mich nicht daran erinnern, sie gebissen zu haben, aber ich weiß noch, dass ich in den Hof gerannt bin, weil ich mir bewusst war, dass ich etwas Schlimmes getan hatte. Vom Hof ging ich in die Küche, holte mir etwas Teig von der Köchin und kroch unter den Küchentisch. Nach ein oder zwei Minuten kam mein Vater aus dem Hof und fragte, wo ich sei. Die warmherzige irische Köchin hatte eine ausgeprägte Verachtung für „Verräter“, aber obwohl sie nichts sagte, entschied sie sich zwischen Verrat und ihrem Gewissen, indem sie einen Blick unter den Tisch warf. Mein Vater ging sofort auf alle viere und stürzte sich auf mich. Ich warf ihm schwach den Teig entgegen und hatte den Vorteil, dass ich unter dem Tisch stehen konnte, sodass ich einen Vorsprung hatte, um zur Treppe zu gelangen, wurde aber auf halber Höhe erwischt. Die Strafe, die darauf folgte, passte zum Vergehen, und ich hoffe – und glaube –, dass sie mir gut getan hat.
Ich habe nie jemanden gekannt, der mehr Freude am Leben hatte als mein Vater, oder jemanden, der jede Pflicht so von ganzem Herzen erfüllte; und niemand, den ich je getroffen habe, kam an seine Kombination aus Lebensfreude und Pflichterfüllung heran. Er und meine Mutter waren sehr gastfreundlich, was damals eher in südlichen als in nördlichen Haushalten üblich war, und besonders in ihren späteren Jahren, als sie in die Stadt gezogen waren, in die Nähe des Central Park, führten sie ein charmantes, offenes Haus.
Mein Vater arbeitete hart in seinem Geschäft, denn er starb mit sechsundvierzig Jahren, zu früh, um in Rente zu gehen. Er interessierte sich für jede soziale Reformbewegung und leistete selbst eine immense praktische Wohltätigkeitsarbeit. Er war ein großer, kräftiger Mann mit einem löwenhaften Gesicht, und sein Herz war voller Sanftmut für diejenigen, die Hilfe oder Schutz brauchten, und voller Zorn gegenüber Tyrannen und Unterdrückern. Er liebte es, sowohl auf der Straße als auch querfeldein zu reiten, und war außerdem ein großartiger Peitschenknaller. Meistens fuhr er einen Vierspänner oder ein Spike-Team, also ein Gespann mit einem dritten Pferd an der Spitze. Ich glaube nicht, dass es so ein Gespann heute noch gibt. Die Kutsche, die er fuhr, nannten wir immer den hohen Phaeton. Die Räder waren vorne nach innen gewandt. Ich habe sie noch. Er fuhr langschwänzige Pferde, die locker in einem leichten amerikanischen Geschirr angespannt waren, so dass das ganze Gespann keinerlei Ähnlichkeit mit etwas hatte, was man heute sehen würde. Mein Vater war immer sehr gut darin, jede freie halbe oder dreiviertel Stunde zu nutzen, sei es für die Arbeit oder zum Vergnügen. Einen Großteil seiner Vierergespannfahrten unternahm er an Sommernachmittagen, wenn er mit dem Zug von seiner Arbeit in New York zurückkam. Meine Mutter und eines oder vielleicht zwei von uns Kindern könnten, könnten ihn am Bahnhof abholen. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er in seinem Leinenmantel aus dem Wagen steigt, in den Wagen springt und sofort in rasendem Tempo davonfährt, wobei der Mantel manchmal wie ein Ballon aufgebläht ist. Die Vierergespann, wie man aus der obigen Beschreibung entnehmen kann, stellte in seinen Augen keineswegs eine mögliche Prahlerei dar. Er fuhr damit, weil es ihm Spaß machte. Er predigte seinen Jungs immer Vorsicht, aber in dieser Hinsicht hielt er sich selbst nicht allzu sehr an seine Predigten; und da er ein ausgezeichneter Kutscher war, ging er gerne Risiken ein. Meistens kam alles gut. Gelegentlich auch nicht, aber er war noch besser darin, sich aus einer brenzligen Situation zu befreien, als sich darin zu verwickeln. Einmal, als wir spät in der Nacht nach New York fuhren, hielten die Pferde an. Er gab ihnen einen Klaps, und im nächsten Moment konnten wir schemenhaft erkennen, dass sie gesprungen waren. Es stellte sich heraus, dass die Straße gesperrt war und eine Platte quer darüber gelegt worden war, die auf zwei Fässern ruhte, aber ohne Laterne. Über diese Platte waren die Pferde gesprungen, und es gab ziemliche Aufregung, bevor wir die Platte von den Fässern nehmen und unsere Fahrt fortsetzen konnten. Wenn wir an Thanksgiving oder Weihnachten in der Stadt waren, fuhr mein Vater meine Mutter und ein paar Freunde gerne zum Rennpark, um dort zu Mittag zu essen. Aber er war immer rechtzeitig zurück, um zum Abendessen in die Unterkunft der Zeitungsjungen zu gehen, und nicht selten auch in Fräulein Satterys Abendschule für kleine Italiener. Schon in sehr jungen Jahren wurden wir Kinder mitgenommen und mussten helfen. Er war ein treuer Freund von Charles Loring Brace und interessierte sich besonders für die Newsboys' Lodging-House und die Abendschulen und dafür, die Kinder von der Straße zu holen und auf Farmen im Westen zu bringen. Als ich Präsident war, war der Gouverneur von Alaska unter mir, Gouverneur Brady, einer dieser ehemaligen Zeitungsjungen, die von Herrn Brace und meinem Vater aus New York in den Westen geschickt worden waren. Mein Vater interessierte sich sehr für Vereine, die sich gegen Kindesmisshandlung und Tierquälerei einsetzten. Sonntags hielt er einen Missionsunterricht. Auf dem Weg dorthin brachte er uns Kinder zur Sonntagsschule in der Presbyterianischen Kirche von Dr. Adams am Madison Square. Ich erinnere mich, wie meine Tante, die Schwester meiner Mutter, sagte, dass er sie immer an Greatheart in Bunyan erinnerte, wenn er mit uns Kindern spazieren ging. Unter dem Einfluss seines Vorbilds gab ich selbst drei Jahre lang Missionsunterricht, bevor ich aufs College ging, und während meiner gesamten vierjährigen Collegezeit. Ich glaube nicht, dass ich dabei besonders erfolgreich war. Aber neulich, als ich in New York aus einem Taxi stieg, sprach mich der Fahrer an und erzählte mir, dass er einer meiner ehemaligen Sonntagsschüler gewesen sei. Ich erinnerte mich gut an ihn und war sehr erfreut, dass er ein begeisterter Anhänger von Bull Mooser war!
Meine Mutter, Martha Bulloch, war eine liebevolle, liebenswürdige, schöne Südstaatlerin, eine reizende Begleiterin und von allen geliebt. Bis zu ihrem Tod war sie völlig „unrekonstruiert”. Ihre Mutter, meine Großmutter, eine der liebenswertesten alten Damen, lebte bei uns und verwöhnte uns Kinder maßlos, da sie ihr Herz uns gegenüber nicht verhärten konnte, selbst wenn es die Umstände erforderten. Gegen Ende des Bürgerkriegs, obwohl ich noch ein kleiner Junge war, entwickelte ich ein teilweises, aber waches Verständnis dafür, dass die Familie in ihren Ansichten über diesen Konflikt nicht einig war, da mein Vater ein überzeugter Anhänger Lincolns war. und einmal, als ich mich durch die mütterliche Züchtigung während des Tages ungerecht behandelt fühlte, versuchte ich, mich teilweise zu rächen, indem ich laut und inbrünstig für den Erfolg der Unionsarmee betete, als wir alle abends vor meiner Mutter unsere Gebete sprachen. Sie war nicht nur eine sehr hingebungsvolle Mutter, sondern auch mit einem ausgeprägten Sinn für Humor gesegnet, und sie war zu amüsiert, um mich zu bestrafen; aber ich wurde gewarnt, das Vergehen nicht zu wiederholen, sonst würde mein Vater informiert werden – der für strenge Strafen zuständig war. Das Morgengebet sprach ich mit meinem Vater. Wir standen am Fuß der Treppe und riefen, wenn Vater herunterkam: „Ich spreche für dich und die Nische auch!“ Wir waren drei kleine Kinder und saßen mit Vater auf dem Sofa, während er das Morgengebet sprach. Den Platz zwischen Vater und der Armlehne des Sofas nannten wir „die Nische“. Das Kind, das diesen Platz bekam, betrachteten wir als besonders begünstigt, sowohl was den Komfort betraf als auch in gewisser Weise in Bezug auf Rang und Titel. Die beiden, die auf der viel breiteren Sofafläche auf der anderen Seite des Vaters sitzen mussten, waren vorerst Außenseiter.
Meine Tante Anna, die Schwester meiner Mutter, wohnte bei uns. Sie war uns Kindern genauso zugetan wie meine Mutter selbst, und wir liebten sie genauso sehr. Sie brachte uns bei, als wir noch klein waren. Sie und meine Mutter unterhielten uns stundenlang mit Geschichten aus dem Leben auf den Plantagen in Georgia, vom Jagen von Füchsen, Rehen und Wildkatzen, von den langschwänzigen Kutschpferden Boone und Crockett und von den Reitpferden, von denen eines in einem Anfall patriotischer Begeisterung während des Mexikanischen Krieges den Namen Buena Vista erhielt, und von den seltsamen Vorgängen in den Negervierteln. Sie kannte alle „Br'er Rabbit”-Geschichten, und ich bin mit ihnen aufgewachsen. Einer meiner Onkel, Robert Roosevelt, war davon sehr beeindruckt und schrieb sie nach ihrem Diktat auf und veröffentlichte sie in Harpers, wo sie jedoch kein Erfolg waren. Das war viele Jahre bevor ein Genie auftauchte, der diese Geschichten in “Onkel Remus” unsterblich machte.
Die beiden Brüder meiner Mutter, James Dunwoodie Bulloch und Irvine Bulloch, besuchten uns kurz nach Kriegsende. Beide kamen unter falschen Namen, da sie zu den Konföderierten gehörten, die zu dieser Zeit von der Amnestie ausgenommen waren. „Onkel Jimmy” Bulloch war ein lieber alter pensionierter Kapitän, der im weltlichen Sinne des Wortes völlig unfähig war, “voranzukommen”, ein tapferer, einfacher und aufrichtiger Mensch, wie es ihn selten gab, ein wahrer Oberst Newcome. Er war Admiral in der Konföderierten Marine und der Erbauer des berühmten Konföderierten Kriegsschiffs Alabama. Mein Onkel Irvine Bulloch war Seekadett auf der Alabama und feuerte die letzte Kanone, die in der Schlacht mit der Kearsarge abgefeuert wurde. Beide Onkel lebten nach dem Krieg in Liverpool.
Mein Onkel Jimmy Bulloch war den Truppen der Union gegenüber nachsichtig und gerecht und konnte alle Phasen des Bürgerkriegs mit absoluter Fairness und Großzügigkeit diskutieren. In der englischen Politik wurde er jedoch schnell zu einem Tory der ultra-konservativen Schule. Lincoln und Grant konnte er bewundern, aber er wollte nichts Gutes über Herrn Gladstone hören. Das einzige Mal, dass ich sein Vertrauen in mich erschütterte, war, als ich ihm vorsichtig andeutete, dass einige der offensichtlich absurden Lügen über Herrn Gladstone nicht wahr sein könnten. Mein Onkel war einer der besten Menschen, die ich je gekannt habe, und wenn ich manchmal versucht war, mich zu fragen, wie gute Menschen so ungerechte und unmögliche Dinge über mich glauben können, wie sie es tun, tröstete ich mich mit dem Gedanken an Onkel Jimmy Bullochs vollkommen aufrichtige Überzeugung, dass Gladstone sowohl im öffentlichen als auch im privaten Leben ein Mann von ganz außergewöhnlicher und unbeschreiblicher Schändlichkeit war.
Ich war ein kränklicher, zartlicher Junge, litt stark unter Asthma und musste oft auf Reisen mitgenommen werden, um einen Ort zu finden, an dem ich atmen konnte. Eine meiner Erinnerungen ist, wie mein Vater nachts mit mir im Arm im Zimmer auf und ab ging, als ich noch sehr klein war, und wie ich im Bett saß und nach Luft rang, während mein Vater und meine Mutter versuchten, mir zu helfen. Ich ging kaum zur Schule. Ich besuchte nie die öffentlichen Schulen, wie es später meine eigenen Kinder taten, sowohl die „Cove School” in Oyster Bay als auch die „Ford School” in Washington. Einige Monate lang besuchte ich die Schule von Professor McMullen in der Twentieth Straße in der Nähe meines Geburtshauses, aber die meiste Zeit hatte ich Privatlehrer. Wie ich bereits erwähnt habe, unterrichtete mich meine Tante, als ich klein war. Eine Zeit lang hatten wir eine französische Gouvernante, eine geliebte und geschätzte „Mamselle”, im Haushalt.
Als ich zehn Jahre alt war, machte ich meine erste Reise nach Europa. Meinen Geburtstag verbrachte ich in Köln, und um mir ein richtiges „Festtagsgefühl” zu vermitteln, erinnere ich mich, dass meine Mutter sich für mein Geburtstagsessen in voller Abendgarderobe kleidete. Ich glaube nicht, dass ich von dieser besonderen Auslandsreise etwas mitgenommen habe. Ich habe sie von ganzem Herzen gehasst, ebenso wie mein jüngerer Bruder und meine Schwester. Praktisch alles, was uns Spaß machte, war, Ruinen oder Berge zu erkunden, wenn wir uns unseren Eltern entziehen konnten, und in den verschiedenen Hotels zu spielen. Unser einziger Wunsch war es, zurück nach Amerika zu kommen, und wir betrachteten Europa mit dem ignorantesten Chauvinismus und Verachtung. Vier Jahre später unternahm ich jedoch eine weitere Reise nach Europa und war alt genug, um sie in vollen Zügen genießen und davon profitieren zu können.
Schon als kleiner Junge begann ich, mich für Naturgeschichte zu interessieren. Ich erinnere mich noch ganz genau an den ersten Tag, an dem ich meine Laufbahn als Zoologe begann. Ich ging die Broadway-Straße hinauf, und als ich an dem Markt vorbeikam, zu dem ich manchmal vor dem Frühstück geschickt wurde, um Erdbeeren zu holen, sah ich plötzlich eine tote Robbe, die auf einem Holzbrett ausgebreitet lag. Diese Robbe erfüllte mich mit allen nur denkbaren Gefühlen von Romantik und Abenteuerlust. Ich fragte, wo sie getötet worden sei, und man sagte mir: im Hafen. Ich hatte bereits begonnen, einige von Mayne Reids Büchern und andere Abenteuerbücher für Jungen zu lesen, und ich hatte das Gefühl, dass diese Robbe all diese Abenteuer auf einmal in greifbare Wirklichkeit verwandelte. Solange die Robbe dort lag, streifte ich Tag für Tag in der Nähe des Marktes umher. Ich maß sie aus, und ich erinnere mich, dass ich, da ich kein Maßband hatte, mein Bestes tun musste, um ihren Umfang mit einem zusammenklappbaren Taschenmaßstab zu ermitteln – ein schwieriges Unterfangen. Ich fertigte sorgfältig eine Aufzeichnung dieser völlig nutzlosen Maße an und begann sogleich, auf Grundlage dieser Robbe eine eigene Naturgeschichte zu schreiben. Diese und spätere Naturgeschichten schrieb ich in leere Hefte, in vereinfachter Rechtschreibung, völlig unüberlegt und ohne wissenschaftlichen Anspruch. Ich hegte vage Hoffnungen, diese Robbe irgendwie zu besitzen und zu konservieren, doch diese Gedanken kamen nie über ein formloses Stadium hinaus. Ich glaube jedoch, dass ich den Schädel der Robbe bekam, und gemeinsam mit zwei meiner Vettern gründete ich sogleich, voller Ehrgeiz, das, was wir das „Roosevelt-Museum für Naturgeschichte“ nannten. Die Sammlung wurde zunächst in meinem Zimmer aufbewahrt, bis ein Aufstand des Zimmermädchens die Zustimmung der höheren Instanzen im Haushalt fand und die Sammlung in ein Bücherregal im hinteren Flur im oberen Stockwerk verlegt wurde. Es war die übliche Sammlung eines kleinen Jungen: eine Ansammlung von Kuriositäten, völlig zusammenhangslos und von keinerlei Wert – außer aus der Sicht des Jungen selbst. Mein Vater und meine Mutter ermutigten mich herzlich in diesem Tun, wie sie es stets taten bei allem, was mir gesunde Freude bereitete oder zu meiner Entwicklung beitragen konnte.
Das Abenteuer mit der Robbe und die Romane von Mayne Reid haben mein instinktives Interesse an Naturkunde noch verstärkt. Ich war zu jung, um viel von Mayne Reid zu verstehen, außer den Abenteuern und der Naturkunde – die haben mich total gefesselt. Aber natürlich habe ich nicht nur Naturkunde gelesen. Meine Eltern haben mich nicht zum Lesen gezwungen, weil sie so vernünftig waren, mir nichts aufzuzwingen, was ich nicht mochte, außer es war für die Schule. Ich durfte Bücher lesen, die sie für mich für gut hielten, aber wenn sie mir nicht gefielen, bekam ich ein anderes gutes Buch, das mir gefiel. Es gab bestimmte Bücher, die tabu waren. Zum Beispiel durfte ich keine Groschenromane lesen. Ich habe mir heimlich welche besorgt und sie gelesen, aber ich glaube nicht, dass der Spaß das schlechte Gewissen aufgewogen hat. Mir war es auch verboten, das einzige Buch von Ouida zu lesen, das ich lesen wollte – „Unter zwei Flaggen“. Ich habe es trotzdem gelesen, mit der gierigen und heftigen Hoffnung, etwas Unmoralisches zu finden, aber tatsächlich haben mich alle Stellen, die einem älteren Menschen unmoralisch erschienen sein könnten, überhaupt nicht beeindruckt. Ich habe einfach auf eine ziemlich verwirrte Weise die allgemeinen Abenteuer genossen.
Ich finde, es sollte Kinderbücher geben. Ich glaube, dass Kinder auch Bücher für Erwachsene mögen, und ich glaube nicht, dass ein Kinderbuch wirklich gut ist, wenn Erwachsene nichts darin finden. Es gibt zum Beispiel ein Buch, das ich als Kind nicht hatte, weil es noch nicht geschrieben war. Es ist „Kinderreime“ von Laura E. Richard. Meine eigenen Kinder haben es sehr geliebt, und ihre Mutter und ich haben es fast genauso geliebt; die herrlich unbeschwerte Geschichte „Der Mann aus New Mexico, der seine Großmutter im Schnee verlor“, die Abenteuer von „Der Eule, dem Aal und dem Wärmflaschenwärmer“ und die außergewöhnliche Genealogie des Kängurus, dessen „Vater ein Wal mit einer Feder im Schwanz war, der im Grönlandmeer lebte“, während „seine Mutter ein Hai war, der sich im Golf von Karibee versteckte“.
Als kleiner Junge hatte ich Our Young Folks, das ich damals felsenfest für die beste Zeitschrift der Welt hielt – ein Glaube, den ich, darf ich hinzufügen, bis heute unverändert bewahrt habe, denn ich bezweifle ernsthaft, dass je eine Zeitschrift, ob für Jung oder Alt, sie je übertroffen hat. Sowohl meine Frau als auch ich besitzen die gebundenen Jahrgänge von Our Young Folks, die wir aus unserer Jugendzeit aufbewahrt haben. Ich habe versucht, die Bücher von Mayne Reid, die ich als Junge so innig liebte, noch einmal zu lesen – nur um leider festzustellen, dass es unmöglich ist. Aber ich glaube wirklich, dass ich heute beinahe ebenso viel Freude daran habe, Our Young Folks wieder durchzublättern, wie damals. „Ausgesetzt in der Kälte“, „Großvaters Kampf um eine Heimstatt“, „Die Briefe von William Henry“ und ein Dutzend anderer Geschichten dieser Art waren erstklassige, gesunde Erzählungen – zunächst spannend, und darüber hinaus lehrten sie Männlichkeit, Anstand und gutes Benehmen. Auf die Gefahr hin, für verweichlicht gehalten zu werden, will ich hinzufügen, dass ich auch die Mädchengeschichten sehr mochte – „Muschi Weide“ und „Ein Sommer im Leben der Leslie Goldthwaite“, ebenso wie ich „Kleine Männer“, „Betty und ihre Schwestern“ und „Ein altmodisches Mädchen“ verehrte.
Diese Vorliebe für die sanftere Seite des Lebens hinderte mich nicht daran, mich an Abenteuergeschichten wie denen von Ballantyne oder Marryats „Midshipman Easy“ zu ergötzen. Ich nehme an, jeder hat seine Macken, und schon als Kind gab es Bücher, die ich hätte mögen sollen, aber nicht mochte. Zum Beispiel hat mir der erste Teil von „Robinson Crusoe“ überhaupt nicht gefallen (und obwohl er zweifellos der beste Teil ist, mag ich ihn auch heute noch nicht), während mich der zweite Teil mit den Abenteuern von Robinson Crusoe, den Wölfen in den Pyrenäen und im Fernen Osten einfach fasziniert hat. Was mir im ersten Teil gefiel, waren die Abenteuer, bevor Crusoe endlich seine Insel erreichte, der Kampf mit den Sallee-Rovers und die Anspielung auf die seltsamen Tiere, die nachts ihr unwahrscheinliches Bad im Ozean nahmen. Da ich bereits ein angehender Zoologe war, mochte ich „Die Schweizer Familie Robinson“ nicht, weil die würdige Familie auf ihrem Weg ins Landesinnere nach dem Schiffbruch auf eine völlig unmögliche Ansammlung von Tieren traf. Selbst in der Poesie war es die Erzählung von Abenteuern, die mich als Junge am meisten faszinierte. Schon ziemlich früh begann ich, bestimmte Gedichtbände zu lesen, insbesondere Longfellows Gedicht „Die Saga von König Olaf“, das mich total in seinen Bann zog. Damit kam ich zur skandinavischen Literatur, und ich habe mein Interesse und meine Vorliebe dafür nie verloren.
Zu meinen ersten Büchern gehörte ein Band von Mayne Reid über Säugetiere – ein hoffnungslos unwissenschaftliches Werk, illustriert mit Bildern, die zwar kaum künstlerischer, dafür aber ebenso aufregend waren wie jene in einem typischen Schulatlas. Als mein Vater bemerkte, wie sehr mich dieser nicht eben zuverlässige Band fesselte, schenkte er mir ein kleines Buch von J. G. Wood, dem englischen Verfasser populärwissenschaftlicher Werke über Naturgeschichte, und später ein umfangreicheres von ihm mit dem Titel „Heime ohne Hände“. Beide Bücher wurden zu geschätztem Besitz. Ich studierte sie mit Eifer, und schließlich gingen sie an meine Kinder über. „Heime ohne Hände“ erhielt übrigens noch eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit einem pädagogischen Fehlschlag meinerseits. In Übereinstimmung mit dem, was ich für eine moderne Theorie hielt – nämlich Bildung interessant zu gestalten und nicht zur Last werden zu lassen –, versuchte ich, meinem ältesten kleinen Sohn ein oder zwei Buchstaben anhand der Titelseite beizubringen. Da der Buchstabe „H“ im Titel ungewöhnlich oft vorkam, wählte ich ihn als Ausgangspunkt. Mein Ziel war es, das Kind bei Laune zu halten, ihm nicht das Gefühl zu geben, eine Lektion zu lernen, und es davon zu überzeugen, dass es einfach nur Spaß habe. Ob es nun an der Theorie lag oder an meiner Art, sie umzusetzen, vermag ich nicht zu sagen – aber ich schaffte es jedenfalls, ihm jegliche Fähigkeit, den Buchstaben „H“ zu erkennen, vollständig auszutreiben. Und noch lange, nachdem er auf altmodische Weise alle anderen Buchstaben des Alphabets gelernt hatte, war er unter keinen Umständen imstande, sich an das „H“ zu erinnern.
Ohne es selbst zu wissen, stand ich als Junge beim Studium der Natur unter einem hoffnungslosen Nachteil. Ich war stark kurzsichtig, sodass ich nur jene Dinge untersuchen konnte, gegen die ich lief oder über die ich stolperte. Als ich etwa dreizehn Jahre alt war, durfte ich Unterricht im Präparieren von Tieren bei einem gewissen Herrn Bell nehmen – einem hochgewachsenen, glatt rasierten, weißhaarigen alten Herrn, so aufrecht wie ein Indianer, der einst ein Gefährte Audubons gewesen war. Er besaß ein muffiges kleines Geschäft, das ein wenig an Mr. Venus’ Laden in „Unser gemeinsamer Freund“ erinnerte – ein kleines Geschäft, in dem er sehr wertvolle Arbeit für die Wissenschaft geleistet hatte. Dieses „berufliche Studium“, wie es moderne Pädagogen wohl nennen würden, belebte und lenkte mein Interesse am Sammeln von Exemplaren zum Präparieren und Aufbewahren. In jenem Sommer erhielt ich mein erstes Gewehr, und es verwunderte mich, dass meine Gefährten offenbar Dinge zum Schießen sahen, die ich überhaupt nicht erkennen konnte. Eines Tages lasen sie laut eine Anzeige in riesigen Buchstaben auf einer entfernten Plakatwand vor, und da wurde mir klar, dass etwas nicht stimmte – denn ich konnte nicht nur die Schrift nicht lesen, ich konnte nicht einmal die Buchstaben erkennen. Ich sprach mit meinem Vater darüber, und kurz darauf bekam ich meine erste Brille, die mir buchstäblich eine völlig neue Welt eröffnete. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie schön die Welt war, bis ich diese Brille bekam. Ich war ein unbeholfener und linkischer kleiner Junge gewesen, und obwohl vieles von meiner Ungeschicklichkeit und Steifheit gewiss auf allgemeine Wesenszüge zurückzuführen war, lag ein guter Teil davon doch daran, dass ich nicht sehen konnte – und mir dessen völlig unbewusst war. Die Erinnerung an diese Erfahrung erfüllt mich mit tiefem Mitgefühl für jene, die in unseren öffentlichen Schulen und anderswo versuchen, die körperlichen Ursachen von Schwächen bei Kindern zu beheben – Kindern, die oft zu Unrecht als trotzig, ehrgeizlos oder geistig träge verurteilt werden.
Im selben Sommer habe ich auch verschiedene neue Bücher über Säugetiere und Vögel bekommen, darunter die Veröffentlichungen von Spencer Baird, und mich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Im Freien habe ich nicht viel gelernt, weil ich erst spät im Herbst, kurz bevor ich mit meiner Familie zu einer zweiten Europareise aufbrach, eine Brille bekam. Wir wohnten in Dobbs Ferry am Hudson. Meine Waffe war eine doppelläufige Hinterlader-Nadelfeuerwaffe französischer Herstellung. Es war eine ausgezeichnete Waffe für einen tollpatschigen und oft zerstreuten Jungen. Sie hatte keine Feder zum Öffnen, und wenn der Mechanismus rostig wurde, konnte man sie mit einem Ziegelstein öffnen, ohne sie ernsthaft zu beschädigen. Wenn die Patronen klemmten, konnten sie auf die gleiche Weise entfernt werden. Wenn sie jedoch geladen waren, war das Ergebnis nicht immer glücklich, und ich habe mich mehr als einmal mit teilweise unverbrannten Pulverkörnern tätowiert.
Als ich vierzehn Jahre alt war, im Winter 1872/73, besuchte ich zum zweiten Mal Europa, und diese Reise war ein wirklich nützlicher Teil meiner Ausbildung. Wir fuhren nach Ägypten, reisten den Nil hinauf, durch das Heilige Land und einen Teil Syriens, besuchten Griechenland und Konstantinopel; und dann verbrachten wir Kinder den Sommer bei einer deutschen Familie in Dresden. Meine ersten richtigen Sammlungen als Naturforschschüler machte ich während dieser Reise in Ägypten. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits gute Kenntnisse über die Vogelwelt Amerikas aus oberflächlich wissenschaftlicher Sicht. Über die Ornithologie Ägyptens wusste ich nichts, aber in Kairo fand ich ein Buch eines englischen Geistlichen, dessen Namen ich inzwischen vergessen habe, der eine Reise auf dem Nil beschrieb und in einem Anhang seines Buches über seine Vogelsammlung berichtete. Ich wünschte, ich könnte mich noch an den Namen des Autors erinnern, denn diesem Buch verdanke ich sehr viel. Ohne es hätte ich völlig im Dunkeln gesammelt, während ich mit seiner Hilfe in der Regel herausfinden konnte, um welche Vögel es sich handelte. Meine ersten Lateinkenntnisse erwarb ich, indem ich die wissenschaftlichen Namen der Vögel und Säugetiere lernte, die ich mit Hilfe solcher Bücher sammelte und klassifizierte.
Die Vögel, die ich am Nil und in Palästina erbeutet hatte, stellten lediglich die übliche Sammlung eines Jungen dar. Einige Jahre später übergab ich sie, zusammen mit den anderen ornithologischen Exemplaren, die ich gesammelt hatte, der Smithsonian Institution in Washington, und ich glaube, einige auch dem American Museum of Natural History in New York. Man sagt mir, dass die Bälge noch heute in beiden Einrichtungen sowie in anderen öffentlichen Sammlungen zu finden seien. Ich bezweifle allerdings, dass sie noch meine ursprünglichen Etiketten tragen. Mit großem Stolz hatten die Direktoren des „Roosevelt-Museums“ – bestehend aus mir selbst und den beiden erwähnten Vettern – eigens eine Serie von Roosevelt-Museum-Etiketten in rosafarbener Tinte drucken lassen, als Vorbereitung auf das, was als mein abenteuerlicher Ägyptenaufenthalt galt. Das Vogelsammeln war in Wahrheit der Hauptreiz meiner Nilreise. Ich war alt genug und hatte genug gelesen, um die Tempel, die Wüstenlandschaft und das allgemeine Gefühl von Romantik zu genießen; doch all dies hätte mit der Zeit seinen Reiz verloren, wenn ich nicht auch die ernsthafte Aufgabe gehabt hätte, meine Exemplare zu sammeln und zu präparieren. Zweifellos hatte die Familie ihre Leidensmomente – insbesondere bei einer Gelegenheit, als ein gutmeinendes Hausmädchen aus meinem Präparierkasten die alte Zahnbürste entnahm, mit der ich die arsenhaltige Seife auf die Häute auftrug, die zu deren Konservierung notwendig war, sie teilweise auswusch und sie dann mit dem übrigen Waschzeug für meinen persönlichen Gebrauch zurückließ. Ich nehme an, dass alle heranwachsenden Jungen dazu neigen, schmuddelig zu sein; doch der ornithologisch interessierte Junge – oder überhaupt der Junge mit einer Vorliebe für Naturkunde – ist in der Regel der schmuddeligste von allen. Ein zusätzlicher Umstand in meinem Fall war, dass ich während meines Aufenthalts in Ägypten plötzlich zu wachsen begann. Da es am Nil keine Schneider gab, brauchte ich bei meiner Rückkehr nach Kairo eine neue Garderobe. Doch es gab einen Anzug, der zu gut war, um ihn wegzuwerfen, den wir als „Wechselkleidung“ behielten und der als mein „Smike-Anzug“ bekannt war, weil er meine Handgelenke und Fußknöchel ebenso bloß ließ wie die des armen Smike selbst.
Als wir in Dresden ankamen, wurden wir jüngeren Kinder für den Sommer im Hause von Herr Minckwitz untergebracht, einem Mitglied entweder der Stadtverwaltung oder der sächsischen Regierung – ich habe vergessen, welcher genau. Man hoffte, dass wir auf diese Weise ein wenig von der deutschen Sprache und Literatur lernen würden. Es war die freundlichste Familie, die man sich nur vorstellen kann. Ich werde niemals die unermüdliche Geduld der beiden Töchter vergessen. Der Vater und die Mutter sowie ein schüchterner, hagerer Vetter, der als Student in der Wohnung lebte, waren nicht minder freundlich. Wann immer ich hinaus aufs Land konnte, sammelte ich eifrig Naturproben und belebte den Haushalt mit Igeln und anderem kleinen Getier und Reptilien, die es sich zur Gewohnheit machten, aus halb geschlossenen Kommodenschubladen zu entkommen. Die beiden Söhne waren faszinierende Studenten der Universität Leipzig, beide Mitglieder von Duellverbindungen und dementsprechend stark vernarbt. Einer, ein berühmter Fechter, wurde Der Rote Herzog genannt, und der andere trug den Spitznamen Herr Nashorn, weil ihm in einem Duell die Nasenspitze abgetrennt und wieder angenäht worden war. Ich lernte hier eine ganze Menge Deutsch, obgleich eher widerwillig, und vor allem wurde ich vom Nibelungenlied gefesselt. Die deutsche Prosa wurde mir nie wirklich leicht, so wie es bei der französischen Prosa der Fall war, aber für deutsche Dichtung empfand ich ebenso viel wie für englische. Vor allem aber gewann ich einen Eindruck vom deutschen Volk, der mich nie wieder losließ. Seit jener Zeit bis heute wäre es völlig unmöglich gewesen, mir einzureden, dass die Deutschen wirklich Fremde seien. Die Herzlichkeit, die Gemütlichkeit (ein Begriff, der sich durch kein einzelnes englisches Wort genau wiedergeben lässt), die Arbeitsamkeit, das Pflichtbewusstsein, die Freude an Literatur und Wissenschaft, der Stolz auf das neue Deutschland, das mehr als freundliche und wohlwollende Interesse an drei fremden Kindern – all diese Ausdrucksformen des deutschen Wesens und des deutschen Familienlebens hinterließen einen unterbewussten Eindruck in mir, den ich damals keineswegs klar benennen konnte, der aber auch vierzig Jahre später noch sehr lebendig ist.
Als ich mit fünfzehn Jahren nach Amerika zurückkehrte, begann ich ernsthaft zu lernen, um in Harvard aufgenommen zu werden, unter Herrn Arthur Cutler, der später die Cutler School in New York gründete. Ich konnte nicht zur Schule gehen, weil ich in einigen Fächern so viel weniger wusste als die meisten Jungen in meinem Alter und in anderen so viel mehr. In Naturwissenschaften, Geschichte und Geografie sowie in unerwarteten Bereichen des Deutschen und Französischen war ich stark, aber in Latein, Griechisch und Mathematik leider sehr schwach. Mein Großvater hatte sich einige Jahre zuvor in Oyster Bay ein Sommerhaus gebaut, und mein Vater machte Oyster Bay nun auch zum Sommerdomizil seiner Familie. Neben meinen Vorbereitungen für das College arbeitete ich als praktischer Student der Naturgeschichte. Ich arbeitete fleißiger als ich intelligent oder erfolgreich war und trug nur sehr wenig zum menschlichen Wissen bei; aber bis heute findet man in bestimmten obskuren ornithologischen Publikationen Aufzeichnungen darüber, dass beispielsweise ein Fischkrähe und ein Ipswich-Spatz von einem gewissen Theodore Roosevelt Jr. in Oyster Bay an der Küste des Long Island Sound gefangen wurden.
Im Herbst 1876 ging ich nach Harvard und machte 1880 meinen Abschluss. Ich habe Harvard sehr genossen und bin sicher, dass es mir gut getan hat, aber nur im Allgemeinen, denn nur sehr wenig von dem, was ich tatsächlich gelernt habe, hat mir im späteren Leben geholfen. Mehr als einer meiner eigenen Söhne hat bereits von der Freundschaft mit bestimmten Lehrern in der Schule oder im College profitiert. Ich habe auf jeden Fall von meiner Freundschaft mit einem meiner Tutoren, Herrn Cutler, profitiert, und in Harvard verdanke ich dem Englischprofessor, Herrn A. S. Hill, sehr viel. Zweifellos durch meine eigene Schuld habe ich fast nichts von Präsident Eliot und nur sehr wenig von den Professoren gesehen. Ich hätte viel mehr aus dem Schreiben von Aufsätzen und Reden herausholen können, als ich es getan habe. Dass ich das nicht getan habe, lag vielleicht zum Teil daran, dass mich die Fächer nicht interessierten. Bevor ich Harvard verließ, schrieb ich bereits ein oder zwei Kapitel eines Buches, das ich später über den Seekrieg von 1812 veröffentlichte. Diese Kapitel waren so trocken, dass sie im Vergleich dazu ein Wörterbuch wie leichte Lektüre erscheinen ließen. Dennoch waren sie Ausdruck meiner Zielstrebigkeit und meines ernsthaften Interesses und nicht nur eine oberflächliche Anstrengung, um eine bestimmte Note zu erreichen; und die Korrekturen eines erfahrenen älteren Mannes hätten mich beeindruckt und meine respektvolle Aufmerksamkeit erzwungen. Aber ich war noch nicht reif genug, um mich wirklich für einige der mir zugewiesenen Themen zu interessieren – zum Beispiel für die Figur der Gracchen. Ein sehr kluger und fleißiger Junge hätte das sicher geschafft, aber ich persönlich habe mich erst viele Jahre später für dieses Thema begeistern können. Die Fregatten- und Schaluppen-Gefechte zwischen den amerikanischen und britischen Seeräubern von 1812 waren mir viel näher. Ich habe mich mühsam durch die Gracchen gearbeitet, weil ich musste; mein gewissenhafter und sehr bemitleidenswerter Professor hat mich mit aller Kraft durch das Thema gezerrt, während ich mich mit aller Kraft in langweiliger und völlig ideenloser Abwehr verkrallte.
Ich hatte damals keine Ahnung, dass ich mal ins öffentliche Leben gehen würde, und ich habe nie Rhetorik gelernt oder Debattieren geübt. In gewisser Weise war das ein Verlust für mich. In anderer Hinsicht aber auch nicht. Ich persönlich habe nicht die geringste Sympathie für Debattierwettbewerbe, bei denen jeder Seite willkürlich eine bestimmte These zugewiesen wird und sie diese vertreten muss, ohne dass es auch nur im Geringsten darauf ankommt, ob diejenigen, die sie vertreten, daran glauben oder nicht. Ich weiß, dass dies in unserem System für Anwälte notwendig ist, aber ich lehne es in Bezug auf allgemeine Diskussionen über politische, soziale und industrielle Themen entschieden ab. Was wir brauchen, sind junge Männer, die unsere Hochschulen mit einer festen Überzeugung für das Recht verlassen, und nicht junge Männer, die je nach Interesse gute Argumente für das Recht oder das Unrecht vorbringen können. Die derzeitige Methode, Debatten über Themen wie „Unsere Kolonialpolitik”, „Die Notwendigkeit einer Marine” oder „Die richtige Position der Gerichte in Verfassungsfragen” zu führen, fördert genau die falsche Haltung bei den Teilnehmern. Es wird kein Versuch unternommen, Aufrichtigkeit und Überzeugungskraft zu vermitteln. Im Gegenteil, das Ergebnis ist, dass die Teilnehmer das Gefühl bekommen, dass ihre Überzeugungen nichts mit ihren Argumenten zu tun haben. Ich bedaure, dass ich an der Universität keine Rhetorik studiert habe, aber ich bin überaus froh, dass ich nicht an Debatten teilgenommen habe, bei denen es nicht darum ging, einen Redner zum richtigen Denken zu bringen, sondern ihn dazu zu bringen, geschickt für die Seite zu argumentieren, der er zugeordnet war, ohne Rücksicht darauf, was seine Überzeugungen waren oder sein sollten.
Ich war ein einigermaßen guter Student am College und gehörte, wenn ich mich recht erinnere, gerade noch zum obersten Zehntel meines Jahrgangs; obwohl ich nicht sicher bin, ob sich das auf das Zehntel aller bezieht, die das Studium aufgenommen hatten, oder nur auf jene, die es auch abschlossen. Man verlieh mir den Phi-Beta-Kappa-Schlüssel. Mein Hauptinteresse galt den Naturwissenschaften. Als ich das College betrat, war ich ganz der Naturgeschichte im Freien verschrieben, und mein Ziel war es, ein wissenschaftlicher Mann vom Schlage eines Audubon, Wilson, Baird oder Coues zu werden – ein Mann wie Hart Merriam, Frank Chapman oder Hornaday in unserer Zeit. Mein Vater hatte mir von frühester Kindheit an beigebracht, dass ich arbeiten und mir meinen Weg im Leben selbst bahnen müsse, und ich war stets davon ausgegangen, dass dies bedeutete, ich müsse ins Geschäftsleben eintreten. Doch in meinem ersten Studienjahr (er starb, als ich im zweiten war) sagte er mir, dass ich, wenn ich ein wissenschaftlicher Mann werden wolle, dies auch tun könne. Er erklärte mir, ich müsse mir sicher sein, dass ich die wissenschaftliche Arbeit mit ganzer Leidenschaft wolle, denn wenn ich diesen Weg einschlüge, müsse ich ihn als ernsthafte Laufbahn begreifen; er habe genug Geld verdient, um es mir zu ermöglichen, eine solche Laufbahn einzuschlagen und gemeinnützige, aber nicht einträgliche Arbeit zu leisten, wenn ich gewillt sei, mein Bestes zu geben; doch ich dürfe keinesfalls daran denken, dies als Dilettant zu tun. Er gab mir auch einen Ratschlag, den ich nie vergessen habe, nämlich: Wenn ich kein Geld verdienen würde, müsse ich das dadurch ausgleichen, dass ich auch keines ausgäbe. Wie er es ausdrückte: Ich müsse den Bruch konstant halten, und wenn ich den Zähler nicht erhöhen könne, müsse ich eben den Nenner verringern. Mit anderen Worten: Wenn ich eine wissenschaftliche Laufbahn einschlüge, müsse ich endgültig auf alle Freuden verzichten, die mit einer gewinnbringenden Karriere einhergehen, und meine Erfüllung anderswo suchen.
Nach diesem Gespräch war ich fest entschlossen, die Wissenschaft zu meiner Lebensaufgabe zu machen. Doch ich tat es nicht – aus dem einfachen Grund, dass Harvard damals, und ich vermute auch unsere anderen Hochschulen, die Möglichkeiten des faunistischen Naturforschers, des Feldnaturforschers und Naturbeobachters völlig ignorierten. Man behandelte die Biologie ausschließlich als eine Labor- und Mikroskopwissenschaft, als eine Disziplin, deren Anhänger ihre Zeit mit dem Studium winziger Meereslebewesen oder mit dem Anfertigen von Schnitten und dem mikroskopischen Studium der Gewebe höherer Organismen verbringen sollten. Diese Haltung war zweifellos zum Teil darauf zurückzuführen, dass an den meisten Hochschulen damals eine nicht immer kluge Nachahmung dessen stattfand, was an den großen deutschen Universitäten geschah. Der berechtigte Aufstand gegen oberflächliches Studium war ins Extrem getrieben worden; Gründlichkeit im Kleinsten war zum alleinigen Ziel des Studiums erhoben und zu einem Fetisch gemacht worden. Man hatte völlig versäumt zu erkennen, welch große Vielfalt an Arbeiten von Naturforschern geleistet werden konnte – einschließlich jener Arbeiten, die von Feldnaturforschern verrichtet werden konnten, jener Art von Arbeit, die Hart Merriam und seine Mitarbeiter im Biologischen Dienst in Bezug auf die nordamerikanischen Säugetiere zu einer so hohen Vollendung gebracht haben. Im durchaus berechtigten Bestreben, gründlich zu sein und schlampige Methoden zu vermeiden, neigte man dazu, jede Art von Arbeit, die nicht mit mühsamer Akribie im Labor betrieben wurde, als unseriös und unwissenschaftlich abzutun. Mein Interesse war jedoch in eine völlig andere Richtung gelenkt, und ich hatte weder den Wunsch noch die Fähigkeit, Mikroskopiker oder Schnitttechniker zu werden – ebenso wenig wie Mathematiker. Daher gab ich jeden Gedanken daran auf, Wissenschaftler zu werden. Zweifellos bedeutete dies, dass ich nicht jene tiefe Hingabe an die Wissenschaft besaß, von der ich geglaubt hatte, sie zu haben; denn hätte ich sie wirklich besessen, so hätte ich mir ungeachtet aller Entmutigungen irgendwie eine Laufbahn in der Wissenschaft geschaffen.
Was die politische Ökonomie betrifft, so wurde mir während meiner Collegezeit natürlich die Laissez-faire-Doktrin beigebracht – darunter auch der Freihandel –, die damals als kanonisch galt. Die meisten amerikanischen Jungen meines Alters lernten sowohl durch ihr Umfeld als auch durch ihr Studium bestimmte Prinzipien, die aus Sicht des nationalen Interesses sehr wertvoll waren, und bestimmte andere, die genau das Gegenteil waren. Die politischen Ökonomen waren dafür nicht besonders verantwortlich; es war die allgemeine Haltung der Autoren, die für unsere Generation schrieben. Nimm zum Beispiel mein geliebtes Magazin „Our Young Folks“, von dem ich bereits gesprochen habe und das mir viel mehr beigebracht hat als alle meine Lehrbücher. Alles in dieser Zeitschrift vermittelte individuelle Tugenden und die Notwendigkeit des Charakters als Hauptfaktor für den Erfolg eines jeden Menschen – eine Lehre, an die ich heute noch genauso fest glaube wie damals, denn alle Gesetze, die der Verstand des Menschen erfinden kann, werden einen Menschen niemals zu einem würdigen Bürger machen, wenn er nicht das richtige Zeug dazu hat, wenn er nicht Selbstvertrauen, Energie, Mut, die Kraft, auf seinen Rechten zu bestehen, und die Sympathie, die ihn die Rechte anderer achten lässt. All diese individuelle Moral wurde mir durch die Bücher vermittelt, die ich zu Hause las und die ich in Harvard studierte. Aber es gab fast keine Lehre über die Notwendigkeit kollektiven Handelns und über die Tatsache, dass es neben der individuellen Verantwortung auch eine kollektive Verantwortung gibt, die diese nicht ersetzt. Bücher wie Herbert Crolys „Das Versprechen des amerikanischen Lebens“ und Walter E. Weyls „Neue Demokratie“ wurden damals im Allgemeinen entweder als unverständlich oder als reine Ketzerei angesehen.
Die Lehre, die ich erhielt, war in gewisser Weise wirklich demokratisch. In anderer Hinsicht war sie weniger demokratisch. Ich wuchs mit der festen Überzeugung auf, dass ein Mensch für das, was er aus sich macht, respektiert werden muss. Aber mir wurde auch bewusst oder unbewusst beigebracht, dass die Pflicht eines Mannes in gesellschaftlicher und beruflicher Hinsicht darin besteht, das Beste aus sich zu machen, dass er ehrlich mit anderen umgehen und den Unglücklichen auf altmodische Weise Nächstenliebe entgegenbringen soll, dass es aber nicht seine Aufgabe ist, sich mit anderen zusammenzuschließen, um die Lage der Mehrheit zu verbessern, indem er die abnormale und übertriebene Entwicklung des Individualismus einiger weniger eindämmt. Ich will damit nicht sagen, dass diese Erziehung in jeder Hinsicht schlecht war. Im Gegenteil, das Beharren auf individueller Verantwortung war, ist und bleibt eine Grundvoraussetzung. Die Lehre, die ich sowohl aus meinen Lehrbüchern als auch aus meinem Umfeld aufgenommen habe, ist ein gesundes Gegenmittel gegen die Sentimentalität, die durch selbstgefällige Entschuldigungen für alle Unzulänglichkeiten des Einzelnen letztlich die Quelle moralischer Entschlossenheit hoffnungslos schwächen würde. Sie hält auch jene männliche Kraft am Leben, ohne die keine noch so perfekte Gesetzgebung oder Gemeinschaftsaktion jemals den Mangel des Durchschnittsmenschen ausgleichen könnte. Aber eine solche Lehre, wenn sie nicht durch andere Lehren korrigiert wird, bedeutet die Duldung eines zügellosen, gesetzlosen Geschäftsindividualismus, der für die echte Zivilisation ebenso zerstörerisch wäre wie der gesetzlose militärische Individualismus des Mittelalters. Ich verließ das College und trat in die große Welt ein, mit einer Dankbarkeit, die ich nicht in Worte fassen kann, für die Ausbildung, die ich erhalten hatte, insbesondere in meinem eigenen Zuhause; aber ich musste noch viel lernen, wenn ich wirklich bereit sein wollte, meinen Teil zu der Arbeit beizutragen, die vor der Generation von Amerikanern lag, zu der ich gehörte.
KAPITEL II
DIE KRAFT DES LEBENS
Wenn man zurückblickt, hat man eigentlich ein objektiveres Bild von sich selbst als Kind als von seinem Vater oder seiner Mutter. Man hat das Gefühl, dass dieses Kind nicht das gegenwärtige Ich ist, sondern ein Vorfahr, genauso wie die eigenen Eltern. Die Redewendung „Das Kind ist der Vater des Mannes“ kann in gewisser Weise fast umgekehrt verstanden werden, als man gemeinhin denkt. Das Kind ist der Vater des Mannes in dem Sinne, dass seine Individualität von der Individualität des Erwachsenen, zu dem es wird, getrennt ist. Das ist vielleicht ein Grund, warum ein Mensch mit einem Gefühl der Distanz über seine Kindheit und frühe Jugend sprechen kann.