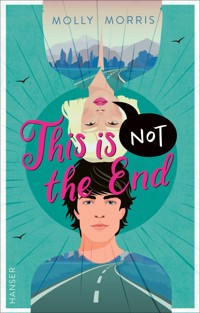
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein Roadtrip voller Liebe, Überraschungen und verrückter (Un-)Möglichkeiten – witzig, mitreißend und magisch. Für Fans von Adam Silvera Ein beeindruckendes Debüt voller Humor und ungewöhnlicher Ideen. Auf seinem Blog bewertet Hugh beliebte Filme, Serien und Bücher danach, wie sie ausgehen. Schlechte Enden hasst er auf der Leinwand nämlich genauso wie im echten Leben. Auch Veränderungen meidet er. Als Hugh Olivia trifft – Mitschülerin, Außenseiterin und allem Anschein nach unsterblich –, werden die Dinge kompliziert. Denn um mehr über sie zu erfahren, muss er Olivia einen Gefallen tun. Er soll helfen, eine Kiste mit ihren wertvollsten Besitztümern zurückzuholen. Und so fahren Hugh und Olivia in einem gestohlenen Eis-Van nach New York. Auf ihrem turbulenten Roadtrip kommen die beiden sich näher, und Hugh muss erkennen, dass Chaos und Unvorhergesehenes das Leben auch bereichern können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Ein Roadtrip voller Liebe, Überraschungen und verrückter (Un-)Möglichkeiten — witzig, mitreißend und magisch. Für Fans von Adam SilveraEin beeindruckendes Debüt voller Humor und ungewöhnlicher Ideen. Auf seinem Blog bewertet Hugh beliebte Filme, Serien und Bücher danach, wie sie ausgehen. Schlechte Enden hasst er auf der Leinwand nämlich genauso wie im echten Leben. Auch Veränderungen meidet er. Als Hugh Olivia trifft — Mitschülerin, Außenseiterin und allem Anschein nach unsterblich —, werden die Dinge kompliziert. Denn um mehr über sie zu erfahren, muss er Olivia einen Gefallen tun. Er soll helfen, eine Kiste mit ihren wertvollsten Besitztümern zurückzuholen. Und so fahren Hugh und Olivia in einem gestohlenen Eis-Van nach New York. Auf ihrem turbulenten Roadtrip kommen die beiden sich näher, und Hugh muss erkennen, dass Chaos und Unvorhergesehenes das Leben auch bereichern können.
Molly Morris
Aus dem Englischen von Jessika Komina und Sandra Knuffinke
Hanser
Für Diane Tettamble, die mich selbst dann noch zum Schreiben ermutigt hat, nachdem ich sie in jeder meiner Geschichten abgemurkst habe.
Prolog
Im Grunde hätte ich schon stutzig werden müssen, als die Wohnungstür meiner Tante nicht abgeschlossen war. Ich hatte schließlich genug Horrorfilme gesehen, in denen irgendein argloser Trottel durch eine Tür marschierte, nur um — Überraschung! — eine Axt ins Gesicht zu kriegen. Aber wir waren hier immerhin in New York City. Das Apartmentgebäude, in dem meine Tante wohnte, hatte einen Portier. Da sollte man doch meinen, man dürfte ruhig auch mal das Abschließen vergessen, oder?
Mit müdigkeitsvernebeltem Blick ließ ich mich auf die Couch plumpsen und überlegte, während mir schon die Augen zufielen, wann ich eigentlich zum letzten Mal richtig geschlafen hatte. Auf jeden Fall vor diesem bescheuerten Wochenende, an dem ich so ziemlich jede zwischenmenschliche Beziehung ruiniert hatte, die mir je wichtig gewesen war. Wahrscheinlich würden meine Erinnerungen mich nie wieder zur Ruhe kommen lassen: daran, wie ich versucht hatte, mir beim Tanzen nicht anmerken zu lassen, dass ich komplett zugedröhnt war, oder daran, wie ich mir fast gewünscht hatte, Olivia würde mich auslachen und mir einen ihrer sarkastischen Sprüche reinwürgen, weil mir das zumindest die Gewissheit gegeben hätte, dass ich ihr nicht egal war.
Beim Gedanken an Olivia verkrampfte sich mein Magen, und die Bilder vom Wochenende geisterten mir erneut durch den Kopf.
Wie Olivia sich von mir verabschiedete.
Wie Olivia durch das Tor des zwielichtigen Brooklyner Konzertschuppens verschwand. Allein.
Wie ich ihr hinterherstolperte, wie immer zu spät.
Clark in seiner dämlichen Lederweste.
Wie Olivia mich ansah, als —
Ein Geräusch ließ mich aufhorchen. Es klang, wie ein feuchtes Handtuch, das auf die Badezimmerfliesen klatschte.
Ich drückte mir eins der schicken Samtkissen, mit denen die Couch vollgepackt war, aufs Gesicht, als könnte mich das vor dem Schwall von Fürsorge bewahren, der ganz sicher gleich über mich hereinbrechen würde.
»Ich hab die beschissenste Nacht meines Lebens hinter mir, und wenn du jetzt anfängst, mich darüber auszuquetschen, kotze ich dir auf die Couch«, warnte ich Tante Karen schon mal vor.
Als sie jedoch nicht im nächsten Moment auf Socken den Flur runtergeschlittert kam, nahm ich das Kissen wieder vom Gesicht und runzelte die Stirn.
»Karen?«
Erst jetzt fiel mir auf, wie still es ansonsten in der Wohnung war. Es war eine harte, kalte Stille, die Art von Stille, kurz bevor die Handgranate detoniert, während das Ding noch durch die Luft segelt und man nur hilflos dastehen und auf die Explosion warten kann. Auf den ohrenbetäubenden Knall. Auf die Dunkelheit.
Adrenalin schoss mir ins Blut, und ich schwang die Füße vom Sofa. Irgendwie war mir klar, dass mich im Badezimmer weder meine Tante noch ein Axtmörder erwartete. Mir war klar, dass das da drin nur eine Person sein konnte. Dass diese Nacht nur auf eine einzige Art enden konnte.
Mein Sprint den Flur runter dauerte nicht länger als eine halbe Sekunde, aber als ich mit der Schulter die Badezimmertür aufstieß, war ich trotzdem außer Atem. Was ich sah, ließ mein Hirn stotternd zum Stillstand kommen. Die zusammengekauerte Gestalt unter dem Waschbecken, das weißblonde Haar, ihr Markenzeichen, grünlich im Schummerlicht.
»Olivia?« Mehr als ein Flüstern brachte ich nicht raus.
Sie regte sich nicht. Aber ich wusste auch so, was Sache war, ganz ohne ihren Puls zu fühlen oder ihr in die glasigen, verdrehten Augen zu sehen.
Ich wusste es. Olivia Moon war tot.
ENDE
1
Vier Tage zuvor
DER HERR DER RINGE: DIE RÜCKKEHR DES KÖNIGS
Gepostet unter FILME von Hugh.jpg am 10. November um 21:13 Uhr
Nach stundenlangen Schlachten um Leben und Tod und — nicht zu vergessen — Ruhm und Ehre, Geisterbegegnungen, einem ausgedehnten Gewaltmarsch und literweise vergossenem Orkblut … endet der letzte Film der Herr der Ringe-Trilogie mit einer Kissenschlacht, einer Fast-schon-Stummfilm-Szene in einer Bar und einer Hochzeit, zu der keiner eingeladen ist? Da denkt sich selbst der gute Frodo: »Nein, danke, ich bin raus.«
So routiniert, wie sie an der Kante des Vordachs balancierte, konnte Olivia Moon nicht zum ersten Mal auf ein Haus geklettert sein.
»Was soll das denn werden?«, murmelte ich vor mich hin und beugte mich über die Mittelkonsole des Eiswagens, um sie besser durchs Beifahrerfenster sehen zu können. Und dann, noch leiser: »Und was hat sie da eigentlich an?«
Als ich Olivia Moon zum letzten Mal gesehen hatte — was irgendwann um unsere Highschool-Abschlussfeier rum gewesen sein musste —, hatte ihr Outfit aus einem Basketballtrikot und einer glänzend schwarzen Lederhose bestanden. Jetzt trug sie ein beiges Hawaiihemd der Größe XXL und khakigrüne Zip-off-Shorts. Ihre Handgelenke zierten wie immer die breiten Lederarmbänder, über die ein Typ von unserer Schule mal gesagt hatte, sie sähe damit aus wie frisch einem Mittelalterporno entsprungen. Wofür sie ihn spontan um einen Schneidezahn erleichtert hatte.
Das Haus hatte zwei Fenster im ersten Stock; die abblätternde weiße Farbe der Rahmen war selbst von der anderen Straßenseite aus zu erkennen. Olivia blieb kurz stehen und stemmte die Hände in die Hüften, dann kniete sie sich hin und versuchte, eins davon zu öffnen. Erfolglos.
Ich sah zu, wie sie am zweiten Fenster ruckelte, das sich jedoch als ebenso verschlossen entpuppte. Sie ballte frustriert die Fäuste. Obwohl sie offensichtlich anderes im Kopf hatte, machte ich mich ganz klein auf dem Fahrersitz, nur für den Fall, dass sie sich umdrehte, während ich sie gar nicht mal so unauffällig aus dem Eiswagen meiner Schwester beobachtete.
»Sollte ich was unternehmen?«, wandte ich mich fragend an die Luft um mich.
Jemanden anrufen?
Jemandem schreiben?
Ich nahm mein Handy, das zwischen meinen Beinen klemmte, und starrte darauf. Doch bevor ich irgendwas tippen konnte, klopfte es plötzlich ans Fenster, und ich fuhr zusammen. Draußen standen ein paar Jungs, vielleicht so zwölf Jahre alt, die ihre Fahrräder auf dem Gehweg abgelegt hatten.
»Ist hier offen?«, fragte der Junge ganz vorne.
Ich fuchtelte unwirsch mit den Händen. »Haut ab.«
Nicht mal hiervon schien Olivia was mitzukriegen. Sie presste gerade die Nase gegen eins der Fenster und schirmte ihre Augen mit den Händen ab.
»Äh, hallo?« Ein anderer Junge schlug mit der flachen Hand an die Autoscheibe. »Wir wollen Eis!«
»Hab ich gehört«, zischte ich noch immer fuchtelnd. »Und jetzt verzieht euch.«
Der Anführer verdrehte die Augen und zeigte mir den Mittelfinger, bevor er und seine Kumpels sich endlich wieder auf ihre Räder schwangen und von dannen strampelten. Als ich mich das nächste Mal zurück zum Haus wandte, wurde mir der Mund plötzlich ganz trocken. Olivia stand wieder an der Dachkante, nur diesmal andersrum. Mit dem Gesicht zu mir.
»Kann ich was für dich tun?«, schrie sie mir über die Straße zu.
Spätestens jetzt sollte ich wohl wirklich was unternehmen, dachte ich.
Definitiv.
Ich steckte mein Handy in die Tasche, stieg aus und ging langsam um den Eiswagen herum, die Hand auf der Motorhaube.
»Hey«, sagte ich und zog das Wort gut und gerne zehn Sekunden in die Länge.
Olivia hatte sich wieder dem Haus zugewandt und sah zu dem winzigen Bullauge im zweiten Stock hoch, das höchstwahrscheinlich zum Dachboden gehörte. Sie trug einen von diesen Angler-hüten, den sie sich jetzt aus der Stirn schob. Ihr weißblondes Haar rutschte darunter hervor und fiel ihr über die Schultern.
»Spionierst du öfter mal als Eisverkäufer getarnt Mädchen hinterher, oder ist das der offizielle Beginn deiner Stalkerkarriere?«, rief sie, ohne sich umzudrehen.
Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Ganz unberechtigt war die Frage nicht.
»Hast du deinen Schlüssel vergessen?«, erkundigte ich mich.
»Ich wohne nicht hier«, antwortete sie schlicht.
In meinem Kopf stieg eine Erinnerung an Olivia in ihrem Garten auf. Die Party zu ihrem elften Geburtstag. Ein Kuchen in Form eines Rollerblades, Miley Cyrus aus den Lautsprechern.
»Du wohnst in Columbia Heights«, stellte ich fest. Genau wie ich.
»Stalkst du mich da etwa auch?«
Ich wurde knallrot. »Ich war in der Grundschule mal auf deinem Geburtstag. Da hatte dein Dad so eine Bühne aufgebaut, und wir haben One Direction nachgemacht.« Verlegen fuhr ich mir durch die Haare und scharrte mit dem Fuß. »Keine Ahnung, wie ich das so lange vergessen konnte. So was müsste einem doch ein Trauma fürs Leben verpassen.«
Ein weißes, mit wildem Wein bewachsenes Plastikregenrohr führte senkrecht am Haus hoch. Olivia hielt sich daran fest und lehnte sich zurück, wie um zu testen, ob es ihr Gewicht halten würde.
»Versteh ich auch nicht«, entgegnete sie, während das Rohr bedenklich wackelte. »Du hast bestimmt einen phänomenalen Harry Styles abgegeben.«
»Bitte sag jetzt nicht, du willst dadran hochklettern«, flehte ich. »So sind schon ’ne Menge Leute umgekommen.«
»Kann sein.« Olivia trat einen Schritt zurück. »Aber Clark hat mir was geklaut, und das will ich wiederhaben.«
»Scheiße, Clark Thomas wohnt hier?«
Gehetzt sah ich mich um, als könnte Clark jeden Moment mit einer Machete aus dem Gebüsch stürmen. Clark hatte mal eine Mitarbeiterin unserer Schulcafeteria in den Schwitzkasten genommen, weil sie ihn mit »junger Mann« angesprochen hatte. Offenbar war er es einfach nicht gewohnt, wie ein Mensch behandelt zu werden.
Und Olivia war mit ihm zusammen.
»Ist keiner zu Hause«, erklärte sie, als machte es das irgendwie besser.
»Mhm, das hatte ich schon aus der Tatsache geschlossen, dass du durchs Fenster reinwillst.«
Olivia rieb sich den Kopf und legte ihn dann in den Nacken, um zu irgendwas hochzugucken, vielleicht wieder zu dem Bull-auge im zweiten Stock.
»Mir liegt halt viel an dem, was Clark mir weggenommen hat«, beharrte sie.
Wieder trat sie einen Schritt zurück, aber da sie schon direkt an der Dachkante stand, traf ihre resolut zurückgesetzte Ferse nur noch auf Luft.
Stocksteif stand ich da. »Pass auf —«, fing ich an, doch bevor ich meine Warnung ganz loswerden konnte, kippte Olivia bereits nach hinten, den Rücken gekrümmt, die rudernden Arme ins Leere greifend.
Ein Schrei hallte über die Straße, und ich hätte nicht sagen können, ob er von Olivia kam oder von mir. Sie fiel, ein Bein nach oben gereckt, das Gesicht von ihren wallenden Haaren umrahmt, als befände sie sich unter Wasser. Zuerst prallten ihre Schultern und ihr Rücken auf den betonierten Gartenpfad vor der Veranda, dann ihr Kopf, wie ein mit Wucht geworfener Gummiball. Ihre ausgebreiteten Arme formten ein schlaffes T.
Reglos lag sie da, und mein Hirn brüllte mich an, mich gefälligst in Bewegung zu setzen, ihr zu helfen, doch der Rest meines Körpers hinkte irgendwie hinterher. Ein paar Sekunden vergingen, und dann, als hätte es plötzlich Klick gemacht, rannte ich los. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Als ich bei ihr anlangte, rührte Olivia sich noch immer nicht. Ihr Hut war ihr in die Stirn gerutscht und verdeckte ihr Gesicht.
Von Nahem wirkte ihre Haut blass und wächsern, obwohl ich sie nur vom Mund abwärts sah. Ich ließ mich auf die Knie fallen und schob vorsichtig ihren Hut hoch. Schon jetzt breitete sich auf dem Betonboden unter ihrem Kopf eine Blutlache aus, so schnell, dass ich zurückwich.
»Olivia?«, fragte ich leise, aus Angst, sie zu erschrecken, wenn ich zu laut redete.
Ich erkannte meine eigene Stimme kaum wieder, so unsicher und zittrig, wie von weit her. Alles schien in der Schwebe zu hängen; die Bäume im Vorgarten wiegten sich wie in Zeitlupe in der Brise, die Luft war warm und stickig. Sogar auf der Straße herrschte Stille. Die Autos, die in Richtung Washingtoner Innenstadt unterwegs waren, klangen, als wären sie Lichtjahre entfernt anstatt nur ein paar Straßen weiter.
Mir wurde übel, als ich Olivia sah. Ihren Hinterkopf, ganz offensichtlich vom Betonboden eingedrückt, und das dünne Blutrinnsal, das ihr aus dem Mundwinkel floss. Wenn im Film irgendwer aus dem Mund oder Ohr blutete, dann war das eine ziemlich sichere Todesgarantie. Und ich hatte tatenlos zugeguckt, wie Olivia starb.
Ich wandte mich ab und kramte in meiner Tasche nach meinem Handy. Doch irgendwie hatte ich so ein komisches Gefühl. Ganz langsam drehte ich mich wieder um und riss im nächsten Moment cartoonmäßig die Augen auf.
Einer von Olivias Fingern zuckte.
Ich blinzelte. Blinzelte noch mal.
»Wie …«, flüsterte ich, schaffte es jedoch nicht, den Satz zu beenden.
Dann, als wäre dieser eine Finger bloß die Vorhut, die das mit dem Bewegen erst mal ausprobierte, bevor sie dem Rest des Körpers ihr Okay gab, fingen nun auch Olivias ganze Hände an, sich zu strecken und wieder zu lockern, gefolgt von ihrem rechten Arm, dann dem linken.
»Du kannst nicht am Leben sein«, stieß ich atemlos hervor. »Das geht nicht. Dir quillt das Hirn aus dem Kopf.«
Wie um mir das Gegenteil zu beweisen, fing nun auch Olivia an zu blinzeln. In ihre Augen, die gerade noch stumpf vor sich hin gestarrt hatten, kehrte das Leben zurück, und ihr Blick huschte über den Himmel, als nähme sie eine stille Bestandsaufnahme vor. Sie drückte den Rücken durch, drehte die Fußknöchel gerade und schob, begleitet von einem lauten Knacksen, den Unterkiefer hin und her.
»Steh ja nicht auf, sonst —«, warnte ich, die Hände erhoben, doch Olivia hatte sich schon mit einem Ruck aufgesetzt und riss sich den Hut runter.
Ihr Hinterkopf war eine dunkelrot verschmierte Fläche, in deren Mitte weiche rosa Hirnmasse, durchsetzt von weißlichen Knochensplittern, pulsierte.
»Macaulay Culkin!«, würgte ich hervor. »Ich glaub, ich muss kotzen.«
Olivia saß ganz still, die Hände auf den Boden gestützt, und atmete ruhig, geduldig. Und da sah ich es: Ihr zerschmetterter Schädel fügte sich wieder zusammen, Stück für Stück, wie ein Puzzle. Mit offenem Mund beobachtete ich, wie ihre Kopfhaut über dem frisch verheilten Schädel zusammenwuchs und Haare daraus sprossen, bis sie dieselbe Länge erreicht hatten wie der Rest.
»Was. Zum. Teufel. Ist. Hier. Los«, stieß ich fassungslos hervor.
Sobald ihr Kopf wieder intakt war, stemmte Olivia sich stöhnend hoch auf die Knie. Sie drehte probeweise das Kinn zu beiden Seiten und ließ die Schultern kreisen, während sie sich unter leisem Gemurmel das Blut vom Mund wischte.
Ich musste irgendein Geräusch von mir gegeben haben, denn jetzt wandte sie sich mir zu, die Lippen geschürzt. Als sie mich auf dem Gartenpfad kauern sah, wirkte sie sogar noch verwirrter als ich.
Olivia runzelte die Stirn. »Was?«
Eine ganze Flutwelle von Wörtern und Gedanken schwappte mir durch den Kopf, aber nichts davon ergab genug Sinn, um einen Satz daraus zu bilden. Ich konnte Olivia einfach nur weiter anstarren, was sie ziemlich zu nerven schien.
»Wie hast du — was ist — ich hab doch gesehen — du lebst noch«, stammelte ich schließlich.
Olivia dehnte erneut ihren Hals, sodass sich ein popcornartiges Ploppen vernehmen ließ. »Blitzmerker.«
»Aber ich hab dich doch gerade sterben sehen«, wandte ich ein. »Dein Schädel war zertrümmert. Das sah aus wie … dieses silberne Zeugs, das man für Backkartoffeln braucht.«
»Das Wort, nach dem du suchst, ist Alufolie«, belehrte sie mich.
Die Szene hatte sich mir regelrecht ins Hirn gebrannt und lief dort in zermürbender Endlosschleife. »Dein Hinterkopf war Brei. Alles voller Blut«, sagte ich und sah es natürlich direkt wieder vor mir. Nachdem ich einmal angefangen hatte zu reden, konnte ich gar nicht mehr aufhören. »Wie hast du das gemacht?«
Wir guckten beide runter auf die noch immer frische Blutlache vor ihren Knien, wie um uns zu vergewissern, dass das alles gerade wirklich passiert war.
Olivia stieß einen Seufzer aus. »Ist, äh, kompliziert …« Vorsichtig betastete sie ihren Hinterkopf und verzog das Gesicht. »Hank, oder?«
Ich schluckte. »Hugh.«
»Auch gut. Jedenfalls bin ich im Moment nicht so richtig in der Verfassung, da ins Detail zu gehen. Ich hab tierisch Kopfschmerzen.«
Ich lehnte mich zur Seite, um einen Blick auf ihren Hinterkopf zu erhaschen, doch sie drehte sich mit, sodass ich nichts sehen konnte.
»Was war das eben?« Ich deutete auf sie. »Dein Schädel hat sich von allein wieder zusammengeflickt!«
Abrupt setzte Olivia ihren Hut wieder auf. »Was machst du überhaupt hier?«, wollte sie wissen, ohne auf meine Frage einzugehen. »Wohnst du nicht auch in Columbia Heights?«
Ich deutete auf den Eiswagen auf der anderen Straßenseite. »Eis verkaufen.«
»Ah ja.«
Die Leiter, mit deren Hilfe sie aufs Vordach geklettert war, lehnte noch immer am Haus. Olivia stand auf, wischte sich die Hände an der Hose ab und fing an, die Leiter zusammenzuklappen.
»Moment, ’tschuldige, können wir noch mal kurz zurückspulen? Ich will jetzt echt wissen, was hier abgeht«, beharrte ich.
Hinter einem hohen, buschigen Strauch führte eine versteckte Treppe runter zu einer Kellertür. Dort lehnte Olivia die Leiter gegen ein vergittertes Fensterchen. Dann hüpfte sie zurück auf die Veranda und rückte einen Plastiktisch und die zugehörigen Stühle beiseite, offenbar auf der Suche nach einem Schlüssel.
Wieder blinzelte ich, weil ich einfach nicht fassen konnte, was hier gerade passierte. »Wir sollten lieber schnell ins Krankenhaus fahren, damit die wenigstens ’nen Hirnscan machen können oder so.«
»’nen Hirnscan?« Olivia lachte, schrill und heiser. »Erscheint dir etwa irgendwas hieran nicht in Ordnung?«
Sie riss sich den Hut wieder vom Kopf und drehte sich um, sodass ich sie von hinten sehen konnte. Wo gerade noch alles blutverklebt gewesen war, schien jetzt alles in bester Ordnung. Die nachgewachsenen Haare wirkten sogar wie frisch gekämmt. Doch als Olivia sich mir wieder zuwandte und meinen Gesichtsausdruck sah, milderte sich ihr eigener von stinksauer zu einfach nur ungeduldig.
»Mir geht’s gut, ehrlich. Du kannst mich also gerne in Ruhe lassen.« Olivia rüttelte ein letztes Mal unter vollem Körpereinsatz an der Haustür und gab dann seufzend auf. »Die schließen sonst nie ab, aber ausgerechnet heute natürlich schon«, grummelte sie und stürmte gleich darauf die Verandatreppe wieder runter.
»Vielleicht ja, weil Clark weiß, dass da was drin ist, was du haben willst«, merkte ich an.
Olivia blieb stehen und musterte mich finster. »Messerscharfe Schlussfolgerung«, höhnte sie.
Und bevor ich noch irgendwas hinzufügen konnte, marschierte sie los und verschwand die Straße runter.
»Wie, und jetzt haust du einfach ab?«, rief ich.
Mein ganzer Körper kribbelte. Meine Finger, meine Füße, mein Hals. Olivia schlenderte so lässig und unbefangen dahin, als wollte sie bloß kurz zum Supermarkt anstatt weg von einer Marvel-Film-würdigen Gruselszene. Das wollte sie doch wohl nicht ernsthaft so stehen lassen? Es gab zu viele Fragen, auf die ich Antworten brauchte.
»Kann ich dich irgendwohin mitnehmen?«, brüllte ich ihr wenig einfallsreich hinterher.
Doch Olivia drehte sich nicht mal mehr um.
Nach ein paar Sekunden rappelte ich mich hoch, immer noch verstört und wackelig auf den Beinen, und die Ereignisse der letzten Minuten rasten jetzt so schnell vor meinem inneren Auge vorbei, dass die Reihenfolge völlig durcheinandergeriet. Olivias eingedrückter Schädel. Die Fahrradjungs. Der Schrei. Weil ich nicht wusste, was ich sonst machen sollte, machte ich mich auf den Weg zurück zum Eiswagen und schlug dabei einen großzügigen Bogen um Olivias Blutlache. Die begann bereits, zu einem schmierig schwarzen Fleck zu trocknen. Ich hatte das Gefühl, trotzdem einen Krankenwagen rufen oder sonst was unternehmen zu müssen, aber ich wusste ja nicht mal, wohin Olivia wollte. Sie war schon am Ende der Straße um die Ecke gebogen und genauso schnell verschwunden, wie alles angefangen hatte.
Eine Sache aber ging mir nicht aus dem Kopf, während ich den Motor anließ und ihn unter mir brummen fühlte. Nicht Olivias tödlicher Sturz vom Dach oder das Bild ihres zerschmetterten Hinterkopfs und auch nicht die Frage, was wahrscheinlicher war: dass ich mir das Ganze bloß zusammenhalluziniert hatte oder dass Olivia Moon echte Superkräfte hatte. Nein, es war etwas so Profanes und Egozentrisches, dass ich mich einfach nur schämte.
Was am meisten an mir nagte, war die Tatsache, dass sie meinen Namen vergessen hatte.
2
DAVID BOWIE
Gepostet unter MENSCHEN von Hugh.jpg am 1. Juli um 07:13 Uhr
Ich respektiere ja David Bowies Recht auf Privatsphäre und dass er nicht gleich der ganzen Welt von seinem bevorstehenden Tod erzählen wollte, trotzdem hätte ich wirklich ein bisschen mehr Zeit gebrauchen können, um mich auf das vorzubereiten, was man ja wohl mit Fug und Recht als das Ende der Musik bezeichnen kann.
»Wahr oder falsch: In einem Gesangsduell würde Lin-Manuel Miranda Marvin Gaye den Arschtritt seines Lebens verpassen.«
Razz biss in seinen Kirschblütendonut und verteilte dabei hellrosa Glasurflöckchen auf seiner Jeans. Wir hatten alle Fenster runtergefahren, aus dem Kassettenplayer des uralten Eiswagens dröhnte Marvin Gayes »Baby Don’t You Do It« und übertönte den Lärm der Touristen und Geschäftsleute, die ringsum für Tacos und Pulled-Pork-Sandwiches anstanden.
Ich hatte Razz gegen Mittag zu Hause abgeholt, und wir waren in die Innenstadt gefahren. Die ganze Zeit gab ich mir größte Mühe, nicht wie ein Mensch zu wirken, der gerade rausgefunden hatte, dass das komische Mädchen aus seiner Highschool in Wahrheit der Terminator war. Aber seit wir das mächtige rote Tor am Eingang zu Chinatown passiert und uns neben den anderen Foodtrucks auf dem Farragut Square postiert hatten, wanderten meine Gedanken immer wieder zurück zu Olivias eingedrücktem Schädel, zu der Blutlache, die ein bisschen die Form von George Washingtons Profil auf der Eindollarnote gehabt hatte. Zu ihrem ausdruckslosen Blick, als hätten wir uns noch nie gesehen und als wäre ich der Freak von uns beiden.
»Hugh?« Razz machte eine Scheibenwischergeste vor meinem Gesicht. »Alter, das wäre jetzt der Moment, in dem du aufs Heftigste drauflosdiskutierst.«
Ich blinzelte. »Wovon laberst du?«
»Ich hab gesagt, wahr oder falsch: In einem Gesangsduell würde Lin-Manuel Miranda Marvin Gaye den Arschtritt seines Lebens verpassen.«
Ich lockerte die Schultern, als könnte ich meine Nervosität einfach abschütteln. »Falsch«, antwortete ich. »Falsch hoch tausend. Marvin Gaye ist der unangefochtene Motown-King. Und Lin-Manuel Miranda ist nicht viel mehr als ’ne Disneyfigur.«
Razz machte untertassengroße Augen. Er schien seinen Ohren nicht zu trauen. »LMM zu beleidigen ist die reinste Blasphemie«, verkündete er, während er das schwarze Beanie auf seinem Hinterkopf zurechtrückte. »In New York City steht darauf die Todesstrafe. Der Mann ist ein Genie.«
Ich knabberte die dünne Zuckerkruste vom Rand meines Braune-Butter-Donuts. »Ich bestreite ja gar nicht, dass er für Disney und den Broadway Gold wert ist. Aber gesangstechnisch hat er nun mal gegen Marvin keine Schnitte. Marvin Gaye war der personifizierte Soul. Ganz ehrlich? Wahrscheinlich würde Lin-Manuel Miranda mir da sogar selbst zustimmen. Der wäre zum Hyper-Fanboy mutiert, wenn er Marvin Gaye je begegnet wäre.«
»Tja, gibt nur einen Weg, um das rauszufinden.« Razz legte seinen Donut hin und griff stattdessen nach seinem Handy. Das Display erstrahlte in Twitterblau, als er seinen Tweet absetzte. »Wenn Lin-Manuel Miranda darauf antwortet, kommst du Thanksgiving zu mir nach Kalifornien.«
»Wenn Lin-Manuel Miranda darauf antwortet, ziehe ich gleich mit nach Kalifornien, fertig.«
»Abgemacht.«
Wenn ich versuchte, mich einfach nur auf die Leute zu konzentrieren, die uns Eis abkaufen wollten, bestand möglicherweise die hauchfeine Chance, dass ich den Nachmittag ohne Nervenzusammenbruch überstand. Normalerweise hatte ich nie Geheimnisse vor Razz. Aber wenn ich ihm jetzt erzählte, dass ich Zeuge einer umgekehrten Kopfexplosion bei Olivia Moon geworden war, würde er mich wahrscheinlich diskret in Richtung der nächsten psychiatrischen Anstalt komplimentieren. Außerdem war ich mir ja selbst nicht sicher, was ich da eigentlich genau gesehen hatte. Eine Marvel-Heldin? Oder doch eher den Anfang eines Films, in dem ein paar Mutanten ein Kraftwerk verklagten, weil es Giftmüll in die Trinkwasserversorgung geleitet hatte?
Da das letzte richtige Sommerwochenende vor der Tür stand, war in D. C. zum Glück die Hölle los. Noch immer verstopften Touristen, die zur National Mall wollten, die Gehwege und stürmten die Museen, bevor der Herbst seine kühle Decke über die Stadt breitete.
»Habt ihr Cherry Garcia?«
Ganz vorne in der Eisschlange, kaum zu sehen über der Metallkante unserer Theke, stand ein kleines Mädchen mit flamingo-rosa Sonnenbrille.
Razz seufzte. »Wenn du Ben & Jerry’s oder irgendwas Spongebobförmiges willst, musst du’s woanders versuchen«, erklärte er. »Am Dupont Circle ist ein Minimarkt.«
»Weißt du was?«, sagte das kleine Mädchen und deutete mit einem glitzerlackierten Fingernagel auf ihn. »Du bist ein ganz schlechter Geschäftsmann.«
Jetzt war ich an der Reihe mit Seufzen. »Unser Weiße-Schokolade-Wuornos ist mit Erdbeeren, und dazu gibt’s Marshmallows und bunte Streusel.« Das war einer der Sätze, die ich diesen Sommer so oft gesagt hatte, dass sie mir quasi auf die Innenseite der Augenlider tätowiert waren.
»Und was ist mit Banana-Bundy? Ist das nach diesem Mörder benannt?«
Ich zog so weit die Augenbrauen hoch, dass sie wahrscheinlich unter dem dicken schwarzen Haarwust verschwanden, den meine Schwester Ellen nur »den Dschungel« nannte. »Du weißt, wer Ted Bundy ist?«
Das Mädchen verschränkte die Arme und erwiderte: »Ich gucke halt Dokus.«
»Na dann.« Ich deutete auf die Eiskarte an einer der aufgeklappten Türen des Wagens. »Also, jede unserer Eiskreationen ist nach einem Serienkiller benannt. Oder einer Killerin. Weiße-Schokolade-Wuornos zum Beispiel nach Aileen Wuornos.«
Normalerweise machten die Fahndungsfotos von Charles Manson und Dennis »BTK« Rader auf den Flanken des Eiswagens deutlich genug, worum es bei »Killer Ice Cream — zum Sterben lecker« ging, nur Kinder oder sehr naive Erwachsene wussten manchmal nicht, wer Leute wie Richard Ramírez oder John Wayne Gacy waren. Ellen meinte immer, wir sollten Fragen so ehrlich wie möglich beantworten, solange wir nicht unbedingt Albträume provozierten. Was bisweilen zu ziemlich schrägen Gesprächen führte.
»Und was ist Green River?«
»Das ist mit Minze und Schokostreuseln. Und benannt nach Gary Ridgway, dem Green-River-Killer«, erklärte ich. »Den mag meine Schwester am liebsten.«
Die Kleine riss so weit die Augen auf, dass man es sogar unter ihrer Sonnenbrille sah, und kriegte den Mund nicht mehr zu. Verstohlen spähte sie zur Schlange vor dem Pulled-Pork-Wagen rüber, in der vermutlich ihre Eltern standen.
Ich hüstelte. »Ich meinte, das. Das Eis mag meine Schwester am liebsten.«
»Das nehm ich«, beschloss das Mädchen und schluckte. »Mit doppelt Streuseln, bitte.«
Und zwar im Becher, spezifizierte sie noch, während Razz bereits die Gefriertruhe mit den Eisbehältern aufschob. Die Sonne knallte zum Fenster rein, und es war unerträglich heiß. Die Luft stand und hatte ungefähr zehntausend Prozent Feuchtigkeit. Ich wischte mir über die Stirn, bevor ich das Eis gegen einen Fünfdollarschein eintauschte und dem Mädchen sein Wechselgeld reichte.
Razz und ich bedienten weiter wie auf Autopilot, bis die Kundenschlange allmählich kürzer wurde. Es ging auf zwei Uhr zu, was bedeutete, dass der mittägliche Andrang bald vorbei war und uns wieder die langen, krampfigen Pausen bevorstanden, die ich normalerweise mit cleveren Kommentaren über Will Smith oder Buffy — Im Bann der Dämonen füllte.
Heute sagte ich bloß leise: »Ich hab vorhin Olivia Moon von einem Dach fallen sehen.«
Der Satz war raus, bevor ich mich stoppen konnte.
Razz drehte sich wie in Zeitlupe zu mir um. »Äh, was hast du gerade gesagt? Sollte das ein Witz sein?«
»Nein.«
»Und damit rückst du erst jetzt raus?«
»Ihr geht’s gut«, wiegelte ich ab. Was ja auch stimmte — nachdem sich ihr Schädel selbst repariert hatte. »Sie wollte bei Clark Thomas einbrechen.«
»Na klar«, schnaubte Razz. »Und hast du zufällig nachgefragt, was genau es bei Mini-Manson zu holen gab?«
»Angeblich hat er ihr irgendwas geklaut.«
»Warum überrascht mich das von allen Elementen dieser Geschichte am allerwenigsten?« Razz schob beide Verkaufsfenster zu. »Lass uns abhauen, Alter«, drängte er und kletterte auf den Beifahrersitz. »Wenn ich noch mehr ›I Heart D. C.‹-Shirts sehen muss, fangen meine Augen an zu tränen. Und wer auch immer behauptet hat, diese Gürteltaschen wären wieder in, hat ernsthaft einen an der Klatsche.«
Es war ein ganz normaler Donnerstag, trotzdem waren die Straßen voll. Behutsam steuerte ich den Wagen durch das Labyrinth aus Bürohochhäusern bis auf die Constitution Avenue, die breiter und von alten Bäumen beschattet war. Wir bogen nach rechts in die 15th Street ab und umrundeten die Rasenfläche, in deren Mitte sich das Washington Monument erhob. Von dem cremeweißen Marmor war derzeit nicht viel zu sehen, weil er auf allen Seiten hinter Baugerüsten verschwunden war. Auf der Wiese ringsum tummelten sich Menschen, die picknickten oder Frisbee spielten. Segway-Touren und Kindertrupps, angeführt von Erwachsenen mit Schildern in der Hand, bevölkerten die Wege. Zur Linken lag die National Mall, deren braungrüne Grasfläche von gesichtslosen Museen und dem Capitol ganz am Ende gesäumt wurden. Wie eine Riesenkokosmakrone reckte sich die weiße Kuppel in den weiten blauen Himmel.
Die vertrauten, geschichtsträchtigen Straßen erfüllten mich mit einer Wärme und Leichtigkeit, die ich nicht mehr verspürt hatte, seit Olivias Kopf vor meinen Augen auf dem Gartenpfad zermatscht worden war. Ich mochte D. C. Der Distrikt war so winzig, dass man mit der Metro alles zwischen Virginia und Maryland locker erreichte. Nachts im Bett hörte ich zwar manchmal Schüsse aus den Vierteln Shaw und Petworth, aber das gehörte halt einfach dazu, quasi als Soundtrack zur Stadt. Ich kannte alle meine Nachbarn, weil die meisten von ihnen mehr oder weniger dauerhaft auf der Veranda kampierten, um die Straße und jeden, der dort nichts zu suchen hatte, im Blick zu behalten. Sie wohnten schon ihr ganzes Leben lang in diesen Häusern, genau wie ihre Eltern vor ihnen. Gut möglich, dass ich eines Tages auch so enden würde, und noch war ich mir nicht ganz sicher, was ich davon halten sollte. Washington war nun mal das einzige Zuhause, das ich kannte. Der einzige Ort, an dem ich mich wirklich wohlfühlte.
Wir schlichen mit dem Verkehr dahin, der wegen einer roten Ampel immer wieder ins Stocken geriet. Rechts, ganz in der Ferne, war das Lincoln Memorial zu sehen, der gute alte Abe, nur ein winziges Pünktchen in seiner Betonschuhschachtel. Vor ihm erstreckte sich das lange, rechteckige Wasserbecken mit seiner reflektierenden blaubraunen Oberfläche.
Als wir an einer Familie in rosa T-Shirts mit dem Aufdruck »DIE CONNORS AUF REISEN« vorbeifuhren, rümpfte Razz die Nase. »Mein Gott, was ist eigentlich los mit den Leuten?«, schimpfte er. »Warum macht man freiwillig Urlaub in einem Sumpf? Wir haben heute mindestens vierzig Millionen Grad.«
»Wenn du nicht rumlaufen würdest wie ’ne Goth-Zwiebel, wäre dir vielleicht auch nicht so heiß.«
Razz musterte mich finster durch eine Lücke in seinem langen lila-schwarzen Haarvorhang, dabei war das einfach die Wahrheit: Er verließ selten in weniger als drei Lagen gekleidet das Haus, für gewöhnlich bestehend aus einem T-Shirt — meist schwarz, meist mit irgendeinem Bandnamen in Horrorfilmbuchstaben drauf —, einem Longsleeve — natürlich schwarz — darunter und einem Flanellhemd darüber, meist ebenfalls schwarz, lila oder ab und an dunkelrot. Dazu kamen schwarze Jeans, klobige schwarze Lederstiefel und ein schwarzes Beanie, das er gekonnt auf dem Hinterkopf balancierte, wodurch seine Mangafrisur ihm wie ein Wasserfall in die Stirn fiel.
Als wir schließlich das Ende der 15th Street erreichten, kam links das Holocaustmuseum in Sicht. Ich setzte den Blinker, um wieder nach Norden vorbei am Weißen Haus und weiter Richtung Columbia Heights zu fahren, aber Razz tippte mir auf die Schulter und schüttelte den Kopf.
»Fahr nach links«, sagte er und deutete rüber zur Mall.
»Musst du nicht noch fertig packen?«
»Ich hab noch genug Zeit, um meine Plattensammlung durchzugucken«, antwortete er. »Lenk mich lieber ein bisschen ab und erzähl mir von Olivias aktueller Modephase.«
Ich grinste schief. »Heute hatte sie ein riesiges Hawaiihemd an, dazu Cargoshorts und so einen Anglerhut.«
»Heißt also, im Moment sieht sie aus wie ’ne Couch.«
Ich schnaubte. »Kommt hin.«
»Klingt ja eher nach ’nem Rückschritt, verglichen mit ihrer Basketballgroupie-Zeit.«
»Immer noch besser als die Preppy-Idiotin von davor.«
»Hey, du warst doch selber mal so ein Preppy-Idiot.« Razz sah mich an und seine Haare fielen ihm über die Nase. »Du warst quasi der Ober-Preppy-Idiot.«
Ich erschauderte bei der Erinnerung. »Sagt der Richtige. Du hast doch auch dazugehört.«
Er klimperte mit den Wimpern. »Seither sind viele, viele Monde ins Land gezogen«, deklamierte er pathetisch, eine Hand aufs Herz gepresst. Dann lächelte er und zeigte mir seine perfekten, strahlend weißen Zähne. »Weißt du noch, in der Neunten, als Olivia ihre fromme Phase hatte? Die nur ein paar Tage angehalten hat, weil sie dann mit diesem Typen aus der Zwölften mit dem Mohawk zusammengekommen ist?«
Ich runzelte die Stirn. »War das, als sie ständig im Rollkragenpulli rumgelaufen ist?«
»Nee, da hat sie einen auf Kunstkennerin gemacht, darum auch die Baskenmütze.«
»Ach, na klar«, erinnerte ich mich. »Auf jeden Fall hatte sie heute wieder ihre Lederarmbänder an, weißt schon, die aussehen wie Handschellen aus Game of Thrones.«
»Tja, ist doch schön, dass sie sich in der Hinsicht treu bleibt.«
In den zwölf Jahren, die wir mit Olivia Moon zur Schule gegangen waren — in unserem Abschlussjahrbuch hieß das »lebenslänglich«, was bedeutete, dass wir allesamt die örtliche Grundschule, Junior Highschool und Highschool besucht hatten —, hatte sie mindestens fünfzehn solcher Phasen durchlaufen, die meisten davon in der Highschool. Einige hatten nur wenige Tage angedauert, andere Jahre. Da gab es die schon erwähnte Kunstkennerinnenphase, die Emophase, die Softballmädchenphase und die alternative Phase, die wahrscheinlich am längsten angehalten hatte. Dann waren da noch die Schauspielphase und sogar eine kurze, aber interessante Hockeyphase, in der sie ständig in Vintage-Trikots der Washington Capitals rumgelaufen war.
Keine Ahnung, was die treffendste Bezeichnung für ihren neuesten Kleidungsstil war. Florida-Dad? Trailer-Trash? Auf jeden Fall war das Ganze äußerst seltsam, selbst für Olivias Verhältnisse.
»Musst du vor heute Abend noch mal nach Hause?«, erkundigte ich mich. »Ich leihe dir nämlich keine Boxershorts mehr.«
Donnerstag war unser Survivor‑Abend, was bedeutete, dass Razz bei mir übernachtete, zumindest wenn Ferien waren. Beim Gedanken an diese lieb gewonnene Tradition normalisierte sich mein Herzschlag ein wenig, denn anders als bei Olivias magischer Schädelreparatur wusste ich dabei, was mich erwartete.
»Alter, ich hab dir doch schon tausendmal gesagt, dass heute Abend unser letztes offizielles Familienabendessen vor Thanksgiving ist«, erklärte Razz. »Morgen fahre ich dann bis Samstagnachmittag nach Richmond zu meiner Grandma, und wenn ich wiederkomme, pennst du bei mir, und wir gucken noch mal alle Hobbit-Filme und fressen uns ins Koma, bevor ich mich auf die Socken nach Kalifornien mache. Ich hab uns schon sämtliche Sorten Oreos besorgt, die sie bei Giant hatten.«
Ich stieß einen frustrierten Seufzer aus und sah rüber zur goldbraunen Kuppel des Naturkundemuseums, die sich über dem vertrockneten Rasen der National Mall erhob. Dann hielt ich an einer roten Ampel.
»Ich verdränge halt immer noch, dass du mich ab Sonntag für diese Kommunistenhippies sitzen lässt«, erwiderte ich.
Das war gelogen. Vor der Sache mit Olivia hatte ich kaum an was anderes denken können als an Razz’ Umzug nach Berkeley. Aber ich hoffte wohl einfach, dass es, je mehr Witze ich darüber riss, dass Razz sich ohne mich aufs College verzwitscherte, zumindest nach außen hin den Anschein machte, als würde ich das Ganze als unvermeidlichen Teil des Lebens akzeptieren, obwohl ich davon in Wahrheit Herzflattern bekam.
»Ich frag mich immer noch, ob ich nicht einen Krankenwagen hätte rufen sollen«, sagte ich leise. Oder eigentlich rutschte es mir eher heraus. »Für Olivia, meine ich.«
»Damit die Polizei mitkriegt, dass du einfach zugeguckt hast, wie sie in ein fremdes Haus einbrechen wollte? So was nennt sich Beihilfe zu einer Straftat.«
Ich verdrehte die Augen. »Wohl kaum.«
Die Ampel wurde grün, und wir fuhren weiter. So schnell sie in Sicht gekommen war, so schnell war die National Mall auch wieder weg, und wir landeten im verworrenen Straßennetz des Capitol Hill. An der nächsten roten Ampel sah Razz schweigend aus dem Fenster, während ich mich verzweifelt bemühte, nicht an Olivia Moon zu denken, was natürlich unvermeidlich dazu führte, dass ich an nichts anderes dachte als an Olivia Moon. Denn auch wenn sie mich ganz offensichtlich nicht für erinnerungswürdig hielt, hatte sie mir mit ziemlicher Sicherheit vor zwei Jahren das Leben gerettet.
3
THE DARK KNIGHT RISES
Gepostet unter FILME von Hugh.jpg am 25. Februar um 21:19 Uhr
Christian Bale, du bist tot. Tut mir leid, aber lässt sich nicht ändern. Du bist mit einem bombenbeladenen Helikopter aufs offene Meer rausgeflogen, so was überlebt niemand. Wie kommt’s also, dass du jetzt in ’nem Café sitzt und bräsig Michael Caine zunickst? Wie kann das sein, Christian? Wie?
Ich starrte auf das leere Textfeld vor mir und versuchte, in Worte zu fassen, warum genau ich das Ende von Interstellar so hasste. Denn eigentlich war das doch ein Wahnsinnsfilm, zum größten Teil zumindest. Ein echtes Meisterwerk, das einem das Gefühl gab, live dabei zu sein, während Geschichte geschrieben wurde oder Wissenschaft oder was auch immer.
Aber dieses Ende? Unbefriedigend war gar kein Ausdruck. Von unlogisch mal ganz zu schweigen.
Einsam und allein reiste Matthew McConaughey in seinem Marshmallowanzug durch ein Schwarzes Loch, das ihn korrekterweise tief ins Weltall saugen und wie eine Rosine hätte zusammenschrumpeln lassen müssen, aber stattdessen gabelte ihn natürlich im allerletzten Moment ein vorbeituckerndes Raumschiff auf. Große Wiedersehensfreude, der Kreis schloss sich, bablabla.
Jetzt mal im Ernst, wie unwahrscheinlich war das denn bitte? Klar war das nur ein Science-Fiction-Film, aber diese Rettung war ja wohl alles andere als glaubwürdig. Alles viel zu glatt, viel zu reibungslos. Matthew McConaughey — beziehungsweise seine Filmfigur — war eine der wenigen Personen auf der Welt, denen ich jemals aus puren Logikgründen den Tod gewünscht hatte.
Ich fing an, meine Gedanken niederzutippen, löschte und formulierte um, während mir immer weitere Ideen durch den Kopf schossen. Meistens versuchte ich, meine Posts auf Spoiler Alert kurz zu halten, eher knappe Zusammenfassungen als ausgedehnte Abhandlungen. Auf die Weise lieferte ich den Lesern Diskussionsanstöße, was ihnen Gelegenheit gab, sich ihre eigene Meinung zu bilden.
In den zwei Jahren, seit ich mit dem Bloggen angefangen hatte, waren fast tausendzweihundert Posts über schlechte Enden zusammengekommen. Damit beschäftigte ich mich an den meisten Nachmittagen nach meinen Schichten im Eiswagen, aber auch morgens und nachts, wenn der Rest von Washington schlief. Nach meinen letzten Schätzungen hatte Spoiler Alert eine aktive Community von etwa siebenhundert Usern. Ich war immer offen für Anregungen, und manchmal ließ ich die treuesten Follower sogar Gastposts verfassen. Hin und wieder half auch Razz aus, besonders wenn es um Bücher von toten britischen Autorinnen und Autoren ging oder jeden Evil Dead-Film, der je gedreht worden war.
Die Website war in fünf Kategorien unterteilt: Bücher, Filme, Fernsehen, Menschen und Vermischtes. Unter Letzteres konnten zum Beispiel Bands fallen, aber auch Kriege, und jede Kategorie enthielt Posts zu verschiedenen Dingen, die ein schlechtes Ende nehmen konnten. Happy Ends und die Fake-Ordnung, die sie suggerierten, waren nichts für mich. Die fühlten sich immer an wie ein Schlag in die Magengrube.
Unter jedem der Posts entspannen sich Diskussionen, mal länger, mal kürzer. Der letzte, zu The Dark Knight Rises, hatte ganze dreihundert Kommentare eingefahren, während sich für Oasis niemand so wirklich zu interessieren schien. Niemand musste sich mit dem Oberthema auskennen, den Film gesehen, den Song gehört oder das Buch gelesen haben, um seinen Senf dazuzugeben. Das sahen ein paar Leute aus der Community zwar anders, aber in dem Punkt hatte ich nun mal meine feste Meinung. Ein schlechtes Ende war ein schlechtes Ende, egal, ob man miterlebt hatte, wie es dazu gekommen war, oder nicht.
Aber was genau machte ein Ende denn nun schlecht? Noch so was, worüber sich die Spoiler-Alert-Userschaft alles andere als einig war. Für mich gab es da allerdings ziemlich eindeutige Kriterien. Was gar nicht ging:
Enden, die zu lang waren (Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs)
Enden, die mit dem Rest der Handlung gar nichts zu tun hatten (Krieg der Welten)
Enden, die einfach irgendwie mau waren (Matrix)
Enden, die komplett unerwartet kamen (Led Zeppelin)
Enden, die zu kurz waren (das Staffel-10-Finale von Akte X)
Enden, die keinen Sinn ergaben (Buddy Holly)
Und die Liste wuchs und wuchs, je mehr ich guckte, las und recherchierte. Ich fand immer weitere Gründe, warum mir ein ganz bestimmtes Ende nicht passte, und suchte geradezu obsessiv nach neuen, während mein Ärger über all die geballte Dummheit sich anstaute. Ziemlich ironisch eigentlich, denn je miserablere Enden ich ausfindig machte, desto weniger schlimm erschienen mir die von davor.
Nachdem ich auf »Posten« geklickt hatte, aktualisierte ich die Seite, lehnte mich zurück und überflog meinem Interstellar-Beitrag noch mal. Ich hatte schon besser abgeliefert. Das Ganze wirkte etwas zerstreut, die Argumente schwammig. Was vielleicht daran lag, dass, wann immer ich mir Matthew McConaughey vorstellte, wie er auf seiner nachgebauten Veranda im Weltall in gedehntem Südstaatendialekt auf diesen sarkastischen, rechteckigen Roboter einredete, Olivia Moons Gesicht im Fenster hinter ihm erschien. Egal, wie sehr ich mich auch bemühte, mich an der Empörung festzuklammern, die mich gepackt hatte, als McConaughey nach seiner glücklich überlebten Reise durch das Schwarze Loch im Krankenhaus aufgewacht war — die Sache mit Olivia ließ mich einfach nicht los.
Als ich nachmittags heimgekommen war, hatte ich sofort angefangen, Olivias Social-Media-Profile zu durchforsten, bis ich kaum mehr geradeaus gucken konnte. Hatte mich von oben bis unten durchgescrollt, auf Facebook sogar bis zu ihrem allerersten Post aus der Junior Highschool. Wenig überraschend gab es allerdings weder Fotos noch Videos, auf denen sie sich den Arm abhackte und einen neuen nachwachsen ließ oder ihr ein Amboss auf den Fuß fiel, der davon völlig unversehrt blieb. Rein oberflächlich betrachtet war alles an ihr frustrierend normal.
Olivia hatte 587 Facebook-Freunde, fast doppelt so viele, wie Leute in unserem Jahrgang gewesen waren — was vermutlich nur logisch war, wenn man Teil nahezu jeder Clique gewesen war, die die Mount Luther Highschool zu bieten hatte. Ihr letzter Post war vom 13. Februar, eine einzelne kryptische Zeile unter einem Foto des Frontmanns der Band The Killers:
Wenn du nicht Brandon Flowers heißt, kannst du nicht mein Valentinsschatz sein!!!!!!!!!!!!!!!
Okay, auf den zweiten Blick eigentlich gar nicht kryptisch. Sondern ziemlich eindeutig.
Abgesehen davon enthielt ihr Profil nur Fotos, die andere Leute von ihr gemacht hatten. Auf dem letzten trug sie dasselbe Hawaii-hemd wie heute, dessen Ärmel ihr bis über die Ellbogen reichten. Sie stand vor einem hohen Strauch und hatte eine Hand erhoben, wie um sich die Haare aus der Stirn zu streichen, schien sich jedoch in letzter Sekunde noch mal bewegt zu haben, wodurch ihr Gesicht zu einem unscharfen, pfirsichrosa-weißen Fleck verschmiert war, umrahmt von weißblondem Gewuschel. Irgendwas an diesem Foto gab mir ein unangenehmes Gefühl, als hätte ich das letzte Bild einer Person vor mir, die mittlerweile gestorben war.
Ich klickte auf mein eigenes Profil, scrollte mich gedankenverloren durch die Timeline und versuchte, mir in Erinnerung zu rufen, was ich eigentlich über Olivia Moon wusste. So weit meine bisherigen Erkenntnisse:
Sie wohnte in Columbia Heights, genau wie ich.
Sie war mit Clark Thomas zusammen (na ja, mittlerweile wohl eher gewesen).
Klamotten kaufte sie momentan offenbar ausschließlich in der Männerabteilung von Secondhandläden.
Wir waren früher mal befreundet gewesen, auf die ober-flächliche Art, wie man mit zwölf eben befreundet ist (also eigentlich gar nicht).
Vor zwei Jahren hatten wir zusammen ein ziemlich seltsames Erlebnis gehabt, das für mich von einschneidender Bedeutung, für sie aber anscheinend total unwichtig gewesen war — ein Erlebnis, über das wir danach nie ein Wort verloren hatten und das ihr völlig entfallen zu sein schien.
Sie konnte sich selbst heilen, entweder kraft ihrer Gedanken oder … des Universums?
Ich wusste also quasi alles und nichts über sie.
Wieder klickte ich mich zurück zu ihren Fotos und scrollte in der Timeline ganz nach unten. Das allererste Bild, das sie je gepostet hatte, zeigte sie in einem himmelblauen T-Shirt, die Haare hoch auf dem Kopf zum Pferdeschwanz gebunden, im Gesicht ein so strahlendes Lächeln, dass man davon fast erblindete. Alles an ihr verströmte aufrichtige Fröhlichkeit, ganz anders als die beißende Genervtheit von heute Morgen. Was hatte sich da bloß verändert?
Die Foto-Olivia hatte die Arme um zwei Leute gelegt: links Becky Cayman, meine Nachbarin von gegenüber, und rechts Razz, dessen einer Fuß auf einem Fußball ruhte. Sie trugen alle drei die gleichen Trikots und hatten sich schwarze Streifen unter die Augen gemalt.
»Razz hat mal Fußball gespielt?«, murmelte ich vor mich hin.
Meine Erinnerungen an die Junior Highschool waren verschwommen, allerdings tauchten hin und wieder detailliertere Fragmente auf, zum Beispiel an das eine Mal, als wir uns ins Kino geschlichen hatten, um uns den Hobbit anzugucken, oder Tagträume, in denen ich bei Shake Shack Cara Delevingne über den Weg lief. Aber Razz und Sport? Das hätte ich ganz sicher nicht vergessen. Ausgerechnet Razz, den ich schon mal nach dem etwas über einen Kilometer langen Fußweg von der Metrostation in Chinatown bis zum Weißen Haus mit einem Becher Eiswasser aufpäppeln musste.
Auf jeden Fall interessant. Denn ich hatte zwar gewusst, dass Olivia und er als Kinder irgendwie befreundet gewesen waren, aber wie es schien, hatten sie ja nicht bloß in der Mittagspause mal zusammengesessen, sondern sich auch außerhalb der Schule getroffen. Zumindest, bevor sie sich beide abgesondert hatten.
Olivia und ich hatten früher auch mal zur selben Clique gehört, zusammen mit Razz und Becky. Das Ganze war eine von diesen aus Bequemlichkeit entstandenen Allianzen gewesen, in denen Jungs und Mädchen zusammengematscht wurden wie zwei verschiedene Farben Knete. Becky und mich verband allein die Tatsache, dass wir schon unsere ganze Kindheit lang Nachbarn gewesen waren, denn wenn man noch klein ist, fällt so was schwer ins Gewicht. Also luden wir einander immer zu unseren Geburtstagen ein oder trafen uns am Wochenende im Meridian Hill Park, aber trotzdem war das zwischen uns keine ernst zu nehmende Freundschaft. Zumindest nicht bis zur Oberstufe, als uns dämmerte, dass das mit der Grüppchenbildung so schnell nicht aufhören würde und wir uns tatsächlich ganz gern hatten. Aber da waren Razz und Olivia schon längst nicht mehr dabei.
Nachdem ich Olivias restliche Fotos durchgeguckt hatte, ging ich zurück auf ihr Profil und blinzelte ein paarmal, um meinen Blick wieder scharfzustellen. Innerhalb der letzten Minuten war ein neuer Post von jemandem erschienen, der einen Chihuahua mit goldenem Partyhütchen als Profilbild hatte.
Regina Smalls > Olivia Moon
24. August um 17:02 Uhr
Hallo, Schätzchen, wir denken dieses WE ganz fest an dich. Vermissen dich sehr u haben dich lieb, Grandma Reggie
Gern hätte ich Regina Smalls’ Profil näher unter die Lupe genommen, aber es war auf privat gestellt, und ich konnte außer dem Chihuahua-Foto nichts sehen.
Also klickte ich mich zurück zu Olivia und starrte stirnrunzelnd auf den neuen Post. Ihre Grandma dachte fest an sie? Dafür musste es einen bestimmten Anlass geben. Aber welchen? Tja, vielleicht umfasste Olivias Leben ja tatsächlich noch mehr als versuchte Hauseinbrüche. Etwas Trauriges vielleicht. Oder etwas Aufregendes. Es konnte schließlich auch ein »Wir denken ganz fest an dich!« im Sinne von »Wir drücken dir die Daumen« sein. Aber wofür? Dass sie sich schnell von ihrem Sturz erholte? Aber das hätte ja eigentlich nur gepasst, wenn Olivia bleibende Schäden zurückbehalten und sich die Nachricht davon sehr schnell im Land der partyhütchentragenden Chihuahuas verbreitet hätte.
»Nö«, seufzte ich in mich hinein. »Immer noch nichts.«
Wie sollte man da bitte keinen Frust schieben? Wieso wusste ich so wenig über jemanden, mit dem ich immerhin jahrelang zu tun gehabt hatte? Gut, wir hatten jetzt auch nicht ständig miteinander rumgehangen, aber uns dafür fast jeden Tag in der Schule gesehen. Zählte das denn gar nicht?
Gerade als ich meinen Laptop zuklappen wollte, ploppte in der rechten unteren Ecke ein Fenster auf. Eine Nachricht, nur fünf Wörter, bei denen mir plötzlich eiskalt wurde.
Olivia Moon: Wir sollten uns mal unterhalten.












![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)
















