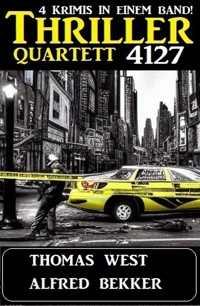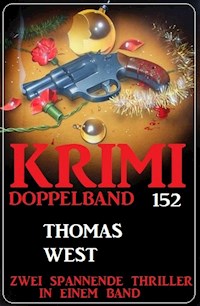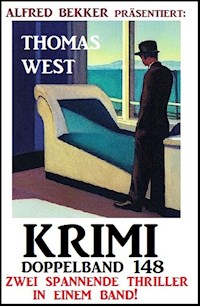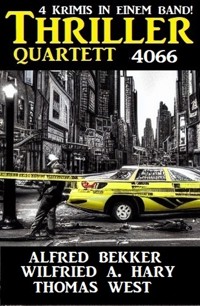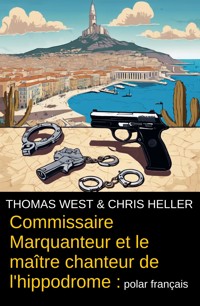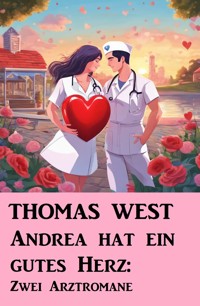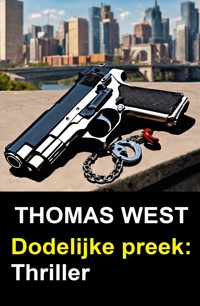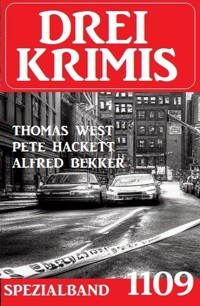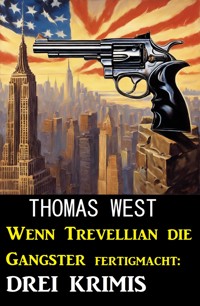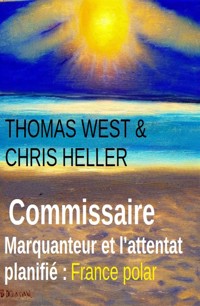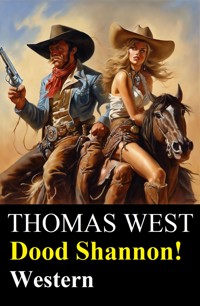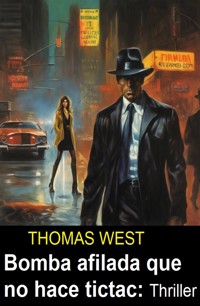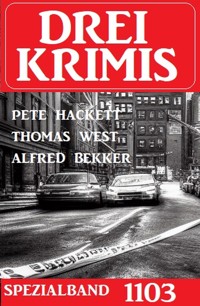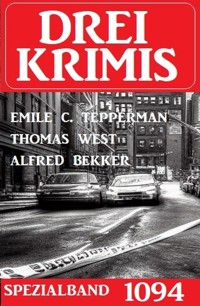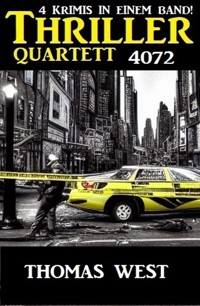
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Krimis von Thomas West: Milo muss sterben Die zur Hölle fahren Rächer ohne Namen Ein Cop läuft Amok Elf Agenten arbeiteten seit drei Monaten an dem Fall. Den Chef nicht mitgerechnet, obwohl er keinen der gerade aktuellen Fälle mit der gleichen Dringlichkeit verfolgte wie diesen. Also zwölf Agenten. Zwölf Agenten rund um die Uhr! Dazu die Büros in London, Paris und Brüssel, vier Beamte von Interpol und sechs Kontaktleute vom New York City Police Department. Dabei gab es nicht einmal eine Leiche. Allerdings ein paar Vermisste. Und sehr konkrete Hinweise aus Brüssel. Der Stadtplan von Manhattan hatte sich aufgebaut. In der East Side, mitten in einem Gebäudekomplex zwischen York Avenue und East River blinkte ein roter Punkt. Der Standort des zweiten Undercover-Agenten. Milo tippte die Frequenz seines Mikrosenders in die Tastatur. "Federal Plaza an Einsatzzentrale, kommen", quäkte Clives elektronisch verzerrte Stimme im gleichen Moment aus dem Empfänger. "Was ist das für eine bescheuerte Stimmqualität", schimpfte Milo und drehte an den Knöpfen des Empfängers herum. "Einsatzzentrale hört, kommen." "Wir haben eine Mail aus Europa erwischt..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 896
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thriller Quartett 4072
Inhaltsverzeichnis
Thriller Quartett 4072
Copyright
Milo muss sterben
Die zur Hölle fahren
Rächer ohne Namen
Ein Cop läuft Amok
Thriller Quartett 4072
Thomas West
Dieser Band enthält folgende Krimis
von Thomas West:
Milo muss sterben
Die zur Hölle fahren
Rächer ohne Namen
Ein Cop läuft Amok
Elf Agenten arbeiteten seit drei Monaten an dem Fall. Den Chef nicht mitgerechnet, obwohl er keinen der gerade aktuellen Fälle mit der gleichen Dringlichkeit verfolgte wie diesen. Also zwölf Agenten. Zwölf Agenten rund um die Uhr!
Dazu die Büros in London, Paris und Brüssel, vier Beamte von Interpol und sechs Kontaktleute vom New York City Police Department. Dabei gab es nicht einmal eine Leiche. Allerdings ein paar Vermisste. Und sehr konkrete Hinweise aus Brüssel.
Der Stadtplan von Manhattan hatte sich aufgebaut. In der East Side, mitten in einem Gebäudekomplex zwischen York Avenue und East River blinkte ein roter Punkt. Der Standort des zweiten Undercover-Agenten.
Milo tippte die Frequenz seines Mikrosenders in die Tastatur. „Federal Plaza an Einsatzzentrale, kommen“, quäkte Clives elektronisch verzerrte Stimme im gleichen Moment aus dem Empfänger.
„Was ist das für eine bescheuerte Stimmqualität“, schimpfte Milo und drehte an den Knöpfen des Empfängers herum. „Einsatzzentrale hört, kommen.“
„Wir haben eine Mail aus Europa erwischt...“
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Milo muss sterben
Thomas West
Ein Jesse Trevellian Roman
In der Serie „Jesse Trevellian“ erschienen bislang folgende Titel (ungeachtet ihrer jeweiligen Lieferbarkeit auf allen Portalen):
Alfred Bekker: Killer ohne Namen
Alfred Bekker: Killer ohne Skrupel
Alfred Bekker: Killer ohne Gnade
Alfred Bekker: Killer ohne Reue
Alfred Bekker: Killer in New York (Sammelband)
Thomas West: Rächer ohne Namen
Thomas West: Gangster Rapper
Thomas West: Richter und Rächer
Thomas West: Die zur Hölle fahren
Thomas West: Alte Leichen
Thomas West: Milo muss sterben
Weitere Titel folgen
Ein CassiopeiaPress E-Book
© Serienrechte „Jesse Trevellian“ by Alfred Bekker
© 2001 des Romans by Author
© 2013 der Digitalausgabe by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
Mit der Subwaylinie Drei fuhr Adam Dabandy von SoHo in die 125th Street hinauf. Während der Fahrt las er zum ersten Mal in seinem Leben die New York Post. Und zum letzten Mal. Aber das ahnte er zu diesem Zeitpunkt nicht einmal. Wie auch? In Adams Vorstellung begann mit seiner USA-Reise ein neuer Lebensabschnitt.
Schon fast in Harlem stieß er zu dem Teil mit den Inseraten vor. Kontaktanzeigen - jemand bot eine Führung durch das Manhattaner Nachtleben an. Ein weiblicher ‚Jemand’. Individuelle Führung durchs Manhattaner Nachtleben. Diskrete Betreuung und Begleitung in allen Lagen...
Verlockend so ein Inserat. Doch Adam Dabandy hatte kein Geld – oder korrekter: Noch hatte er kein Geld.
Die U-Bahn war nicht so voll, wie er es für eine U-Bahn in New York City erwartet hatte. Auf den Fotos seiner Reiseführer drängten sich Massen von Menschen auf Bahnsteigen und in U-Bahn-Wagons. Nichts davon. Kein Wunder: Es war halb zwölf Uhr vormittags, die meisten Manhatties hielten sich in ihren Büros auf, oder zur Mittagspause in irgendwelchen Imbissen oder Straßencafés.
Für seine Verhältnisse war Adam Dabandy früh aus dem Bett gekommen. Das lag allerdings mehr am Jetlag, als an Adams festen Vorsatz, den Sonnenuntergang nicht ohne einen Vertrag in der Tasche zu erleben. Gestern am späten Nachmittag war er mit einem Airbus der British Airways auf dem John F. Kennedy International Airport gelandet.
Vor den Fenstern wurde es hell – der Bahnsteig der 125th Straße schob sich vorbei, wurde langsamer, und stand schließlich still. Der überwiegende Teil der Fahrgäste stieg aus. Auch Adam. Den kleinen Lederrucksack geschultert und die Mappe mit seinen Bildern unter den Arm geklemmt, ließ er sich mit der Menge zum Treppenaufgang treiben.
Die meisten Leute waren um ihn herum waren farbig, er fiel nicht weiter auf. Nicht einmal durch seine Kleidung. Man sah hier fast genauso viele exotisch gekleidete Gestalten, wie in bestimmten Vierteln Londons.
Adam trug einen weißen Sari. Dazu schwarze Ledersandalen. Goldkettchen zierten seine Knöchel, und goldene Kreolen seine Ohrläppchen. Sein dichtes, glattes Haar hatte er zu einem langen Zopf geflochten. Es schimmerte rötlich – Henna. Adam benutzte es seit Jahren.
Die Mittagshitze des Julitages traf ihn wie ein Fausthieb, als er den Bürgersteig erreichte. Auch dass man im Hochsommer New York City besser meidet, hatte er in einigen seiner Reiseführer gelesen. Einen Rat, den er gern befolgt hätte. Aber im September begann die Ausstellungssaison in Manhattan. Bis dahin musste er einen Galeristen für seine Fotos gefunden haben. Er versenkte die New York Post in einem Abfalleimer.
Das war gut so.
Hier oben in Harlem nannten sie die Hundertfünfundzwanzigste ‚Martin Luther King Boulevard’. Auch das wusste Adam Dabandy aus verschiedenen Reiseführern. Er hatte sich gründlich vorbereitet auf seine erste New-York-Reise.
Eine Zeitlang schlenderte er über die breite Hauptstraße Harlems Richtung Osten. Vorbei an Straßencafés, Verkaufsständen, Straßenmusikanten, und scheinbar untätig am Bordsteinrand oder in Haus- und Hofeingängen sitzenden Menschen. Er wunderte sich über die vielen weißhäutigen Leute, die er sah. In Adams Vorstellung war Harlem immer schwarz gewesen.
Die Adressen von sieben Galerien hatte ihm sein Londoner Galerist in den Wochen vor der Reise besorgt. Jede hatte Adam angeschrieben, seinen Lebenslauf und kleine Formate einiger Abzüge seiner Arbeiten geschickt, und mit fast allen telefoniert. Adam Dabandy mochte in vielerlei Hinsicht ein Abenteurer und ein Chaot sein – aber bei der Eroberung Manhattans wollte er so wenig wie möglich dem Zufall überlassen. Es war schwer als Künstler hier Fuß zu fassen. Aber wem es gelang, der hatte es geschafft.
Die erste Galerie lag in der 126th Straße. Die professionellste und etablierteste in Harlem – ‚The Wall’. Eine New Yorker Kunstkritikerin führte sie – Doris Lincoln. Adams Brief hatte sie durch eine Sekretärin beantworten lassen. Ihre Stimme am Telefon hatte tief und kühl geklungen.
Adam Dabandy wagte nicht zu hoffen, dass man in ‚The Wall’ mehr als freundlich-distanziertes Interesse für ihn übrig haben würde. Wahrscheinlich nicht einmal das. Aber er wollte die größte Hürde zuerst nehmen, wollte sich gewissermaßen warmlaufen für die Bewerbungen bei den kleineren, vielversprechenderen Galerien.
‚The Wall’ war zwischen einer Autowerkstatt und einem Kinderspielplatz auf zwei Stockwerken in einer ehemaligen Pizzeria untergebracht. Ein halbes Dutzend Besucher hielt sich im Untergeschoss auf. Männer in Sommeranzügen und Frauen in teuren Sommerkleidern und Hüten. Alle zwischen fünfundvierzig und fünfundfünfzig Jahre alt. Und alle sahen sie nach Geld aus.
Sie standen um eine Stahlskulptur herum – eine kopflose, nackte Figur auf einer Art Tisch mit einem überdimensionalen, gespaltenen Apfel in den Armen. Eine Klinge ragte aus dem Spalt in dem Apfel – rostig und zerklüftet.
Wäre Adam auch nur ein wenig abergläubisch gewesen, hätte er die Skulptur vielleicht als Warnung verstanden. Aber er glaubte nicht an Götter, Teufel, Vorzeichen und dergleichen. Der junge Brite glaubte an überhaupt nichts – nur an das, was sein Objektiv einzufangen in der Lage war. Und manchmal nicht einmal an das.
Die Leute schienen sich angeregt über die Skulptur zu unterhalten. Adam Dabandy erkannte die Galeristin an ihrer dunklen Stimme – eine füllige Frau mittleren Alters und mit voluminösem, rotem Haar. Sie blickte auf, als sich die Tür hinter Adam schloss.
„Mister...?“ Ihr fragender Blick wanderte von seinen Fußkettchen über seinen Sari bis zu seinem Zopf hinauf. „Ah – Sie sind der Fotograf mit dem indischen Namen aus London...“ Sie kam näher.
Adam lächelte. „Dabandy, pakistanisch...“ Vielmehr brachte er nicht heraus.
„Ich hab Kundschaft.“ Die Frau blickte auf ihre Armbanduhr. „Vielleicht in zwei Stunden? Versuchen Sie solang woanders Ihr Glück.“ Und schon lief sie wieder zu der geköpften Stahlskulptur und dem gespaltenen Apfel. Die Männer und Frauen würdigten den schmächtigen Exoten keines Blickes.
Die Enttäuschung brannte wie billiger Whisky in Adams Kehle. Er drehte sich um und ging hinaus auf die Straße. Ziellos lief er ein paar Minuten lang über den Bürgersteig. Bis sich seine Mutlosigkeit in Wut verwandelte.
Du bist empfindlich, okay, sagte er sich, aber du bist nicht so dumm zu glauben, dass man einem Londoner Künstler, der aussieht wie ein Freak aus Goar oder Bombay hier in New York City einen roten Teppich ausrollt...
Er setzte sich in eines der Straßencafés, bestellte Cola mit Eis und packte Stadtplan und Adressenliste aus. Zwanzig Minuten später lief er die 125th Street Richtung Osten. Und wenn er zwei Monate lang sämtliche Galerien im Big Apple abklappern müsste – er würde einen Raum finden, in dem er seine Bilder ausstellen und verkaufen konnte! Adam schwor sich das.
Nicht weit vor der Ecke zur 8th Avenue gab es ein altes Feuerwehrhaus. ‚Firepatrol No. Nintynine’ hieß die Galerie, die darin untergebracht war. Ein Franzose hatte sie zwei Jahre zuvor eröffnet. Der Mann nahm sich eine halbe Stunde Zeit für Adam Dabandy und seine Bilder. Für die nächsten Monate sei er leider ausgebucht. Adam solle Ende des Jahres noch einmal anklopfen.
Wenigstens kein hartes ‚Nein’.
Weiter ging es. Die nächste Galerie auf seiner Liste lag am Malcom X Park. Ein Antiquitätenhändler aus Italien. Kein Interesse.
Weiter zu Galerie Nummer vier. Sie lag an der Ecke Madison Avenue, 127th Straße. Eine Klitsche, kaum vierzig Quadratmeter Ausstellungsfläche. Dem jungen Österreicher, dem sie gehörte, waren Adam Fotos nicht avantgardistisch genug.
Fast eine Stunde später – inzwischen war es halbvier – stand er vor der Eingangstür einer großen Galerie in der Amsterdam Avenue in der Nähe der University of New York: Wegen Urlaub bis Ende August geschlossen verkündete ein Schild. Durchs Schaufenster hindurch blickte Adam auf leere Wände.
Seine Beine waren schwer, während er die sechste Galerie auf seiner Liste ansteuerte. Nicht etwa Erschöpfung steckte ihm in den Knochen – Enttäuschung und Mutlosigkeit bedrückten ihn.
‚Gallery A’ hieß die Galerie zwischen der 129th Street und dem Malcom X Boulevard im Herzen Harlems. Eine armenische Malerin – nicht viel älter als Adam selbst – bot dort jungen Künstlern eine Plattform, um bekannt zu werden und ihre Werke zu verkaufen. Eine hübsche Frau. Verstohlen glitten Adams Blicke über ihre nackten Oberarme, ihren schlanken Nacken und die Rundungen ihres Gesäßes, während sie seine Fotos begutachtete.
Die Kontaktanzeige fiel ihm ein. Individuelle Führung durchs Manhattaner Nachtleben. Diskrete Betreuung und Begleitung in allen Lagen...
Die Armenierin redete wie ein Wasserfall. Von ihr erfuhr Adam, dass in dem halben Jahr, seit Clinton angekündigt hatte, sein Büro in Harlem einzurichten, sich mehr Weiße in Harlem niedergelassen hatten, als in den fünf Jahren zuvor. „Aber nur Ausländer und Künstler – die WASPs aus Midtown trauen sich nicht her...“
WASP war die Abkürzung für White Anglosaxon Protestants. Das wusste Adam zufällig aus einem seiner Reiseführer.
„Also, Mr. Dabandy – ist ja wirklich hübsch, was Sie da machen...“
Die Hälfte von Adams Fotos waren Porträtfotos. Gesichter von Menschen in der ganzen Welt – Südeuropäer, Türken, Berber, Afghanen, Skandinavier, Aborigines, Afrikaner, Asiaten, und so weiter und so weiter. Lauter unbekannte Menschen, die er in beliebigen Alltagssituationen abgelichtet hatte.
„...ich denke, dass könnte ein paar von den Leuten interessieren, die bei mir so ’reinschauen...“ Die Frau legte einige Bilder beiseite.
Die andere Hälfte seiner Fotos zeigten den kleinen Künstler selbst in den unterschiedlichsten Posen: Adam Dabandy beim Baden, Adam Dabandy als Metzger, Adam Dabandy in Handschellen, Adam Dabandy auf dem elektrischen Stuhl, Adam Dabandy mit dem Wirtschaftsteil der Times, Adam Dabandy mit einem Säugling auf dem Arm, Adam Dabandy betrunken im Rinnstein...
Auf den meisten Bildern war er nackt.
„Lassen Sie mir ein paar von den Fotos hier – ich werde sie meinem Partner zeigen.“ Der junge Brite hätte gern einen Luftsprung gemacht. Er nickte aber nur.
Ganz cool bleiben, mein Junge...
„Wir haben schon lange daran gedacht, mal wieder einen Fotografen auszustellen.“ Er packte seine Bilder in die Mappe. „Vielleicht im Herbst. Rufen Sie die nächsten Tage an...“ Sie reichte ihm Hand und Karte und begleitete ihn zur Tür.
Als er den Malcom X Boulevard zur Hundertfünfundzwanzigsten hinunterlief, hatte er das Gefühl zu schweben. Kurz vor der Subway-Station fiel sein Blick auf die Standuhr neben der Treppe: Zehn nach halb fünf.
Er ging nicht zum Bahnsteig hinunter. Stattdessen lief er weiter Richtung Osten. Rüste dich, Lady Lincoln, murmelte er, ich komme! Auch ‚The Wall’ werde ich erklimmen...
Adam neigte zu einer gewissen Pathetik, wenn er Morgenluft witterte...
*
Diesmal trat er wesentlich forscher ein, als beim ersten Mal fünf Stunden zuvor. Die Galeristin musterte ihn unwillig. Sie stand mit einem Paar auf der Treppe ins Obergeschoss und betrachtete ein Ölbild an der Wand des Treppenaufgangs. Das Ölbild zeigte weiter nichts als eine hellgrüne Fläche, und der Mann und die Frau sahen nicht aus wie arme Künstler.
„Hi, Mrs. Lincoln!“ Adam blieb nicht an der Tür stehen, sondern ging zu dem runden Kirschholztisch in der Mitte des Eingangsbereiches. „Hab mich ein bisschen verspätet!“ Er öffnete seine Mappe und begann seine Arbeiten auf dem Tisch auszubreiten. Unglaublich entspannt fühlte er sich.
Eine steile Falte erschien zwischen den aufgemalten Brauen Mrs. Lincolns. Sie murmelte eine Entschuldigung Richtung Kundschaft und stieg die Treppe herunter. Mit energischen Schritten kam sie zu Adam. Sie räusperte sich. „In zwei Stunden war ausgemacht – inzwischen sind fast fünf Stunden vergangen.“ Ihre Miene war streng, aber ihr Tonfall sachlich und beherrscht. In nicht einer Silbe hob sie die Stimme. „Inzwischen habe ich wieder Kunden und anschließend einen Termin. Kommen Sie morgen früh vorbei.“
„Es dauert nicht lang, Mrs. Lincoln, wirklich nicht...“
„Ein Fotograf aus Indien?!“ Die Frau auf der Treppe lächelte. Gefolgt von ihrem Begleiter kam sie zu Adam und der Galeristin. „Wie interessant!“ Sie war Mitte dreißig und sehr hübsch.
„Aus London, Ma’am – mein Vater stammt aus Islamabad, das liegt in...“
„...Pakistan, verzeihen Sie, Sir.“ Sie lächelte charmant und Adam war beeindruckt – eine US-Amerikanerin mit global-geographischen Grundkenntnissen! Gewissen europäischen Zeitungen zufolge kein allzu häufiges Phänomen in den Staaten.
Die Frau beugte sich über die Fotos. „Sieh dir das an, Darling!“ Ihr Begleiter setzte eine Lesebrille auf beschäftigte sich nun auch mit Adams Bildern.
Mrs. Lincoln mied jeden Blickkontakt zu Adam und machte eine Zeitlang gute Miene zum bösen Spiel. Bis ihr der Mann eines der Fotos reichte. „O ja“, sagte sie. Weiter nichts, einfach nur ‚o ja’, und zwar sagte sie das bei fast jedem zweiten Foto, dass sie vom Tisch aufnahm, oder das man ihr reichte.
Nach einer halben Stunde etwa verkaufte sie dem Paar zwei von Adams Selbstporträts und nahm die Bestellung von drei weiteren entgegen, von denen Adam nur kleinformatige Abzüge dabei hatte. Der Mann blätterte siebenhundertfünfzig Dollar hin – fünfhundert für die beiden Selbstporträts, zweihundertfünfzig als Anzahlung für die bestellten Fotos. Adam wurde schwindelig...
Siebenhundertfünfzig Dollar...! Zweihundertfünfzig Anzahlung...!
Später, als sie allein waren, vereinbarten sie eine Ausstellung für den Oktober. Adam unterschrieb irgendeinen Vertrag. Zuvor tat er so, als würde er ihn lesen. Die Worte verschwammen vor seinen Augen. Mrs. Lincoln behielt fünfundsiebzig Dollar als Provision. Sie verabschiedeten sich mit Handschlag.
Adam merkte nicht, dass er laut sang, wusste nicht in welche Richtung er ging, vergaß für Minuten, wo er war. Er sang einen alten Dylon-Song – ‚The Times They Are A-Changin’ – es fiel ihm nicht auf, dass Passanten ihn anstaunten. Manche blieben stehen und sahen ihm hinterher.
In der Tasche seines Saris hielt seine Linke sechshundertfünfundsiebzig Dollar in kleinen Scheinen umklammert. Sechshundertfünfundsiebzig Dollar!
Irgendwann stand er in der Nähe des Marcus Garvey Parks vor einem Zeitungskiosk. Er kaufte die New York Post.
Das hätte er besser unterlassen.
Er ging ein Stück in den Park hinein und setzte sich auf eine Parkbank. Dort blätterte er den Teil mit den Kontaktanzeigen auf.
Individuelle Führung durchs Manhattaner Nachtleben. Diskrete Betreuung und Begleitung in allen Lagen...
Adam Dabandy schrieb sich die angegebene Telefonnummer heraus...
*
Er wartete in einem Nachtlokal in SoHo, in der Grand Street. Es hieß Lucky Strike und war so voll, dass Adam Sorge hatte, sie zu übersehen.
Sie – die Frau die sich am Telefon gemeldet hatte. Unter der Nummer aus der Zeitung.
„Sagen wir: Eine Stunde vor Mitternacht im Lucky Strike?“ Es hatte ihm schier den Atem verschlagen, so unkompliziert hatte sie geklungen. Als würde sie sich jeden Tag auf diese Weise verabreden. „Ich bin blond, trage schwarze Lederhosen und ein bauchfreies, rotes Top. Und einen Goldring im Bauchnabel.“
Adam war nervös. Trank schon den zweiten Whisky und hatte sogar eine Schachtel Zigaretten gekauft. In London hätte er niemals die Nummer von einer Kontaktanzeige angerufen. Schon gar nicht die Nummer einer derart eindeutigen Kontaktanzeige.
Nicht nur, weil sich in den Kreisen, in denen er verkehrte, immer willige Frauen fanden. Es hatte mit seiner religiösen Erziehung zu tun.
Die Familie seines Vaters hatte zu der verschwindend kleinen katholischen Minderheit in Pakistan gehört. Und seine englische Mutter war strenggläubige Anglikanerin.
Adam hatte keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern. Zu seiner gesamten Familie nicht. Dass man sie auf eine verhängnisvolle Art dennoch niemals los wurde, merkte er nicht zum ersten Mal.
Adam Dabandy hatte sich einen Platz an der Mittelsäule gesucht. Von hier aus konnte er den Eingang überblicken. An der Theke drängte sich eine Menge junger Leute – Studenten, vermutete Adam. Aus den Boxen an der Decke dröhnte Popmusik – Madonna, Britney Spears, Blood Hound Gang und ähnliches. Rauchschwaden umflorten die niedrighängenden Lampen. Junge Männer und Frauen – vermutlich Studenten - mit dunkelroten Schürzen balancierten Tabletts voller Gläser und Flaschen an Gästen und Tischen vorbei.
Adam hatte sich eine graue Leinenhose und ein helles Jackett angezogen. Hätte er den auffallenden Sari nicht abgelegt, hätte er wenigstens der Polizei die Arbeit ein wenig erleichtert. Er selbst war zu diesem Zeitpunkt schon so gut wie verloren...
Er erkannte sie sofort: Ihre Art sich zu bewegen und sich in der überfüllten Kneipe umzusehen war ähnlich unkompliziert wie ihre Telefonstimme. Ihr Blick blieb an seiner Gestalt hängen. Adam hatte ihr gesagt, dass er dunkelhäutig war und einen geflochtenen Zopf trug.
Sie winkte, und er winkte zurück. Fasziniert beobachtete er sie, während sie durch die Menge tänzelte. Erleichtert registrierte er, dass sie klein und zierlich war. Eine seiner größten Existenzsorgen: Eine Frau, die ihn körperlich überragte. Adam Dabandy war nicht einmal hundertsiebzig Zentimeter groß.
Sie trug ihr weißblondes Haar zu einer Dauerwelle gestylt. Das erinnerte Adam an Fotos seiner Mutter. In jungen Jahren hatte sie sich ähnlich frisiert. Kurz vor seiner Geburt Anfang der siebziger Jahre.
„Hi!“ Sie setzte sich neben ihn und strahlte ihn an. „Nenn mich Lou und bestell mir’n Bier.“
„Adam.“ Er winkte einem der studentischen Kellner.
„Und? Was willst du sehen heute Nacht, Adam? Tanzbars, Diskos, Schwulenbars, Jazzkeller, Rockfabriken, Country-Clubs...?“
Adam blickte in ihre grünen Augen und wusste nicht, was er sagen sollte. Sie gefiel ihm. Sie gefiel ihm sehr. Er zuckte mit den Schultern.
„Also mach ich das Programm – versteh ich das richtig...?“
Und das tat sie dann auch. Nach einer halben Stunde Small Talk und einem Bier fuhren sie mit einem Cabby hinüber in die Varick Street. SOB hieß der Club, in den sie ihn dort führte. Dort gab es eine lockere Atmosphäre und lateinamerikanische Rhythmen. „SOB bedeutet Sounds of Brazil“, erklärte sie ihm.
Nach einer Stunde fuhren sie nach Süden. Unterwegs fragte er sie nach dem Preis. „Das kommt ganz darauf an, was du von mir willst“, sagte sie.
Im Zwielicht des Wageninneren konnte er ihre Gesichtszüge nicht erkennen. Aber ihre Stimme klang weich und verheißungsvoll.
„Alles...“, sagte Adam heiser.
Sie schauten in einen Nachtclub am Battery Park hinein. Nur eine halbe Stunde blieben sie dort. Danach ging es nach Nordosten zur Bowery. Rockmusik war angesagt.
Der Laden hieß an CBGB. Auch diese Abkürzung erklärte sie ihm, aber Adam verstand sie nicht, weil die Musik so laut war. Sie tanzten, und die Frau namens Lou hatte nichts dagegen sich von Adam küssen zu lassen.
Als es ihnen zu laut wurde, gingen sie zu Fuß in eine schmuddelige Nachtbar am Westrand der Lower East Side. Adam hatte nur noch einen Gedanken.
An der Theke trank er Bier, und Lou Kaffee. Sie fragte ihn aus – was er mache, woher er komme, und so weiter. Nach dem zweiten Bier wurde Adam ziemlich redselig. Sogar von dem Zerwürfnis mit seinem Vater erzählte er. Und dass er sich noch im Herbst in New York City niederlassen würde, obwohl er keinen Menschen in Manhattan kannte. Außer ihr, Lou, und einer gewissen Mrs. Doris Lincoln, aber auch die erst seit wenigen Stunden...
Sie erwies sich als geduldige Zuhörerin, nickte, fragte nach, ließ es zu, dass seine Hand erst auf ihrem Knie lag, dann über ihren Rücken streichelte.
Gegen Morgen fuhren sie in ihr Apartment. Adam hatte nur noch etwas mehr als dreihundertfünfzig Dollars in der Tasche. Und nicht die geringste Ahnung in welchem Stadtteil sie sich befanden. Wie weggeblasen alles, was er in seinen Reiseführern gelesen hatte. Die Frau namens Lou – ihre Beine, ihre Stimme, ihr Haar, ihr Geruch – beanspruchte jede seiner Hirnzellen.
Das erste Grau des neuen Tages dämmerte über Dachfirsten und einem Park, als er hinter ihr her das Treppenhaus eines Klinkerbaus betrat. „Leise“, flüsterte sie ihm ins Ohr. Rechts zog er sich am Geländer hoch, links stützte sie ihn. Er bereute, soviel Bier getrunken zu haben.
Während sie ihre Apartmenttür aufschloss – war es im zweiten oder im dritten Obergeschoss? – lehnte er gegen den Türrahmen. Es war schön anzusehen, wie die Schulterblätter sich unter ihrem Hemd wölbten und der Stoff sich über ihren Brustwarzen straffte. Gott – hatte Adam plötzlich Appetit! Appetit auf Frau...
Sie zog ihn in die Wohnung und schloss ab. Die Zeit ließ er ihr noch, aber danach kam sie nicht einmal mehr dazu, das Licht einzuschalten – kaum hatte sie sich umgedreht, riss er sie an sich und küsste sie. Wild und leidenschaftlich.
Das Temperament hatte Adam von seinem pakistanischen Vater geerbt. Dabandy senior war ein Vulkan...
Lou machte sich von Adam los. Sie rang nach Luft und wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab. „Scheint lange her zu sein, was?“ Sie lächelte. „Lass mich erst einmal ins Bad gehen, ja?“
Er sah ihr nach – Gott! Dieser Hüftschwung! Lou drückte einen Lichtschalter und verschwand hinter einer Tür. Sie lehnte die Tür nur an, und Adam konnte nicht widerstehen: Auf leisen Sohlen schlich er ihr hinterher.
Die Hand schon fast an der Klinke hörte er ein Geräusch hinter sich. Als würde jemand einen Vorhang beiseite ziehen. Er fuhr herum. Fünf Schritte entfernt von ihm die Konturen eines Mannes im Halbdunkeln.
Etwas klickte metallen. Licht flammte auf. Da stand er – im Durchgang zu einem anderen Raum, den Vorhang noch in der Linken. In grauen Bagpants und aus der Hose hängendem schwarzem Hemd. Schlank, mit blonden Locken und einen Kopf größer als Adam. Und etwa in seinem Alter.
„Lou?“ Staubtrocken war Adams Mund plötzlich. Kaum wagte er zu atmen. Hinter sich hörte er, wie die Badezimmertür aufgezogen wurde. „Wer ist der Kerl...?“
Und dann sah er die Waffe in der Rechten des Blonden. Er schrie auf und wollte zur Tür rennen. Aber ein Arm legte sich von hinten um seinen Hals, und eine Hand auf seinen Mund. Beide zu kräftig, um Arm und Hand der zierlichen Lou sein zu können. Der Blonde hob die Waffe und zielte auf Adams Kopf. „Du hältst still, oder du stirbst...“
Jemand riss ihm das Jackett vom Leib, jemand zerrte an seinem linken Arm und schnürte oberhalb der Ellenbeuge etwas fest. Dann ein Stich an der Innenseite des Unterarms. Adams Kopf füllte sich mit warmer Watte...
*
Das erste Mal sah ich sie nur flüchtig. Vom Beifahrersitz eines schwarzen Mercedes 300 TD aus, einem Leichenwagen.
Zusammen mit zwei Männern verließ sie das Grundstück der Jugendstil-Villa auf der anderen Straßenseite. Sie trug einen Violinenkasten. Einer der beiden Männer hatte einen Cellokasten geschultert, und der zweite schob einen rollbaren Kontrabass-Koffer vor sich her.
Groß und schlank erschien sie mir, und ihr schwarzes Haar war auffällig kurz. Sie trug weiße Jeans und eine leichte, hemdartige Jacke – grüner Samt oder Cord, so genau konnte ich das auf die Entfernung nicht erkennen – und weiße Sportschuhe. Ihr Outfit wollte nicht recht zu dem der beiden Männern passen. Die waren in dunkelblaue Anzüge gehüllt und sahen aus, als kämen sie gerade von einem Kammerkonzert.
Die drei wirkten angespannt. Keiner lächelte, keiner sah den anderen an. Die Frau lief in der Mitte, oder nein: Sie lief nicht – sie schritt. Ja, ihre ganze Art sich zu bewegen hatte etwas Beherrschtes, fast Würdevolles an sich. Auch war sie den Männern immer einen halben Schritt voraus. Der Eindruck einer Prominenten drängte sich mir auf. Einer Prominenten, die von zwei Bodyguards flankiert wurde.
Vor einem metallic-blaues Van machten sie Halt – ein Ford Galaxy, vermutete ich. Einer der Männer öffnete die Heckklappe, sie schoben ihre Instrumente in den Stauraum.
Der Mann, der neben mir am Steuer des Leichenwagens saß, tat nur noch so, als würde er in seinem Sportmagazin blättern. Sein Blick flog zwischen den Fotos der NBA-Meisterschaftsfeiern und den Leuten am blauen Van hin und her. Ich beobachtete ihn aus den Augenwinkeln. Irgendwie kam er mir plötzlich nervös vor.
„Du kennst sie?“
„Machen manchmal Musik bei Trauerfeiern.“ Er blätterte wieder in seinem Sportmagazin. „Die Los Angeles Lakers haben’s mal wieder allen gezeigt.“ Er lächelte. Das tat er selten, und wenn er es tat, wirkte es meistens unecht. So wie in diesem Moment. „108:96 gegen die Philadelphia 76ers! Und zum zweiten Mal Meister...!“
Der Mann hieß Donald Reese und war exakt auf die gleiche Weise gekleidet wie ich: Graues, kariertes Hemd, schwarze Krawatte, schwarzer Anzug, schwarze Schildmütze.
Donald Reese wollte, dass ich ihn ‚Don’ nannte, und er nannte mich ‚Billy’.
Don war ein paar Jahre älter als ich. Er hatte silbergraues, aber sehr dichtes, welliges Haar und einen ziemlich dunklen Teint. Vermutlich gab es Latinos unter seinen Vorfahren - er stammte von der Westküste. Daher auch seine Vorliebe für die Basketballer aus Los Angeles.
Donald Reese gehörte zu der Art von Männern, die sich selbst in den besten Jahren wähnten und die Blicke von zehn Jahre älteren Frauen anzogen, die auf der Suche nach einem Abenteuer waren. Oder die Blicke von zwanzig Jahre jüngeren Frauen, die auf der Suche nach einem väterlichen Beschützer waren.
Don und ich kannten uns seit vier Wochen. Seit ich für das Bestattungshaus Moreland & King arbeitete.
„Schau dir den an!“ Don hielt mir die Großaufnahme eines dunkelhäutigen Basketballers unter die Nase. „Shaquille O’Neal! Zwei Meter sechzehn groß! Was schätzt du, wie viel der auf die Waage bringt?“
Dass Shaquille O’Neal der Center der Los Angeles Lakers war, wusste selbst ich. Ich tippte auf 250 Pfund.
„Falsch! Zweihundertsechsundachtzig Pfund!“
Die drei Musiker stiegen in den Van, die Frau mit den dunklen Haaren auf den Beifahrersitz. „Hübsche Frau“, sagte ich.
„Guck nicht so auffällig hin.“
„Du kennst sie näher?“
„Musikerin. Wie die Männer, sag ich doch.“ Der Van – es war tatsächlich ein Ford Galaxy – rollte an uns vorbei. Keiner der drei Insassen schien Notiz von uns zu nehmen.
„Wenn eine Trauerfeier im Altenheim stattfindet, kommen sie mit ihren Streichinstrumenten und drücken ein wenig auf die Tränendrüsen.“ Don steckte das Sportmagazin in die Seitenablage.
„Berufsmusiker?“
„Du fragst zuviel, Billy.“ Er startete den Motor. Dabei musterte er mich von der Seite. „Manchmal kommst du mir vor, wie einer von diesen Medienhyänen, die sich irgendwo einschleichen, 'rumschnüffeln, und hinterher Ammenmärchen in ihren Computer hacken.“
„Wenn du mir verrätst, wie viele Scheintote Mr. Moreland jedes Jahr beerdigt, kriegst du zehn Prozent vom Honorar.“ Ich tat gelassen. „Und wenn sie mir dafür den Pulitzer-Preis geben, spendier’ ich dir ’ne Freikarte für die nächste NBA-Saison.“
„Witzbold...“ Donald Reese lächelte sein humorloses Lächeln. Manchmal fragte ich mich, ob er etwas ahnte.
„Die Musiker sind fertig – unser Auftritt.“ Don ließ den Leichenwagen bis vor den Eingang des Villengrundstücks rollen – ein gut zweieinhalb Meter gusseisernes Tor und eine schmale Besuchertür, ebenfalls aus schwarzem Gusseisen. In der mittleren der drei Pfostensäulen aus braunem Sandstein hing ein Messingschild – Martin Luther King Senior Residence of Long Island City.
Auf den beiden Außensäulen, halb versteckt im Laub der Birken rechts und links des Tores, je eine Videokamera. Wir standen kaum, da begann sich das Rolltor auch schon zur Seite zu schieben.
Ich wusste nur, dass wir einen Verstorbenen aus einer Seniorenresidenz abzuholen hatten. Aus einer Einrichtung, in der sehr wohlhabende Mitmenschen ihren Lebensabend verbrachten.
Das hatte mir George Moreland erzählt, mein Chef. Mein vorübergehender Chef.
Von ihm wusste ich auch, dass einige der alten Villenbewohner keine Kontakte zu Angehörigen mehr pflegten. Oder einfach keine Angehörigen mehr hatten. Deswegen wunderte ich mich auch nicht, keine Trauergäste auf der Vortreppe des Gebäudes zu sehen.
Durch eine kleine Parkanlage ging es im Schritttempo auf die Jugendstil-Villa zu. Weißer Kies knirschte unter unseren Reifen. Ein Springbrunnen auf einem gepflegten Rasen schob sich in mein Blickfeld. Zwischen Zierbüschen und verblühten Rhododendron-Sträuchern antike Skulpturen – Venus, Herkules und Amorknaben.
Spazierwege führten an Sitzbänken vorbei. Ein Gärtner arbeitete in Rosenrabatten. Eine Zentaurenskulptur stand links am Rand des Zufahrtsweges, rechts ein überlebensgroßer Löwe, und ein Stück im Rasen, neben einem blühenden Jasminbusch und nicht weit vom Springbrunnen entfernt, ein Satyr. Er beobachtete zwei Nymphen, die sich am Rand des Brunnens räkelten.
Zunächst dachte ich, die Figuren seien aus Gips. Doch als wir am Löwen vorbei fuhren, sah ich die Reflexe des Sonnenlichts auf seiner Flanke glänzen – die Skulpturen waren tatsächlich aus weißem Marmor.
„Sieht aus wie der Vorgarten eines Sanatoriums“, sagte ich. „Und hinter dem Haus liegt wahrscheinlich der Friedhof.“
Don antwortete nicht.
Das Gebäude selbst erinnerte mich an die schlossartigen Häuser, wie man sie in alten Villenvierteln mancher Südstaaten-Städte findet. Dreistöckig, wuchtig, aus braunem Sandstein und mit dunkelrotem Satteldach lag es inmitten der morbiden Idylle.
Die breite Vortreppe war von Säulen gesäumt. Darüber zog sich die Balustrade eines weitläufigen Balkons. Ecktürme erhoben sich aus dem Dach, groß genug, einem Zimmer Raum zu bieten. Kleinere Säulen auch seitlich der Fensterrahmen und des doppelflügligen Hauptportals.
Hinter der Balustrade darüber sah ich ein paar weiße Häupter. Drei oder vier Senioren saßen auf dem Balkon. In Rollstühlen, wie es schien. Auch auf einer der Parkbänke entdeckte ich einen Mann mit weißem Haar. Er las Zeitung, ein Gehstock lehnte neben ihm gegen die Bank.
Zugegeben: Kein Altersheim für den All-American-Pensionär, aber dennoch ein Altersheim. Oder eine ‚Seniorenresidenz’ von mir aus – was sonst? Zu behaupten, ich hätte zu diesem Zeitpunkt etwas geahnt, wäre gelogen.
Don stoppte nicht vor dem Haupteingang. Er bog nach links ab, und fuhr an der linken Seite der Villa entlang. Hinter dem Prachthäuschen erstreckten sich drei Flachbauten tief in den Garten hinein. Zwei waren direkt an die Villa angebaut. Zwischen ihnen hielten wir und stiegen aus.
Don verschwand hinter einer Metalltür und kehrte kurz darauf mit einem fahrbaren Gestell zurück, wie Sanitäter es benutzten, um Tragen darauf zu transportieren. Wir vom Bestattungshaus Moreland & King benutzten es, um Särge von Leichenhallen ins Auto, oder vom Auto in Trauerhallen oder Krematorien zu transportieren.
Wir vom Moreland & King...
Wir...
Wenn mich ein alter Bekannter so gesehen hätte – im Leichenwagen von Moreland & King und in der Dienstkluft von Moreland & King – er hätte mich vermutlich entsetzt gefragt, seit wann ich meine Dollars nicht mehr als Special Agent des FBI-Districts Manhattan, sondern in der Bestattungsbranche verdiente.
Allerdings war die Wahrscheinlichkeit, dass ein alter Bekannter mich als Jesse Trevellian wiedererkannte seit vier Wochen eher gering: Ich trug einen schulterlangen Haarzopf, Koteletten und einen ziemlich dichten Schnauzer. Außerdem hatte Frozzel mir braune Kontaktlinsen verpasst.
Wenn ich abends in das kleine Apartment kam, das der FBI mir in Brooklyn Flatbush gemietet hatte, verbrachte ich erst einmal ein paar Minuten vor dem Spiegel...
Ich öffnete die Heckklappen des Benz. Gemeinsam zogen wir den Sarg aus dem Wagen und legten ihn auf den rollenden Untersatz – kein Holzsarg, wie meistens, sondern eine Zinkwanne. Wer auch immer hier verstorben war, er würde eingeäschert und seine Urne im Greenwood Cemetery vergraben werden. Und zwar auf dem Teil des Brooklyner Friedhofs, auf dem man ausschließlich anonyme Gräber fand.
Das hatte Donald Reese mir auf der Fahrt von Manhattan nach Long Island City erklärt.
Wir schoben die Bahre in den Anbau. Don ging voran. Er blickte in den blauen Julihimmel, bevor er das flache Gebäude betrat. „Schönes Wetter zum Sterben.“ Don lächelte nicht, während er das sagte.
Angenehme Frische wehte mir aus dem Halbdunkeln entgegen. Es roch ein wenig nach altem Wachs und frischen Champions. Don drückte auf einen Wandschalter. Licht flammte auf. Ich sah Wandschränke aus Aluminium, zwei Müllsackständer und an der gegenüberliegenden Wand zwei große Metalltüren mit Sichtfenstern. Endlich begriff ich – eine gekühlte Leichenhalle.
Es war mir neu, dass Altenheime mit Leichenhallen ausgestattet sind.
Don öffnete die linke der beiden Türen. Die Leiche lag auf einem fahrbaren Tisch, zugedeckt mit einem Zellstofftuch.
Auch das fand ich gelinde gesagt erstaunlich. „Die Musiker haben doch erst vor fünf Minuten das Grundstück verlassen – haben sie ihre Trauerhymne hier in der Leichenhalle gefiedelt? Oder warum liegt der Tote schon hier unten?“
„Unsinn.“ Don zog den Tisch heraus. „Sicher ist die Trauerfeier schon länger vorbei. Wahrscheinlich haben die Musiker noch einen Kaffee bekommen.“ Wir schoben unsere Zinkwanne neben die Bahre und nahmen den Deckel ab.
„Pack du an den Füßen an.“ Don schob mich vom Kopfende des Tisches weg. Schon das hätte mich stutzig machen müssen.
Ich griff unter die Einmaldecke und tastete die Füße des Toten – und Fußkettchen um seine Knöchel. Ich versuchte mich zu erinnern, ob ich je einen alten Menschen mit Fußkettchen gesehen hatte. Eine greise Schauspielerin fiel mir ein.
Während wir die Leiche in die Wanne hinüberhievten, war Don bemüht, ihr Gesicht nicht zu enthüllen. So bemüht, dass es mir auffallen musste. Und als wir sie ablegten, verrutschte das Zellstofftuch am Fußende. Für Sekunden sah ich Unterschenkel und Füße des Toten: Kleine Füße, relativ schlanke Unterschenkel, dunkle, glatte Haut, und um jeden Knöchel ein goldenes Fußkettchen...
„Pass doch ein bisschen auf, du Trottel!“ Don reagierte ungehalten. Es gab keinen ersichtlichen Grund dafür – abgesehen von meinem kurzen Blick auf den Toten. Oder – auf die Tote...?
Ein Adrenalinstoß trieb meinen Herzschlag an.
„Du bist mir ein bisschen zu nervös heute.“ Ich glaube, es gelang mir äußerlich die Ruhe selbst zu mimen. Don antwortete nicht. Die Art, wie er mich musterte, bekam plötzlich etwas Lauerndes. „Dafür, dass die Los Angeles Lakers die Meisterschaft geholt haben, solltest du ein entspannter sein.“ Ich grinste ihn an. Er reagierte nicht darauf.
Wir schoben den Zinksarg aus der Leichenhalle zum Wagen und luden ihn ein. Fiebrige Erregung hatte mich gepackt. Fast euphorisch fühlte ich mich. Nach drei Monaten Wühlerei endlich die Spur, auf die wir gewartet hatten.
„Bring das Gestell zurück ins Kühlhaus.“ Don schlug die Heckklappe zu und stieg ein. Es war klar: Er wollte mich nicht allein mit der Leiche im Wagen lassen.
Ich schob also den fahrbaren Aluminiumuntersatz in den Anbau. Bevor ich das Gebäude verließ, hielt ich meine Armbanduhr an die Lippen – es war zehn vor zwei. „Trevellian an Einsatzleitung...“ Ich gab meinen Standort und das Kennzeichen des Leichenwagens durch. „Ich sollte zwei oder drei Minuten allein in dem Fahrzeug sein. Will mir die Leiche anschauen, möglichst ohne dass Reese es merkt. Wenn wir im Krematorium sind ist es zu spät. Vielleicht könnt ihr das arrangieren...“
„Verstanden“, kam es schwach aus dem Inneren der Uhr. Aber deutlich genug, dass ich Milos Stimme erkennen konnte.
Ich schloss die Tür und schlenderte zum Benz zurück. Dons Finger trommelten gegen das Lenkrad. Er startete den Motor.
Der schwarze Benz-Kombi rollte langsam an der Villa vorbei. Plötzlich erschien sie mir ganz und gar nicht mehr, wie eine normale Seniorenresidenz. Plötzlich erschien sie mir wie ein Spukschloss, wie die Residenz von Mördern.
Als wir vor dem sich langsam öffnenden Rolltor standen, blickte ich in den Seitenspiegel. Hinter der Balustrade über der Vortreppe stand eine Frau: Schlank, hochgewachsen, dunkles, kurzes Haar.
Ich kniff die Augen zusammen. Unwillkürlich beugte ich mich nach vorn. Es blieb dabei: Schlank, hochgewachsen, dunkles, kurzes Haar...
War sie es, oder ähnelte sie ihr nur? Die Musikerin war doch in dem Ford Galaxy an mir vorbeigefahren – konnte es wirklich sein, dass sie schon wieder zurückgekehrt war?
Der Leichenwagen fuhr an. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass Don mich beobachtete...
*
„Mobile Einsatzleitung an Zentrale, kommen.“ Nur beiläufig registrierte Milo Tucker, dass der Van stoppte, und sein Motor verstummte.
„Zentrale hört, kommen.“ Clive Caravaggios Stimme aus dem Empfänger.
„Jesse hat sich gemeldet. Folgendes...“
Milo blickte auf den 21-Zoll-Monitor vor sich auf der Konsole, während er die Bitte seines Partners weitergab. Ein Gerät reihte sich dort an das andere – Computer, Bildschirme, Tuner, Sender und so weiter. Der GM-Van war vollgestopft mit Elektronik. Milos Arbeitsplatz seit vier Wochen.
Mit Jay Kronburg und Jennifer Johnson wechselte er sich vor den Geräten ab. Im Acht-Stunden-Rhythmus. Am Steuer der mobilen Einsatzzentrale saßen entweder Ben Brown oder Fred LaRocca. Die beiden schoben Zwölf-Stunden-Schichten.
Auf dem Monitor das Straßennetz von Queens und Brooklyn. Ein blinkender roter Punkt bewegte sich auf der Greenpoint Avenue auf die Interstate 278 zu. Der Rechner empfing den Peilsender aus Jesses Uhr, rechnete sie in seine aktuelle Position um und visualisierte sie auf dem Stadtplan.
„...sie werden gleich die Auffahrt zum Brooklyn Queens Expressway erreichen. Der Weg zum Friedhof ist klar – seht zu, dass ihr die Sache geregelt kriegt, bevor sie das Krematorium erreichen. Kommen, ob verstanden.“
„Verstanden, Ende.“
„Halt! Ich bin noch nicht fertig!“
„Was gibt’s noch, Milo?“ Clives Stimme klang ungeduldig.
„Ich will, dass ein Hubschrauber die Gegend hier abfliegt. Wir brauchen Fotos von der Umgebung dieser Seniorenheims – ein Plan muss her. Ein Plan, auf dem ich jeden Baum, jeden Busch sehen kann. Gib das an den Chef weiter, mit ’nem Gruß von mir. Ende.“
„Mach ich, Milo. Ende.“
Milo lehnte sich zurück und streckte sich. Die Scheibe des Trennfensters wurde aufgezogen, das stoppelbärtige Gesicht Ben Browns erschien. „Neuigkeiten?“ Er trug einen dunkelgrünen Overall mit dem Firmenlogo einer Brooklyner Gebäudereinigungsfirma – Magic-Clean. Die Karosserie des GM-Vans zierte das gleiche Logo.
„Sieht so aus.“ Milo zuckte mit der Schulter. „Jesse scheint die Leiche nicht für koscher zu halten, die sie da zum Friedhof fahren. Er hat eine kleine Sondereinlage angefordert, damit er sie untersuchen kann, bevor sie in Rauch aufgeht.“
„Wird auch Zeit, dass sich was tut“, sagte Ben.
„Wo sind wir?“ Bild blickte sich um und sah zum Seitenfenster hinaus.
„Auf dem Astoria Boulevard.“
„Okay. Wir sollten gleich weiter, aber mein Magen knurrt. Gibt’s hier irgendwo ’n Imbiss?“
Ben sah sich um. „Einen Chinesen. Gleich gegenüber.“
Milo kramte ein einige Münzen aus der Tasche. „Beschaff mir ein paar Frühlingsrollen und eine Kanne Cola, sei so nett.“ Er stand auf und reichte Ben das Geld.
„Kein Problem. Was macht unser zweiter Maulwurf?“
„Noch nichts gehört. Ist erst seit einer Stunde oder so am Einsatzort.“ Milo zog die Tastatur heran. „Wenn du mit den Frühlingsrollen zurückkommst, kann ich dir mehr sagen.“
Ben Browns Gesicht verschwand, die Wagentür schlug zu, Schuhsohlen knallten über Asphalt, Schritte entfernten sich. Milos Finger flogen über die Tasten. Auf dem Monitor baute sich ein neues Bild auf. Er wartete. „Was für ein Aufwand“, seufzte er. „Was für ein unglaublicher Aufwand...“
Elf Agenten arbeiteten seit drei Monaten an dem Fall. Den Chef nicht mitgerechnet, obwohl er keinen der gerade aktuellen Fälle mit der gleichen Dringlichkeit verfolgte wie diesen. Also zwölf Agenten. Zwölf Agenten rund um die Uhr!
Dazu die Büros in London, Paris und Brüssel, vier Beamte von Interpol und sechs Kontaktleute vom New York City Police Department. Dabei gab es nicht einmal eine Leiche. Allerdings ein paar Vermisste. Und sehr konkrete Hinweise aus Brüssel.
Der Stadtplan von Manhattan hatte sich aufgebaut. In der East Side, mitten in einem Gebäudekomplex zwischen York Avenue und East River blinkte ein roter Punkt. Der Standort des zweiten Undercover-Agenten.
Milo tippte die Frequenz seines Mikrosenders in die Tastatur. „Federal Plaza an Einsatzzentrale, kommen“, quäkte Clives elektronisch verzerrte Stimme im gleichen Moment aus dem Empfänger.
„Was ist das für eine bescheuerte Stimmqualität“, schimpfte Milo und drehte an den Knöpfen des Empfängers herum. „Einsatzzentrale hört, kommen.“
„Wir haben eine Mail aus Europa erwischt...“
*
„...um es einmal ganz direkt zu sagen, Schwester Rose – wir sind sehr zufrieden mit Ihnen, wir sind sogar angenehm überrascht.“
Die füllige Frau auf der anderen Seite des Schreibtischs rückte ihre Brille zurecht, neigte den Kopf und lächelte. Ein offenes, etwas verlegenes Lächeln.
„Ich habe gestern mit Mr. O’Neill und dem Chefarzt gesprochen, und selbstverständlich auch mit Dr. Guderian – alle äußerten sich positiv, Schwester Rose. Wir sind mehr als zufrieden mit Ihnen.“
Jetzt entblößte sie ihr tadelloses Gebiss und strahlte die junge Afroamerikanerin an. Rose spürte, wie sehr ihre Chefin es genoss, sie zu loben. Fast fürchtete sie, die dicke Oberschwester könnte aufstehen, um den Schreibtisch herumkommen und sie in den Arm nehmen. Jane Kirschbaum war der Typ Mensch, dem so etwas zuzutrauen wäre.
Rose fühlte sich genötigt irgendwie zu reagieren. „Das freut mich, Mrs. Kirschbaum“, log sie. Sie schlug die Beine übereinander und glättete ihr weißes Kleid über ihren schwarzen Schenkeln. Es war eines dieser etwas knappen Krankenschwester-Schutzkleidchen, das die älteren Stationsschwestern so ungern an ihren jüngeren Untergebenen sahen – tailliert, kurz und mit einem angedeuteten Ausschnitt. Den hielt in Roses Fall allerdings eine Brosche zusammen, ein in Silber gefasster Mondstein.
Die Oberschwester blieb sitzen, beugte sich aber vor und faltete ihre fleischigen Hände über dem Hängeordner, der vor ihr auf dem Schreibtisch lag. „Zufrieden nicht nur in fachlicher Hinsicht übrigens, sondern auch in menschlicher...“
Innerlich verdrehte Rose die Augen. Sie versuchte das Lächeln der Oberschwester zu erwidern. Es fiel ihr schwer.
Sicher – besser durch gute Leistung auffallen, als durch Faulheit und Inkompetenz. Besser durch eine sympathische Art auffallen, als durch eine biestige. Am allerbesten jedoch: Überhaupt nicht auffallen.
Okay – damit war es vorbei. Die Pflegedienstleitung des New York University Medical Centers hatte Rose ins Personalbüro bestellt. Gleich nach dem Beginn der Spätschicht. Zum Feedback-Gespräch. Rose arbeitete seit einem Vierteljahr als Krankenschwester in der Universitätsklinik am East River. Auf der chirurgischen Abteilung.
„...ja, auch in menschlicher Hinsicht, Schwester Rose“, wiederholte Edith Kirschbaum, und ihre glatte, etwas kindliche Miene nahm einen besorgten Ausdruck an. „Wir glauben, dass Sie dem Arbeitsklima auf der chirurgischen Abteilung gut tun. Sie wissen ja, dass diese Abteilung unter einer besonders hohen Fluktuation leidet. Und Frau Dr. Guderian ist sicher keine ganz einfache Vorgesetzte, das ist uns selbstverständlich bewusst...“
‚Keine ganz einfache Vorgesetzte’, war sehr höflich ausgedrückt. Die Guderian war ein Zicke. Rose hatte es gleich am ersten Tag zu spüren bekommen. Die Oberärztin hatte sie zunächst kaum eines Blickes gewürdigt - und sie dann gleich mit zum Verbandswechsel genommen. Unter den Röntgenaugen der Medizinerin hatte Rose an die zwanzig Verbände gewechselt – von der einfachen Gipsbinde, bis hin zur Tamponade eitriger Wunden. Bestanden, bescheinigte ihr eine Kollegin am nächsten Tag.
„...nun – und dass Mr. O’Neill Probleme hat, wird auch für Sie kein Geheimnis mehr sein, Rose...“
Wahrhaftig nicht. Spencer O’Neill, der leitende Pfleger auf der chirurgischen Abteilung hatte das Pech seine Probleme nicht mehr verbergen zu können: Rote Augen, zitternde Finger und Alkoholfahne schon bei Antritt der Frühschicht. Rose schätzte aber, dass sein Techtelmechtel mit der Oberärztin sein größeres Problem war.
„...wir sind der Ansicht, dass er die Leitung der Station...“
Aus Rose’ Kleidertasche orgelte die Melodie von Joshua fit the battle of Jericho. Fast war sie erleichtert. „’tschuldigung, Mrs. Kirschbaum...“ Sie griff in die Tasche und zog ihr Handy heraus. Im Display eine vertraute Nummer – 335-2700. Sie stellte das Gerät aus und versenkte es wieder in der Tasche. Dabei betätigte sie den Fernauslöser für die Mikrokamera.
Die Oberschwester lächelte nachsichtig. Wahrscheinlich hätte sie Rose sogar verziehen, wenn sie sich eine Zigarette in ihrem Büro angezündet hätte.
„Also, was ich sagen wollte...“ Zögernd fuhr sie fort. „...und zwar ganz im Vertrauen sagen wollte – in nicht allzu ferner Zukunft wird die Stelle der Stationsleitung frei werden. Und wenn wir dann an Sie herantreten, Schwester Rose, wäre es gut, Sie hätten sich schon mal ein paar Gedanken gemacht...“
Ach du Scheiße...
„...das muss selbstverständlich unter uns bleiben, Schwester Rose.“ Ein eindringlicher Unterton mischte sich in die Stimme der Oberschwester. „...aber ich wollte Sie vorbereiten. Es kann nämlich von heute auf morgen...“
„Ich bitte Sie, Mrs. Kirschbaum!“ Rose hatte sich wieder gefasst. „Ich habe gestern erst meine Probezeit abgeschlossen...!“
„Drei Monate reichen mir, um mir ein Bild von einer neuen Mitarbeiterin zu machen – glauben Sie mir, Schwester Rose...“
„...Schwester Mary-Lou arbeitet schon seit drei Jahren auf der chirurgischen Abteilung – sie kennt die Station viel besser als ich...“
„Schwester Mary-Lou arbeitet nur halbtags...“
„...und Kevin – er ist nach Spencer der Dienstälteste. Und leitet seit Ewigkeiten eine Schicht...“
„Er scheint uns nicht ganz so geeignet zu sein wie Sie, Rose...“ Die Oberschwester griff in den Hängeordner. Rosalie Warren – Roses Personalakte. „Ich habe mir Ihre Zeugnisse noch einmal angeschaut...“
Sie blätterte in Roses Dokumenten – Fälschungen von eindrucksvoller Professionalität – schmeichelte, lobte, sprach von besserer Bezahlung, von der Schwierigkeit gutes Personal zu finden, von persönlicher Verantwortung für die eigene Karriere, und so weiter, und so weiter.
Nur nicht noch mehr auffallen, dachte Rose. Sie hörte ein Weilchen zu, nickte hier und da, und gab ihren Widerstand schließlich auf. Sie versprach noch einmal in Ruhe über alles nachzudenken.
Später stand sie unter dem Vordach des Hinterausgangs, den man in der Klinik die Dampfecke nannte, weil sich dort die Raucher trafen. Von hier aus gelangte man auf den Klinikparkplatz, und von hier aus sah man auf den Viadukt des Roosevelt Drives.
Rose hatte sich einen Kaffee aus dem Automaten gelassen und eine Zigarette angezündet. Das Gespräch mit der Oberschwester war starker Tobak gewesen. Warum um alles in der Welt musste dieses gutmütige Elefantenbaby ausgerechnet in ihr einen Narren fressen? Sie versuchte zu sondieren, was diese Entwicklung für ihre eigentliche Aufgabe bedeutete.
Ein Stein am Bein, murmelte sie. Das liegt doch auf der Hand, oder? Ich lass mich zur Chefin machen, und alle beneiden und belügen mich. Und ich erfahr nichts mehr, nichts...
Der Anruf fiel ihr ein. Rose stellte den Kaffeebecher neben sich auf den Boden. Es war ausgemacht, dass man sie nur in dringenden Fällen anrief. Sie holte das Handy heraus und hörte ihre Mailbox ab. Die Einsatzzentrale hatte angerufen. „Es wird ernst, Rose – sie haben eine neue Lieferung angefordert.“ Milo Tuckers Stimme. “Meld dich, sobald du kannst und halt die Ohren steif.“
„Na, super...“ Sie ließ das Handy in ihre Kleidertasche rutschen und sah auf die Uhr – viertel nach zwei. Oben auf Station würden sie jetzt gerade den Kaffee verteilen. Noch Zeit für eine zweite Zigarette...
Rose drückte die erste im Standaschenbecher aus, den die Klinikleitung hier hatte aufstellen lassen. Notgedrungen, um die Schweinerei mit den Kippen im Gras und auf dem Weg abzustellen.
Glasklar stand Rose vor Augen, was sie zu tun hatte: Ablehnen. Punkt. Aber vielleicht kam es ja gar nicht so weit. Vielleicht war der Fall ja vom Tisch, bis das Personalbüro Spencer O’Neill endgültig abservieren wollte und ernsthaft an sie herantreten würde.
Rose holte die frische Schachtel Nil aus der Brusttasche, die sie vor Dienstantritt gekauft hatte. Sie rauchte mehr, seit sie den neuen Job angetreten hatte. Fast alle rauchten sie auf der chirurgischen Abteilung.
Eine Polizeisirene schwoll an, auf dem Roosevelt Drive fegte ein Fahrzeug mit Rotlicht Richtung Süden. Die Sirene entfernte sich. Zwischen den Säulen des Viadukts glitzerte die Sonne auf dem Band des East Rivers. Ein Passagierdampfer glitt vorbei. Links, über die Zufahrt von der First Avenue, rollte ein schwarzes Golf-Cabrio. Es bog auf den Parkplatz ein.
Rose zündete sich die Zigarette an. Sie beobachtete den Wagen, während sie sich nach dem Kaffee bückte – er parkte auf den für diensthabende Oberärzte reservierten Plätzen.
Rose kannte das Fahrzeug. Alles, was sie wissen konnte, wusste sie über die Leute, die sie seit drei Monaten beobachtete: Spencer O’Neill soff und war seelisch und körperlich von der Oberärztin abhängig; Mary-Lou Armstrong liebte Kevin Miller und klaute Betäubungsmittel aus dem Giftschrank; Kevin Miller neigte dazu Leichen zu verwechseln und Patienten zu quälen; und Dr. Carol Guderian, die Oberärztin der Chirurgie, fuhr ein schwarzes Golf-Cabriolet und wurde hinter vorgehaltener Hand Ice-Angel genannt – Eis-Engel.
Die Spitze des Eisberges, nur die Spitze – Rose ahnte es.
Eine hochgewachsene Frau stieg aus. Mit raschen Schritten näherte sie sich dem Hintereingang. Die Guderian bewegte sich wie eine Frau, die sich ihrer Attraktivität bewusst war. Enge, weiße Jeans und ein knappes weißes Shirt unter der hellgrünen Samtjacke betonten ihre ausgeprägten weiblichen Formen. Dunkel das kurze Haar und die Gesichtszüge ebenmäßig, fast schön. Fast – der herrische, ein wenig geringschätzige Ausdruck passte nicht in Rose’ Vorstellung von Schönheit.
Wenn Rose dem Geschwätz der Kolleginnen glauben wollte, neigte die Ärztin seit drei Monaten dazu, den Trumpf ihrer Attraktivität auffällig häufig auszuspielen. Seit Rose auf der chirurgischen Abteilung arbeitete und ihr in Sachen Weiblichkeit die Show zu stehlen drohte.
Rose war das gleichgültig. Nicht einmal amüsant fand sie es. Sie schlürfte ihren Kaffee und sog an ihrer Zigarette, während die Ärztin die vier Stufen der breiten Vortreppe hinaufstieg. „Hi!“, grüßte Rose.
Bernsteinfarbene Augen musterten sie unwillig. „Wann geben Sie endlich das Rauchen auf, Rose?“ Carol Guderian rauschte an Rose vorbei und zog die Tür auf. „Ich hab’s nicht gern, wenn meine Leute nach Rauch stinken.“
„Ich werd’ gelegentlich drüber nachdenken, Doc.“
Rose hörte die Schritte der Ärztin aus dem Gang hallen, dann fiel die Tür zu. Sie zog ihr Handy aus der Tasche und wählte die Nummer der Einsatzzentrale. Das Mikrofon in der Uhr zu benutzen erschien ihr zu auffällig. Milo Tucker war in der Leitung. „Was gibt’s, Milo?“
„Orry und Paula haben eine E-Mail aus dem Netz gefischt und entschlüsselt. Irgendjemand in Brüssel fordert drei Nieren und eine Leber an. Blutgruppe B Rhesus-negativ. Kurz nach zwei hat jemand die Nachricht vom Klinik-Server geholt.“
„Okay. Wir hören uns.“ Sie unterbrach die Verbindung. Kurz nach zwei – das hieß also: Jemand von der Spätschicht. Oder jemand, der über eine persönliche Mailbox verfügte und über Handy Zugang zum Server der Universitätsklinik hatte. Ein leitender Arzt also. Das schien Rose am wahrscheinlichsten zu sein.
Sie drückte die Zigarette aus und zog Stift und Notizblock aus der Brusttasche ihres Kleids. Auf die vorletzte Seite des Notizblocks schrieb sie die Blutgruppe – B Rhesus-negativ... Keine allzu häufige Blutgruppe in Nordamerika – das hatte sie in ihrer Kompaktausbildung gelernt.
„Also los, schwarzes Mädchen – in den Kampf mit dir...“ Rose trank den Kaffee aus. “Wird Zeit mal wieder was anderes zu sehen als Weißkittel, Gipsbeine und vernarbte Bäuche.“ Sie betrat das Klinikgebäude.
Männerblicke folgten der langbeinigen, schwarzen Frau, während sie durch die Empfangshalle zu den Aufzügen lief. Blicke von Besuchern, Ärzten, Pflegern. In dieser Beziehung hatte Rose denkbar schlechte Karten für jemanden, der nicht auffallen wollte.
Vor allem die beiden Pförtner hinter ihrer Glaswand bekamen glasige Augen. Sie hatten Wetten abgeschlossen, welchem Arzt es als erstem gelingen würde, die Frau ins Bett zu bekommen, die sie für eine neue Krankenschwester hielten...
*
Auf dem Weg hinunter nach Brooklyn Park Slope sprach Don Reese kein Wort. An sich nichts Ungewöhnliches. Don war für meine Einarbeitung zuständig und so war ich öfter mit unterwegs gewesen in den ersten vier Wochen bei Moreland & King – selten hatte er mehr als vier zusammenhängende Sätze am Stück gesagt. Doch sein Schweigen auf der Rückfahrt von Long Island City hatte etwas Gespanntes.
Der Verkehr auf dem Brooklyn Queens Expressway war nicht besonders dicht an diesem Nachmittag. Don fuhr schnell. Schneller als nötig, fand ich. Die Borduhr zeigte kurz nach halb drei, und die Einäscherung unseres stillen Fahrgastes stand erst für viertel nach drei auf dem Programm des Krematoriums. Es waren noch höchstens fünf Meilen bis zum Greenwood Cemetary. In einer Viertelstunde spätestens würden wir den Friedhof erreichen.
Ich konnte es drehen und wenden, wie ich wollte – es musste mit unserem stummer Fahrgast hinter uns in der Zinkwanne zu tun haben, dass Don es so eilig hatte. Und dass er so unruhig war, auch.
„Warst du schon mal in Hawaii...?“ Don schüttelte den Kopf. „Da musst du unbedingt mal Urlaub machen...“ Ich erzählte von Hawaii, von Stränden, Hotels, Bars, Mädchen – einfach, um ein bisschen Small Talk zu machen, doch Don hörte mir nur mit halbem Ohr zu.
Die Skyline Manhattans schälte sich aus Dunst und flirrender Luft. Für ein paar Minuten lag der East River rechts neben mir. Im Seitenspiegel konnte ich die Brooklyn Bridge sehen. Eine Fähre legte vom Seaport-Ufer ab, eine große Yacht glitt über die Wasseroberfläche Richtung Süden, Helikopter schwebten über den Gipfeln der Wolkenkratzer, und ich erzählte von Hawaii, und plünderte anschließend mein Witzrepertoire aus. Ein paar Mal brachte ich Don wenigstens zum Lächeln.
Kurz nach der Brooklyn Bridge entfernt sich der Brooklyn Queens Expressway vom East River Ufer. Es ging ein Stück Richtung Süden nach Brooklyn hinein und dann auf den Prospect Expressway. Im Seitenspiegel sah ich einen Streifenwagen. Langsam schob er sich an unseren Benz-Kombi heran.
Milos Antwort auf meine Kurznachricht – etwas anderes kam mir gar nicht in den Sinn.
„Was wollen die von uns?“, brummte Don, als der Streifenwagen überholte, und der Cop auf dem Beifahrersitz eine Kelle zum Fenster hinausstreckte. „Bullshit...“ Don schielte auf den Tacho und ging gleichzeitig vom Gas.
Mein Herzschlag beschleunigte sich.
Der Streifenwagen setzte sich vor uns und winkte uns rechts in die 4th Avenue hinein. Don stoppte am Straßenrand hinter einem Lieferwagen. „Was soll das...?“ Er war plötzlich bleicher als sonst, die Anspannung verhärtete seine Miene. Der Streifenwagen fuhr etwa zwanzig Meter weiter in eine Parklücke schräg auf den Bürgersteig.
So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt.
„Wahrscheinlich ist ein Bremslicht im Eimer.“ Ich mimte den Gleichmütigen. „Oder ein Blinker.“ In Gedanken spielte ich meine Möglichkeiten durch – viele hatte ich nicht: Entweder über die Heckklappe in den Laderaum hinein, oder von der Seitentür auf der Beifahrerseite aus den Deckel vom Zinksarg heben und das Gesicht des Toten aufdecken.
Die Cops kamen zu zweit – einer steuerte die Fahrerseite an, der andere die Beifahrerseite. Misstrauische Mienen machten sie, und ihre Bewegungen wirkten lauernd, als würden sie sich einer Zeitbombe nähern. Ich war gespannt auf ihre Story. Beide griffen zu ihren Dienstpistolen – sie entsicherten die Waffen, kein Zweifel. Mir wurde mulmig zumute.
Um Himmels Willen, Kollegen, macht bloß keinen Quatsch...
„Sind die übergeschnappt?“ Don senkte das Seitenfenster auf der Fahrerseite herunter und streckte den Kopf hinaus. „Alles im grünen Bereich, Officer?! Oder was ist los?!“
Ein zweiter Streifenwagen hielt mit quietschenden Bremsen neben unserem Benz. Dons Kopf zuckte zurück ins Wageninnere. Türen wurden aufgestoßen, die Cops sprangen aus dem Auto. Die Angelegenheit nahm langsam pietätlose Formen an.
„Hey!“ Don ließ das Steuer los und hob die Hände in Schulterhöhe. Auf dem Lenkrad glänzte ein feuchter Abdruck. „Dass wir einen Toten transportieren, heißt nicht automatisch, dass wir ihn umgebracht haben...!“ Ein krampfhaftes Lächeln huschte über seine Gesichtszüge, er war jetzt leichenblass.
„Das wollen wir doch hoffen, Mister.“ Einer der Cops zog die Fahrertür auf. „Sorry, ich muss Sie bitten auszusteigen...“
Auch auf meiner Seite erschien ein Uniformierter und zog die Tür auf. „Sie auch.“ Wir stiegen aus und wurden nach Waffen abklopft.
„Lieutenant Berry.“ Der offensichtlich ranghöchste Cop tippte sich an den Mützenschirm. „Tut mir Leid, Sir – in Manhattan drüben ist ’ne Bank überfallen worden. Zeugen haben einen Leichenwagen gesehen. Und Sie sind ziemlich schnell gefahren.“
„So dumm kann man doch nicht sein oder Officer?“ Wieder versuchte Don seine Nervosität mit Heiterkeit zu kaschieren. „Mit einem Leichenwagen zum Banküberfall – was sagst du dazu, Billy?!“ Er grinste zu mir herüber. Es war ein schiefes Grinsen.
Die Cops fanden natürlich keine Waffen – bei Don nicht, weil er keine bei sich trug, bei mir nicht, weil sie die kleine Walther THP in meinem Unterschenkelholster nicht finden wollten. Ihre Haltung und ihre Mienen entspannten sich.
„Papiere, bitte – auch den Totenschein und so weiter“, sagte Lieutenant Berry.
„Wir sind hier am Greenwood Cemetary, Officer...!“ Don kramte Wagenpapier und die Dokumente für den Leichentransport heraus. „Da fährt öfter mal ein Leichenwagen hin – ist Ihnen sicher schon aufgefallen...“ So redselig kannte ich Don Reese noch nicht.
Der Lieutenant studierte die Unterlagen. „Schon okay, Mr. Reese. Kommen Sie bitte mal mit zu unserem Wagen.” Er winkte Don hinter sich her zu dem Steifenwagen, der zwanzig Meter weiter auf dem Bürgersteig stand.
Gut macht ihr eure Sache, Kollegen, dachte ich.
Lieutenant Berry drehte sich um. „Und Sie machen bitte mal den Laderaum auf, Mister.“ Er deutete auf mich. „Die Kollegen wollen einen Blick in den Sarg werfen. Ihr habt doch einen dabei, oder...?“
„Das ist doch lächerlich!“ Don wurde laut. „Ich bitte Sie, Officer!“ Er drehte sich ständig um, während er dem Polizeilieutenant und seinem Partner folgte. „Wir transportieren einen Toten – weiter nichts! Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie in meinem Wagen einen Sarg voller Dollarnoten finden...!“
„Routine, Mr. Reese, reine Routine.“ An seinem Streifenfahrzeug angekommen, verwickelte er Don in ein Gespräch über seine Papiere. Mein Kollege hörte trotzdem nicht auf, sich nach mir umzudrehen.
„Sergeant O’Rourke“, sagte einer der Cops, die mit mir beim Benz geblieben waren. „Öffnen Sie den Wagen, Sir.“
Ich ging zum Heck des Wagens – dort fühlte ich mich am wenigsten beobachtet von Don. „Bitte.“ Ich zog beide Klappen auf.
Die Cops betrachteten erst den Zinksarg und dann mich. „Worauf warten Sie, Sir – ’runter mit dem Deckel.“
Ich kletterte in den Laderaum. „Kompliment, Kollegen.“ Am Kopfende des Sargs schob ich den Deckel beiseite. „Das habt ihr raffiniert eingefädelt...“
Der Sergeant kletterte zu mir in den Wagen. Ich schlug das Zellstofftuch auseinander. Ein junges, kaffeebraunes Gesicht wurde sichtbar. „Jesus...“, entfuhr es mir. Blutkrusten klebten im dicken Haarzopf des Toten.
„Sieht aus wie ein Inder“, murmelte O’Rourke. In beiden Ohren hingen goldene Ringe.
Ich enthüllte den Oberkörper der Leiche. Vom Brustkorb bis hinunter zum Schambein zog sich eine nur grob vernähte Narbe.
Einen Moment zögerte ich. Dass ich ein Mordopfer vor mir hatte, lag auf der Hand. Jetzt zugreifen und Reese und Moreland verhaften lassen? Die Leiche als Beweismittel beschlagnahmen und einen Durchsuchungsbefehl für die Senioren-Residenz beantragen? Und damit natürlich meine Identität preisgeben? Oder die verdeckten Ermittlungen weitertreiben – bis ich sicher sein konnte die Hintermänner des Mordkartells zu kennen...?
Sergeant O’Rourke räusperte sich. „Sie sollten sich beeilen, Sir.“
Ich zog ein Taschentuch aus der Uniformjacke. „Haben Sie einen Cellophanbeutel dabei?“ Der Sergeant nickte. Während er die Brusttasche seines Uniformhemdes öffnete und umständlich eines kleine Plastiktüte herausfischte, tupfte ich die quastige Narbe mit dem Taschentusch ab. Es färbte sich rot – die Wunden waren also frisch.
„Nun macht schon“, raunte der zweite Cop. Er stand auf der Straße vor den offenen Heckklappen und schielte zu Lieutenant Berrys Streifenwagen.
Ich faltete das Tuch zusammen, griff damit ins blutige Haar des Toten und zupfte ihm ein paar Haare aus.
„Was soll das?“ Sergeant O’Rourke runzelte die Stirn.
„Die Leiche wird eingeäschert.“ Ich flüsterte. „Wir brauchen aber gerichtsmedizinisch verwertbare Zellen, wenn wir den Toten nachträglich identifizieren wollen.“
Der Sergeant hielt die Tüte auf, ich stopfte das Tuch hinein. „Haben Sie noch ein Taschentuch?“ Er machte große Augen, griff aber in die Hosentasche und reichte mir ein zweites Tuch. „Lassen Sie sich’s von ihrem Captain bezahlen. Und leiten sie das Material weiter ans Zentrallabor.“
Mit dem frischen Tuch versuchte ich Sekrete aus dem Mund des Toten aufzunehmen. Selbst daraus würden die Pathologen noch Material für eine DNA-Analyse gewinnen. So unsinnig es aussah – eine andere Möglichkeit, den Toten zu identifizieren, sah ich nicht.
„Sie kommen.“ Der Cop am offenen Heck wurde ungeduldig. „Kommt endlich zu Potte!“
Ich holte meine Mikrokamera aus dem Jackett. „Kann sein, Sie werden bald als Zeuge vor Gericht erzählen müssen, was wir hier gesehen haben...“
„Ich bin Polizist, Sir.“ Sergeant O’Rourke verzog keine Miene.
Ich schoss vier oder fünf Bilder von dem armen Kerl im Zinksarg...
*
Endlos schier der breite Gang der chirurgischen Station, und schnurgerade. Weißgekleidete Gestalten huschten hin und her, gedämpfte Stimmen, Geklapper von Gläsern, Schritte.
Männer und Frauen in Morgenmänteln pilgerten an den Wänden entlang – vorsichtig tastend, als hätten sie Angst auf Glasscherben zu treten – und zwei alte Leute, die Rose auf die Entfernung weder als Männer noch als Frauen identifizieren konnte, schoben sich auf Gehwagen gestützt durch die Zimmerflucht. Einer der beiden Gebrechlichen hatte nur noch ein Bein. Ein Krankengymnast begleitete ihn.
Rose ließ die Milchglastür los. Hinter ihr pendelte sie hin und her, während Rose das Stationszimmer ansteuerte. Auf Höhe der beiden Arztzimmer blieb sie stehen. Laute Stimmen hinter der Tür des Oberarztzimmers. Daneben eine Trage mit frischgewaschenen Mullbinden. Rose stellte sich vor die Trage und begann das Verbandsmaterial zu glätten und aufzuwickeln. Sie lauschte.
Eine Frauen- und eine Männerstimme. Sie stritten. Rose verstand nur einzelne Worte, hier und da einen Satzfetzen.
„Verträge... wir sind gebunden... unsere Partner steigen aus, wenn...“ Die Frauenstimme war besser zu verstehen.
„Lieferschwierigkeiten... und gleich zwei... Blutgruppe... selten...“ Die Männerstimme nuschelte und klang sehr erregt.
„So weich plötzlich...? Auf einmal...?“, zischte die Frauenstimme. „Denk an das Geld...“
Es waren eindeutig die Stimmen von Spencer O’Neill und Carol Guderian. Dass die beiden mehr als nur zwangsläufige Kontakte verband, die ein gemeinsamer Arbeitsplatz nun mal mit sich brachte, hatte Rose schon nach den ersten zwei Wochen herausgefunden. Und Menschen, die miteinander intim waren, stritten nun mal hin und wieder. Aber hier ging es nicht um einen normalen Beziehungsclinch – Rose’ Instinkt sagte ihr, dass der Streit im Oberarztzimmer mit der Mail zu tun haben musste, die Orry und Paula erwischt hatten.
Ein akustisches Signal ertönte – wie der Alarmruf auf einem Kriegsschiff. Ein Schwesternruf blinkte, drei Zimmer entfernt von Rose. Sie versuchte das Geräusch zu ignorieren.
„Aussteigen..., wahnsinnig..., ich geh kaputt...!“ O’Neills Stimme klang weinerlich plötzlich.
„...mir zuliebe...“ Die Stimme der Ärztin wurde weicher, schmeichelnder. „...dieses eine Mal noch...“
Die Stationstür öffnete sich, jemand schob einen Wäschewagen herein. Der Aluminiumkasten rasselte hinter Rose vorbei. Kein Wort aus dem Arztzimmer war mehr zu verstehen.
Dafür bohrte sich das akustische Signal des Schwesternrufes um so nervtötender in Rose’ Bewusstsein. Sie ließ die Mullbinden auf die Trage fallen und lief zu dem Zimmer, über dessen Tür das Licht blinkte.
Bevor sie eintrat, zog sie ihren Notizblock heraus. Auf der vorletzten Seite notierte sie die Stichworte, die sie gehört hatte. Danach betrat sie das Zimmer und stellte den Schwesternruf ab.
„Was kann ich für Sie tun, Lilian?“
Eine junge Frau lag im einem der beiden Betten des Zimmers – abgemagert, rote Locken, Sommersprossen, große, dunkelblaue Augen. Lilian Newman, neunzehn Jahre alt, fast noch ein Mädchen. Das zweite Bett war leer.
„Es ist schon nach drei.“ Ein vorwurfsvoller Blick traf Rose. „Um viertel vor drei wollte Dr. Guderian mit mir sprechen.“
„Nun ja, Lilian – Sie wissen doch, wie es den Ärzten geht: Eine Operation dauert länger als geplant, Schwerverletzte werden überraschend eingeliefert, irgendjemand hat plötzlich Schmerzen.“ Rose fiel es nicht schwer zu lügen. Sie dachte an die frostige Begegnung mit der Oberärztin unten bei der Dampfecke. „Klinik-Alltag eben.“ Rose zuckte mit den Schultern.
„Und wenn sie mich nun vergessen hat?“
„Glaub ich nicht – um was geht es denn, Lilian?“
„Um meine Entlassung. Ich soll doch in eine Rehabilitationsklinik nach Connecticut verlegt werden...“
Rose zog die Brauen hoch. „Ich hab davon gehört. Aber schon so bald?“ Lilian Newman war vor sechs Wochen nach einem schweren Autounfall eingeliefert worden – Rippenbrüche und schwere Schädelfraktur. Ihr Freund war bei dem Unfall ums Leben gekommen.
Seit die Studentin aus dem Koma erwacht war, litt sie unter Wortfindungs- und Gedächtnisstörungen. Rose wusste, dass die Chirurgen einen Neurologen hinzugezogen hatten und über eine Verlegung in eine neurologische Spezialklinik diskutierten. Der Neurologe sah darin die einzige Chance für Lilian, irgendwann einmal ihr Studium wieder aufnehmen zu können.
„Ich hoffe – ich will doch im Herbst wieder an die Uni.“
„Dr. Guderian ist auf der Station“, sagte Rose. „Sie wird sicher gleich kommen.“
„Könnten Sie ihr Bescheid sagen, dass ich auf sie warte, Rose? Ich will sie fragen, ob ich nicht in eine Rehaklinik zu Hause verlegt werden kann.“
Zu Hause – das hieß für Lilian Newman: Süd Afrika.
„Okay...“ Rose verließ das Zimmer.
Die junge Frau tat ihr Leid – kam Anfang des Jahres von der anderen Seite des Globus zum Studium in die Vereinigten Staaten und verunglückte wenige Wochen später so schwer, dass ihre geistigen Fähigkeit vielleicht für immer eingeschränkt bleiben würden. Und als wenn das des Unglücks nicht genug wäre, verlor sie auch noch den einzigen Menschen, mit dem sie in New York City vertraut war.
Kein Wunder, fühlte sie sich auf der chirurgischen Abteilung des New York University Medical Center geborgen, kein Wunder, wollte sie zurück nach Süd-Afrika.
Das Leben kann verdammt hart sein, dachte Rose. Im Arztzimmer wurde noch immer gestritten. Wenn auch nicht mehr so laut. Rose klopfte und öffnete die Tür ohne auf ein ‚Herein’ zu warten. „Miss Newman wartet auf Sie, Dr. Guderian.“
Sie erntete ein Stirnrunzeln und ein knappes Nicken. Zurück im Zimmer begann sie Lilians Bett zu machen – Teil der Nachmittagsroutine. „Dr. Guderian kommt sofort.“
Zu ihrer eigenen Überraschung geschah das tatsächlich – ohne, dass jemand zuvor geklopft hätte, öffnete sich die Tür und die Oberärztin trat ein. Gefolgt vom leitenden Pfleger, Spencer O’Neill.
„Tut mir Leid, Miss Newman – das OP-Programm hat sich mal wieder bis in den Nachmittag hineingezogen.“ Carol Guderian lächelte zuckersüß und drückte dem Mädchen die Hand. „Lässt sich vorher nie so genau abschätzen, aber dafür hab ich gute Nachrichten für Sie...“
Rose zog sich von Lilians Bett zurück. Ihr Blick traf sich kurz mit dem des Pflegers. Dunkle Ringe lagen unter seinen braunen Augen, und die Skleren waren rot statt weiß. Spencer O’Neill war ein mittelgroßer, kräftig gebauter Enddreißiger. Dünne, brünette Löckchen rahmten seinen breiten Schädel ein, und zwischen seiner großen Nase und den wulstigen Lippen wirkte sein Schnauzer irgendwie zerfleddert und fehl am Platz.
O’Neill war blass, aber das wollte nichts heißen – seine Haut wirkte immer ein wenig ungesund. Doch heute kam seine versteinerte Miene dazu. Als hätte man ihm gerade gekündigt. Aber Rose wusste ja Bescheid – der Streit mit der Oberärztin.
„Wir haben einen Platz für Sie“, flötete Carol Guderian. „In einer schönen Rehaklinik in Groton, Connecticut – das liegt direkt an der Küste. In zwei oder drei Tagen können wir Sie verlegen. Ich muss nur noch ein paar Einzelheiten klären...“
Rose beschäftigte sich mit dem zweiten Bett im Zimmer. Lilians Nachbarin war heute entlassen worden. Bett und Nachttisch mussten zur Reinigung in die Bettenzentrale geschickt werden. Sie ließ sich Zeit.