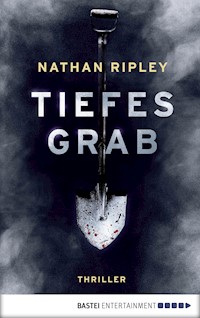
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Familienvater Martin Reese pflegt ein ungewöhnliches Hobby. Er spürt die lang verschollenen Opfer von Serienkillern auf, gräbt ihre Überreste aus und meldet seinen Fund dann anonym der Polizei. Martin selbst sieht sich als aufrechter Kämpfer für die Gerechtigkeit, fast schon als Held. Bis er bei seinem nächsten Streifzug eine schockierende Entdeckung macht: Offenbar ist jemand bestens informiert über ihn und sein kleines Hobby. Martin muss erkennen, wie gefährlich es ist, einem Serienkiller ins Handwerk zu pfuschen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumPROLOG1. KAPITEL2. KAPITEL3. KAPITEL4. KAPITEL5. KAPITEL6. KAPITEL7. KAPITEL8. KAPITEL9. KAPITEL10. KAPITEL11. KAPITEL12. KAPITEL13. KAPITEL14. KAPITEL15. KAPITEL16. KAPITEL17. KAPITEL18. KAPITEL19. KAPITEL20. KAPITEL21. KAPITEL22. KAPITEL23. KAPITEL24. KAPITEL25. KAPITEL26. KAPITEL27. KAPITEL28. KAPITEL29. KAPITEL30. KAPITEL31. KAPITEL32. KAPITEL33. KAPITEL34. KAPITEL35. KAPITEL36. KAPITEL37. KAPITEL38. KAPITEL39. KAPITEL40. KAPITEL41. KAPITEL42. KAPITEL43. KAPITEL44. KAPITEL45. KAPITEL46. KAPITEL47. KAPITEL48. KAPITEL49. KAPITEL50. KAPITELÜber dieses Buch
Familienvater Martin Reese pflegt ein ungewöhnliches Hobby. Er spürt die lang verschollenen Opfer von Serienkillern auf, gräbt ihre Überreste aus und meldet seinen Fund dann anonym der Polizei. Martin selbst sieht sich als aufrechter Kämpfer für die Gerechtigkeit, fast schon als Held. Bis er bei seinem nächsten Streifzug eine schockierende Entdeckung macht: Offenbar ist jemand bestens informiert über ihn und sein kleines Hobby. Martin muss erkennen, wie gefährlich es ist, einem Serienkiller ins Handwerk zu pfuschen …
Über den Autor
Nathan Ripley ist preisgekrönter Journalist, Literaturkritiker und Sachbuchautor. Er lebt und arbeitet in Toronto. Tiefes Grab ist sein Thriller-Debüt.
N A T H A N R I P L E Y
T I E F E SG R A B
Jeder Held hat eine dunkle Seite,man muss nur tief genug graben
T H R I L L E R
Aus dem kanadischen Englisch vonStefan Hohner
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by Naben Ruthnum
Titel der Originalausgabe: »Find You In The Dark«
Originalverlag: Simon & Schuster Canada
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Steffi Korda, Hamburg
Titelillustration: © Design by Jessica Horrocks; © Arcangel/Henry Steadman; © iStockphoto/POMACHKA/FelixRenaud/Gun2becontinued/undrey
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-7225-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
P R O L O G
Bella Greene verließ sein Apartment. Ihr Entschluss stand fest: Sie würde nicht zurückkehren. Er ahnte davon nichts. Auf die Idee, dass er in Wahrheit gar keine Macht über sie besaß, wäre er nie gekommen. Wieso auch? Sie hatte seine Demütigungen und Qualen ja die ganze Zeit brav ertragen. Aber damit war jetzt Schluss.
Als sie unten in der Lobby des Apartmentblocks angekommen war, marschierte sie an dem Portier vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Der ekelhafte Kerl mit seinem Stalin-Schnurrbart voller Zigarillokrümel hatte sie jedes Mal anzüglich angestarrt, wenn sie allein aufgetaucht war. Einmal hatte er sogar »Wie viel?« gefragt. Daraufhin hatte sie auf seinen Empfangstresen gespuckt – einen schönen dicken Schleimklecks, mitten auf die Marmoroberfläche.
Aber der Typ hatte nur gelacht und den Schleim weggewischt. »Nur zu«, hatte er gesagt. »Geh hoch und erzähl ihm, was passiert ist. Mal sehen, ob er dir glaubt.« Die Mühe hatte sich Bella gar nicht erst gemacht.
Sie öffnete die Tür und trat nach draußen. Vor dem Apartmentgebäude befand sich ein leerer Springbrunnen. Das Wasser war irgendwann gegen Ende des Sommers abgeschaltet worden. Bella ging langsam an dem ausgetrockneten Becken vorbei, dann begann sie, schneller zu laufen. Als sie neun Jahre alt gewesen war, hatte ihre Mutter sie mal dabei erwischt, wie sie Silbermünzen aus einem Springbrunnen geangelt hatte. Zur Strafe hatte Bella einen Schlag auf den Arm bekommen, was nicht nur all die anderen Mütter mitbekommen hatten, sondern auch Marianne, ihre beste Freundin. Allerdings hatte Marianne sie am Ende der fünften Klasse dann sowieso verraten, um sich bei Kelly Robinson beliebt zu machen, einem Mädchen, dessen Eltern Kabelfernsehen hatten.
Inzwischen war es nach Mitternacht. Hier in der Gegend waren kaum noch Leute zu Fuß unterwegs. Aber jetzt bemerkte Bella einen Mann mit einem leicht gekrümmten Rücken, der gerade aus einem weiteren Apartmentblock trat. Der Mann lächelte ihr zu, wobei sein Lächeln nicht einfach nur höflich war. Eher erwartungsvoll. Als ob er davon ausging, dass sie ihm gleich etwas anbieten würde.
»Nein«, nahm sie die Antwort vorweg und ging an ihm vorbei.
Genau das war ihr Problem: Die Typen nahmen sich von ihr, was sie wollten. Sie dagegen hatte es nie so richtig hinbekommen, sich etwas zurückzuholen. Etwas, das einen wirklichen Wert hatte. Am Anfang hatte sie es toll gefunden, Drinks spendiert zu bekommen. Irgendwann auch Drogen. Aber nach einiger Zeit war ihr klar geworden, dass man für alles im Leben bezahlen musste. Ganz besonders für die Drogen.
Der bucklige Kerl schien ihr zu folgen. Sie war in der Zwischenzeit einen halben Straßenblock weiter gegangen, aber noch immer befand sich jemand hinter ihr. Okay, vielleicht wollte er nur zu seinem Auto, das hier irgendwo parkte. Doch da war dieser gierige Blick, der an ihrem Rücken klebte. Sie wusste, dass es so war. Für so etwas hatte sie ein Gespür. Und bei dem Spinner im Apartment hatte sie dieses Gespür zum ersten Mal im Leben sinnvoll eingesetzt. Genau wie alle anderen hatte er natürlich etwas von ihr gewollt: bizarre Sexspielchen, die mit der Zeit immer abgedrehter wurden. Aber sie hatte nur so getan, als würde sie seine armseligen Fantasien derart extrem finden. Sie hatte sich gefügt und zu allem Ja gesagt – aber nur solange es ihren eigenen Zwecken diente. Auf diese Weise hatte sie einen Unterschlupf gefunden. Außerdem hatte sie einen Dummen gehabt, mit dem sie ab und zu mal reden konnte, während sie sich von ihrem alten Leben befreite: von den Leuten und dem Würgegriff des Heroins, irgendwann auch vom Methadon und zum Schluss sogar vom Alkohol. In den letzten drei Wochen hatte sie nichts anderes getrunken als Orange-Pekoe-Tee. Ja, sie hatte es geschafft, all den Mist loszuwerden. Nicht nur die Drogen, sondern die ganze verkorkste Art zu leben. Am Ende der Woche würde sie in San Diego sein, raus hier aus Seattle. Und dann würde sie ihre Mutter einladen. Ein netter, normaler Besuch, ohne den ganzen Blödsinn. Kein Klauen mehr. Keine Lügen.
Bella griff nach ihrem Handgelenk und ließ das Silberarmband mit den ziselierten Blättern durch die Finger gleiten. Sie hatte immer noch das Gefühl, angestarrt zu werden. Allerdings schien das Starren jetzt von rechts zu kommen. Sie drehte den Kopf und bemerkte eine Seitengasse, in der ein großer Wagen stand. Ein Pick-up oder etwas in der Art. Bei dieser spärlichen Beleuchtung war das nicht so leicht zu erkennen. Ein Mann lehnte an der Kühlerhaube.
»Starr du nur«, rief sie ihm zu und ging weiter, bevor sie abrupt stehen blieb und sich noch mal zu dem Typen umdrehte.
Er hatte den Oberkörper zurückgelehnt, sodass sein Gesicht nicht vom Schein der Lampe erfasst wurde. Bella hörte, wie er leise lachte.
Sie marschierte auf die Gasse zu. »Macht dich das scharf, Frauen Angst einzujagen? Gehörst du zu der Sorte von Idioten?« Sie ging noch ein paar Schritte näher.
Er war groß und stämmig, mit einem ungewöhnlich breiten Brustkorb. Sein Gesicht konnte sie immer noch nicht erkennen. Und was Bella nicht erwartet hatte, war, dass er so unglaublich schnell sein würde. Das waren Männer von dieser Größe eigentlich nie.
Er packte sie mit einer Hand an der Schulter, während die andere Hand zu ihrer Kehle schnellte. Bella spürte einen stechenden Schmerz am Hals. Das Gefühl entsprach nicht dem Faustschlag, den sie erwartet hatte. Es glich eher einem Insektenstich, nur ging es tiefer unter die Haut. Dann folgten das Druckgefühl und das Brennen, als die Flüssigkeit in sie hineingepresst wurde. Gleich darauf verspürte sie fast so etwas wie inneren Frieden. Diese Vene, dachte Bella benommen, hatte sie noch nie ausprobiert.
Sie sackte zusammen. Aber bevor sie den Boden erreichte, fing der Mann sie auf und trug sie nach hinten. Hinein in die Dunkelheit.
1. K A P I T E L
Diesmal dauerte es länger, die Grabungsstelle zu säubern. Zum Schlafen blieb mir daher nur wenig Zeit. Ich legte mich in meinem Zelt noch mal zwei Stunden aufs Ohr, bevor ich pünktlich um vier Uhr früh auf den Highway nach Seattle einbog – ausgerüstet mit einer Thermoskanne Kaffee und einigen dieser legalen Energydrinks, die bei Truckern so beliebt sind.
Vierzehn Stunden später befand ich mich kurz vor meinem Ziel. Wäre es nach mir gegangen, hätte ich die Sporthalle schon fünfzig Minuten früher erreicht. Nur schien es dem Verkehr in Seattle nicht ganz so wichtig zu sein wie mir, dass meine Tochter rechtzeitig vom Schwimmtraining abgeholt wurde. Ich überprüfte im Rückspiegel noch mal, dass ich die Ausrüstung richtig verstaut hatte. Ja, nichts zu sehen außer den Campingsachen. Der ganze Rest war abgedeckt, kein Teil schaute irgendwo hervor. Den Laptop hatte ich wohlweislich unter die Rückbank gelegt statt darauf. Denn dorthin würde Kylie gleich ihre Sporttasche pfeffern. Ich ließ meinen Blick über die Sitze gleiten auf der Suche nach irgendwelchen Spuren, die ich vielleicht übersehen hatte – Erde oder schlimmere Dinge. Dank dieses Manövers hätte ich fast den alten Camry übersehen, der unerlaubterweise meine Fahrbahn kreuzte. Ich tippte die Bremse an, um sie dann komplett durchzutreten. Verständlicherweise versetzte das die Fahrer hinter mir ein wenig in Aufregung. Wildes Gehupe ertönte. Ich fuhr weiter, um schließlich am Bordstein direkt vor der Sporthalle zu halten.
»Du bist zu spät«, verkündete Kylie, nachdem sie die Tür geöffnet hatte. Sie ließ sich auf den Beifahrersitz fallen und schleuderte mit geübtem Schwung die Sporttasche über die Schulter nach hinten. Prompt erwischte mich der Riemen der Tasche am Auge. Blinzelnd beobachtete ich, wie Kylie ihrer Freundin Danielle zuwinkte, wobei ich aus der Entfernung nicht ganz sicher war, ob es sich wirklich um Danielle handelte. Ebenso gut konnte das Ramona oder ein anderes Mitglied des Schwimmteams sein. Wenn sie vom Training kamen, sahen diese vierzehnjährigen Mädchen alle beunruhigend ähnlich aus mit ihren hochgeschlagenen Jackenkragen und den feuchten Haaren, die sie unter den Mützen verborgen hatten.
Kylie ließ ihre Schultasche in den Fußraum plumpsen. Dann drehte sie sich zu mir und musterte mich kritisch.
Natürlich grenzte es an Wahnsinn, meine Tochter die halbe Woche um fünf Uhr früh zum Seattle Athletic Club zu kutschieren und sie die andere Hälfte um siebzehn Uhr abzuholen. Väterlicher Ehrgeiz hätte mich nie dazu bewegen können, das zu tun. Liebe vermutlich auch nicht – jedenfalls nicht die Art von Liebe, die ich für Ellen, meine Frau, empfand. Aber für Kylie tat ich es. Eine Tatsache, die mich manchmal selbst erstaunte. In den letzten zwei Jahren war ich nur acht Mal zu spät gekommen. Heute war das neunte Mal.
Meine Tochter hatte die schmale Nase und den großzügig geschwungenen Mund ihrer Mutter geerbt. Von mir hatte sie die dunklen Brauen und diese hellblauen Augen. Wenn Kylie mich, wie jetzt, leicht kritisch anstarrte, wirkte es dank der zweifachen Ähnlichkeit, als würde ich auf eine Strafpredigt meiner Frau zusteuern, während ich gleichzeitig mein eigenes enttäuschtes Gesicht im Spiegel betrachtete.
»Fahr los, Dad. Bevor noch jemand zu uns rüberkommt und dich genauer ansieht. Quietschende Reifen und so, wenn du verstehst.«
Ich fuhr in normalem Tempo los, auch wenn die Botschaft angekommen war. »Tut mir leid. Ich komme direkt vom Zelten. Natürlich hätte ich an einer Raststätte angehalten und mich gewaschen, wenn ich geahnt hätte, dass dir das derart peinlich ist.«
»Wo warst du noch mal?«
»In der Nähe von Tacoma. Wirklich schön dort.« Was der Wahrheit entsprach – zumindest der halben Wahrheit. Ich hatte tatsächlich auf einem Campingplatz in Kent nahe Tacoma die Anmeldung ausgefüllt, alle Gebühren bezahlt und ein kleineres Zelt aufgebaut. Erst danach war ich weiter nach Kalifornien gefahren. Das machte ich immer so, wenn ich auf eine Grabung ging. Falls Ellen oder jemand anderes nachfragen sollte, konnte ich auf diese Weise sofort die nötigen Belege hervorziehen.
Sobald ich den offiziellen Teil erledigt hatte, folgte der inoffizielle. Ab diesem Punkt zahlte ich nur noch in bar. Außerdem ›vergaß‹ ich normalerweise mein Handyladegerät. Das bewirkte, dass der GPS-Tracker, den wir alle ständig mit uns herumtragen, zeitgleich mit der Batterie schwächer wurde und schließlich ganz ausging. In anderen Fällen, wenn ich wusste, dass Ellen anrufen würde, setzte ich alles außer Gefecht, wodurch sich mein Standort ausfindig machen ließ. Nach zwanzig Jahren als Chef eines High-Tech-Unternehmens besaß ich – zusätzlich zu dem Haufen Geld auf meinem Konto – gewisse Fähigkeiten.
»Du bist zu spät gekommen, und du stinkst«, erklärte Kylie schließlich.
»Du stinkst auch.«
»Chlor stinkt nicht. Das ist nur ein Geruch.«
»Tja. Und ich verströme den Geruch nach Pinien, frischer Luft und dem Zauber des Outdoor-Lebens. Ist doch besser, als nach Zeug zu stinken, mit dem sie die Pisse im Wasser neutralisieren.«
»Du riechst wie ein ungewaschener alter Mann, Dad.« Seit wir losgefahren waren, hielt meine Tochter den Blick fest auf ihr Handy gerichtet. Ich dagegen sah nach vorn und konzentrierte mich auf den Verkehr. Aber an Kylies Stimme konnte ich erkennen, dass sie nur mühsam ein Lachen unterdrückte. Was mir ebenso ging. Seit etwa einem Jahr fochten wir dieses kleine Wortduell aus – ein munterer Austausch von Beleidigungen, die keiner von uns ernst meinte. Heute war jedoch das erste Mal, dass ich Kylie direkt nach einer Grabung abholte. Daher war es neu für mich mitzuerleben, wie die beiden wichtigsten Bereiche meines Lebens nahtlos ineinander übergingen. Denn neben der Erschaffung von Kylie – an der ich zugegebenermaßen einen ziemlich kleinen Anteil gehabt hatte – waren die Grabungen das Beste und Sinnvollste, was ich je getan hatte.
Als wir kurz vor unserem Haus waren, fragte ich Kylie etwas, das ich schon längst hätte fragen sollen, am besten direkt, als sie ins Auto gestiegen war. Dann hätte ich nämlich Zeit gehabt, mich vorzubereiten.
»Wie geht es Mom? Seid ihr gut klargekommen, während ich weg war?«
»Nö«, nuschelte Kylie und steckte sich das vierte Bio-Kaugummi in den Mund. Obwohl die Dinger nach nichts schmecken, kauft Ellen sie massenweise, um Zucker und Aspartam aus dem familiären Blutkreislauf fernzuhalten.
»Oh«, erwiderte ich.
Im gleichen Moment entdeckte ich Ellens Wagen, einen VW, der sich unserem Haus aus der entgegengesetzten Richtung näherte. Die untergehende Sonne sandte orangefarbene Strahlen durch das Rückfenster und verwandelte den Kopf meiner Frau in einen schwarzbraunen Schattenriss. Ich bremste und ließ den VW zuerst in die Garage fahren, bevor ich auch in die Auffahrt einbog.
Ellen wartete auf uns. Sie stand auf der kleinen Treppe, die von der Garage direkt ins Haus führte, und hielt in beiden Händen eine prall gefüllte Einkaufstüte. Den Riemen ihrer Handtasche hatte sie zwischen die Zähne geklemmt. Ich stieg schnell aus dem Jeep, während Kylie sich in der Kunst übte, möglichst lange für das Einsammeln ihrer Sachen zu brauchen. Als ich die beiden Stufen hochhoppelte, bemerkte ich, wie steif meine Arme und Beine waren. Kein Wunder, schließlich hatte ich die ganze Nacht gegraben und dann stundenlang hinter dem Steuer gesessen. Ich nahm Ellen ihre Tüten ab. Sie lächelte mir zu und griff nach dem Schlüssel für die Haustür.
»Hey«, sagte ich. »Laut unserer Tochter muss ich mit einer spannungsgeladenen Woche rechnen.« Ich sprach leise, obwohl Kylie noch immer im Auto saß. Vermutlich plante sie, dort zu bleiben, bis Ellen und ich in der Küche waren, um dann wortlos im oberen Stockwerk zu verschwinden.
»Oh«, erwiderte Ellen. »Mir war gar nicht klar, dass es hier um dich geht, Martin. Tut mir leid. Du Armer, du musst ganz schön unter uns leiden.« Noch während sie mich zurechtwies, begann meine Frau zu lächeln. Dann trat sie auf mich zu und küsste mich.
Ellen hielt die Rolle der genervten Mutter und Ehefrau nie lange durch. Dabei hätte sie eigentlich genug Übung darin haben sollen, denn inzwischen war es achtzehn Jahre her, dass sie aufgehört hatte, meine Freundin zu sein, und meine Frau geworden war.
»Du stinkst übrigens«, setzte sie hinzu.
»Das hat unsere Tochter auch gesagt.«
»Apropos unsere Tochter: Kylie und ich hatten am Samstag einen kleinen Streit. Eigentlich hätte es nur eine kurze Diskussion sein sollen. Aber wir waren beide müde, und dann ist das Ganze ausgeufert. Sie wollte mit Jhoti essen gehen und danach bei ihr zu Hause übernachten. Die Verabredung zum Essen hatte ich schon genehmigt. Aber das mit dem Übernachten war eine spontane Idee. Also habe ich Nein gesagt.«
»Im Sinne von: ausgeschlossen?« Wir betraten die Küche, und ich stellte die Tüten auf dem Tresen ab. Als ich die klebrigen Milchglasringe und die Tomatensoße-Spritzer auf der Arbeitsfläche bemerkte, begann ich, die Einkäufe einzeln rauszuziehen, um sie direkt in die Schränke zu stellen. Die Sauberkeit, speziell in der Küche, ließ häufig nach, wenn ich für einige Tage im Wald verschwand.
Als ich aufsah, bemerkte ich, dass Ellen mich beobachtete. Also änderte ich rasch meine Vorgehensweise und leerte die Tüten aus, damit wir die Einkäufe sortieren konnten. Ich war gut darin vorzutäuschen, dass mir gewisse Dinge gar nichts ausmachten.
»Wenn Kylie lange ausgehen oder bei anderen Leuten übernachten will, sage ich grundsätzlich Nein. Du kennst die Gründe dafür, Mart. Und das tut Kylie auch.«
»Mhm.« Ich griff nach einer Tüte Pflaumen und bohrte mit dem Daumen ein Loch hinein. Dabei entdeckte ich etwas Dreck unter dem Fingernagel. Offenbar hatte ich beim Verstauen der Geräte nicht richtig aufgepasst. Während der eigentlichen Grabung trug ich immer Handschuhe und die entsprechende Schutzkleidung, sodass keine meiner Körperzellen auf dem Fund landen konnte. Die Pflaumen purzelten in die Holzschüssel, die auf dem Tresen stand. Dabei begruben sie eine verschrumpelte Limette unter sich. »Aber ich denke, wir werden trotzdem noch mal darüber sprechen müssen. Und zwar bald. Kylie wird fünfzehn in … fünf Wochen, stimmt’s?« Bevor Ellen die Chance bekam, etwas zu erwidern, fuhr ich schnell fort: »Es war natürlich richtig, darauf zu bestehen, dass Kylie sich an eure Vereinbarung hält – das ist ja klar. Nichtsdestotrotz sollten wir uns überlegen, wie eine etwas flexiblere Regelung aussehen könnte, wenn Kylie abends weggehen will. Sie ist kein Kind mehr.«
»Ich habe mir weniger Sorgen gemacht, als sie noch ein Kind war«, entgegnete Ellen. Eine typische Eltern-Aussage, allerdings hätten die meisten Eltern dabei wohl leicht schief gelächelt. Ellen dagegen tat das nicht. Meist gelang es meiner Frau, ihre Angst zu verbergen, aber letztlich verschwand die Panik nie. Und sobald Kylie außer Sichtweite war, wurde diese Angst so stark, dass sie fast mit Händen zu greifen war.
Ellen hatte sich umgedreht und räumte jetzt die Einkäufe in den Kühlschrank ein. Sie trug noch immer die Regenjacke, die ihren Oberkörper in einen zerknitterten Zylinder verwandelte. Darunter verbargen sich, wie ich wusste, Business-Kleidung und ein sehr durchtrainierter Körper. Ellen hatte nach Kylies Geburt hart gekämpft, um schnell zu ihrer alten Form zurückzufinden. Ich dagegen hatte keine figurbedrohende Geburt mitgemacht, war jedoch der stolze – oder zumindest schambefreite – Besitzer eines hübschen Bauchs, dem ich jeden Abend sein Fläschchen gab. Pils, vorzugsweise.
Als ich hörte, wie Kylie ins Haus kam, nutzte ich meine Chance zu verschwinden. »Ich weiß nicht, ob das so stimmt, Ellen. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Bin gleich zurück. Ich gehe nur mal kurz den Jeep auspacken«, sagte ich. »Ihr beide seid nett zueinander, bis ich zurück bin. Dann können wir uns alle zusammen bekriegen, okay?«
Die Campingsachen verstaute ich an verschiedenen Stellen in der Garage. Wenn ich von einer Grabung wiederkam, war mein Gepäck immer um einiges leichter als auf dem Hinweg. Was daran lag, dass ich während der Rückfahrt Schaufeln, Hacken, den Metalldetektor und die Sonden in verschiedenen Müllcontainern entsorgte. Bevor ich das tat, rieb ich das Werkzeug mit Bleiche und anderen Ätzmitteln so lange ab, bis die äußere Schicht sich zersetzt hatte und sämtliche genetischen Spuren verschwunden waren. Umgekehrt kamen die Campingsachen und alles, was ich später mit nach Hause bringen würde, niemals in die Nähe der Grabung. Ich war bei der Arbeit immer höchst konzentriert. Aber manchmal passierte es doch, dass ich in einen Rausch geriet, wenn ich recht behielt und genau das fand, wonach ich gesucht hatte. Solche Rauschzustände waren gefährlich. Daher hatte ich mir gewisse Regeln ausgedacht, die ich strikt einhielt: Mein Zelt musste mindestens drei Meilen entfernt von der Grabung errichtet werden. Ich grub vom frühen Nachmittag bis zum Einsetzen der Dämmerung. Sobald ich mich meinem Ziel näherte, verlangsamte ich den Rhythmus, bis ich schließlich nur noch mit Bürsten statt mit der Schaufel arbeitete. Bisher hatte ich noch nie etwas zerstört, und darauf war ich stolz. Es war ein Zeichen von Respekt.
In der Garage herrschte eine friedvolle Atmosphäre. Es war hier so still wie bei der Grabung am Tag zuvor, als nur das silberhelle Chop-chop-Geräusch meiner Schaufel zu hören gewesen war. Stück für Stück hatte ich die Erde über den Knochen abgetragen – Knochen, von denen ich genau gewusst hatte, dass ich sie finden würde. Während ich jetzt das Auto ausräumte, legte ich mir im Kopf ein paar Worte für den Anruf bei der Polizei zurecht, den ich später am Abend machen würde. Auf der Rückfahrt war ich schon mal ein paar Varianten durchgegangen und hatte geprobt, wie es sich anhörte. Wobei die Polizei natürlich niemals meine echte Stimme zu hören bekommen durfte.
Ich faltete die letzte Zeltplane zusammen und räumte sie weg. So, fertig. Jetzt war in der Garage nur noch das leise Ticken der beiden abkühlenden Motoren zu hören. Der Jeep würde wahrscheinlich noch eine Weile brauchen, um nach der langen Fahrt wieder Normaltemperatur zu erreichen. Eine Fahrt, die mich mehr erschöpft hatte, als ich Ellen gegenüber zugeben konnte. Aber, gut, eine Dose von diesem scheußlich süßen Red Bull, die hier zusammen mit anderen Meisterwerken der Dosenindustrie auf einem Regal stand, würde mein Energie-Level hoffentlich wieder in unverdächtige Höhe treiben. Ich öffnete die Hintertür des Jeeps und zog das alte Apple PowerBook hervor, das mir als Scrapbook diente – eine Art Sammelalbum mit Fotos, Zeitungsausschnitten und anderen Memorabilien.
Nachdem ich mit meiner kostbaren Fracht ins Haus zurückgekehrt war, ging ich zu dem großen Schreibtisch, der an dem einen Ende unseres Eingangsbereichs stand. Ich schloss die unterste Schublade auf. Vorsichtig legte ich das Scrapbook hinein. Es war eingewickelt in eine gepolsterte, wasserdichte Plane, und ich musste schwer gegen das Verlangen kämpfen, es auszuwickeln und anzuschalten.
»Kannst du mal nachschauen, ob die Überweisung an City Light durchgegangen ist?«, rief Ellen. Dem Klang ihrer Stimme nach befand sie sich noch in der Küche. Vermutlich saß sie am Tresen und aß Pflaumen. Oder sie wühlte in dem kleinen Wäschekorb herum, den sie dort deponiert hatte, um ihre Business-Klamotten schnell gegen etwas Bequemeres austauschen zu können.
»Du kannst das selbst überprüfen. Auf deinem Handy«, rief ich zurück, während ich die Schublade abschloss und dann mit einem kleinen Ruck überprüfte, ob sie auch wirklich zu war.
»Ich vertraue dieser dummen App nicht. Tu es einfach, Martin, okay? Und wann wolltest du eigentlich diese vergammelte Limette wegwerfen?«
»Das ist deine Limette«, gab ich zurück. »Ich dachte, du hängst an ihr und willst sie bis in alle Ewigkeit aufheben. Die Limetten, die ich gekauft habe, befinden sich übrigens im Kühlschrank. Dort, wo sie hingehören.«
»Klugscheißer«, rief sie und verfiel daraufhin in Schweigen. Offenbar wartete sie darauf, dass ich in die Küche kam, um die Unterhaltung fortzusetzen. Aber ich war noch nicht so weit. Nach einer Grabung brauchte ich stets eine Zeit lang Ruhe, um mein Gehirn umzuprogrammieren, sodass es wieder im domestizierten Modus lief. Das war wie bei Ellen, die nach der Arbeit einen Kleiderwechsel brauchte, um das Gefühl zu haben, dass sie wirklich zu Hause angekommen war.
Mein Schreibtisch stand vor einer blanken Wand, die ich beharrlich gegen jede Invasion von Fotos und Bildern verteidigte. Ich wollte keine Ablenkung. An diesem Ort gab es nur mich und den riesigen Tisch aus Eichenholz mit seinen vier canyontiefen Schubladen. Die unterste war abgeschlossen, um mein Scrapbook vor neugierigen Blicken zu schützen. Wobei ich nicht davon ausging, dass das ein großes Problem darstellte. Ellen gehörte nicht zu den Frauen, die gerne herumschnüffeln. Sie verhielt sich hier zu Hause genauso diskret und vertrauenswürdig wie in ihrem Job bei der Kreditgenossenschaft. Und Kylie wäre es nie in den Sinn gekommen, dass ihr Vater irgendetwas tat, was von Interesse sein könnte.
Ich schloss meine Augen und versetzte mich mental in die richtige Stimmung. Dann stand ich auf. »Hast du mein Handy-Ladekabel irgendwo gesehen? Das aus der Küche?«, fragte ich, als ich um die Ecke bog.
»Es ist hier, du Schlaukopf. In der Küche«, entgegnete meine Frau, während ich mich bemühte, im Chaos auf der Arbeitsplatte das Kabel ausfindig zu machen.
Dann fummelte ich es hervor und suchte mir eine freie Steckdose.
»Kochst du heute?« Ich spürte ihren Blick im Rücken und drehte mich um. Ellen hatte einen regulären Acht-Stunden-Arbeitstag. Trotzdem sah sie müder aus als ich.
»Nein, tue ich nicht. Und du wirst das auch nicht tun.«
Nachdem mein Handy mit einem Summgeräusch wieder zum Leben erwacht war, schaltete ich den Lautsprecher ein und wählte die Nummer des Sezuan-Imbiss, der sich ein paar Blocks weiter in der Einkaufspassage befand. Normalerweise bekam man da nur Take-away-Essen, aber uns belieferten sie auch. Was daran lag, dass ich jedes Mal ein Trinkgeld von zwanzig Dollar zahlte. »Den frittierten Tintenfisch, bitte. Einmal Rindfleisch mit Ingwer und …«
»Zitronenhühnchen!«, schrie Kylie vom oberen Stockwerk herunter. Ihre Stimme klang so flehend, dass selbst Ellen einen Moment lang den Mutter-Tochter-Streit vergaß und zu lachen begann.
»Und Zitronenhühnchen«, teilte ich dem Mann am anderen Ende der Leitung mit, obwohl ich sicher war, dass er Kylie sowieso gehört hatte. Unsere Tochter stampfte in ihr Zimmer zurück, und ich drehte mich zu Ellen um.
»Was ist?«, fragte sie. Offenbar wirkte meine Miene ein wenig schuldbewusst.
»Ich verschwinde heute Abend noch mal für ein paar Stunden. Treffe mich mit Keith auf ein Bier.«
»Keith der Cop? Wirklich, Martin, kaum bist du von deinem zweitägigen Camping-Ausflug zurück, verlieren wir dich schon wieder – und dann auch noch an die Polizei?« Diesmal lag ein leichter Flunsch in Ellens Stimme. Aber von echter Empörung war das noch meilenweit entfernt.
»Wir essen jetzt erst mal in Ruhe zusammen. Und die restliche Woche werde ich garantiert nicht wieder weggehen. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich fertig. Aber du weißt ja, wie Keith ist. Wenn er in seiner Es-ist-dringend-Stimmung ist, sollte man Treffen mit ihm lieber nicht verschieben.«
»Na schön. Ich habe keine Lust, mich mit Kylie und dir gleichzeitig zu streiten. Also werde ich jetzt so tun, als ob das für mich in Ordnung ist. Und früher oder später wird es das hoffentlich auch sein.«
»Tut mir leid, Ellen. Wirklich.«
Meine Frau hätte eigentlich gar nichts von Keith wissen sollen. Aber vor ein paar Jahren hatte sie uns überrascht, als wir in der Nähe ihrer Arbeit einen Kaffee zusammen getrunken hatten. Ellen hatte sich einen halben Tag frei genommen, weil sie nach neuen Vorhängen hatte suchen wollen. Stattdessen hatte sie dann ihren Ehemann entdeckt, der sich mitten am Tag mit einem Polizisten traf. Ich hatte mir eine kunstvolle Lüge ausgedacht, die – wie alle guten Lügen – teilweise der Wahrheit entsprach. Laut meiner Geschichte hatten Keith und ich uns kennengelernt, als wir beide in einer langen Schlange vor dem Postschalter gestanden hatten. Wir waren ins Reden gekommen, und seitdem half ich Keith, wenn er mal wieder irgendwelche Probleme hatte. Im Gegenzug erzählte er mir spannende Geschichten aus seinem Polizeialltag. Ellen schien der Gedanke zu gefallen, dass ich einen Freund hatte, um den ich mich kümmerte. Denn die Zahl meiner Sozialkontakte war insgesamt eher gering. Die meiste Zeit verbrachte ich mit Ellen und Kylie. Oder allein im Wald.
Ich nahm Anlauf und schlidderte auf den Dielen zu Ellen hinüber. Wir hatten den neuen Boden vor vier Monaten verlegen lassen. Trotzdem bekam ich noch immer nicht genug davon, diese berühmte Tom-Cruise-Szene aus Risky Business nachzuspielen oder im Arbeitszimmer mit meinem Bürostuhl vom Schreibtisch zum Kühlschrank zu gleiten, wenn ich mir ein Bier holen wollte. Als ich bei Ellen angekommen war, legte ich meinen Kopf an ihre Schulter und sagte: »Sorry.«
Sie strich mir über die Haare und presste dann die Fingerspitzen sanft gegen meine Stirn. Wie üblich waren ihre Nägel kurz geschnitten. Ellen behauptete, dass sie auf diese Weise gegen den ›Tussi-Bullshit‹ einiger Kolleginnen im Büro protestierte, die offenbar einen Maniküre-Wettstreit ausfochten. »Du könntest das Klima hier erheblich verbessern, indem du duschen gehst. Und zwar sofort«, sagte sie.
»Okay.« Auf dem Weg nach oben nahm ich immer zwei Treppenstufen auf einmal.
Die Tür zu Kylies Zimmer war geschlossen. Trotzdem war dieser Drake-Song, den meine Tochter dauernd spielte, bis ins Bad zu hören. Eigentlich konnte ich Drake nicht leiden. Aber irgendwie ertappte ich mich doch dabei, dass ich mitsummte, während ich unter der Dusche stand, um Dreck und Schweiß abzuwaschen. Sobald das erledigt war, schaltete ich die Massagefunktion der Dusche ein und versuchte, so gut es ging, meine verspannten Muskeln zu lockern.
Als ich schließlich aus dem Badezimmer kam, war die Musik aus und Kylie stand auf dem oberen Treppenabsatz. »Dad! Falls du jemals wieder einen meiner Lieblingssong singst, ziehe ich aus.«
»Mach das. Allerdings werde ich dann deinen Treuhandfonds einer Tierschutzorganisation überschreiben. Zur Rettung der Schimpansen oder so.«
»Ich mag Schimpansen.«
»Super, dann sind wir uns ja einig.«
Als wir runterkamen, suchte Ellen gerade nach ihrer Tasche, um den Mann zu bezahlen, der mit unserem Essen vor der Tür stand. Der Imbissmitarbeiter wirkte erleichtert, als er mich sah. Ich zog schnell meinen Geldbeutel aus der Jacke, die am Regal neben der Tür hing.
»Ich wollte zahlen«, erklärte Ellen, nachdem wir die Tür geschlossen hatten.
»Ja, ich weiß. Aber ich war zufällig schneller.«
»Keine Sorge, ich hätte ihm schon auch dieses absurd hohe Trinkgeld gegeben. Im Ernst, Martin. Ich mag es nicht, dass du dich jedes Mal vordrängst, wenn es ums Bezahlen geht.« Ellen hatte sich umgezogen und trug jetzt ein ›University-of-Washington‹-Sweatshirt, das sie schon besessen hatte, als wir beide zusammen aufs College gegangen waren. In dem weit geschnittenen Shirt wirkte sie klein, kaum älter als Kylie und fast ein wenig verloren.
Ich konnte mich noch genau an den Moment erinnern, als ich dieses Sweatshirt zum ersten Mal gesehen hatte: An einem Oktobernachmittag vor zwanzig Jahren, als ich Ellen vom College zurück zu ihrem Studentenapartment folgte, kurz nachdem ich herausgefunden hatte, wer sie war. Und wer ihre Schwester war. Das Sweatshirt war damals lila gewesen, während die Farbe jetzt eher ein verwaschenes Blaugrau war. Zu jener Zeit war ich ein Experte darin gewesen, anderen ungesehen zu folgen. Ellen hatte mich nie bemerkt. Nicht mal, wenn ich minutenlang auf der anderen Straßenseite neben ihr her spaziert oder ganz dicht hinter ihr gelaufen war. So dicht, dass ich ihr das Scrunchie-Haarband mit einem einzigen Griff hätte abziehen können, wenn ich Lust dazu gehabt hätte.
Und ich hatte Lust gehabt. Aber es war mir gelungen, mich unter Kontrolle zu halten. Was sich letztlich ausgezahlt hatte.
»Natürlich hättest du bezahlen können. Ich wollte nicht …«
»Sprich nicht mit mir, als müsstest du ein kleines Kind beruhigen, Martin.« Ellen seufzte. Es war einer jener kurzen Seufzer, mit denen sie ein Thema abschloss, um sich dann blitzschnell etwas Neuem zuzuwenden. Ich bewunderte sie für ihre Spontaneität, gerade weil wir in diesem Punkt so unterschiedlich waren. In meinem Leben war alles sorgfältig kalkuliert. »Vergiss es«, schloss sie prompt das Thema ab, um zum nächsten überzugehen. »Es gibt wichtigere Dinge, über die wir sprechen müssen. Neben dem, was du zum Thema ›Kylie‹ loswerden willst, ist da noch mein Job, über den ich mit dir reden möchte. Ich wollte das eigentlich heute Abend tun. Aber wenn du jetzt weggehst, bleibt uns nicht genügend Zeit.« Wir hörten, wie Kylie in der Küche mit Geschirr rumklapperte. Sie faltete die Pappbehälter, in denen das Essen geliefert wurde, gerne auseinander, um sie dann als Teller-Ersatz zu benutzen. Aber unsere Tochter wusste, dass Ellen und ich in diesem Punkt hart blieben: Wenn wir für das Essen sorgten, wurde richtiges Geschirr benutzt.
Heute legte Kylie beim Tischdecken ein ziemliches Tempo vor, obwohl sie sonst nicht die Allerschnellste war, wenn sie sich im Haushalt nützlich machen sollte. Offenbar hatte sie Hunger.
»Ja, natürlich. Das besprechen wir, Ellen. Und zwar möglichst bald. Aber es ist besser, wenn wir etwas mehr Zeit dafür haben.«
Wir setzten uns an den Küchentisch und begannen alle drei ziemlich schnell zu essen. Kylie musste wieder zu Kräften kommen, nachdem sie gerade eine Trainingseinheit absolviert hatte, die zweifellos ziemlich brutal gewesen war. Ihr Coach gehörte zu den Typen, die grundsätzlich Dinge wie »Landeswettkampf!« und »Legt euch ins Zeug!« schrien, egal wie weit die Mädchen von diesem Ziel entfernt waren. Ich dagegen musste dringend etwas in den Magen bekommen, weil mein Puls dank des Energy-Gesöffs und der Unmengen von Kaffee noch immer viel zu hoch war. Ellen aß zwar mit der üblichen Eleganz und Effizienz, allerdings schien sie heute etwas energischer als sonst zu kauen. Vermutlich war sie doch ein wenig verärgert über die Tatsache, dass ich gleich wieder verschwinden wollte. Und dazu kam die Anspannung vor dem Gespräch, das wir jetzt führen würden.
Eigentlich hatte ich mit dem Thema loslegen wollen, aber Kylie kam mir zuvor. Leider war ihr Einstieg ein wenig … direkt.
»Wenn ich nicht Punkt zehn Uhr zu Hause bin, dreht Mom jedes Mal durch und denkt, dass ich ermordet wurde.«
»Oh«, entfuhr es Ellen.
Dieser kurze Laut enthielt so viel Schmerz, dass Kylie zusammenzuckte. Sie ließ die Stäbchen sinken ließ, mit denen sie gerade ein Stück Hühnchen in Richtung ihrer neuerdings zahnspangenlosen Zähne befördert hatte. Offenbar war sie auf einen Kampf vorbereitet gewesen. Die Möglichkeit, dass sie ihre Mutter verletzen könnte, hatte sie nicht bedacht.
»Sag so was nie wieder, Kylie. Mit der Bemerkung bist du zu weit gegangen. Das würden alle Eltern so sehen. Aber hier, in diesem Haus, gilt das besonders.«
»Das stimmt«, erklärte Ellen. Sie ließ jetzt ebenfalls die Stäbchen sinken. Einen Moment lang schien sie nach Kylies Hand greifen zu wollen, doch dann besann sie sich anders und griff stattdessen nach der Chilisoße. Nachdem ein blutroter Fleck auf ihrem Tellerrand zu sehen war, fuhr sie fort: »Wirklich, Kylie, was denkst du dir eigentlich? Es ist richtig – ich bin vermutlich ängstlicher als die meisten anderen Mütter. Aber das hat seinen Grund, wie du weißt. Ich bekomme Angstattacken, und es hilft auch nichts, wenn ich mir irgendwelche Tabletten dagegen verschreiben lasse. Weil die Dinge, vor denen ich Angst habe, nämlich kein Produkt meiner Einbildung sind. Es sind Erinnerungen an etwas, das wirklich passiert ist.«
»Tinsley«, sage Kylie mit einem Nicken.
Als wir herausgefunden hatten, dass Ellen schwanger war, hatte sie das Kind so nennen wollen: Tinsley, nach ihrer verschwundenen Schwester. Ich hatte meine Frau gebeten, das nicht zu tun – damals, fünf Jahre nachdem ich ReeseTech gegründet und ernsthaft mit dem Graben begonnen hatte. Denn ständig an Tinsley erinnert zu werden, hätte alles nur noch schlimmer gemacht.
»Ja, Tinsley«, erwiderte Ellen. »Ich denke oft über sie nach. Meine Schwester kam mir immer unglaublich stark vor. Eine Frau, die mit jeder Situation klarkommt und vor nichts Angst haben muss. Und wenn ich an Tinsley denke, denke ich auch an dich, Kylie. Denn das ist der Punkt, um den es hier geht: Es ist egal, wie stark und selbstbewusst du dich fühlst. Das schützt dich vor gar nichts. Da draußen sind nämlich Männer, die genau das wollen: starke, selbstbewusste Mädchen, die sie quälen und zerstören können, Stück für Stück. Und am Ende sind diese Mädchen dann tot. Ich frage mich, ob dir das wirklich klar ist.«
Unwillkürlich zuckte ich zusammen, während Kylie stocksteif dasaß und keinen Mucks von sich gab. Nachdem ich kurz überlegt hatte einzugreifen, entschied ich mich dagegen. Aber ich hörte genau zu, während ich über meine Schüssel gebeugt dasaß und Nudeln in mich reinschaufelte. Ellen hatte noch nie so unverblümt mit unserer Tochter über Tinsley gesprochen, jedenfalls nicht in meiner Gegenwart. Und sie hatte auch noch nie diese Methode bei Kylie angewendet, die sie immer dann nutzte, wenn es ihr richtig ernst war. In solchen Fällen klang Ellen nämlich, als würde sie mit sich selbst sprechen, wodurch man das Gefühl bekam, in ihre Privatsphäre eingedrungen zu sein und Dinge mitangehört zu haben, die sie eigentlich für sich behalten wollte.
»Diese Angst, die ich immer habe, wenn du weg bist, und ich nicht weiß, wo du steckst, Kylie? Das ist eine ziemlich berechtigte Reaktion, würde ich mal sagen. Selbst wenn inzwischen zwanzig Jahre vergangen sind.« Ellen schaute zu mir. Ich nickte und sah dann Kylie an.
Ellen hatte recht: Nächste Woche würde es genau zwanzig Jahre her sein, dass Tinsley Schultz verschwunden war. Mir war klar, womit meine Frau zu kämpfen hatte. Sie war gezwungen, mit dieser inneren Anspannung zu leben, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Auch ich zuckte jedes Mal zusammen, sobald ich eine Frau sah, deren Haare oder Hals mich an Tinsley erinnerten. Manchmal glaubte ich auch, ihr Lachen zu hören, diese Mischung aus ungenierter Lebensfreude und Eleganz. In solchen Fällen zwang ich mich, nach ein paar Sekunden den Kopf abzuwenden. Es war wichtig, dass ich mich nicht in mein altes Ich zurückverwandelte – in jenen Mann, der damals auf dem College Ellen heimlich gefolgt war. Die Gefühle, die ich mir in diesen Momenten versagte, konnte ich dann bei meinen Grabungen herauslassen.
»Aber wir müssen einen Kompromiss finden, das ist mir klar. Einen Weg, wie du ein normales Teenagerleben führen kannst, ohne dass ich ständig Angst um dich haben muss, Kylie. Das ist jedenfalls, was dein Vater gleich sagen wird. Richtig, Martin?«
»Ja, darauf wollte ich hinaus«, erklärte ich und fügte dann hinzu: »Schaut mal, ihr zwei, könnt ihr vielleicht trotzdem weiteressen? Dann endet diese Diskussion zumindest nicht mit kalten China-Nudeln. Das wäre schon mal der erste Erfolg.«
Diese Bemerkung brachte mir erwartungsgemäß keine Lacher ein. Aber die Spannung im Raum ließ ein wenig nach und die Stäbchen setzten sich wieder in Bewegung.
»Was wir tun müssen – wir alle –, ist, darüber zu reden«, fuhr ich fort. »Wenn du abends weggehst, Kylie, muss klar sein, wo du bist und wie wir dich erreichen können. Keine Last-Minute-Verabredungen, ist das klar? Du sorgst dafür, dass dein Handy-Akku immer geladen ist. Und wenn deine Mutter dir eine Nachricht schickt, wirst du genauso schnell antworten, wie du das bei Ramona tust. Okay?«
»Das musst gerade du sagen, Dad«, gab Kylie prompt zurück. »Wir hören nie was von dir, wenn du mal wieder campen bist oder so.«
»Um mich muss sich niemand Sorgen machen. Das ist der Unterschied.«
»Jaja.«
»Und ich bin nicht verrückt«, setzte Ellen hinzu. »Deine Tante wurde entführt und ermordet.«
»Das wissen wir nicht«, warf ich ein.
»Doch, ich weiß das. Sie wäre niemals ohne irgendeine Erklärung gegangen. Und inzwischen wäre sie auch längst wieder aufgetaucht. Verdammt noch mal, ich mache mir eben Sorgen um meine Tochter. Das ist doch nicht unnormal, oder?« Offenbar hatte Ellen kurz vergessen, dass besagte Tochter mit uns am Tisch saß, denn normalerweise fluchte meine Frau nie in Kylies Gegenwart.
»Mom. Mommy. Ich weiß. Trotzdem kann ich … Wir bekommen das hin, okay? Ich verspreche, dass ich dir immer sage, wo ich bin, sobald ich das Haus verlasse. Aber eines Tages werde ich aufs College gehen. Und vielleicht auch mal in eine andere Stadt ziehen. Also sollten wir lieber jetzt damit anfangen, uns irgendwas auszudenken, wie wir beide damit zurechtkommen.«
Meine Tochter hatte das viel besser erklärt, als ich es jemals gekonnt hätte. Was mich ein wenig nervte, aber zugleich verdammt beeindruckte. Ich beschloss, mir den väterlichen Stolz nicht anmerken zu lassen, und bemühte mich um eine gleichgültige Miene, während ich aß.
Als ich bemerkte, dass die beiden in ein Gespräch vertieft waren, sah ich schnell auf die Uhr. Mir blieben noch eine Stunde und zehn Minuten. Ich traf mich heute mit Keith, weil er neue Dokumente für mich hatte. Er hatte seine Ware schon seit Wochen angepriesen. Angeblich würde ich schwer beeindruckt sein. Keith behauptete das zwar jedes Mal, trotzdem war ich ein wenig aufgeregt und malte mir aus, was es wohl diesmal war und wen ich in diesen Dateien finden würde.
Ellen und Kylie redeten noch immer, als ich schließlich aufstand und meine Jacke anzog. Die Unterhaltung drehte sich um Kylies Schwimmteam, eine Celebrity-Scheidung und die Frage, wann es endlich aufhören würde zu regnen. Kein Wort mehr über Kidnapping, Mord und derartige Dinge. Unsere dreckigen Teller standen noch auf dem Tisch, und als ich Tschüss sagte, registrierten es die beiden kaum.
Das hier war der ideale Moment, um mein Scrapbook noch mal anzuschauen. Die Versuchung war einfach zu groß. Also drehte ich um und ging statt zur Haustür leise zu meinem Schreibtisch zurück. Behutsam öffnete ich die Schublade. Das Geräusch würde hoffentlich in dem Stimmgewirr untergehen, das immer noch aus der Küche zu hören war.
Der Computer brauchte nur ein paar Sekunden, um hochzufahren. Ich hatte das alte Teil mit einem brandneuen Prozessor ausgestattet und auch sonst ein paar neue Teile hinzugefügt. Sobald ich mich eingeloggt hatte, öffnete ich das Foto-Programm, wo ich gestern die Fotos deponiert hatte, bevor ich den Speicher meiner Kamera löschte. Ich drehte meinen Schreibtischstuhl so, dass ich gleichzeitig auf den Bildschirm schauen und die Küche im Auge behalten konnte. Ich würde die Fotos sowieso nur einmal kurz durchscrollen. Mehr war nicht möglich. Ich durfte mich nicht in dem Anblick verlieren. Nicht, wenn Kylie und Ellen im Nebenzimmer waren.
Mit dem ersten Foto hatte ich – wie immer – meine Schaufel dokumentiert. Das Schaufelblatt war neu und wurde nur ein einziges Mal verwendet. Danach fand es seine letzte Ruhestätte in irgendeinem Müllcontainer, genau wie all seine Vorgänger. Was auf dem Foto nicht zu sehen war, war meine rechte Hand. Aber ich wusste, dass sie sich in diesem Moment nur wenige Zentimeter außerhalb des Bildbereichs befunden hatte. Fast konnte ich das Gefühl der Handschuhe auf meiner Haut und diesen Drang loszulegen noch einmal spüren. Zu graben, bis ich sie irgendwo in der Erde fand, in der sie jahrelang gut verborgen gelegen hatte.
Nächstes Bild: die Grabungsstelle, rein und unberührt. Wobei man über ›rein‹ in diesem Fall wohl diskutieren konnte, denn der Boden war mit Müll vom nahen Highway übersät.
Dann: Bilder der kleinen Kunststofftafeln, mit denen ich das Grabungsgebiet markiert hatte. Und: ein Beweisfoto von der Erderhebung, die sich nur wenige Meter von der Stelle entfernt befand, die ich anhand der Ermittlungsakten errechnet hatte. Ich schaute auf, in Richtung Küchentür, und ließ fünf Sekunden verstreichen, während ich meinen rechten Zeigefinger an mein linkes Handgelenk presste. Diesen Trick hatte ich mir beigebracht, um meinen Pulsschlag zu verlangsamen. Nachdem die fünf Sekunden verstrichen waren, scrollte ich weiter durch die Bilder, diesmal allerdings schneller. Ich wollte einmal alle Fotos durchsehen, bevor die Unterhaltung in der Küche verebbte und ich das Scrapbook in der Schublade verstauen musste.
In rascher Folge arbeitete ich mich durch die Dokumentation der Grabung, das tiefer werdende Loch, die sorgfältig aufgeschichtete Erde, bis irgendwann der erste Knochen auftauchte: eine Ulna, der dünne Unterarmknochen einer Frau Anfang zwanzig. Die nächsten Fotos zeigten, wie der Rest von ihr sichtbar wurde, nachdem ich gestern Abend sorgfältig die Erde entfernt hatte.
2. K A P I T E L
Ich steuerte meinen Jeep durch die schmalen Sträßchen, die mein Haus umgaben, bevor ich auf die Hauptstraße einbog und mich von der Masse mitreißen ließ, die in Richtung Innenstadt strömte. Zum Glück war die Rushhour schon vorbei. Trotzdem kam ich nur langsam voran. Wobei das hier noch einigermaßen erträglich war. Mit Regen kamen die Autofahrer von Seattle ansatzweise klar, aber wehe, wenn es mal mehr als drei Tage am Stück schneite. Dann fand man sich augenblicklich in der allerschlimmsten Art von Stop-and-go-Verkehr wieder. Mein Ziel heute Abend war der 7-Eleven in der Nähe des Pemberton-Hotels, wo ich Sergeant Keith Waring treffen wollte, nachdem ich vorher kurz noch etwas erledigt hatte.
Ich war nach Kalifornien gefahren, um die sterblichen Überreste von Winnie Mae Friedkin aufzuspüren, einer Tramperin, die 1976 verschwunden war. Sie gehörte zu den zahlreichen Opfern (vierzehn, nach derzeitigem Stand) von Horace Marks, einem nicht allzu intelligenten Truck-Fahrer. Marks hatte sich ein Jahr lang damit vergnügt, Frauen entlang des Pacific-Coast-Highways aufzugabeln und sie zu ermorden. Wenn er einen Kühlanhänger dabeihatte, suchte Marks sich beispielsweise ein Mädchen in Cali aus, tat, was er nicht lassen konnte, und verstaute die Leiche anschließend in seiner praktischen Kühleinrichtung. Erst wenn er Washington State erreichte, vergrub er sein Opfer. Keine wirklich brillante Strategie, aber immerhin lagen so viele Kilometer zwischen Tatort und Grab, dass einige dieser Frauen für immer verschwunden bleiben würden, davon schien Marks jedenfalls auszugehen.
Als er schließlich verhaftet wurde, konnte er sich laut eigener Angabe nämlich nicht mehr genau daran erinnern, wo sich all seine Gräber befanden. Aber wenigstens war es der Polizei geglückt, den Typen aus dem Verkehr zu ziehen – wortwörtlich. Bei der Aktion, die fast schiefgegangen wäre, waren elf weibliche Cops eingesetzt worden. Einige von ihnen hatten am Straßenrand gestanden und nervös die Daumen in die Luft gereckt. Andere waren auf den Rastplätzen rumspaziert, um zu sehen, ob irgendwann mal ein Psychopath auftauchte, der vorgab, ihnen eine Mitfahrgelegenheit anzubieten. Wieder andere hatten sich als Nutten auf dem Straßenstrich ausgegeben. Marks hatte sich schließlich für Dana Brant entschieden. Er hatte sie einige Kilometer nördlich von Newbury Park getroffen, und als er ihr die Hände um den Hals legen wollte, hatte Dana eine Beretta aus dem Cowboy-Stiefel gezogen und ihm in den Magen geschossen. Marks befand sich gegenwärtig noch immer hinter Gittern und hatte nach wie vor Verdauungsprobleme.
Ich parkte einige Blocks entfernt von dem 7-Eleven und streifte meine Tarnung über. Keine Perücke, Gesichtsmaske oder etwas in dieser Art. Einfach nur Mütze, Brille und eine Regenjacke mit Kapuze, die ich über meine Barbour-Jacke zog. Die Wachsjacke war zu gut geschnitten, um wirklich unauffällig zu sein. Manchmal sehen teure Dinge eben auch teuer aus, selbst auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera. Die Polizei hatte nicht genügend Ressourcen, um meine Anrufe mühsam zurückzuverfolgen. Aber falls die Cops irgendwann doch mal beschließen sollten, einige Hundert Stunden damit zu verbringen, alle Kamera-Aufnahmen der Läden zu sichten, die diese Art von Handys verkauften, wollte ich auf der sicheren Seite sein.
Der Regen prasselte auf mich hinab, während ich durch eine schmale Seitengasse ging, die von einigen Pennern bevölkert wurde. Sie bauten sich gerade einen Regenschutz, indem sie zwischen ihren Einkaufswagen blaue Plastikplanen spannten – die Baustellen-Discountversion der teuren Planen, die die Spurensicherung nutzte und die ich bei den Grabungen immer dabeihatte.
Einer der Männer murmelte »Kleingeld?«, als ich an ihm vorbeikam. Ich streckte ihm die zwei Dollarscheine entgegen, die ich in der hinteren Tasche meiner Jeans fand. Wie der Mann aussah, wusste ich nicht genau. Ebenso wenig hätte er mich beschreiben können. Er hielt seinen Blick fest auf das Geld gerichtet, während ich strikt nach vorne blickte und im zügigen Businessman-Schritt die dreckige Gasse durchquerte, um dann auf den mit Schirm- und Anzugträgern verstopften Gehweg einzubiegen und vor dem kleinen Kramladen anzuhalten. Ich zahlte in bar für das billige Handy, das eine Prepaid-Karte mit der geringstmöglichen Anzahl an Freiminuten enthielt. Ich würde sowieso weniger als fünf Minuten brauchen. Maximal zehn, wenn 911, die Notrufzentrale, überlastet sein sollte.
Winnie May Friedkin war Opfer Nummer acht. Ihr Grab gehörte zu jenen fünf, die Horace Marks angeblich nicht hatte finden können, als die Polizei kurz vor dem Prozess wieder und wieder den Highway mit ihm entlanggefahren war. Die Akte, die Keith mir gegeben hatte, zeigte, dass selbst ein Idiot wie Marks Spaß daran hatte, Spielchen zu spielen. Die Mädchen waren irgendwo da draußen, unter der Erde. Geheime Denkmäler, die Marks an seine Taten erinnerten. Nur ein Mal hatte er einen Hinweis auf den Verbleib einer Leiche gegeben. Aber Bobby Flowers, der Lieutenant, der Marks zunehmend entnervt vernahm, hatte diesen Hinweis natürlich nicht kapiert. Dafür hatte Bobby vermutlich ein paarmal zugeschlagen, wovon in der Mitschrift der Vernehmung selbstverständlich kein Wort zu lesen war.
Ich habe Winnie ein Eis gekauft. Eine Kugel Karamell im Becher. Sie wollte das so: im Becher, nicht in der Waffel.Ich hab sie aufessen lassen, bevor sie dran war.
Kein besonders klarer Hinweis. Aber genau das ist der Trick, wenn man alte Fälle aufklären will: Man muss nach Dingen suchen, die den Cops – sogar den richtig schlauen unter ihnen – entgangen sind. Es gibt bei der Polizei immer ein oder zwei clevere Typen, die in die oberen Dienstränge aufsteigen möchten. Also knöpfen sie sich die alten Akten noch mal vor und suchen nach dem Hinweis, den alle Kollegen bisher übersehen haben. Das Problem ist allerdings, dass diese Leute immer glauben, es müsse sich um etwas Großes, Wichtiges handeln.
Ich dagegen suche nach etwas, das so trivial erscheint, dass das Ermittlungsteam es überhört. Etwas, was auch den vielen neugierigen Blicken entgeht, die später erneut über die Akten gleiten – bis der Täter tot ist oder lange genug eingesessen hat, dass die Cops das Interesse verlieren. Bis sie aufhören, Anteil am Schicksal der Opfer zu nehmen, die irgendwann nur noch eine vage Erinnerung sind, kein Fall mehr. Kaum jemand denkt dann noch an die verschwundenen Mädchen, ihre vergrabenen Leichen. Was von ihnen übrig bleibt, sind nur ein paar grobkörnige Bilder auf irgendwelchen True-Crime-Seiten im Internet. Und selbst ihre Eltern, die nicht aufhören können, an sie zu denken, sterben eines Tages und nehmen die Erinnerung mit ins Grab.
Nachdem ich zurück im Auto war, zog ich die Tarnkleidung aus und verstaute sie auf dem Rücksitz. Dann fuhr ich den Mac hoch und startete das Sprachprogramm. Während ich mich auf den Weg in Richtung Innenstadt machte, wählte ich mit dem neuen Handy die 911.
»911. Bitte schildern Sie Ihren Notfall.«
Ich hielt die Luft an, damit nicht mal ein Atemzug hörbar war. Behutsam legte ich das Handy auf einen der Lautsprecher im Wagen und drückte am Mac die Leertaste. Die künstliche, emotionslose Stimme unterbrach die Fragen des Notruf-Mitarbeiters, die ich zwar nicht hören konnte, die er aber sicherlich weiterhin abfeuerte.
»Das ist der Ort, an dem Winnie Mae Friedkin zu finden ist, ehemals wohnhaft in San Francisco. Sie ist das achte Opfer von Horace Marks, derzeit wohnhaft in San Quentin. Ich habe Winnie Mae Friedkin auf die gleiche Weise gefunden wie die anderen: Indem ich euren Job für euch erledigt habe. Sie lag inmitten einer Baumgruppe – Birken, glaube ich –, etwa sechzig Meter hinter dem Gebäude, das 1976 ein Fastfood-Laden war, der auch Eis verkauft hat. Jetzt ist es ein Geschäft für Outdoor-Ausrüstungen. Die Leiche befand sich knapp unterhalb der Erdoberfläche. Mein Metall-Detektor hat auf den Reißverschluss, ihre Ringe und den Christophorus-Anhänger reagiert. Das Mädchen auszugraben, war kein Problem. Richtet das ihrer Mutter aus. Sagt dieser armen Frau, was ihr versäumt habt bei der Suche nach ihrer Tochter. Jetzt kann sie ihr Kind begraben. Was sie nicht euch zu verdanken hat. Auf Wiederhören.«
Ich wartete, bis die Computerstimme die Koordinaten des Fundorts durchgegeben hatte, dann schaltete ich das Handy aus und deponierte es in einem der Becherhalter, während ich weiter kreuz und quer durch die Innenstadt fuhr.
Irgendwann beruhigte sich die paranoide Stimme in meinem Kopf, die mir beharrlich Begriffe wie ›Dreiecks-Peilung‹ zugeflüstert hatte.
Also machte ich mich auf den Weg zum Pemberton, einer Spelunke, die sich im Foyer eines heruntergekommenen Hotels befand. Hier hatte ich mich schon einmal mit Keith getroffen, vor ungefähr zwei Jahren. Ich entdeckte einen Parkplatz direkt vor dem Gebäude, musste aber erst mal einige Sekunden lang nachdenken, wie die richtige Reifenstellung beim Parken an einem derart steilen Hang war. Nachdem das erledigt war, stieg ich aus. Als ich mein Jacke anzog, merkte ich, dass sie feucht war. Vermutlich Regentropfen, die von der billigen Plastik-Scheiße abgeperlt waren, die ich vorhin beim Handykauf getragen hatte. Ich ließ das Handy im nächstbesten Gully verschwinden und ging weiter.
Keith würde in einer der hinteren Ecken des Pemberton sitzen. Also lief ich an den Leuten vorbei, die sich vor der Bar versammelt hatten, ohne sie eines weiteren Blickes zu würdigen. Meine Beobachtungen hatten ergeben, dass Keith sich jeden Abend in irgendeinem halbwegs billigen Etablissement in der Stadt betrank. Aber ich hatte dafür gesorgt, dass er das Pemberton mied, seit wir uns zum ersten Mal dort getroffen hatten. An den Abenden, an denen wir verabredet waren, verließ Keith die Polizeistation etwas früher, um schon mal mit dem Trinken zu beginnen, bevor ich eintraf. Schließlich würde ich ja später die Getränke bezahlen.
Bevor wir uns das erste Mal getroffen hatten, hatte ich ihn mehrere Tage lang heimlich beobachtet. Er hatte mich nicht bemerkt, offenbar hatte ich die Tricks aus meiner Collegezeit nicht verlernt. Was gut war, denn natürlich hatte ich erst mal sicherstellen müssen, dass Keith mich nicht übers Ohr hauen wollte, bevor ich mich mit ihm traf, ihm Kopien abkaufte und die Infos dann verwendete.
Das Pemberton versuchte, die Trinker dieser Stadt mit einem kostenlosen Büfett anzulocken. Am frühen Abend wurden Metallschalen mit Billigessen aufgetragen, das im Wasserbad warmgehalten wurde. Diese Art von Service hatte ich bislang eigentlich nur in Stripclubs gesehen. Wobei es inzwischen ewig her war, dass ich zum letzten Mal irgendwelchen Stripperinnen bei der Arbeit zugeschaut hatte. Damals, während meiner ReeseTech-Zeit, hatten die Jungs mich manchmal überredet, sie bei ihren Wochenendvergnügungen zu begleiten. Als guter Chef hatte ich das ab und zu getan, obwohl mir das Ganze wie Anatomieunterricht der schlimmsten Sorte mit noch schlimmerer Musikbegleitung vorgekommen waren. Aber – das musste man sagen – selbst in den übelsten Clubs war das Essen deutlich besser gewesen als die traurige Pyramide aus laschen Mikrowellen-Tacos, die ich heute auf der Bar erblickte. Das Management des Pemberton sorgte immerhin dafür, dass die Zapfanlage immer bestens in Schuss war. So viel hatten sie begriffen: In Bezug auf Bier verstand die Kundschaft keinen Spaß.
An regnerischen Tagen wie heute drängte sich eine bunt gemischte Truppe vor der Bar; Businesstypen und Bauarbeiter, die alle darauf warteten, dass der Regen nachließ, damit sie sich auf den Heimweg machen konnten. Aber es schüttete getreulich weiter, also gönnten sie sich alle noch ein paar Bier.
Trotz des Gedränges vor der Bar, der voll besetzten Tische und des Labyrinths aus Barhockern war es nicht weiter schwer, Keith ausfindig zu machen. Dreihundert Pfund Schwabbelmasse, in die irgendwo am oberen Ende unpassend attraktive Paul-Newman-Augen eingebettet waren, ließen sich nicht so leicht übersehen. Keith hatte sich auf der Bank in der Nische zurückgelehnt und ließ den Blick über die Menge gleiten. Er schien nach mir zu suchen. Dabei trank er abwechselnd Bier und verspeiste Essig-Gürkchen. »Du musst immer so dasitzen, dass du die Tür im Blick hast«, hatte er mir bei unserem ersten Treffen mit ernster Miene erklärt. »Auf diese Weise siehst du sie, bevor sie dich sehen.« Mir war noch immer schleierhaft, wer ›sie‹ sein sollten. Aber mir war sowieso schnell klar geworden, dass Keith ein absoluter Idiot war. Sein Wert beschränkte sich auf die Waren, die er zu verkaufen hatte. Und natürlich auf die Tatsache, dass er ein Feigling war, der sich nicht trauen würde, unser Geheimnis zu verraten.
»Setz dich, Mart«, erklärte er, als ich ihn erreichte. Er zeigte auf die feuchte und zerschlissene Sitzbank mit den herausgequollenen Federn, die er großzügigerweise für mich vorgesehen hatte. Solange einer von uns die Tür im Blick hatte, war offenbar alles in schönster Ordnung. »Ich habe ein paar richtig gute Sachen für dich dabei. Wie lief es in Kalifornien?«
Bevor ich antworten konnte, winkte er die Kellnerin herbei und bestellte zwei ›Dead Guy‹-Ales. Trotz der Geschäfte, die uns hergeführt hatten, entging ihm garantiert die Ironie, die im Namen des Biers – ›Toter Mann‹ – lag. Für solche Dinge fehlten Keith schlichtweg die geistigen Kapazitäten.
Ich wartete, bis unser Bier gekommen war. »Kalifornien? Da war ich nicht mehr, seit ich mich zur Ruhe gesetzt habe«, sagte ich dann und bemühte mich, meinen Schock zu verbergen. »Auf diese nervigen Idioten in Silicon Valley kann ich gut verzichten. Aber Ellen fährt ab und zu noch mal hin.«
»Also echt, Mart. Versuchst du, mich zu verarschen? Deinen guten Freund Keith? Das tut mir weh. Und sowieso – ich weiß, was ich weiß. Die Jungs heute auf der Wache haben sich über einen Knochenfund unterhalten. Kurz bevor ich loswollte zu unserem Treffen. Angeblich könnte es sich um eins der Opfer von diesem Truckfahrer handeln. Der Mann, dem das Grundstück gehört, hat die Leiche entdeckt, kurz bevor du deinen üblichen Anruf gemacht hast. Vermutlich habt ihr euch knapp verpasst.« Keith schloss den Mund und lehnte sich zurück. Offenbar wartete er darauf, dass ich das Vakuum unserer Unterhaltung nun mit dem Namen Horace Marks füllen würde.
Stattdessen füllte ich meinen Mund mit Bier und ließ Keith seinen durchdringendsten Cop-Blick an mir ausprobieren. Dass ich nur knapp einer Enttarnung entgangen war, unterstrich noch einmal, was ich seit Monaten gedacht hatte: Die nächste Grabung würde meine letzte sein.
»Na schön«, erklärte Keith schließlich, als ihm klar wurde, dass all sein Gestarre nichts nützte. »Dann werde ich morgen überprüfen, ob ein gewisser Jemand einen Fund gemeldet hat. Damit wäre die Sache klar. Mehr Beweise brauche ich nicht.«
»Was hast du für mich, Keith? Irgendetwas Gutes? Ich bin ziemlich müde.«
»Müde? Tja, schon hart, den Vater und Ehemann zu spielen, wenn man steinreich ist und nicht arbeiten muss. Stimmt’s, Martin?«
»Na klar, Keith.« Ich konnte sehen, dass er anfing, maulig zu werden. Da ich mir wenigstens anschauen wollte, was er dabeihatte, setzte ich schnell ein interessiertes Lächeln auf. Die Vorstellung, dass alle im Umkreis gebannt an seinen Lippen hingen, liebte Keith fast so sehr wie mein Geld.
»Weshalb hast du dich eigentlich zur Ruhe gesetzt, Martin? Dein kleines Hobby beschäftigt dich doch keine vierundzwanzig Stunden am Tag. Vermisst du es nicht, ein Dotcom-Superstar zu sein?«
»Deine Terminologie ist etwas veraltet, Keith. Aber ich verstehe, was du meinst. Die Sache ist die: Als Kylie ungefähr acht Jahre alt war, haben Ellen und ich sie mit auf einen Kurztrip nach Oregon genommen. Dort hatte ich eine Hütte. Kylie, Ellen und die Nanny waren schon ein paarmal dort gewesen. Ich selbst noch nie, schließlich habe ich zu der Zeit ungefähr neunzig Stunden pro Woche gearbeitet. Jedenfalls kamen wir da an und haben uns an den Strand am See gelegt. Dann sind wir alle drei kurz mal eingedöst, und irgendwann wurde ich von Ellens Schreien wach. Kylie war weg. Es war ein riesiges Grundstück, und wir waren ganz allein dort. Nach einer Minute oder so bin ich dann auch in Panik geraten. Flacher Strand, man konnte alles im Umkreis von einer Meile überblicken. Kylie war nirgends. Schließlich haben wir jemanden rufen hören und sie auf einer dieser kleinen Inseln in der Mitte des Sees entdeckt. Das verdammte Teil war ungefähr drei Fußballfelder weit vom Ufer entfernt. Kylie ist ins Wasser gegangen, hat die Insel bemerkt und ist einfach immer weiter geschwommen, bis sie da ankam – das hat sie uns jedenfalls erzählt, nachdem wir das Boot geholt hatten und zu ihr hinübergerudert sind, um sie zurückzuholen.« Ich trank einen Schluck von meinem Bier. »Das war der Moment, in dem mir klar wurde, dass ich keine Ahnung hatte, was im Kopf meiner Tochter vorging und wozu sie in der Lage war. Also habe ich alles durchgerechnet und bin zum Ergebnis gekommen, dass ich mit ReeseTech genug Geld verdient hatte, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Dann habe ich meine Firma verkauft. Ich wollte sicherstellen, dass Kylie eine Kindheit hat, die meiner möglichst unähnlich ist.«
Nichts brachte Keith so schnell zum Schweigen wie Aufrichtigkeit. Im Verlauf der Geschichte hatte er begonnen, unbehaglich hin und her zu rutschen. Kurz darauf war der Punkt gekommen, an dem er ganz abgeschaltet hatte. Vermutlich, um sich eine passende Erwiderung zu überlegen. Entweder eine schnodderige Bemerkung, mit der er die ganze Sache beiseitefegen konnte, oder eine aufwühlende Geschichte, die er erlebt hatte und die meine übertraf.
Klugerweise entschied er sich jedoch dafür, einfach nur zu nicken. Dann faltete er die Zeitung auseinander, die vor ihm auf dem Tisch lag, und enthüllte einen USB-Stick. Ich griff danach, wobei ich mir Zeit ließ. Denn natürlich würde Keith seine salsa-verschmierte Pranke auf den Stick legen, bevor ich ihn nehmen konnte.
Prompt tat er es. »Warum hackst du nicht einfach unsere Datenbank, wenn du so wild auf diese Infos bist, Mart?«
»Weil in der Datenbank nur einige Infos sind. Nicht alle. Dafür bezahlen sie dich doch, Keith: für das Scannen und Einpflegen der alten Ermittlungsakten.«
Ich hatte diese Art von Hackerangriff einmal durchgeführt. Anfang der 90er, aus einem Internetcafé in Portland. Nie mehr im Leben habe ich dermaßen geschwitzt wie in den wenigen Minuten, als ich vor diesem fremden Computer saß und versuchte, so viele Rohdaten wie möglich herunterzuladen, bevor sie meine Backdoor entdeckten. Damals waren die Sicherheitsmaßnahmen vergleichsweise lasch gewesen, und seitdem hatte ich nie mehr versucht, in das System einer Strafverfolgungsbehörde einzudringen.





























