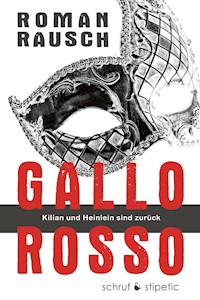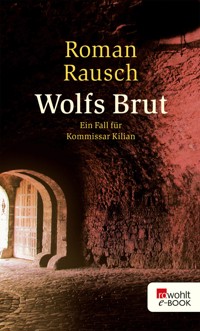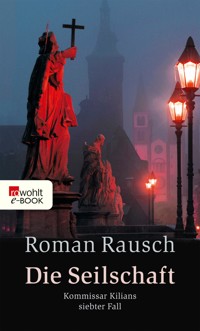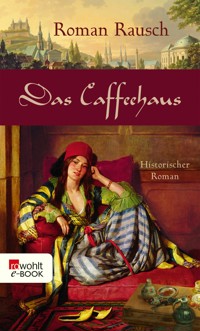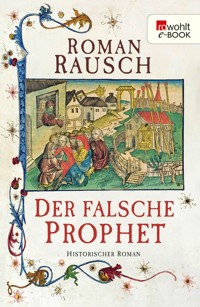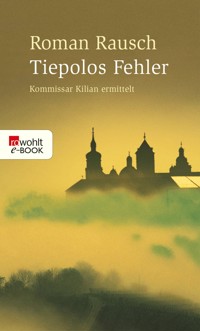
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Kilian ermittelt
- Sprache: Deutsch
Kilian und Heinlein – ein unschlagbares Ermittlerduo aus Würzburg Kurz vor Beginn des Mozart-Festes wird in der Würzburger Residenz ein Wachmann erstochen unter dem größten Deckenfresko der Welt aufgefunden. Die Kriminalkommissare Kilian und Heinlein finden heraus, dass die Mordwaffe eine seltene Vogelfeder ist, wie sie früher von Freskenmalern benutzt wurde. Ist es Zufall, dass justament Tiepolos Fresko restauriert wird? Frauenheld Kilian ist nur allzu gerne bereit, sich von der attraktiven Restaurationsleiterin Giovanna Pellegrini in die Geheimnisse ihrer Arbeitsmethoden einführen zu lassen. «Der Mann hat einen Bestseller geschrieben.» (Süddeutsche Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Roman Rausch
Tiepolos Fehler
Kommissar Kilian ermittelt
Über dieses Buch
Kilian und Heinlein – ein unschlagbares Ermittlerduo aus Würzburg
Kurz vor Beginn des Mozart-Festes wird in der Würzburger Residenz ein Wachmann erstochen unter dem größten Deckenfresko der Welt aufgefunden. Die Kriminalkommissare Kilian und Heinlein finden heraus, dass die Mordwaffe eine seltene Vogelfeder ist, wie sie früher von Freskenmalern benutzt wurde. Ist es Zufall, dass justament Tiepolos Fresko restauriert wird? Frauenheld Kilian ist nur allzu gerne bereit, sich von der attraktiven Restaurationsleiterin Giovanna Pellegrini in die Geheimnisse ihrer Arbeitsmethoden einführen zu lassen.
«Der Mann hat einen Bestseller geschrieben.» (Süddeutsche Zeitung)
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Januar 2012
Copyright © 2003 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
ISBN 978-3-644-45481-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Bernd, Tina und Blanka
Oh unsterbliche Erinnerung an jenen Augenblick der Illusion, des Rauschs und der Bezauberung. Niemals, niemals sollst du in meiner Seele erlöschen!
Jean-Jacques Rousseau
1
Unmerklich legte sich ein kühler Schleier über die Stadt.
Ein Montag ging zu Ende, so feurig heiß wie die zwei vorangegangenen Wochen, in denen keine einzige Wolke auf einen erlösenden Regenschauer hatte hoffen lassen. Schatten war knapp und die Lust, hinaus ins Freie zu gehen, verschwunden. Zu Beginn der Hitzewelle hatten Biergärten und Cafés noch gute Geschäfte gemacht. Doch nun mussten sie schon klimatisierte Plätze bieten, um Gäste zu locken.
Die Straßen vor der barocken Residenz zu Würzburg waren zu dieser späten Stunde menschenleer. Eine lähmende Schwüle machte den abendlichen Spaziergang zur Qual. Von Westen her zog Wind auf. Auf den Terrassen spürte man ihn auf schweißnasser Haut. In den Bäumen raschelten durstende Blätter, und ein Wetterhahn knarrte in seinem Lauf. Schwarze Wolken brauten sich am Horizont beunruhigend schnell zusammen. Ein Blitz schnitt den Himmel entzwei.
Der dicke Wachmann hastete schnaubend über das unebene Kopfsteinpflaster geradewegs auf das klaffende Maul der imposanten Residenz zu. Die Außenbeleuchtung war bereits abgeschaltet, sodass sie, einer Trutzburg gleich, im Sternenlicht zu schlafen schien.
Das Hemd klebte ihm am Rücken, und bei jedem Schritt drohten die Beine der ausgeleierten Sporthose ihn zu Fall zu bringen. Von Stirn und Schläfen rann ihm der Schweiß hinab und vermengte sich mit den Resten Spinat, die noch an seinem Kinn klebten.
«Verdammt», keuchte er, als er schon von weitem sah, dass die Tür am Seitenportal offen stand. Gehetzt schaute er sich um, ob noch jemand seine Fahrlässigkeit entdeckt hatte. Doch niemand schien sich für die vergessene Tür zu interessieren, die ins Innere der Residenz führte. Auch auf dem Parkplatz, der sich über eine Fläche so groß wie drei Fußballfelder erstreckte, herrschte Leere. Lediglich ein paar Autos standen verwaist am Eingang zur Residenz-Gaststätte.
Aus der nahe gelegenen Musikhochschule waren klassische Klänge zu hören. Hinter sperrangelweit geöffneten Fenstern übten Musiker die Kleine Nachtmusik ein. Es waren die Bamberger Symphoniker, die am kommenden Samstag das alljährliche Mozartfest im Hofgarten eröffnen sollten.
Der Wachmann schleppte sich auf die verglaste Eingangstür zu. Am Türstock angekommen, sackte er erschöpft zu Boden.
«Kreuzverreck», röchelte er, als wollte er sich auf der Stelle übergeben. «Lang mach ich des fei nimmer mit.»
Er japste nach Luft und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er holte den schweren Schlüsselbund hervor und suchte im silbern scheinenden Mondlicht, das allmählich von den aufziehenden Wolken verdeckt wurde, nach dem passenden Schlüssel.
Im dunklen Gang hinter ihm schlug plötzlich Metall auf Metall. Der Wachmann erschrak.
«Ist da jemand?», rief er vorsichtig aus.
Er wartete, bis der Hall seiner Stimme verklungen war, um seine Frage zu wiederholen. Erneut bekam er keine Antwort.
«Wenn da jemand ist, dann raus! Sofort! Das ist meine letzte Warnung», donnerte es nun aus seiner geschwellten Brust. Doch auch jetzt wollte sich nichts und niemand ergeben.
Der Wachmann zögerte. Er konnte sich nicht entscheiden. Sollte er hineingehen und herausfinden, was sich dort tat, oder war ein kontrollierter Rückzug angebrachter? Er dachte an sein schmales Gehalt und an seine Rolle als Ernährer und Familienoberhaupt.
So ergriff er die Türklinke, um die Tür wieder zu schließen. Noch bevor sie zufiel, quetschte sich ein dumpfer Knall heraus, so, als wäre ein Eimer zu Boden gefallen und hätte seinen Inhalt verstreut.
Dieses Geräusch kannte er nur zu gut, um es übergehen zu dürfen. In den vergangenen zwei Monaten hatten die Restaurateure unter dem Deckenfresko einen beträchtlichen Steinbruch aufgerichtet, und der grobkörnige Dreck verteilte sich über die wertvollen Holzböden. Mit Engelszungen hatte er auf sie eingeredet, damit sie Acht gaben und Respekt hatten vor einem Bauwerk, das einzigartig war.
Nun fest entschlossen, schob er die Tür auf, brummte voller Missmut und tastete sich an der Wand entlang.
Im weiten Treppenhaus baumelte eine verdreckte Glühbirne von einem der beiden Gerüste herab und warf ihr schwaches Licht auf die vornehmen Statuen aus dem 18. Jahrhundert. Von der rechteckigen Galerie führten an den Längsseiten zwei Treppen ins Erdgeschoss hinab, die sich auf halber Höhe zu einer vereinigten. Unten am Treppenaufgang türmten sich Bauschutt und Holzlatten. Über allem thronte das rotundenförmige Deckengewölbe.
Die Restaurierungsarbeiten am Deckenfresko von Giambattista Tiepolo standen unmittelbar vor dem Abschluss. Nur noch eines der Gerüste, mittig in luftiger Höhe an der Decke verankert, war voll verschalt. Allein an dieser Stelle konnte das Fresko nicht eingesehen werden.
Die Fassung der Glühbirne hatte sich in einer tief gelegenen Leitersprosse verfangen und drohte durch das ruckartige Zerren am Kabel zu zerspringen. Die Verschalung am Gerüst wurde zur Seite geschoben, und eine Gestalt stieg vorsichtig die Leiter herunter. Sie trug weiße Strümpfe, die von einer rubinroten Kniebundhose gehalten wurden. Darüber schloss sich ein ebenso farbiges Wams an, ein weißer Schal um den Hals und auf dem Kopf eine rote Kappe. Von ihr ging in weitem Bogen eine weiße, zirka fünfzig Zentimeter lange Feder ab, die von der Spitze her farbverschmiert war.
Beim Herabsteigen fiel ein Gipsbrocken vom Gerüstplateau herab, schlug hart auf der schweren Steintreppe auf und kullerte bis zum Bauschutthaufen hinunter. Dort kam er neben einem Brett mit aufragenden Nägeln zum Liegen.
«Porco dio», zischte die Gestalt mit zusammengekniffenen Zähnen. Sie verharrte ein paar Sekunden unbeweglich, horchte in den dunklen Treppenaufgang unter ihr.
Alles schien ruhig. Sie stieg weiter Sprosse für Sprosse herab, löste die Fassung der Glühbirne aus der Leiter, nahm sie mitsamt dem Kabel in die Hand und stieg zurück nach oben.
«Hallo, ist da jemand?», tönte ein Echo aus der Eingangshalle empor. Die Gestalt fuhr erschrocken zusammen, drehte sich langsam um, und hastige Augen suchten nach der Gefahr im weiten Treppenhaus.
Der Wachmann tastete vergebens nach dem Lichtschalter. Tausendmal hatte er ihn schon ein- und ausgeschaltet, aber gerade jetzt konnte er ihn nicht finden. Mit ausgestreckten Armen trippelte er weiter, bis er an der letzten Säule am Treppenaufgang angekommen war. Ein schwacher Lichtschein fiel vom Obergeschoss auf den Schutthaufen, der sich zwischen der ersten Stufe und der Treppenumkehr befand.
Konzentriert nahm er Stufe um Stufe und sinnierte, wer zu jener späten Stunde noch im Haus sein konnte.
Als er den Bauschutthaufen erreicht hatte, blickte er empor, um die Quelle des Lichts auszumachen. Verlassen baumelte die Glühbirne zwanzig Meter über ihm am Gerüst, von dem eine Leiter zur Balustrade führte.
«Wer ist da oben?», rief er streng. Er erwartete eine sofortige Antwort.
Stattdessen erlosch der karge Schein. Die Leiter knarrte.
«Kruzifix. Stellt das Licht wieder an, oder soll ich mir alle Knochen brechen?», brüllte er zum Baugerüst hinauf.
Da noch immer nichts geschah, trieben ihn Pflicht und Stolz die Treppe hoch. Im Obergeschoss angekommen, fand er die Leiter vor, die noch immer an der Balustrade lehnte, und rief nach dem Handwerker der späten Stunde. Keine Reaktion.
Hinter ihm standen die hohen Flügeltüren zum Weißen Saal offen. Er trat hindurch, stapfte weiter in den Kaisersaal und fand auch dort niemanden.
«Jetzt reicht’s mir aber. Ich bin doch net euer Depp!»
Hundertfach verhöhnte ihn das Echo. Wutentbrannt stürmte er zur Balustrade zurück und rüttelte an der Leiter.
Sie führte hoch zum Gerüst, das mit Hilfe von Stangen auf dem Handlauf der Treppe abgestützt war. Im Halbschatten wirkte es wie eine riesige Spinne, die zum Angriff bereit war. Über einer Leitersprosse hing das Kabel samt erloschener Glühbirne. Er musste sich weit hinauslehnen, um sie zu fassen. Auf den Zehenspitzen hangelte er danach, bis er sie endlich schnappen und mit einem Ruck an sich heranziehen konnte. Mit einem jähen Aufschrei gab er sie jedoch sofort wieder frei. Die heiße Birne knallte gegen die Leiter und zerbarst mit einem dumpfen Knall.
«Kruzitürken», fluchte er.
Instinktiv drückte er die Hand auf die Marmorbrüstung, die trotz der Hitze der letzten Wochen erstaunlich kühl geblieben war. Langsam linderte der Stein den Schmerz, und der Wachmann entspannte sich.
Hinter der Flügeltür zum Weißen Saal trat leise jemand hervor und näherte sich dem Wachmann, der sich erleichtert umdrehte.
«Na endlich, wie lange soll ich …», konnte er noch sagen, bis er stockte, da er sich einer seltsamen Gestalt gegenübersah. Ungläubig musterte er sie im schwachen Schein des einfallenden Lichts.
Auf dem Kopf schien die Gestalt eine seltsame Kappe zu tragen, darunter einen für die Jahreszeit mörderisch warmen Frack, Kniebundhosen und zu guter Letzt Schuhe, die sich spitz nach oben kringelten. Ein Blitz von draußen erhellte die bizarre Szenerie schlagartig. Er starrte für einen Moment in die schmalen Gesichtszüge eines jungen Mannes. Seine dünnen Lippen waren zu einem wirren Lächeln verzogen, die schmale Nase führte zu einem Augenpaar, das durch zwei dünne, für einen Mann außergewöhnlich gepflegte Augenbrauen eingerahmt war.
«Che cosa c’è?», fragte der junge Mann übertrieben freundlich. Dabei zog er das è gekünstelt in die Höhe. Die Lippen versprachen dem Wachmann Hilfe, doch die Augen blieben kalt.
«Wer … wer sind Sie?», wollte der Wachmann wissen.
«Sono il maestro.»
Dieses Mal veränderte er die vorher helle Stimme zu einem dunklen Bass. Er legte seine von einem farbverschmierten Handschuh verhüllte Hand auf die Schulter des Wachmannes und hielt sie umklammert.
Der Wachmann schaute verdutzt der noch immer lächelnden Gestalt ins Gesicht, wartend, was als Nächstes geschehen würde.
Langsam erhob sich die andere Hand. Sie hielt etwas Gebogenes, Helles, mit einer scharfen Spitze. Eine Feder. Als der Arm ganz ausgestreckt war, schoss er herab. Die Feder bohrte sich in den Hals des Wachmannes. Durch die Wucht des Stoßes drohte dieser über die Balustrade zu fallen. Seine Augen waren weit aufgerissen, aus seinem Mund traten schaumiges Blut und ein kehliges Röcheln, das im aufstoßenden Blutschwall schnell erstickte. Der dünne Faden verlor sich im fahlen Lichtschein hinab ins Dunkel, mit einem Ruck folgte der schwammige Körper. Der Aufschlag war dumpf. Eine Holzlatte brach.
Oben an der Balustrade hielt die Gestalt die Feder in das einfallende Straßenlicht. Einem Thermometer gleich, sog sich das Blut am Schaft entlang in die Höhe und verteilte sich nach außen in die Federn. Das Rot begann die Gestalt zu begeistern, und die Bewunderung wuchs im Tempo des aufsteigenden Saftes.
«Che rosso!», rief sie aus, als ein Blitz das Treppenhaus in gleißendes Blau tauchte und der Donner des Gewitters die Fenster erschütterte.
2
Sie zu warnen wäre sinnlos gewesen. Ihre selbstgerechte Überheblichkeit ließ es nicht zu. Jeder wusste, was hier vor sich ging. Dass man nicht den Hauch einer Chance hatte. Dafür waren die Jungs zu gut. Ihr System war einfach, beruhte auf Menschenkenntnis und einem sicheren Auge. Es gab keinen Trick im Spiel der drei Scheiben. Nichts geschah jemals verdeckt. Alles passierte direkt vor ihren Augen. Jede Bewegung konnte eingesehen werden. Den einzigen Vorwurf, den man ihnen machen konnte, war, dass sie unbarmherzig mit den Geldtaschen umgingen. So nannten sie sie. Nicht Monsieur, Mister oder Mein Herr, sondern einfach nur Geldtaschen. Denn mehr waren sie in ihren Augen nicht wert.
Kilian hegte eine fast selbstverständliche Sympathie für sie. Nicht, dass er es nach außen gutheißen konnte, was sie da mit den Müller-Lüdenscheids, Smiths und Le Grands anstellten. Das verbot ihm sein Auftrag als Gesetzeshüter. Aber er schätzte ihr Können. Die Kunst, das Auge zu verführen. Es in eine Richtung zu lenken, es zu täuschen und zu unterhalten. Reihenweise ließen sie sich unter der Sonne Genuas von den Scheibenspielern ausnehmen. Jeder wettete, dass er zwischen weiß und schwarz unterscheiden konnte. Doch am Ende mussten sie zahlen und fortan schweigen.
Genuas Porto Vecchio lebte nach einer einfachen Regel. Sie basierte auf dem kollektiven Einverständnis, die Kuh zu melken, solange sie sich auf der Weide befand. Das war legitim. Jeder machte das. Auch er, wenn er in seine zahllosen Masken schlüpfen musste, um die entscheidende Information zu bekommen, die Quelle des Verrats auszumachen oder einfach nur, um sich zu schützen.
Es war kurz nach 22.00 Uhr. Die Schiffe spuckten ihre Ladung aus. Tagesausflügler prahlten mit dem Tand, den sie bei fliegenden Händlern erstanden hatten. Deutsche und englische Touristen schoben sich an ihm vorbei. Ab und zu ein Schweizer. Doch in der Hauptsache deutsche Geldtaschen, prall gefüllt mit Weitwinkelobjektiven, surrenden Videokameras und Portemonnaies.
Ein Deutscher – Kilian schätzte ihn auf fünfzig Jahre –, Berliner, hatte sich in der weit verzweigten Altstadt mit unzähligen kleinen Fluchtgassen verloren und schrie nun verzweifelt nach den Carabinieri. Aus seinem Mund sprudelten Flüche und Verwünschungen, schließlich Niedergeschlagenheit, da er einsehen musste, dass sich niemand für ihn interessierte. Genovesen und Carabinieri hatten nur mitleidiges Kopfschütteln für einen übrig, der seine Haut freiwillig zu Markte trug. In diesem Fall in der Via di Pré, wo er schon nach zwanzig Metern am ersten Stand in seinen aufgeschlitzten Bauchbeutel griff.
Die Sonne war seit einer Viertelstunde hinter dem Porto Vecchio untergegangen. Der rote Streif verlor sich am Horizont, und der Gestank von Diesel und Salzwasser verflog allmählich. An der Hafenmole reihten sich vergammelte Fischerboote aneinander, die zusammengeschusterten Netze waren zum Trocknen aufgespannt. Aus den Kajüten drang fetter, fauliger Dunst, eine Mischung aus Tabak, Fischinnereien, Pesto und gebratenem Gemüse.
Kilian hätte tausendmal lieber über den Dächern der Stadt vor einer Flasche Tignanello und einem Teller Scampi gesessen, als sich im neuen Armani-Anzug an der Via di Gramsci die Beine in den Bauch zu stehen. Er lauerte Galina auf. Sie war der Schlüssel zu Sergej und der Lohn für ein Jahr aufreibender Ermittlungsarbeit. Nur über sie konnte er an ihn herankommen – das Phantom Sergej. Sein Gesicht, das in keinem Computer von Interpol gespeichert war und das man nur aus Erzählungen kannte, sein Einfluss, der hohe Regierungsbeamte aus der Mittagsruhe holte, und sein Geld, das über Sein oder Nichtsein entschied. Was Sergej sagte, war Gesetz. Für viele vernichtend, sofern sie nicht gehorchten. Galina war sein Fleisch gewordener Wille. Wenn sie sprach, befahl der Herr.
Ein einziges Mal hatte Kilian sie bisher zu Gesicht bekommen. Nur kurz, vor wenigen Tagen, als sie mit zwei Leibwächtern durch die engen Gassen der Altstadt flanierte. Wie Kegel stoben die meckernden Touristen auseinander, wenn sie den Weg für Galina freimachten. Es war ihr Terrain, und daran ließ sie keinen Zweifel.
Selbst die Carabinieri respektierten sie als feste Größe im Hafenviertel. Kein Wunder, denn Galina sorgte für Ordnung, wo sie keinen Einfluss mehr hatten. Sie half, wo der Staatssäckel verebbte, und sie entschied, wenn sich die mächtigen Familien in den Haaren lagen. Sie war das Regularium, wenn niemand mehr helfen wollte und die Vendetta drohte. Dafür durfte sie ihren Geschäften nachgehen, ohne ernsthafte Verfolgung befürchten zu müssen. Jedoch gab es auch für sie eine Grenze. Kein Carabiniere durfte sein Leben verlieren. Kilian konnte das akzeptieren. Ohne die andere Seite ging auf Dauer nun einmal nichts.
Es war aber sein Job, den Galinas und Sergejs das Handwerk zu legen. Dafür war er ausgebildet worden, dafür hatte Europol ihn nach Barcelona, Marseille und schließlich nach Genua geschickt. Immer auf der Spur Sergejs und Galinas. Sie hatten ihr Verteilernetz über den ganzen Mittelmeerraum gespannt. Gespeist wurde es von Sewastopol aus. Sergejs Familie genoss dort vor und nach der Oktoberrevolution die besten Geschäftskontakte. Und das änderte sich nicht, auch nicht nach Glasnost und Perestroika mit den neuen Genossen, die Geschmack am Westen und an der Marktwirtschaft gefunden hatten. Die Krim war seine Burg, sein Hafen, aber auch heilige Erde. Denn er war stolzer Tatare.
Nie zuvor war Kilian ihm so nahe gekommen. Heute Nacht würde er sich ihm zeigen. Sergej hatte einen Schatz im Angebot. Einen vergoldeten und mit Edelsteinen besetzten Schrein aus dem Grab eines ägyptischen Königs, der im Sturm auf Berlin in die Hände der einmarschierenden Roten Armee gefallen war und über Asien, Südamerika und Europa schließlich wieder in Sergejs Fänge geraten war. Amerikaner, Araber oder Japaner würden jede erdenkliche Summe dafür zahlen. Aber Sergej musste sich beeilen. Der Schrein war nur schwer vor den Augen seiner Helfer zu verbergen. Lagerung und Transport waren ein zusätzliches Problem. Das Ding wog gut eine Tonne.
Kilian sollte im Auftrag von Europol und des LKA München den Schrein für die Europäer sicherstellen, bevor ihn die anderen in die Finger bekamen und er auf immer in einer privaten Sammlung verschwinden würde.
Kilian nahm einen letzten tiefen Zug von seinem Zigarillo. Es war bereits halb elf. Galina hätte sich schon längst zeigen müssen. Sein Informant war sicher, dass sie an diesem Abend ins La Gondola kommen würde. Nur wie sicher war «sicher» nach Genoveser Definition? Pendini riet zum Abwarten. Er war sein Kontaktmann vor Ort und Leiter der italienischen Sondereinheit für organisierte Kriminalität. Im Einsatzzentrum wartete das Sonderkommando auf Kilians Zeichen, wenn ihn Galina zum Schrein und somit zu Sergej führte. Doch zuvor musste sie sich erst mal zeigen. Vorher wollte Pendini die Pferde nicht scheu machen.
Kilian wurde unruhig. Er ging an der Hafenmole entlang und überprüfte die in die Altstadt abzweigenden kleinen Straßen, vielleicht würde Galina aus dieser Richtung kommen. Außer Händlern, Taschendieben und Geldtaschen war jedoch nichts zu sehen. Vielleicht war sie aber auch gewarnt worden? Keiner konnte hier den Mund halten. Obwohl das oft der Gesundheit zuträglicher war.
Er ging auf einen Fischer zu, der gerade sein Boot für die Nacht klarmachte. Es war einer von der Sorte, die wusste, was in ihrem Viertel, im Hafen vor sich ging. Seine Augen waren stets überall, die Ohren weit geöffnet, und sein siebter Sinn schlug Alarm, wenn Gefahr im Anzug war. In diesem Moment war es so weit. Er zog eilends den schmalen Holzsteig von der Hafenmauer zurück auf sein Boot.
«Scusi, signore!», rief ihm Kilian zu.
«Non capisco», kam es zurück, und der Fischer ging unter Deck.
Mist. Sogar ein dahergelaufener Fischer hatte ihn erkannt. Zumindest ahnte er etwas. Kein Wunder, dass Galina nicht auftauchen würde. Sie hatte den Braten bestimmt schon von weitem gerochen und ahnte, dass hier jemand anderes als ein Käufer auf sie wartete.
Kilian beschloss, die Sache abzubrechen und Pendini zu informieren. Er kramte in seiner Hosentasche nach dem Schlüssel für die Harley, die wenige Meter weiter im Schutze eines Carabiniere stand. Kilian hatte ihm erlaubt, sie zu bewachen. Und das machte er gut. Zwei schwarzhaarige Fraschette belagerten ihn, während er von seinen Touren durch die Alpen und nach Spanien prahlte.
Kilian ging auf ihn zu, als eine grüne Jaguar-Limousine in die Via di Gramsci einbog und vor dem Eingang zur Altstadt hielt.
Ein Hüne in schwarzem Anzug stieg auf der Beifahrerseite aus und öffnete die Hintertür. Anmutig trat Galina auf das schmierige Trottoir. Allem Anschein nach war sie Kubanerin. Kaffeebraune Haut, hoch gewachsen, mit schwarzem Kurzhaarschnitt. Ein weißes, eng anliegendes, rückenfreies Kleid schwebte respektvoll um ihren Körper. Sie drehte ihren Kopf zur Seite und deutete den Weg. Touristen und Einheimische traten ehrfurchtsvoll zur Seite. Der Fahrer lief eilfertig um den Wagen und steuerte zusammen mit dem Hünen auf die Via di Pré zu. Bevor sich die Gasse, die die Leibwächter für sie freigemacht hatten, hinter Galina wieder schloss, bestaunte Kilian, was er da vor sich sah. Galina war mehr als nur eine Kriminelle, die er dingfest machen sollte. Sie war eine von diesen Frauen, für die man sich wider besseres Wissen ins Unglück stürzte, um einen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.
Er war gefährdet wie jeder andere Mann an seiner Stelle auch. Das wusste er, als er seinen Armani-Anzug zurechtzupfte, die schulterlangen braunen Haare zurückstreifte und sich auf den Weg ins La Gondola machte, um in die Rolle des Hubertus von Schönborn zu schlüpfen – dem Abgesandten eines Konsortiums finanzkräftiger Investoren.
3
In der Bischofsstadt mit den 99 Kirchen tobte indes ein Gewitter, dass es selbst dem frömmsten Katholiken angst und bange um sein Seelenheil wurde. Das Unwetter hatte sich im Kessel, in den sich die Mainstadt schmiegte, festgesetzt. Der Himmel entlud sich zornig zwischen den drei Haupterhebungen der mainfränkischen Metropole, dem Steinberg, Festungsberg und Galgenberg. Der Sturm peitschte den Regen durch das Tal und wusch die wertvollen Weinböden aus. Die Straßen im Frauenland und in Grombühl waren Sturzbächen gewichen, die herrenlose Fahrräder und Mülltonnen mit sich rissen. Die Blaulichter ausrückender Feuerwehren tanzten über den Autodächern, und der Klang der Martinshörner vermischte sich mit dem Heulen des Sturms und dem Bersten und Grollen des Gewitters.
Ungeachtet dessen fand im obersten Stockwerk der Polizeidirektion eine kleine, förmliche Abschiedsfeier statt. Rund dreißig uniformierte Beamte harrten seit einer geschlagenen halben Stunde in Habtachtstellung aus, um den gesalbten Worten ihres Polizeidirektors Ferdinand Oberhammer zu lauschen. Oberhammer war ein stämmiger, nicht allzu großer, grobschlächtiger Typ. Im runden und gut durchbluteten Gesicht thronte ein beträchtliches Riechorgan, das er hin und wieder mit weißem mentholhaltigem Schnupftabak füllte. Darüber prangten zwei buschige Augenbrauen, die ihn in die Nähe des früheren Wirtschaftsministers rückten. Seine Hände waren kräftig und an den Knöcheln so behaart, dass er kalte Finger im Winter nicht zu fürchten brauchte. Doch all das unterschied ihn nicht sonderlich von den Kollegen vor ihm. Sein Aussehen war zweitrangig. An erster Stelle, und das ließ er jeden möglichen Zweifler wissen, stand der Umstand, dass er Oberbayer war. Gebürtiger und stolzer Sohn eines Ortsvorstandes aus Oberpframmern, südwestlich seines Shangrilas gelegen – München, Hauptstadt und Ziel seines Strebens.
Oberhammer kämpfte derweil nicht nur mit seiner Rede, die seine Sekretärin Uschi fein säuberlich auf zwölf Seiten getippt hatte, sondern auch mit der Wahl des richtigen Tons. Sein polternder oberbayerischer Dialekt stand im Gegensatz zum verschmitzt heiteren, nicht immer leicht verständlichen Mainfränkischen.
An seiner Seite stand entspannt der Ehrengast des Abends, der scheidende Kriminalhauptkommissar Erwin Schömig. Geduldig ließ er die Erinnerungen an seinen Dienst als Leiter des K1, des Kommissariats für Tötungsdelikte und Sexual- und Brandsachen mit Todesfolge, über sich ergehen. Wie sehr hatte er den heutigen Tag seit dem Amtsantritt Oberhammers herbeigesehnt. Schömig konnte sich beim Anblick des um jedes Wort ringenden Oberhammer ein Schmunzeln nicht verkneifen.
«Kriminalhauptkommissar Schömig», sprach Oberhammer eindringlich und mit einer unüberhörbaren Drohung ausgestattet, «hat sich nie mit der einfachsten Lösung zufrieden gegeben. Es woar sei …, na ja, auch sei Verdienst», verbesserte er sich, «dass euer …», er räusperte sich auffällig laut und nachhaltig, um den vermeintlichen Versprecher zu überspielen, «dass unser Würzburg in derer Kriminalstatistik unseres ehrwürdigen Freistaates so guat dasteht.»
Um seine Aussage zu untermauern, kramte Oberhammer im Bündel der verknitterten Schreibmaschinenseiten nach der Statistik und wippte unruhig, als er sie auf Anhieb nicht finden konnte. Aus dem Hintergrund trat eilends Uschi hervor, um ihn auf die richtige Spur zu bringen.
«Wenn ihn doch endlich mol der Schlag treff dät», zischte Heinlein an die Schulter seines Kollegen.
«Dafür würd i gladd a Sau schlacht», kam es prompt zurück.
Heinleins Kopf schoss zur Seite. «Werkli?»
Uschi und Oberhammer fieselten inzwischen die Seiten auseinander, doch die kriminalistische Hitliste des Freistaates blieb unauffindbar.
Schömig machte nicht im geringsten Anstalten, seinem Vorgesetzten und Erzfeind aus der Klemme zu helfen. Er stand einfach da und genoss. Dabei stützte er sich auf einen Gehstock, den er seit zwei Jahren immer öfter brauchte und in den letzten Monaten einfach nicht mehr versteckt halten konnte.
Seinem Kollegen und eigentlichen Nachfolger Kriminaloberkommissar Georg Heinlein hatte er es zu verdanken, dass die Gehhilfe nicht schon weit früher aufgefallen war. Heinlein hatte ihm den Rücken freigehalten. Die gefährlichen Einsätze, bei denen es um Sekunden ging und körperliche Fitness über Kopf und Kragen entschied, hatte sein Freund Schorsch geleitet. Das rettete Schömig die karge Rente und den letzten Rest Ehre für eine bedeutungslose Zukunft.
«Zweiundvierzig Dienstjahre. Und, was hat er jetzt davon?», raunte es an Schorsch Heinleins Schulter.
«Mageng’schwür, zerschossene Knie und ’ne G’schiedene», antwortete Heinlein. «Aber er hat’s wenigstens hinter sich.»
Heinlein schaute sich noch einmal an, wie sich Schömig nur mühselig auf den Beinen hielt. Ob es ihm auch mal so ergehen würde? Wann würde ihn die Kugel treffen? Würde er überhaupt so lange durchhalten? Mit Mitte dreißig gewannen diese Fragen an Bedeutung.
Schömig hatte ihn vor acht Jahren aus dem Streifenwagen in seine Abteilung geholt und ihm alles beigebracht, was er als Kriminaler wissen musste – Spuren auswerten, taktisches Verhalten bei den Ermittlungen, Umgang mit Staatsanwaltschaften und Richtern. Und mehr als alles andere: wie man Oberhammer aus dem Weg gehen konnte. Wenn es nach dem feisten Oberbayern gegangen wäre, würde Heinlein immer noch mit Blaulicht um die Häuser fahren und sich von besoffenen Randalierern voll kotzen lassen. Er war für Oberhammer ein rotes Tuch. Ein Eisenbahnerbub, der nichts in seinem Kommissariat zu suchen hatte. Dort wollte er nur Spürhunde mit Format, wie er sich ausdrückte. Ermittler, die Erfolge einfuhren. Aufklärungsrate, Statistik, zero tolerance. Das war die Voraussetzung für eine glorreiche Rückkehr Oberhammers ins Münchner Präsidium. Heinlein, ein Franke, konnte in den Augen des Oberbayern dafür nicht taugen.
Oberhammer hatte inzwischen die Suche nach dem Dokument aufgegeben und rang um einen neuerlichen Einstieg. Jetzt in freier Rede.
«Ein vorbildlicher Polizist», giftete Heinlein vorausahnend.
«Unser liaber Kollege Schömig», setzte Oberhammer an, «a vorbildlicher Polizist, geht heit in sei wohlverdiente Pension. Wer mi kennt, woas, dass i des Kompliment nur selten soag …»
Ein verächtliches Räuspern aus der zweiten Reihe brachte den Redefluss Oberhammers ins Stocken. Seine buschigen Augenbrauen krümmten sich nach innen und bildeten mit der grobporigen Nase ein unansehnliches Fadenkreuz, das die Quelle des Widerstandes auszumachen suchte. Aber wie so oft seit der Übernahme des Amtes, das er gar nicht haben wollte, gab sich niemand aus der feigen Bande zu erkennen. Das ging nun schon die ganzen drei Jahre so.
«Kollege Schömig verlässt uns heit», führte Oberhammer zum wiederholten Male aus, «und i soll … derf Äna im Namen von uns oin viel Glück und oan beschaulichen Lebensabend wünschen. Liaber Kollege, wenn i jetzt zum Abschluss unserer net immer ganz fruchtbaren Zusammenarbeit a persönliches Wort an di richten derf …»
Das persönliche Wort riss dreißig Augenpaare aus der Lethargie. Selbst Schömig erschrak. Er verlagerte sein Gewicht auf den Gehstock und ging auf Sicherheitsabstand zu Oberhammer.
«Gehabt di wohl und denk a amol an uns, wie wir a an di denken. Amen.»
Oberhammer war heilfroh, am Ende dieser unangenehmen Pflichtübung angekommen zu sein, und wedelte Uschi mit den Seiten seines Manuskriptes herbei.
Uschi schleppte sich an einem Fresskorb, der mit Bocksbeuteln, Salami und Knabberzeugs prall gefüllt war, fast zu Tode und stellte ihn Oberhammer vor die Füße.
Uschi war eine zierliche Person. Kolleginnen beschrieben sie als zickig. Sie trug ihr schwarzes Haar hochgesteckt, und auf ihrer Stupsnase suchte eine schwarze Hornbrille verzweifelt Halt. Es machte sie einen guten Schuss intellektueller, wenn sie bei einer Frage absichtlich erst einmal das Gestell zurechtrückte und die Nachdenkliche mimte.
Oberhammer machte sich nicht die Mühe, den Fresskorb hochzunehmen und ihn Schömig zu überreichen. Stattdessen schüttelte er ihm mit einem gezwungenen Lächeln die Hand und entließ ihn in den Stand eines Privatiers. Der falsche Gesichtsausdruck Oberhammers verriet jedoch jedem im Raum: «Schleich di und lass di nimmer seng.»
Schömig nahm es hin und wandte sich seinen Kollegen zu.
«Ich will net viel Worte verlier», sagte er und schielte zur Seite, wo ein Buffet auf die hungrigen Beamten wartete. «Es war a lange Zeit, die ich bei euch war. Viele, die jetzt vor mir stehen, hab ich noch als Buben gekannt oder …», dabei deutete er schmunzelnd auf immerhin sieben Beamtinnen, «als kleine Mädle mit Zöpfen und Gummibändern. Jetzt seid ihr alles gstandene Polizisten worn, und ich bin a bissle stolz darauf, dass ich euch hab helf könn. So, des war’s. Macht’s gut und bleibt sauber. Das Buffet wartet.»
Die Ehrenformation hob geschlossen die Hand zum Polizistengruß. Schömig erwiderte den Gruß zum letzten Mal. Dann löste sich die Formation auf und stürmte geschlossen das Buffet.
Heinlein ging auf Schömig zu. Er hatte Tränen in den Augen und mühte sich redlich, sie zu unterdrücken. Schömig nahm ihn in die Arme und drückte ihn an sich.
«Schorsch», sagte er, «altes Haus. Jetzt heul mir bloß keinen vor, sonst fang ich auch noch an.»
Heinlein gehorchte, auch wenn es ihm verdammt schwer fiel. Schömig löste die Umarmung und fasste ihn bei der Schulter.
«Du wirst es schon hinkriegen», ermutigte er Heinlein. «Und wenn du mal nicht weiterweißt, bin ich auch noch da. Ruf mich einfach an. Okay?»
Heinlein nickte und streifte sich mit dem Ärmel die Wangen trocken.
«Abschiedsschmerz?», frotzelte Oberhammer, der sich genüsslich neben den beiden aufbaute und mit einiger Mühe seinen randvoll geladenen Teller festhielt.
Heinlein bemühte sich, die aufsteigende Wut zu unterdrücken und Oberhammer nicht auf der Stelle eine zu verpassen. «Lang hat’s gedauert», sagte Heinlein, «aber jetzt hamses ja gschafft.»
«Machen Sie sich bloß keine Hoffnungen», konterte Oberhammer, der mit einem Wurstbrötchen kämpfte. Der Schinken hatte sich zwischen Zähnen und Gaumen verfangen. Er würgte und schnappte nach Luft.
«Wer wird denn nun mein Nachfolger?», fragte Schömig neugierig. «Nachdem Ihnen der Kollege Heinlein nicht gut genug ist, muss es ja schon ein ganz besonderes Kaliber sein.»
«Lassen Sie … das … nur meine … Sorge sein», röchelte es unverständlich aus Oberhammer heraus. «Ich hab schon jemand aus München angefordert. Der wird den Laden wieder auf Vordermann bringen.»
Der Brocken wollte sich nicht lösen. Oberhammer ließ den Teller fallen und rannte zur Toilette. Das mainfränkische Wurstbrötchen hatte seinen Dienst getan.
«Hoffentlich erstickt er dran», raunzte Heinlein ihm hinterher.
«Lass gut sein, Schorsch», besänftigte Schömig. «Du hast noch über zwanzig Dienstjahre vor dir.»
«Ich weiß nicht, wie ich das durchhalten soll. Vielleicht sollte ich ihn bei einem Einsatz …», sinnierte Heinlein. Er trommelte erwartungsvoll mit den Fingern auf seiner Waffe.
Schömig lachte und zog Heinlein Richtung Buffet. Die Kollegen hatten bereits ganze Arbeit geleistet. Die Schlachtplatte verdiente nur noch den ersten Teil ihres Namens.
Der Regen hämmerte wie Maschinengewehrfeuer an die Fensterscheiben. Draußen tobte der Sturm über dem Marienberg. Von der Festung war nicht mehr viel zu sehen. Nur noch ein schwacher Lichtschein ließ im Regengrau erahnen, dass sie da oben stand. Ein Blitz erhellte den obersten Stock des Polizeigebäudes, und das Klingeln des Telefons ging nahezu im darauf folgenden Donner unter.
Ein Beamter nahm das Gespräch entgegen und rief nach Oberhammer.
«Herr Polizeidirektor, Ihre Frau. Sie sagt, der Keller ist schon voll gelaufen, und die König-Ludwig-Statuen treibt’s die Straß nunter.»
Schallendes Gelächter und Gejohle brach über Oberhammer herein, der aus der Toilette zum Telefon hastete.
«Himmiherrgottsakrament!», schrie er in den Hörer. «Holse zruck. I bin glei do.»
Wie von der Tarantel gestochen, rannte Oberhammer die Treppe hinunter, um zu retten, was ihm in der Ferne Heimat war.
Einige Beamten stießen auf die schicksalhafte Fügung und Rettung des Abends an. Das Radio wurde laut gestellt, und Discomusik hallte durch den Stock. Ein Beamter räumte die Bierbänke zur Seite und zog die sich wehrende Uschi auf die Tanzfläche.
«Franz, lass des. Ich bin doch gar net richtig in Stimmung», wehrte sie sich vergebens.
«Wart’s ab, Uschi, gleich bist so weit», versprach ihr Franz.
Im Hintergrund tobte das Unwetter weiter. Feuerwehrautos, Sanitäter und Polizeifahrzeuge lieferten sich ein Wettrennen entlang des Mains, der soeben über seine Ufer trat.
«Ein Kaliber aus München», sagte Heinlein trostlos vor sich hin, «den Laden auf Vordermann bringen …»
4
Kilian duckte sich am Eingang hinter den schweren Damastvorhängen, die in dem italienischen Hafenrestaurant völlig deplatziert wirkten. Das Lokal bot an rund zwanzig Tischen Platz und besaß eine Bar, hinter der allerlei Seemannskitsch an der Wand hing. Die Kellner trugen ihre üblichen weißen Schürzen. In ihren unrasierten Gesichtern spiegelte sich jahrelange Erfahrung mit unterschiedlichen Gästen. Egal, welches Lokal gerade angesagt war oder auf der definitiven No-Liste stand, das La Gondola hatte alle Moden überstanden. Die Kellner konnten einem viel erzählen, wenn man sie auf einen Schnaps einlud.
Kilian beobachtete Galina und ihre beiden Begleiter, die sich hinter Sonnenbrillen verschanzten und neben ihr Wache standen. Sie hatte den besten Tisch gleich gegenüber der Bar und keine drei Schritte vom Hinterausgang entfernt, der als Fluchttüre nur mit einem abgewetzten «In caso di pericolo» gekennzeichnet war. Das Lokal war für die Uhrzeit noch gut besucht. Fischer, Händler und Nachbarn nahmen einen Drink, bevor sie von der jungen Genoveser Schickeria nach Mitternacht vertrieben wurden.
Kilian steckte seinen Dienstausweis und die Waffe, die ihm Pendini entgegen allen Vorschriften zugeschoben hatte, zwischen eine Ausgabe des Corriere dello Sport und ließ sie in einer Amphore verschwinden, die hinter der Eingangstür keine Beachtung fand.
«Na dann», ermutigte er sich und ging auf Galina zu.
Die Hünen nahmen ihn bereits beim ersten Schritt ins Visier. Als er auf Galinas Tisch zuhielt, kam ihm der linke entgegen und forderte ihn mit einer Handbewegung auf, stehen zu bleiben. Der andere schob vorbeugend seine Hand unter das Jackett.
Kilian machte Halt und schaute am Hünen hoch.
«Scusi, signore, aber ich habe eine Verabredung mit ihrer Chefin.»
Der Hüne verzog keine Miene und versperrte ihm weiterhin den Weg.
«Scusi», wiederholte Kilian und wollte sich an dem stummen Berg vorbeischieben. Doch der Hüne wich nicht zurück.
Galina musterte Kilian eingehend.
«Check ihn», befahl sie schließlich, und der Berg bewegte sich. Er tastete Kilian nach Waffen ab, danach nickte er ihr zu. Erst jetzt durfte Kilian sich dem Tisch nähern. Der zweite Hüne behielt die Hand im Jackett.
«Hubertus von Schönborn», stellte sich Kilian mit einer leichten Verbeugung vor und reichte ihr die Hand. «Man sagte mir, dass ich Sie hier finde.»
«Wer sagt das?», fragte Galina und schlug die Hand aus.
«Jemand, der meint, dass Sie ein gutes Geschäft zu schätzen wissen.»
«Haben Sie etwas anzubieten?»
«Ich bin hier, um zu kaufen.»
Galina wies ihm den Platz neben ihr zu. Kilian folgte der Aufforderung.
«Es freut mich, Sie kennen zu lernen, Herr von Schönborn», eröffnete Galina in akzentfreiem Deutsch die Verhandlungen.
«Wie kommt es, dass Sie so gut Deutsch sprechen?», fragte Kilian, obgleich er die Antwort wusste.
«Mein Vater lebte eine Zeit lang in Deutschland.»
«Interessant. Wo, wenn ich fragen darf?»
«Potsdam.»
«Potsdam bei Berlin?», fragte Kilian überrascht.
«Potsdam.»
«Wer hätte das gedacht», fuhr er fort, doch Galinas Miene zeigte, dass der Smalltalk beendet war.
«Ich kenne Sie nicht», setzte sie an, «obwohl mir Ihre Familie durchaus bekannt ist.»
«Ich arbeite unauffällig. Dieser Umstand hat sich bei schwierigen Verhandlungen als durchaus förderlich erwiesen.»
«Wie geht es der Verwandtschaft?», fragte Galina, «dem Grafen von …»
«Den Fürsten zu Castell meinen Sie?», führte Kilian den Satz weiter. «Gut. Er erfreut sich bester Gesundheit in seinen alten Tagen. Erst letzte Woche waren wir zusammen und …»
«Schon gut», unterbrach ihn Galina.
Sie befahl den Ober herbei, der ein zweites Glas mit Champagner füllte.
Galina hob ihres, Kilian nahm das seine. Beide prosteten sich zu. Ihre Blicke trafen sich. Kilian schaute in smaragdgrüne Augen, und ihr Lächeln verbannte jeden Ernst, den sie ihm bisher gezeigt hatte.
«Kommen wir nun zum Eigentlichen, zum Grund, wieso Sie mich sprechen wollten», sagte Galina und setzte ihr Glas ab. «Wofür interessieren Sie sich?»
«Für etwas ganz Besonderes, dass nur Sie mir geben können.»
Galina schien geschmeichelt. «Wie kommen Sie darauf?»
Diese Frage war keine. Sie war die Eröffnung. Der erste Schritt zum Schrein.
Kilian ging in die Offensive. «Ich habe meine Quellen und die Partner, für die ich spreche, auch.»
«Partner?»
«Geldsäcke, Verrückte, Golf spielende Langeweiler. Genau in der Reihenfolge.»
Galina lachte. «Eine interessante Mischung. Zu welcher Gruppe gehören Sie?»
«Von jedem etwas, deshalb kann ich für alle sprechen.»
«Nach einem Langeweiler sehen Sie aber nicht aus. Zumindest verstehen Sie sich zu kleiden.»
«Giorgio ist mir behilflich.»
Galina schien Gefallen an Kilian gefunden zu haben. Ihr aufmerksames Lächeln verriet ihm, dass sie eine amüsante Unterhaltung zu schätzen wusste.
«Sie kennen Giò?», fragte sie erstaunt.
«Ich sehe ihn selten. Die Arbeit nimmt ihn sehr in Anspruch.»
«Wie geht es ihm? Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört?»
«Er reist viel. Wie Sie offensichtlich auch.»
Kilian musste schnellstens das Thema wechseln. Was er über Giorgio wusste, hatte er aus der Presse, und was man sich sonst über den Modezaren erzählte.
Galina setzte zum geschäftlichen Teil an. «Meine Geschäfte sind nicht auf eine Stadt oder auf ein Land konzentriert. Doch jetzt zu Ihnen. Was suchen Sie genau?»
«Etwas, wovon ich hörte, dass es in Ihrem Besitz sei.»
«Und was, glauben Sie, ist das?»
Jetzt musste Kilian schmunzeln. Er hatte lange geübt, glaubhaft aus dem Stand ein befreiendes und ablenkendes Lächeln zu spielen.
«Etwas, für das es sich lohnt, um die Welt zu reisen. Immer auf der Suche nach dem sagenhaften Glanz, den die erlesenen Steine selbst im Dunkeln ausstrahlen», übertrieb er.
«Auch noch ein Dichter. Sie werden mir immer sympathischer», schmunzelte Galina und nahm einen Schluck Champagner. Sie schaute ihm dabei tief in die Augen. Kilian spürte ihren Blick in sein Innerstes eindringen. Er fuhr sich nervös am Kragen entlang.
«Heiß?», fragte Galina, wohl wissend, welche Wirkung sie auf ihn ausübte.
«Ungemütlich stickig hier drin», rettete sich Kilian auf seichtes Terrain.
«Möchten Sie lieber ein Glas Wasser?»
«Nein, nein. Es geht schon. Aber diese Temperaturen …»
«Mit Hitze muss man in Genua rechnen», sagte sie mitleidig, ohne es ernst zu meinen. Kilian entging nicht, wie sie provokativ ihre Beine übereinander schlug. Er räusperte sich und lehnte sich vor, um einen klaren Kopf zu behalten.
«Sie haben ihn hier? In Genua?», fragte er.
«Wen, ihn?»
«Den Schrein.»
Galina nahm ohne Hast eine Zigarette aus einem flachen silbernen Etui und hielt sie an ihre Lippen. Kilians Blick folgte dieser Geste. Erst als sie ihn auffordernd anlächelte, verstand er und gab ihr Feuer. Galina inhalierte tief und stieß den Rauch genüsslich in den Raum. Dabei lehnte sie sich lasziv auf der ledernen Couch nach hinten. Er konnte wiederum nicht umhin, den Blick dorthin zu richten, wohin sie es ihm befahl: auf ihre Brüste. Wie an einem Faden aufgehängt, rutschte er näher an sie heran. Der Hüne hinter ihm drückte ihn entschieden zurück.
«Ja, ich habe von einem Schrein gehört», sagte sie schließlich. «Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob Sie dazu die notwendigen Mittel aufbringen können. Er soll sehr kostbar sein, und die Angebote der Interessenten übertreffen sich stündlich. So hat man es mir berichtet.»
Kilian nahm einen Zigarillo aus seiner Reverstasche und steckte ihn an.
«Am Geld soll es nicht scheitern», versicherte er und zückte ein Scheckheft, auf dem das Signet der Castell’schen Bank zu erkennen war. «Meine Partner haben mich ermächtigt, jeden Preis einzutragen, auf den wir uns einigen. Doch bevor ich das tue, möchte ich das Objekt der Begierde sehen und anfassen.»
Kilian lehnte sich zurück und wartete ab. Galinas Blick haftete am Scheckheft. Doch sie fasste sich schnell.
«Papier», sagte sie abfällig.
«Mit meiner Unterschrift können Sie in jeder Bank zwischen Monte Carlo und Hongkong die eingetragene Summe bar abheben. Das Haus steht für mehr als nur Geld», antwortete er selbstbewusst.
Galina taxierte ihn. Jetzt musste es sich entscheiden. Entweder stieg sie auf die Finte ein, oder er würde Bekanntschaft mit den toten Fischen im Porto Vecchio machen.
Kilian zog am Zigarillo und schaute wie beiläufig auf seine Uhr. Das Surren eines Handys brach die Stille. Kilian griff in seine Tasche.
«Ja, hallo», sagte er und wartete. Dann: «Ciao, Paolo, kann ich dich in ein paar Minuten zurückrufen, es ist gerade ungünstig … oder warte mal …», er hielt Galina das Handy hin, sodass der Anrufer hörte, wer er zu sein hatte. «Ein Freund vom Bankhaus Pictet aus Genf. Sie können sich gerne über mich erkundigen.»
Galina zögerte kurz, doch dann winkte sie mit einem Blick ab. Kilian führte das Handy wieder an sein Ohr.
«Es bleibt dabei, ich rufe dich zurück. Schöne Grüße noch an deine Frau.»
Er drückte das Gespräch ab und wandte sich Galina zu. «Nun, ich denke, Sie sollten eine Entscheidung treffen. Es ist spät und …»
Galina drückte ihre Zigarette im Ascher aus und stand auf.
«Andiamo», sagte sie und wies dem Hünen zu ihrer Rechten den Weg. Er schritt vor und machte den Weg frei. Der andere wartete, bis sich Kilian erhoben hatte, und folgte ihm.
Als sie an der Eingangstür vorbeikamen, blickte Kilian auf die Amphore, die seine Waffe versteckt hielt. Ein Versuch wäre es wert gewesen, doch der Hüne hinter ihm wies ihn an, weiterzugehen.
Im Jaguar warteten Galinas lockende Beine bereits darauf, dass Kilian neben ihnen auf dem Rücksitz Platz nahm. Bevor er zustieg, schaute er sich Hilfe suchend um und sah den Carabiniere, der auf seiner Harley Hof hielt. Ihm zurufen ging nicht. Der Hüne hinter ihm drängte ihn in den Wagen. Kilian schoss herum und brüllte ihn an: «Diavolo! Willst du mich umbringen?»
Der Hüne zeigte keine Regung. Doch der Carabiniere wurde aufmerksam. Er verstand und startete die Maschine. Kilian stieg erleichtert ein, und der Hüne schloss die Tür.
«Ein kleiner Schluck gefällig?», fragte Galina, als die Limousine sich in Bewegung setzte.
«Warum nicht?», antwortete Kilian und schaute aus dem Rückfenster. Der Carabiniere folgte ihnen.
Galina reichte ihm ein Glas. «Auf ein gutes Geschäft», sagte sie und stieß mit ihm an.
Dann stellte sie die Gläser auf der Ablage ab und legte einen kleinen Hebel um. Eine milchige Trennwand trennte den Fahrerraum zum Rücksitz ab. Kilian verfolgte es mit einem mulmigen Gefühl, wohl wissend, was jetzt geschehen würde.
«Wir sollten uns ein wenig die Zeit vertreiben», sagte sie.
Bevor er sich versah, fanden sich ihre Lippen auf den seinen wieder. Ihr Kuss war zart, doch voller Entschiedenheit.
Kilian rutschte weg. Er musste einen klaren Kopf behalten.
«Schüchtern?», schnurrte sie und schlug ihr Bein über seines.
«Was wird Sergej dazu sagen?», antwortete er.
Galina nahm sein Kinn zwischen die Finger, riss es herum.
«Was weißt du über Sergej?!», fuhr sie ihn an.
«Was jeder weiß.»
«Red keinen Unsinn.»
«Ich habe meine Recherchen gemacht. Man sagt, dass der Schrein in Sergejs Besitz sei.»
«Und?!»
«Dass nur er ihn verkaufen könne und nicht du.»
Galina musterte ihn. Dann ließ sie los und rutschte von ihm weg.
«Lass Sergej meine Sorge sein», sagte sie ernst und nahm einen Schluck aus dem Champagnerglas.
Kilian versicherte sich im Rückfenster, dass der Carabiniere noch hinter ihnen war. Ein Lichtkegel folgte ihnen in sicherem Abstand. Er erkannte Straßenschilder, die auf den Containerhafen Genuas hinwiesen.
«Ich wusste nicht, dass Sergej ein Problem für dich darstellt», sagte er.
«Sergej tut, was Sergej tut. Galina, was Galina tut.»
Ihr Deutsch klang plötzlich holprig, und die Grammatik schien sie zu verlassen. Kilian hatte also ins Schwarze getroffen. Sergej war sein Mann, und Galina würde ihn zu ihm führen.
Kilians Mut kehrte zurück. Er beugte sich zu ihr.
«Dann ist ja alles wunderbar», sagte er und führte sein Gesicht an ihres heran.
Doch Galina blieb stur. Bevor er einen weiteren Versuch starten konnte, hielt der Wagen, und die Tür wurde geöffnet.
Vor ihnen ragte die Bordwand eines unter Jamaika beflaggten und verrosteten Seelenverkäufers auf. Löcher, so groß wie Autos, waren nur unzureichend mit Blechen und Farbe verdeckt.
Der Fahrer reichte Galina die Hand und geleitete sie die Gangway hoch. Der Beifahrer wies Kilian an, ihnen zu folgen. Während sie die klapperige Brücke hochstiegen, bemerkte er, wie der Carabiniere sie hinter einem Container beobachtete. Kilian kratzte sich unübersehbar am Ohr und machte ein Zeichen, dass ihm deuten sollte, Hilfe zu rufen. Der Carabiniere nickte und nahm sein Funksprechgerät zur Hand.
Die Leute vom Sonderkommando wussten Bescheid. Paolo Pendini hatte sie über einen möglichen Hilferuf des Deutschen Kiliano, wie sie ihn nannten, informiert. Pendini und seine Männer würden innerhalb von wenigen Minuten hier sein. Sofern alles gut ging.
Als sie in den Bauch des Kolosses hinunterstiegen und in einen großen leeren Frachtraum kamen, bemerkte Kilian am Ende des Raums ein Schnellboot, auf dem eine Kiste, mit Seilen festgezurrt, stand. In der Bordwand klafften mannshohe Löcher, durch die das Mondlicht hereinschien. Das Boot selbst lag auf einem Bock, von dem zwei Schienen auf die Außenwand des Frachtraumes zuliefen. Auf Überraschungsgäste oder auf die Zollbehörden sollte wohl mit einer schnellen Flucht reagiert werden.
Galina ging geradewegs auf das Boot zu, während einer der beiden Hünen einen Lichtschalter betätigte, der andere ging aufs Deck zurück. Der schwache Schein reichte aus, um zu erkennen, dass die Kiste und das Boot einen langen Weg zurückgelegt haben mussten. An der Seite war die Kiste aufgeschlagen, und das Dämmmaterial hing zwischen den Sparren heraus. Darüber schützte eine Plane vor neugierigen Blicken. Galina wies den Hünen an, die Fracht freizulegen.
Als die Dämmung beiseite geräumt war, funkelte und blitzte es golden auf. Der freigelegte Schrein verschlug Kilian die Sprache. Auf einer massiv goldenen Tafel zeigte es einen jungen machtvollen König, Kriegsfürst und Quell der Stellung des alten Ägyptens über die damalige Welt. Der Schrein war übersät mit funkelnden Edelsteinen.
Kilian strich sanft über die Hieroglyphen. Er musste sich beherrschen, dass er Galina nicht vorschlug, gemeinsam zu flüchten und die Beute zu teilen.
«Beeindruckend», sagte er, «wirklich beeindruckend.»
«Gut. Das wissen wir jetzt», antwortete Galina ungeduldig. «Dann können wir über den Preis sprechen.»
«Der Preis ist völlig nebensächlich», stammelte Kilian, der sich noch immer nicht auf seine eigentliche Mission besinnen mochte. «Was wollen Sie dafür haben?»
Eine Spur Unsicherheit konnte Galina nicht verbergen. «Ich warte auf Ihr Angebot.»
«Gut. Dann holen Sie Sergej her.»
«Wie bitte?»
«Ich will Sergej sehen. Vorher glaube ich nicht, dass der Schrein echt ist.»
«Sind Sie blind? Wieso sollte Sergej Ihnen das sagen können?»
«Nur er gibt mir die Sicherheit, die ich brauche. Nur Sergej hat den Namen, der zählt.»
Galina dachte nach. Der Hüne drehte sich zu ihr um, als wartete er nur darauf, ihn zu rufen.
«Wir brauchen Sergej nicht», setzte sie an, «weil Sergej …»
Schüsse vom Oberdeck schnitten ihr den Satz ab. Der Hüne rannte zur Treppe, um zu sehen, was draußen los war. Galina wurde unruhig und drängte auf einen schnellen Abschluss. «Also, was ist jetzt? Wollen Sie kaufen?»
Kilian überlegte. Wieso brauchen wir Sergej nicht? Ohne ihn war bisher kein Deal über die Bühne gegangen. Oder hatte Pendini ihm veraltete Informationen gegeben?
«Kaufen oder nicht?», drängte Galina.
Langsam ging ihm ein Licht auf. Sergej, Krim, Potsdam, Ingenieur, Raketen, Kuba, Galina.
«Klar. Wir brauchen Sergej nicht zu rufen», kombinierte er und ging auf sie zu, «weil Sergej schon da ist.»
Er zeigte mit dem Finger auf sie und schüttelte verwundert den Kopf.
«Dass ich das nicht schon früher geschnallt habe …»
Galina starrte in seine Augen. Die Legende Sergej war tot. Alle würden sie jetzt jagen. Und Kilian wusste das.
Der Hüne fiel rücklings die Treppe herunter. Schüsse folgten ihm und fanden ihren tausendfachen Hall in den kahlen Wänden aus verrostetem Stahl. Aus seiner Brust rann Blut. Dennoch besaß er so viel Kraft, um Galina etwas auf Russisch zuzurufen.
Galina legte ihre Arme um Kilian und flüsterte ihm ins Ohr: «Es hätte schön werden können mit uns beiden.»
Kilian erhoffte sich einen letzten Kuss, bevor der anrückende Pendini sie trennen würde. Er bekam ihn auch. Und ein zweites Abschiedsgeschenk noch dazu. Ein Tritt zwischen die Beine schickte ihn zu Boden.
«Du mieses Stück Scheiße!», schrie sie ihn an. «Ich werde dich zermalmen wie eine dreckige Laus. Verlass dich drauf. Du bist tot.»
Sie unterschrieb das Versprechen mit einem weiteren Fußtritt und noch einem, bis er zusammengekrümmt keine Angriffsfläche mehr bot.
Galina schwang sich auf das Boot, zündete die Motoren und eine vorbereitete Ladung am Ende der Rampe, auf der das Boot stand. Zeitgleich rissen mehrere Explosionen ein Loch in die Außenwand des Containerraumes. Der Motor heulte auf, und das Boot wurde auf die gesprengte Öffnung geschleudert und verschwand dahinter.
Kilian rappelte sich hoch. Er hörte das Aufklatschen des Bootes im Wasser und sah, wie Galina es am Pier vorbei aufs offene Meer zusteuerte. Pendini und zwei Carabinieri kamen hinzu.
«Kiliano? Cos’ è succeso?», fragte ihn Pendini aufgeregt.
Kilian antwortete nicht. Er stand an der Öffnung in der Außenwand und verfolgte mit seinem Blick, wie Galina, am Steuer stehend, auf die Hafeneinmündung zuhielt. Vielleicht noch fünfzig Meter, dann wäre sie in Sicherheit. Er entriss dem Carabiniere das Gewehr und suchte in der Zieleinrichtung.
Wellen, Boote, Mondlicht. Da hatte er sie. Galina. Genau im Fadenkreuz. Noch wenige Meter, dann wäre sie weg, hinter der Hafenabgrenzung verschwunden.
Sein Finger suchte den Widerstand am Abzugshebel. Er drückte leicht durch, bis er ihn fühlte. Jetzt Ruhe bewahren und leicht durchziehen. Er hatte Galinas Rücken, ihre braunen Schulterblätter genau im Fadenkreuz. Sie war bereits an der Hafenmauer, schlug das Steuer ein und drehte ab.
«Los, drück ab!», schrie ihn Pendini an.
Sein Finger ruhte noch immer am Widerstand des Abzughebels. Jetzt war es so weit.
Unerwartet drehte sich Galina um. Sie schien ihm direkt ins Auge zu schauen und lächelte.
«Drück endlich ab!», hörte er Pendini von weit entfernt rufen.