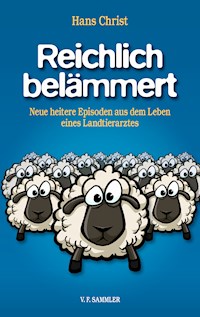Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stocker, L
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auch in seinem mittlerweile siebten Band mit heiteren Tiergeschichten präsentiert sich der Salzburger Tierarzt Dr. Hans Christ wieder als würdiger Nachfolger des beliebten Fernsehtierarztes Dr. James Herriot. Für beide gilt: Oft sind es nicht nur die Tiere, die der tierärztlichen Behandlung bedürfen, sondern auch deren Besitzer benötigen häufig Rat, Unterstützung und Zuwendung des Doktors. Die Erlebnisse des österreichischen Landtierarztes werden eindeutig dem alten Journalistenmotto gerecht: Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Christ
Tiere sindauch nurMenschen
Neue lustige Geschichtenaus dem Lebeneines Landtierarztes
V. F. SAMMLER
Umschlaggestaltung: Werbeagentur Rypka GmbH, 8143 Dobl/Graz, www.rypka.at
Titelbild: Foto Atelier Wolkersdorfer
Illustrationen: Hans Christ
Der Inhalt dieses Buches wurde vom Autor und vom Verlag nach bestem Wissen überprüft; eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden. Die juristische Haftung ist daher ausgeschlossen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Hinweis: Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:
Leopold Stocker Verlag GmbH
Hofgasse 5/Postfach 438
A-8011 Graz
Tel.: +43 (0)316/82 16 36
Fax: +43 (0)316/83 56 12
E-Mail: [email protected]
www.stocker-verlag.com
ISBN 978-3-85365-342-5
eISBN 978-3-85365-347-0
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
© Copyright V. F. SAMMLER, Graz 2023
Layout: Ecotext-Verlag Mag. G. Schneeweiß-Arnoldstein
Inhalt
Vom Saulus zum Gaulus
Immer Ärger mit Henry
Das Alkoholproblem der Polizei
Keine Post für den Tierarzt
Fürsorgliche Bauern
Eine anrüchige Geschichte
Tiere sind auch nur Menschen
Ein paar Schrauben locker
Das letzte Tauerngold
Work-Life-Balance
Professor Antonioli
Horst, das Waldschwein
Wozu braucht ein Tierarzt Intelligenz?
Einbeinchen
BANG
Aller guten Dinge sind drei!
Ein rätselhafter Fall
Ein „Liftboy“
Augen auf, der Tierarzt kommt!
Das Leben ist kein Honigschlecken
Wer zu spät kommt …
Pril, wie bekannt, entspannt
Geflügelte Liebe
In Rausch & Brand
Kleine Episode mit der Leberwurst
Sieben auf einen Streich
Unser Landtierarzt Dr. Hans Christ
Bauer allein zu Hause
Abschied
Der Autor
Vom Saulus zum Gaulus
Herr Plaschke hatte zweifellos ein Problem. Sein Problem bestand in einem gelblich gefärbten Gebiss von beachtlichem Ausmaß, einer schon etwas schütteren Mähne und vier Hufen. Herr Plaschke war nämlich seit Kurzem stolzer bzw. eben nicht besonders stolzer Besitzer eines alten Hannoveranerwallachs namens Blasius. Dieser hatte zuvor seiner Schwester gehört, welche jedoch infolge jahrelanger Krankheit nicht mehr reiten konnte und nun, nach ihrem Tode, dem Bruder nicht nur das kleine Haus samt Garten in Hofgastein vermacht hatte, sondern als Zugabe auch den schon betagten Blasius.
Herr Plaschke, ein ebenso langgedienter wie alleinstehender Wiener, hatte daraufhin seine Wohnung in Ottakring aufgegeben und war nach Salzburg übersiedelt, wo er das Häuschen mit Freuden bezog, nicht zuletzt durch die neuerworbene Nähe zum Gasteiner Heilstollen mit seinem Radon-Gehalt, welcher seinem chronischen Rheumatismus erhebliche Linderung brachte.
Schmerzen anderer Art bereitete ihm jedoch Blasius.
Herr Plaschke, ein sein Leben lang eifriger Besucher sämtlicher Kaffeehäuser im Bezirk, hatte die Bekanntschaft von Pferden bisher nur in der Gestalt des geschnitzten Springers auf dem Schachbrett gemacht, ja selbst um die Fiaker am Stephansplatz pflegte er stets einen weiten Bogen zu schlagen, deshalb zeigte er sich angesichts eines leibhaftigen Exemplars, für das er ab nun auch noch die Verantwortung tragen sollte, ein wenig überfordert.
Zuerst trug er sich mit der Absicht, Blasius an jemanden zu verkaufen, der im Umgang mit Rössern bewanderter war als er, aber unsere Bauern brauchten für die Kutschenfahrten mit Touristen zugstarke Noriker oder Haflinger.
Außerdem war da noch die verfluchte Klausel im Testament, die besagte, dass sich Herr Plaschke höchstpersönlich um das Wohl von Blasius bis zum letzten Atemzug – wer von den beiden damit gemeint war, ließ das Dokument offen – zu kümmern habe, andernfalls die gesamte Erbschaft an ein Tierheim gehen würde.
Was tut man unter solchen Umständen? Richtig! Man ruft als Erstes den Tierarzt zu Hilfe.
Herr Plaschke erwartete mich bereits sehr nervös auf dem Reiterhof, wo Blasius seit Jahren untergebracht war.
„Gott sei Dank, dass Sie da sind, Herr Doktor! Ich weiß mir keinen Rat!“
Er führte mich zur Box, wo Blasius neugierig den Kopf herausstreckte und wieherte. Ich kannte ihn von einigen früheren Visiten her und trotz einiger Spritzen, die ich ihm in der Vergangenheit verabreicht hatte, schien er mich nicht nur wiederzuerkennen, sondern mich sogar zu mögen. Von seinem beachtlichen Stockmaß von nahezu einem Meter achtzig blickte er mit der Würde eines alten Pferdes auf uns herunter.
In kurzen Worten schilderte mir Herr Plaschke sein Dilemma.
„Ja, und was soll ich dabei tun?“, war meine berechtigte Frage.
„Ich habe mir gedacht, ich meine“, Herr Plaschke geriet ins Stottern, „Sie könnten ihn vielleicht einschläfern und mir ein Attest, dass das notwendig war, ausstellen! Außerdem braucht so ein Pferd doch auch einen menschlichen Bezug, den ihm meine Schwester gegeben hat. Aber ich traue mich nicht in seine Nähe. Obwohl er ein netter Kerl zu sein scheint.“ Man merkte ihm deutlich an, dass er sich ob seines Vorschlags schämte.
Recht hatte er.
Ich musterte den schmächtigen Mann mit seinen heruntergezogenen Schultern und seiner Glatze, die er spärlich durch quer darüber frisierte Haarsträhnen höchst unzureichend zu kaschieren suchte, mit strengem Blick. Normalerweise kann ich Leute, die von mir verlangen, ein gesundes Tier zu euthanasieren, auf den Tod nicht ausstehen. Hier aber spürte ich die pure Verzweiflung eines überforderten Laien.
Trotzdem sagte ich kalt: „Tut mir leid, aber das kommt überhaupt nicht in Frage! Das würde gegen jede tierärztliche Ethik verstoßen und außerdem hat Blasius mit Erich“, das war der neue Stallwastl am Reiterhof, ein zugezogener Brandenburger mit Berliner Schnauze, „jemanden, der sich intensiv um ihn kümmert! Denken Sie nicht einmal im Traum daran, sich des Pferdes zu entledigen! Ich kenne jetzt Ihre Absicht, und wenn mir das zu Ohren kommt, gibt es eine saftige Anzeige bei der Amtstierärztin!“ Um dem alten Prinzip „Zuckerbrot und Peitsche“ gerecht zu werden, holte ich aus der Jackentasche ein paar Kandiszuckerwürfel, die Blasius genüsslich zwischen den Zähnen zerknirschte.
Herr Plaschke knickte ein wie ein abgebranntes Streichholz und murmelte: „Sie haben Recht! War nur so ein Gedanke von mir!“
„Aber ein saublöder, vor allem, weil Sie mir den Besuch trotzdem bezahlen müssen!“ In solchen Fällen kannte ich keine Gnade.
Trotzdem erreichte mich einige Wochen später ein Anruf von Herrn Plaschke. „Herr Doktor, schnell! Der Blasius!“
„Was ist mit ihm?“
„Das müssen Sie sich selbst ansehen! Aber kommen Sie bitte rasch!“ Damit legte er auf.
Es ist ein häufiges Problem, welches einen Tierarzt ohne genaue Auskünfte über den ihn erwartenden Patienten auf der mitunter rasenden Fahrt dorthin beschäftigt. Hunderte mögliche Diagnosen rattern durch seinen Kopf, vor allem die schrecklichsten.
Ich hatte sogar das Blaulicht eingeschaltet, was den gut getarnten Polizisten mit der Radarpistole hinter der Mülltonne am Parkplatz des Supermarktes sicherlich frustrierte, was mich jedoch freute, denn in unserer Gegend patrouillierten in letzter Zeit mehr Gesetzeshüter mit solchen Pistolen herum als früher im Wilden Westen Sheriffs mit echten Revolvern. Und da er keinen Grund hatte, mich anzuhalten, erreichte ich den Reiterhof binnen fünfzehn Minuten.
Ich sprang aus dem Auto: „Was ist mit Blasius?“
Herr Plaschke zitterte am ganzen Leibe: „Kommen Sie mit!“
Er führte mich zu den Koppeln, wo ich einen Blasius vorfand, der die Sonne zu genießen schien und mir alles andere als einen kranken Eindruck vermittelte.
„Und? Was soll mit ihm los sein?“
„Ja merken Sie das denn nicht? Sein, sein, sein“, Herr Plaschke begann rot zu werden und zu stottern, „sein Geschlechtsteil!“ Das Thema berührte ihn offensichtlich äußerst peinlich.
Blasius hatte seinen Penis ausgeschachtet und stand gemütlich in der Gegend herum.
Ich kapierte immer noch nicht. „Tut mir leid, keine Ahnung, was Sie meinen!“
„Na sein Ding! Völlig geschwollen, mindestens einen halben Meter lang und hängt seit einer halben Stunde herunter!“
Ich lachte: „Aber das ist völlig normal bei Wallachen! Das tun sie öfters, wenn sie vor sich hindösen oder sich entspannt fühlen. Genau genommen ist das ein gutes Zeichen!“
Herr Plaschke konnte es nicht fassen: „So groß?“, frug er fasziniert. „Das ist ja unglaublich!“ Da er früher, wie ich mittlerweile wusste, am Patentamt gearbeitet hatte, war ich der inneren Überzeugung, dass er, wäre er noch im Dienst gewesen, Blasius glatt ein Patent dafür ausgestellt hätte.
Ich klopfte Herrn Plaschke beruhigend auf die Schulter: „Na in einer gemischten Sauna würde er damit bestimmt einiges an Aufsehen erregen. Aber alles bestens! Kein Anlass zur Sorge! Allerdings auch keiner zum Neid!“
Während ich nach Hause fuhr, der Inspektor mit der Radarpistole hatte mittlerweile auch die Waffen gestreckt, dachte ich belustigt, dass viele Menschen immer von sich auf ihre Tiere schließen.
Es dauerte nicht lange, da ereilte mich erneut ein Notruf von Herrn Plaschke: „Der Blasius, Herr Doktor! Es ist ganz dringend!“ Da ich im Moment ziemlich beschäftigt war, dachte ich grimmig: ‚Du kannst mich mal.‘ Wahrscheinlich sitzt heute nach Herrn Plaschkes Ansicht der Pferdeschweif schief. „Ich komme, sobald ich kann!“
„Nein, um Gottes Willen, er erstickt!“
Himmel, Arsch und Zwirn! Was konnte das denn sein? Klang verdächtig nach einer Allergie.
Da ich gerade in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war, schaltete ich wieder das gute alte Blaulicht ein und riss den Wagen mit quietschenden Reifen herum. Ein sich dadurch behindert fühlender Verkehrsgenosse zeigte mir erbost den Vogel, aber das passte ja zu einem Tierarzt.
Vom üblichen Parkplatzpolizisten war heute nichts zu sehen, wahrscheinlich lauerte er nach Indianerart einen Stellungswechsel vollzogen.
Diesmal hatte Herr Plaschke nicht übertrieben. Blasius stand in seiner Box mit gestrecktem Hals, würgte und jede Menge Speichel lief ihm aus Maul und Nüstern. Ein klassischer Fall von Schlundverstopfung. Der Vorteil von Warmblütern ist, im Gegensatz zu schweren Kaltblütern, ihr relativ gut durchtastbarer Hals. Deutlich konnte ich die Verdickung in der Speiseröhre fühlen.
„Was hat er denn gefressen?“
„Oh, nur ein paar Äpfel! Ich habe sie dort drüben aufgesammelt“, er zeigte auf einen kleinen Baum am Rande der Wiese, „und ihm den Kübel dann hingestellt. Er mag sie so gerne!“
„Ja, aber Sie dürfen die Äpfel doch nicht als Ganzes verfüttern“, rief ich, „die muss man zumindest halbieren! Jetzt steckt einer im Hals fest!“
„O Gott, oh Gott“, jammerte Herr Blaschke, „muss er jetzt sterben?“
„So weit sind wir glücklicherweise noch nicht“, knurrte ich.
Schlundverstopfungen sind allerdings bedrohliche Angelegenheiten, deren Therapie ziemlich zeitaufwändig ist. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Handelt es sich um verklumptes Weichfutter, dann kann mit mehrmals zu wiederholenden Wasserspülungen versucht werden, das Hindernis aufzulösen. Bei aufgequollenen Rübenschnitzeln oder Erdäpfeln ist das schon heikler. Die muss man mechanisch zerkleinern. Da es sich, wie mir ein Blick auf den verbliebenen Rest im Kübel bewies, in diesem Fall um schon sehr weiche Äpfel handelte, entschloss ich mich zur dritten Methode: Den Fremdkörper mit einer Nasenschlundsonde zu pürieren und ihn vorsichtig hinunter Richtung Magen zu bugsieren.
Dazu verpasste ich Blasius eine Beruhigungsspritze und eine gegen den Ösophaguskrampf, flößte ihm etwas Paraffin ein, um die Sache rutschiger zu machen, und begann mit der eigentlichen Arbeit. Zum Glück halfen mir einige Reitklubmitglieder dabei, denn Herr Plaschke wäre nicht imstande gewesen, mir den Pferdekopf am Halfter zu halten. Endlich, nach scheinbar ewiger Zeit, spürte ich, wie sich der Widerstand immer mehr lockerte und schließlich war der Weg in den Magen für die Sonde einwandfrei passierbar. Blasius begann auch sogleich wieder zu schlucken und sein ängstlicher Blick verschwand. Erleichtert seufzte ich auf. Da gab es jedoch noch eine Komplikation zu beachten. Infolge des starken und blockierten Speichelflusses kommt es oft zu einer Inhalation in die Lunge, was zu einer massiven Entzündung führen kann. Also setzte ich ihn für die kommenden drei Tage noch unter antibiotische Abdeckung.
Als ich am nächsten Tag am Reiterhof erschien, um ihm die nächste Spritze zu geben, machte sowohl er als auch Herr Plaschke einen gelösten Eindruck.
Allerdings eröffnete letzterer mir, während er aus sicherer Entfernung zusah, wie ich dem Wallach das Medikament verabreichte: „Herr Doktor, der eine Apfel kann nicht schuld gewesen sein, der Blasius muss eine ganze Menge davon verdrückt haben!“
„Wie kommen Sie darauf?“, war meine erstaunte und auch etwas ärgerliche Frage.
„Na weil der Erich, der Piefke, gemault hat, dass er noch nie so viele Äppel wie heute früh aus der Box hat schaufeln müssen!“
Ich griff mir an den Kopf. Herr Plaschke verwechselte den lieben Blasius offenbar mit einer Zibetkatze, die grüne Kaffeebohnen frisst, um sie hernach in ihrem Darm zum teuersten Mokka der Welt zu fermentieren.
Immer Ärger mit Henry
Henry wusste genau, wie der Hase lief! Was nicht verwundern durfte, war er doch selbst einer. Zwar ein Kaninchen mit Schlappohren, aber Mümmelmann bleibt Mümmelmann.
Er war ein Geschenk an die jüngste Tochter Sandra des Unterhöllerbauern von ihrer Tante und Taufgödin, die selbst Karnickel züchtete.
Dem Unterhöller lief schon beim Gedanken an gedünstetes Kaninchen im Wildkräutersud das Wasser im Mund zusammen, aber da machten ihm seine Tochter Sandra und seine Frau einen gehörigen Strich durch die Rechnung.
Was blieb dem Unterhöller also übrig, als ein Stück seines Vorgartens zu opfern und dort ein großes Freigehege für Henry – auf diesen Namen hatte ihn Sandra mittlerweile getauft – zu basteln. Rundherum vereitelte ein hoher, dichter Maschendrahtzaun ein Überwinden der Begrenzung und zwecks Ausstaffierung des Kaninchenappartements spendierte der Bauer noch eine ausgediente Hundehütte und einen ausgehöhlten Baumstumpf. Diese Mühe hätte er sich sparen können, denn Kaninchen haben eine eigene Vorstellung ihrer Behausung. Henry begann sofort zu buddeln, und weil er so schön im Zuge war, fiel auch nebenbei ein Fluchttunnel für ihn unter dem Zaun ab, denn so ein Höhlensystem ging ziemlich in die Tiefe. Das hatte der Unterhöller natürlich nicht bedacht.
Und so war er basserstaunt, als er beim frühmorgendlichen Gang zum Melken Henry friedlich im Freien hocken und an einem Grasbüschel nagen sah. Drinnen im Gehege sah es nämlich schon binnen Kurzem aus wie nach einem Bombenangriff. Kein Halm wuchs mehr und der blanke Erdboden war übersät mit Eingangslöchern in den weitläufigen Hasenbau.
‚Na warte, Du Falott‘, dachte der Unterhöller und wollte Henry einfangen. Aber Hasen sind bekanntlich Weltmeister im Hakenschlagen, sodass es sogar für einen Fuchs schwer genug ist, einen zu fangen.
Der Unterhöller mochte zwar ein Fuchs im Vieh- und Holzhandel sein, körperlich war er jedenfalls keiner.
Deshalb ging der Sieg an Henry und der resignierte Bauer in den Stall, um zu melken.
Am Abend jedoch saß Henry wieder brav in seinem Refugium und der Unterhöller nützte die Gelegenheit, den Fluchttunnel hastig mit Steinen zu verstopfen und Erdreich drüberzuschaufeln.
Allerdings bewies das nur, dass er noch einiges in punkto Kaninchenkunde zu lernen hatte.
Zwei Tage später hatte Henry einen neuen Ausgang gegraben und ließ sich das saftige Gras im Vorgarten schmecken.
Da er aber jedes Mal bei Einbruch der Dämmerung wieder in seine Einzäunung zurückkehrte, ließ es der Unterhöller dabei bewenden. So hatte sich ein von allen Beteiligten akzeptierter modus vivendi eingestellt: Untertags hoppelte Henry über den Hof und die Nacht verbrachte er in seinem Kaninchenpalast.
Das wäre noch länger gut gegangen, hätte Henry nicht seinen Bewegungsradius langsam erweitert und dabei den hinter dem Haus angelegten Gemüsegarten entdeckt und sich begeistert an die Festtafel gesetzt.
Als nämlich die Unterhöllbäuerin für das Abendessen einen Kopfsalat abschneiden wollte, fand sie nur mehr den Strunk vor und bekam einen leichten Anfall.
Dazu kam, dass Henry reges Interesse am großen Papiersack mit Gerste, den der Unterhöller vorübergehend an die Außenmauer gelehnt hatte, entwickelte, und als der Bauer den Sack schulterte, er das Gefühl hatte, dieser würde auf dem Weg in den Stall immer leichter.
Sobald er sich umdrehte, bemerkte er die breite Spur an Gerstenkörnern hinter sich, die ihn mühelos aus jedem Labyrinth eines Minotaurus wieder hinausgeführt hätte. Henrys Nagezähne hatten ganze Arbeit geleistet. Es erinnerte sogar an die Geschichte von Wilhelm Busch, in der die Nichtsnutze Max und Moritz dem Müller den Mehlsack aufschlitzten, sodass der beim Tragen immer leichter wurde.
Die Idee eines gedünsteten Kaninchens in Wildkräutersud erhielt dadurch neuen Aufwind.
„Ich könnte das Mistvieh erwürgen“, eröffnete mir der Unterhöller anlässlich meiner nächsten Visite, um hinzuzusetzen: „Wenn ich es nur erwischen täte!“
„Dann verschaffen Sie ihm doch ein nettes Weibchen“, schlug ich vor, „vielleicht bleibt er dann lieber zu Hause!“
„Das funktioniert ja nicht einmal bei Menschen“, murmelte der Bauer und mich beschlich das Gefühl, er sprach teilweise aus eigener Erfahrung.
Nichtsdestotrotz besorgte er sich von der kaninchenzüchtigen Tante eine Häsin.
Wenige Tage später stand er in meiner Ordination mit dem arg zerzausten Neuzugang. „Die sind aufeinander los wie die Wilden. So was habe ich noch nicht erlebt!“
„Kein Wunder“, sagte ich nach kurzer Beurteilung des Hinterteils, „das ist ein Rammler. Zwei männliche Hasen im selben Territorium ergibt immer Zoff!“
„Was? Ich habe extra ein Weibchen verlangt! Fünfzig Euro habe ich dafür hingeblättert! Und Sie kosten mir jetzt auch noch die Behandlung!“
„Na, vielleicht nimmt es die Tante mit dem Gendern bei Kaninchen nicht so genau!“, scherzte ich. Nachdem ich den unterlegenen Kämpfer versorgt hatte, wurde er umgehend zurückgebracht und diesmal gegen eine tatsächliche Häsin umgetauscht.
„Schöne Ratschläge geben Sie mir“, knurrte der Bauer bei meinem nächsten Besuch, der einer kranken Kalbin galt, „jetzt habe ich zwei verdammte Hasen im Gemüsebeet!“
Offenbar hatte Henrys bessere Hälfte – Sandra hatte sie auf Henrietta getauft – ihrem Gespons die Gefolgschaft nicht verweigert
„Tja, dann hilft nur noch eins: Sie müssen den Zaun tiefer in die Erde setzen. Zwei Meter, schätze ich.“
Der Unterhöller glotzte mich an, als hätte ich verlangt, er solle den Suez-Kanal neu graben.
„Ich bin doch nicht verrückt! Lieber kauf’ ich den verdammten Salat im Supermarkt! Soll gut zu Kaninchenbraten passen!“
Mittlerweile nahm ich diese düsteren Prophezeiungen nicht mehr ernst. Ich kannte Sandra!
Umso mehr erschreckte es mich, als ich das großzügige Freigehege der beiden Hasen am Abend leer fand. Üblicherweise stellten sie sich – sie kannten mein Auto bereits – am Zaun auf und warteten, bis ich ihnen entweder abgerupfte Grashalme oder im Winter Salatblätter und Karottenstückchen durch die Maschen steckte.
Der Unterhöller hatte doch seine Morddrohung nicht wirklich in die Tat umgesetzt?
Da entdeckte ich zu meiner Erleichterung etwas rechts von der Hausecke einen neuen langgestreckten Verschlag auf Stelzen, hinter dessen Hasengitterfront die pummeligen Gestalten von Henry und Henrietta saßen und an etwas knusperten.
„Na“, frug ich den Unterhöller belustigt, „haben Sie die zwei Banditen nach Sing-Sing gesteckt?“
„War nicht anders möglich! Kürzlich ist er wieder ausgebüchst, gerade wie der Briefträger an der Haustüre war. Der hat im letzten Augenblick den Hasen gesehen und, damit er ihn nicht zertrittt, einen Zwischenschritt eingelegt. Dabei ist er von der Stufe gerutscht und hat sich den Knöchel verstaucht. Drei Wochen lang war er im Krankenstand und jetzt redet er sich auf den Knöchel aus, wenn er noch später als sonst mit der Post auftaucht. Immer der Ärger mit diesem Henry!“
Ich beobachtete Henry durch das Hasenstallgitter, wie er, ganz die Unschuld vom Lande, genüsslich an einem Salatblatt mümmelte und dabei verträumt vor sich hinschaute.
Trotzdem war es unfair, ihm die Schuld zu geben!
Denn im Vertrauen gesagt, der gute Herr Kilian, besagter Briefträger, war auch ohne verstauchten Knöchel nie der Schnellste gewesen!
Das Alkoholproblem der Polizei
Obwohl ich es wieder sehr eilig hatte, fuhr ich an diesem späten Nachmittag doch nur mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit durch das Ortsgebiet. Der sechste Sinn ist nämlich für einen Tierarzt, nicht nur bei der Diagnose, äußerst wichtig.
Gleich darauf durfte ich mir zu meiner Entscheidung gratulieren, denn aus der Entfernung sah ich schon den VW-Bus, der auf der Abbiegespur, die unter anderem zum Stubnerbauern führte, geparkt war. Mit selten ruhigem Gewissen näherte ich mich. Da traten unvermittelt zwei Polizisten an den Straßenrand und winkten mich zur Seite. Nanu, dachte ich, was waren denn das für neumodische Bräuche. Normalerweise lässt mich die heimische Exekutive, noch dazu bei vorschriftsmäßigem Verhalten, in Frieden. Weil sie mich auch manchmal braucht, wenn es gilt, einen verletzten Hund erstzuversorgen oder bei einer gefundenen Katze mit dem Lesegerät die Chip-Nummer zu identifizieren. Manus manum lavat oder eine Hand wäscht die andere! Eben!
Diesmal waren es aber zwei junge Tutter, die noch dazu, coronabedingt, die Gesichtswindel umgeschnallt trugen. Ich kannte sie nicht. Wahrscheinlich von auswärts!
„Was ist los?“, frug ich. „Ich war eh nicht zu schnell.“
„Verkehrskontrolle!“, kam es belehrend unter der Maske hervor.
Na schön, offenbar hatten die beiden, im Gegensatz zu mir, keine andere Arbeit. Ich präsentierte Führer- und Zulassungsschein, währenddessen der andere das Pickerl überprüfte und die Reifenprofiltiefe kontrollierte. Nachdem ich sogar die Warnweste und das Pannendreieck – kein Wunder, der Wagen war noch relativ neu – vorweisen konnte, schöpfte ich schon Hoffnung. Aber elftes Gebot: Du sollst dich nicht täuschen!
„Jetzt machen wir noch einen Alkotest!“
Von mir aus, dachte ich grimmig.
Das Inspektorchen gab mir das Vortestgerät und ich pustete hinein. „0,49“, verkündete es mir grimmig.
„Das gibt es nicht!“, rief ich.
„Haben Sie Alkohol getrunken?“, lautete die strenge Frage.
„Ja! Ein Bier zu Mittag!“ Normalerweise trinke ich daheim fast nie Bier, weil ich finde, dass es dazu Gesellschaft braucht. Aber an diesem Tag war Karin nach Kärnten gefahren, was so viel bedeutete, dass mein Mittagessen nicht allzu üppig ausgefallen war und ich daher, wie es die Mönche in der Fastenzeit zu halten pflegen, zum flüssigen Brot gegriffen hatte.
„Aber davon kann ich keine 0,49 Promille haben!“
„Gut, probieren wir es noch einmal!“
Er hielt mir wieder das Gerät vor die Nase.
Nachdem ich erneut geblasen hatte, schaute er auf die Anzeige und schüttelte den Kopf, ohne mir das Ergebnis zu verraten: „Das Kastl funktioniert nicht!“
„Fein! Dann kann ich ja jetzt fahren!“
Er schüttelte wieder den Kopf: „Nein! Wenn das Gerät nicht korrekt anzeigt, könnten Sie ja trotzdem alkoholisiert sein! Wir bringen Sie jetzt auf den Polizeiposten, dort steht der geeichte Alkomat!“
„Wieso? Ist ja nicht meine Schuld, wenn das Glumpert hin ist!“, protestierte ich.
„Meine auch nicht!“, lautete die behördliche Antwort.
Es half also nichts! Auto absperren, Schlüssel abgeben und hinein in den Bus auf die Rückbank. Das Ganze kam mir vor wie eine Szene aus einem schlechten (gibt es auch gute?) Tatortkrimi. Außerdem war es mir peinlich, weil sich das Ganze in Sichtweite vom Stubnerhof abspielte.
Wir kutschierten also in Richtung Markt, als sich mein Handy bemerkbar machte.
„Herr Doktor! Wo sind Sie?“ Der Stubnerbauer, ausgerechnet! „Ich brauch’ Sie dringend, ich hab’ einen Notfall! Eine Schwergeburt!“
Das auch noch! „Tut mir leid, ich bin gerade auf dem Weg zu einer Amtshandlung! Ich komme so schnell, wie ich kann!“
Zu meinen uniformierten Entführern vor mir im Wagen sagte ich: „Ihr habt gehört, ein Notfall!“
Der Beifahrer zuckte aber nur die Schultern: „Da kann man nichts machen! Es gibt ja auch noch andere Tierärzte!“
‚Idiot‘, dachte ich, hielt mich aber insoweit zurück, als ich lediglich sarkastisch bemerkte:
„Jaja, die Polizei, Dein Freund und Helfer!“
Auf dem Posten angekommen, wurde ich in das Kammerl mit dem Alkomaten geführt. Eigentlich hätte ich ja gar nicht hier sein dürfen, weil ich als Einziger keine Maske bei mir hatte. Aber bei Verbrechern schienen die Corona-Bestimmungen außer Kraft gesetzt zu sein.
In dem Zimmer dürfte seit dreißig Jahren nicht mehr gelüftet worden sein, es herrschte, im wahrsten Sinn des Wortes, eine Bullenhitze.
Ich platzierte mich auf den Armesündersessel, einer der jungen Beamten wickelte den Schlauch vom Apparat, steckte ein Mundstück an und ich blies zum dritten Mal an diesem Nachmittag. Die Anzeige erschien sofort auf dem Display: Messung ungültig!
„Dann halt noch einmal!“, schnarrte der offenbar vom Jagdfieber gepackte Jungspund.
Ein neues Mundstück, ein neuerliches Blasen, nur das Ergebnis war das gleiche: Messung ungültig!
Beim dritten Durchgang hatte ich schon einen trockenen Mund, also bat ich um ein Glas Wasser.
„Das geht nicht“, lautete die Antwort, trinken könne das Ergebnis verfälschen. Ich wette, hätte ich um ein Achtel Wodka gebeten, er hätte es mir serviert.
„Warum stecken Sie jedes Mal ein neues Mundstück an?“ Innerlich kochte ich bereits. „Das ist doch unnötiger Plastikmüll!“
„Vorschrift! Speichelreste können das Ergebnis verfälschen!“
Langsam begann ich zu zittern – vor Wut und auch vor Stress –, denn es wartete ja noch die Schwergeburt auf mich, von den übrigen Visiten gar nicht zu reden. Und der Schweiß rann mir in Strömen herunter.
Das bemerkte auch mein Folterknecht: „Wissen Sie was. Gehen Sie einmal für zehn Minuten an die frische Luft und erholen Sie sich. Danach machen wir weiter!“
Also weitere Zeit verschissen.
Er begleitete mich nach draußen. Genervt stellte ich ihm die Frage, warum er mir auf Schritt und Tritt auf den Fersen hing, ob er glaubte, dass ich die Flucht ergreifen würde, keine Angst, mein Wagen stehe ja ziemlich weit entfernt.
„Nur so!“, sagte er. Also standen wir geschlagene zehn Minuten „nur so“ herum, dann begann die Tortur auf’s Neue. Um es kurz zu machen, würde ich jeden Versuch einzeln schildern, bräuchte ich keine anderen Geschichten mehr, das Buch wäre voll. Einen ganzen Sack Mundstücke hatte ich bereits verbraten, wobei es zu Beginn geheißen hatte: „Blasen Sie nicht so stark“, um sich am Ende in die Aufforderung zu versteigen: „Blasen Sie so stark, wie Sie können!“
Das Ergebnis war stets dasselbe: Messung ungültig!
„Tja, da hilft nichts. Wir müssen eine Blutprobe veranlassen!“
„Und wo bitte?“, fuhr ich auf.
„Beim Sprengelarzt!“
Ich sah auf die Uhr: „Es ist bereits Viertel nach fünf. Da wird in der Ordination niemand mehr sein!“
Natürlich meldete sich am Telefon kein Schwein.
„Dann müssen wir Sie eben ins Spital bringen!“
‚Himmel, hilf‘, schoss es mir durch den Kopf, in solchen Momenten wird der Mensch gläubig, ‚vielleicht kann mich wer zwicken, dass ich aus diesem Albtraum endlich aufwache.‘
Während im Wachzimmer noch Kriegsrat gehalten wurde, wer mich zu dieser Stunde ins Spital eskortieren sollte, ging die Tür auf und ein etwas älterer Inspektor, den graumelierten Augenbrauen nach zu schließen, kam herein.
„Warum geht denn das Scheiß-Kastl nicht?“, fluchte er. „Gestern hat es ja auch noch funktioniert. Hast Du da eh da draufgedrückt?“ Er deutete auf irgendeine Taste.
Ich konnte es deutlich sogar durch die Maske sehen, dass dem Polizeinovizen der Mund offenblieb.
Der Alte drückte kurzerhand auf den entsprechenden Knopf, ich blies noch zweimal, zur Sicherheit, in den Schlauch, dann ratterte es und ein papierener Ausdruck schlängelte sich aus dem Apparat. Das Erscheinen der Jungfrau Maria persönlich konnte nicht beglückender sein.
Der Inspektor warf einen kurzen Blick darauf und brummte: „Na also! Eh alles in Ordnung! Nehmen Sie im Bus Platz, wir fahren Sie gleich zu Ihrem Auto!“
‚Wahrscheinlich nach der Kopfwäsche für den technischen Wunderknaben‘, dachte ich. Gleichzeitig überlegte ich, ob ich den Herrschaften nicht raten sollte, wenn sie für einen apparatemäßigen Alkotest zu inkompetent sind, dass sie das nächste Mal zu der altbewährten Methode, gerade auf einem Strich zu wandeln oder mit dem Zeigefinger die Nasenspitze zu berühren, greifen sollten. Aber andererseits war ich heilfroh, der Fahrt ins Spital entkommen zu sein, und außerdem schien es mir für die Zukunft nicht ratsam, die Polizei gegen mich aufzubringen. Sie waren im Augenblick alle ohnehin klein mit Dienstmütze.
Als sie mich bei meinem Wagen ausluden, wünschten sie mir noch eine „erfolgreiche Geburt“ und machten sich vom Acker.
Ich nichts wie hinein ins Auto, die Kurve zum Stubnerbauern genommen und scharf abgebremst, weil mir der Bauer entgegenkam.
„Was ist mit der Kuh?“, bellte ich.
„Gar nichts. Ich hab’ weder eine Geburt und schon gar keine Schwergeburtl!“ Sein Gesicht verzog sich zu einem Grinsen: „Aber der Vater hat gesehen, wie man Sie in den Polizeibus verfrachtet hat, und hat gemeint, jetzt haben sie unseren Tierarzt verhaftet! Und da habe ich mir gedacht, ich erfinde einen Notfall, vielleicht lässt man Sie dann laufen!“
Keine Post für den Tierarzt
Es war wieder einmal ein Anruf von höchster Dringlichkeit!
„Hier ist der Hasenbichlhof! Bitte kommen Sie schnell, eine Kalbin kann nicht kälbern!“
Die Stimme kam mir bekannt vor, trotzdem war ich irritiert. Die Bäuerin war es jedenfalls nicht. Und ich wusste nicht, wo ich die Anruferin einordnen sollte.
Aber was soll’s! Der Kalbin würde es mit ziemlicher Sicherheit völlig wurscht sein, wer für sie Hilfe anforderte.
Ich legte also einen klassischen Le-Mans-Start hin, überholte dank Blaulicht eine Schleicherkolonne vor mir und traf zehn Minuten später beim Hasenbichl ein. Dort entknotete sich das Rätsel.
Vor der Haustür stand nämlich ein vierräderiges „Spuckerl“ von einer Altenbetreuungsorganisation.
Auf mein Läuten hin öffnete mir die ehemalige Forsthubbäuerin. Jetzt wusste ich, warum mir die Stimme bekannt vorgekommen war.
Die Forsthuberin hatte vor einigen Jahren Mann und Hof verlassen und arbeitete seither in der Pflege.
„Danke, dass Sie so schnell da sind! Die Bauersleute sind auf Urlaub und ich kümmere mich derweilen um die alte Mutter. Da habe ich die Kalbin schreien gehört, und wie ich nach ihr schaue, sehe ich, dass sie in Geburt ist und dass dabei alleine nichts geht!“
Es war sonnenklar. Die Forsthuberin besaß genug Erfahrung im Umgang mit Tieren und konnte eine solche Lage fachfraumännisch beurteilen.
„Hören Sie, wie sie brüllt?“
Tatsächlich drang aus dem alten Holzstall das Blöken eines Rindes in höchster Not.
Wir gingen in den Stall, und was ich da sah, ließ mich glatt um ein Jahr altern.
Eine schmächtige Kalbin lag im Strohbett und wand sich vor Schmerzen. Kein Wunder, denn die Füße eines offenbar riesigen Kalbes ragten bereits aus der Vulva.
„Seit wann geht das so?“, frug ich besorgt.
„Keine Ahnung! Zuerst musste ich mich ja um die Mutter kümmern, aber dann habe ich das Schreien gehört.“
Ich ließ mir warmes Wasser bringen, desinfizierte die Scheidenumgebung und meine Arme, ging auf die Knie und griff einmal hinein. Es war fast unmöglich, an den Haxen vorbeizukommen. Drinnen erwarteten mich zwei große Nasenlöcher.
Langsam richtete ich mich auf: „Und Sie sagen, die Bauersleute sind auf Urlaub?“
„Ja! Bis Sonntag!“
Heute war Mittwoch. So lange konnte ich nicht warten.
Jetzt befand ich mich im Dilemma: Hier wäre die beste Lösung natürlich ein Kaiserschnitt. Aber ohne Zustimmung des Besitzers konnte ich ihn schlecht durchführen, denn die Kalbin war sein Eigentum und rein wirtschaftlich betrachtet wäre ein solcher auch nicht gerechtfertigt. Ein Jungrind aus Mutterkuhhaltung ohne besonderen Wert.
Ja, manchmal muss man in der Veterinärmedizin auch ökonomische Rücksichten nehmen, ob es einem passt oder nicht. Da ist die vielgepriesene Romantik des Berufs schnell dahin.
Wahrscheinlich würde mich der Bauer nach seiner Rückkehr fragen: „Sind Sie verrückt? Wie können Sie ohne meine Einwilligung so eine teure Operation vornehmen?“
Außerdem war da noch zu bedenken, dass bei einem Kaiserschnitt auch einmal etwas schiefgehen kann. Alle meine bisherigen sind zwar glücklich verlaufen, lediglich eine einzige Kuh wurde danach nicht mehr trächtig, aber der Teufel schläft nicht. Das wäre dann eine Angelegenheit der Tierkörperverwertung und gleichbedeutend mit dem finanziellen Totalverlust.
Als blutjunger Tierarzt berichtete mir einmal ein Bauer, dass am Wochenende der notdiensthabende Kollege, ein erfahrener Praktiker und anerkannter Chirurg, so eine Sectio caesareis, wie der Kaiserschnitt fachgerecht heißt, vorgenommen hatte, es gab Komplikationen und hinterher waren Kuh und Kalb tot.