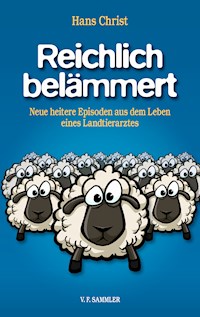Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stocker, L
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Bereits in den beiden Büchern "Mit der Kuh auf Du" und "Die Pfoten hoch" hat der Salzburger Landtierarzt seine Erlebnisse "mit dem lieben Vieh" und dessen zweibeinigen Besitzern geschildert. Auch in seinem jüngsten Buch finden sich eine Vielzahl heiterer oder zum Nachdenken anregende Ereignisse. Da ist von einem übergewichtigen Tierbesitzer die Rede, der den ihm zugedachten Schrittmacher seinem Hund umhängt, und von einer alten Stute, die ihr Leben opfert, um eine andere zu retten, von uralter Bauernschläue und moderner Hubschrauberbergung im Gebirge. Daneben betätigt sich der Herr Doktor als Ehestifter, Schlangen- und Verwandtenbändiger, ist auf der Suche nach einem perfekten Double für einen toten Papagei, widersteht erotischen Heimsuchungen und entpuppt sich zuletzt als Esoteriker wider Willen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Christ
Da lachen die Hühner!
V. F. SAMMLER
Hans Christ
Da lachen die Hühner!
Heitere Episoden aus dem Leben eines Landtierarztes
V. F. SAMMLER
Abbildungsnachweis:Umschlaggestaltung: Thomas Hofer, Werbeagentur / Digitalstudio Rypka GmbH, 8143 Dobl/GrazUmschlagfoto: Wolf-Dietmar Unterweger – Die Strichzeichnungen im Text wurden dem Verlag freundlicherweise vom Autor, die Faksimile der Zeitungsartikel von der Kronenzeitung zur Verfügung gestellt.
Bibliografische Information Der Deutschen BibliothekDie Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN 978-3-85365-233-6Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.© Copyright by V. F. Sammler, Graz 2008Layout: Klaudia Aschbacher, A-8111 Judendorf-StraßengelGesamtherstellung: Druckerei Theiss GmbH, A-9431 St. Stefan
Inhalt
Erfrischung gefällig?
Selbst ist der Mann, wenn er der Tierarzt ist
Appetitzügler
Die Heiratsvermittlung
Der „Schlangenflüsterer“
Auch ein Tierarzt braucht mal Hilfe
Neue Besen kehren gut
Die alte Lisa
Wer ist schon punschlos glücklich
Der Vogelhändler bin ich ja …
Schottische Impressionen
Sport ist gesund
Zwei Chinesen ohne Kontrabaß
Ohrwasch’l à la Peking
Der Veteran
Haarige Angelegenheiten
Alles, was Hörner hat, fliegt
Sexy Hexi
Bauernschläue
Nach Gutsherrenart
Esoterik gefällig?
Das Ende
Erfrischung gefällig?
Der morgendliche und daher nicht ungetrübte Blick auf den Kalender, wo die täglichen Visiten aufgeschrieben werden, zeigte den 1. August! Ein zweiter Blick aus dem Fenster räumte die Möglichkeit ein, daß das stimmen konnte. Ein herrlicher Sommertag spannte sich über das Tal, die rosafarbenen Berggipfel leuchteten unter dem noch blaßblauen, aber wolkenlosen Himmel, und ein warmer, nach frischen Wiesen duftender Windhauch strich sanft durch die Gardinen herein.
Erster August! Plötzlich wurde mir klar, daß ich mit dem heutigen Tag bereits seit acht Jahren hier als Tierarzt tätig war (achtzehn Jahre insgesamt), seit siebzehn Jahren mit Karin verheiratet und seit gestern wußte, woher der seltsame Geruch in meinem Auto herrührte. Ich hatte komplett auf den Plastiksack mit der eingeschläferten Katze vergessen, die ich vor drei Tagen in der Tierkörperverwertungssammelstelle abliefern wollte und seither im Kofferraum mit mir herumgeführt hatte. Für all diese Erkenntnisse war ich dem Schicksal zutiefst dankbar, und ich beschloß, dieses kleine Jubiläum bei einer weiteren Tasse Kaffee noch ein bißchen zu genießen. Viel war offensichtlich heute sowieso nicht los.
Die Tapferen, die meine ersten Bücher gelesen haben, wissen an meinem Beispiel, daß nicht jeder Wiener, der nach Salzburg kommt, dies aus Urlaubsgründen tut. Ich arbeite jetzt schon achtzehn Jahre als eine Art Salzburger James Herriot mit dem lieben Vieh. Daß ich Tierarzt werden wollte, stand für mich seit meinem sechsten Lebensjahr ebenso unverrückbar fest wie die Tatsache, daß ich ab diesem Alter bereits eine Brille brauchte. Nach einem abwechslungreichen Studium noch auf der alten Tierärztlichen Hochschule im 3. Bezirk – die neue Veterinärmedizinische Universität liegt seit Jahren aus Platzgründen jenseits der Donau –, welches ich eingedenk des lustigen Studentenlebens für meinen Geschmack viel zu früh, nach Ansicht meines Vaters viel zu spät beendet hatte, wollte ich meine Karriere als Kleintierchirurg starten.
Aber wie es im Leben so ist … Die angepeilte und zugesagte Assistentenstelle an der Uni wurde erst in acht Monaten frei, bis dahin, empfahl mir der Professor, könnte ich zum Lebensunterhalt den Krankenstandsvertretungsposten an der Besamungsstation Gleisdorf in der Steiermark annehmen.
Hier kam ich das erste Mal so richtig in Kontakt mit der Großtierpraxis, ich fand die Arbeit nicht nur interessant und teilweise noch romantisch, sondern auch körperlich herausfordernd, und langsam, zuerst unbemerkt, aber dann immer schneller begann mein in leuchtenden Farben selbstgemaltes Zukunftsbild als Kleintierchirurg im Goldrahmen am Berufshorizont zu verblassen.
Ich ließ den nächsten Bewerbungstermin für die Chirurgiestelle ungenutzt vorbeiziehen, lehnte sogar das schmeichelhafte Angebot des Pathologieprofessors, der mich völlig überraschend an einem Samstagnachmittag angerufen und mir einen Posten an seinem Institut offeriert hatte, ab und besorgte mir bequemere Gummistiefel.
Ich habe es nicht bereut, obwohl die Anforderungen an einen Großtierpraktiker erheblich sind.
Achtzehn Jahre Landpraxis bedeuteten immerhin, mit kurzen Ausnahmen, achtzehn Jahre lang Rufbereitschaft Tag und Nacht, auf schlechten Almwegen oder vereisten Straßen zu fahren, kräfteraubende Arbeit unter unmöglichen Bedingungen, Dreck, Termindruck, verschiedene Blessuren durch widerspenstige Patienten und der ständige Kampf um Leben oder Tod derselben (wobei die Bilanz Gott sei Dank deutlich auf der positiven Seite liegt).
Aber sie bedeuten auch Anerkennung, schöne und (ehrlicherweise) manchmal verblüffende Erfolgserlebnisse, ständiger Kontakt zu Tieren und das alles vor und in einer landschaftlich grandiosen Kulisse mit noch intakter landwirtschaftlicher Struktur, in der das Individuum noch zählt, Originale nicht gänzlich ausgestorben sind und Tiere eine Würde besitzen.
Das ist die kurze Inhaltsangabe meiner Bücher.
In diese Gedanken versunken, starrte ich das berühmte Loch in die Wand, als meine frisch geduschte Karin im Bademantel in die Küche kam und fast erschrocken fragte: „Nanu, du bist noch da?“
Ich machte eine wegwerfende Handbewegung Richtung Visitenbuch: „Alles ruhig an der Front! Zwei lausige Besamungen, natürlich auf ziemlich entfernten Almen, eine Kuh beim Mühlbauern gibt ,schlechte‘ Milch und das Schwein vom Pflegerbauern hat Rotlauf! Typische Sommerpraxis halt! Wenig Arbeit, aber weite Wege!“
„Fein! Vielleicht kommst du dann heute mittag etwas früher als üblich nach Hause! Dann könnten wir sogar Essen gehen! Ich habe eigentlich keine Lust, bei dem Prachtwetter zu kochen!“
„Abgemacht! Also auf in den Kampf, Torero!“ Ich stürzte den letzten Schluck kalten Kaffees hinunter, ohne auf dessen Schönheitswirkung wirklich vertrauend, und fuhr los.
Auf dem Weg zur Sturzalm, der sich zuerst einige Kilometer entlang des murmelnden Baches durch ein schattiges Waldtal schlängelte, ehe es plötzlich steil bergauf ging, überholte ich zahlreiche Grüppchen von Bergwanderern, die sich bereits frühzeitig auf die verschwitzten Wollsocken gemacht hatten, um der drohenden Tageshitze zu entgehen. Trotzdem ich für meine Begriffe ungewöhnlich langsam fuhr, ließ es sich nicht vermeiden, daß die Staubwolken, die von der groben Schotterstraße hochwirbelten, die Schar der frischlufthungrigen Naturfreunde in eine mehlgepuderte Geisterherde verwandelte. Regen war wirklich dringend nötig.
Die stattliche Sturzalm lag noch jungfräulich und touristenlos in der Morgensonne, die Kühe bimmelten gemächlich den Berghang entlang, und der alte Sturzbauer, den unvermeidlichen kalten Zigarrenstummel im Mund, erhob sich von der Hausbank und hinkte mir entgegen.
„Guten Morgen!“ Elastizität vortäuschend, sprang ich aus dem Auto: „Was für ein Stier soll’s denn sein?“
„A Guater!“
Ich grinste: „Laut Besamungsanstalt haben wir nur gute Stiere!“
„Jaja!“ machte der Sturz gleichmütig und sagte damit eigentlich alles.
Ich suchte das Spermaröhrchen eines hübschen Salzburger Jungbullen aus den Tiefen meines mit Stickstoff gefüllten Tiefkühlcontainers heraus, von dem ich sicher war, daß er gut befruchtete und leichte Abkalbung verursachte. Schwergeburten waren mir ein Gräuel, und als Freund von Kaiserschnitten betrachtete ich mich auch nicht. „Untertags habe ich dazu keine Zeit und in der Nacht keine Lust!“ lautete mein Stehsatz, wenn ein Tierbesitzer einmal trotz meiner Bedenken auf einen Stier beharrte, der laut Katalog dieses hohe Risiko aufwies.
Dem Sturz war die Wahl recht und der Kuh, die bereits ungeduldig im großen Almstall auf ihre Schwangerschaft wartete, um endlich zu ihren Freundinnen auf der Wiese zu kommen, offensichtlich auch.
Während ich den Besamungsschein ausfüllte, zauberte der Sturz plötzlich von irgendwo ein Glas Schnaps hervor und hielt es mir erwartungsvoll vor die Nase: „Erfrischung gefällig, Herr Doktor?“
Ich schielte skeptisch auf die Uhr! Ziemlich früh noch und für die Dimension des Glases eigentlich viel zu früh! Andererseits wäre der Bauer mit Sicherheit enttäuscht, würde ich die gutgemeinte Geste ausschlagen. Der alte Sturz vertrat nämlich die Meinung, ob Sommer oder Winter, ein echter Selbstgebrannter sei die beste Medizin. Böse Zungen behaupten sogar, er selbst handle nach dem Grundsatz, je mehr der Bauer trinke, desto gesünder sei das Vieh.
Allerdings mußte ich zugeben, am Sturzhof gab es krankheitshalber wirklich selten etwas zu tun.
Also ein Prost der Volksmedizin! Ich hob das Glas, sagte: „Gesundheit!“, und trank es aus.
Ehre, wem Ehre gebührt, der Hollerschnaps war ausgezeichnet, vom Brennen verstand der alte Sturz etwas.
Die nächste Alm, wo eine weitere Besamung meiner harrte, lag in Sichtweite, ein Kilometer Luftlinie ungefähr, aber auf dem Landweg gut vierundzwanzigmal soviel. Das sind die Raffinessen einer Gebirgspraxis mit ihren dazwischengestreuten Tälern.
Danach ratterte ich zum Mühlhof, wo sich die Euterentzündung gottlob als relativ harmlose Sommermastitis entpuppte.
Schließlich mußte ich noch zum Pfleger mit dem Rotlaufschwein, ein Besuch, der diesen mittlerweile postkartenmäßig gewordenen Sommertag ziemlich eintrübte.
Der Pfleger war ein alter Raunzer, gewohnheitsmäßig mißmutig und ebenso mißtrauisch und stets bereit, die eigenen Fehler einem anderen zuzuschieben. Es ging auch gleich los, als ich ankam und ausstieg.
Unvermittelt, ohne Gruß, knurrte er: „Spat (spät) kommen S’!“
„Ich weiß, mein Hubschrauber ist gerade beim Service!“
Gegen Sarkasmus war der Pfleger jedoch so gut isoliert wie eine Daunenjacke gegen Schneesturm.
„Hoffentlich san Sie net zu spat!“ präzisierte er den Vorwurf.
„Hoffentlich“, war meine knappe Antwort, mit der ich den Stall betrat.
In seinem Kobel lag ein stattlicher Saubär auf der Seite, schnaufend, von Fliegenschwärmen bedeckt.
Die typischen Rotlaufflecken waren bereits ineinander übergeflossen, so daß die Haut so knallrot war, daß der Eber mühelos an der Spitze des 1.-Mai-Aufmarsches mitmachen hätte können.
Er grunzte nur unwilllig, als ich das Thermometer in den After schob, machte aber sonst keine Abwehrbewegung. Das Digitalthermometer, das ich seit kurzem verwendete, piepste bei 41,8 Grad!
Der Kreislauf war dementsprechend schlecht.
Ich stand auf: „Na, erst seit gestern hat er den Rotlauf mit Sicherheit nicht! Wieviele Tage, aber ich will eine ehrliche Antwort?“
Der Pfleger bekam ein unschuldiges Geschau: „Vor vier Tagen is’ es los’gangen, aber vorgestern hat’s ausg’schaut, als würd’ er es übersteh’n. Und seit gestern is’ er ganz letz (schlecht)!“
„Aha“, sagte ich grimmig. „Der Bauer wartet vier Tage, aber wenn der Tierarzt nach zwei Stunden eintrifft, ist es zu spät, oder?“
„I bin koa Dokta!“ verteidigte sich der Pfleger und schob sich den speckigen Hut trotzig in die Stirne.
„Ich bin zwar einer, aber kein Zauberer“, entgegnete ich. Zwar war ich ziemlich gewiß, das kranke Schwein durchzubringen, aber ein bißchen Verunsicherung konnte hier nicht schaden.
Sofort begann auch die Jammerei: „Naa! Mein schöner Zuchtbär! A so ein Schad’n, a so ein G’frett!“
Ungerührt zog ich das Antibiotikum auf, mischte etwas Entzündungshemmendes und Fiebersenkendes dazu und garnierte den Cocktail mit ein wenig Kreislaufmittel. Als ich die Spritze hinter dem Ohrgrund injizierte, quiekte der Eber nur leicht. Wahrscheinlich würde er am Abend bereits aufstehen und etwas fressen.
Während ich mir die Hände am Brunntrog wusch, ließ der Pfleger keinen Blick von dem Saubären, fast beschwörend fixierte er das kranke Tier.
Erst als ich ins Auto stieg, kam Bewegung in ihn, und er lief mir nach: „Und was is’, wann er stirbt?“
Mir lag schon auf der Zunge: „Na, dann rufen Sie das nächste Mal vielleicht früher an“, aber mir kam ein besserer Gedanke. Ich streckte den Kopf zum Fenster raus und sagte verschwörerisch: „Wenn er es nicht schafft, verrechne ich nichts!“ Ich schaltete eine kleine Kunstpause ein, die dem Pfleger Gelegenheit gab, einen freudig überraschten Ausdruck anzunehmen, um dann fortzusetzen: „Wenn er aber gesund wird, kostet es das Doppelte!“
Ich fuhr los und freute mich im Rückspiegel über das Gesicht des Pfleger, der erstens nicht wußte, ob das ernst gemeint war, und deshalb zweitens im unklaren war, was er sich wünschen sollte.
Mittlerweile war es kurz vor Mittag, und ich freute mich schon auf ein gemütliches Essen mit Karin im schattigen Garten unseres Stammwirtshauses. In Gedanken ging ich die Speisekarte, die ich bis auf die jahreszeitlichen Variationen auswendig wußte, durch und entschied mich virtuell für einen saftigen Kalbsbraten mit Reis und grünem Salat.
Während mir bereits das Wasser im Mund zusammenlief, meldete sich das Handy. Karin wollte nachfragen, wann ich etwa rechnete, heimzukommen.
Aufgekratzt trompetete ich: „Hallihalloh! Du wirst es nicht glauben, aber ich bin bereits auf dem Weg ins traute Heim!“
„Ich glaub’s auch nicht!“ war die trockene Antwort.
Recht hatte sie! Kaum, daß ich aufgelegt hatte, klingelte das verdammte Ding erneut!
Meine vage Hoffnung, es wäre nochmals Karin, verflog angesichts der knarrenden Männerstimme, die zweifelsfrei dem Hochleitenbauern gehörte: „Herr Dokta? Sie müass’n schnell kumman, mir hab’n a Kuah zum Kalb’n und bringen das Kaibl net füra!“
Also statt Kalbsbraten Kalbsgeburt!
Mein Stimmungsbarometer sank beträchtlich, denn wenn bei uns im Gebirge ein Hofnahme mit „Hoch“ begann, konnte man sich darauf verlassen, das das die Lage des Anwesens glänzend beschrieb. Darüber hinaus war das Hochleitengut nur über einen elendslangen, naturbelassenen Serpentinenweg zu erreichen, der dem Namen Weg eigentlich hohnsprach. Zwei sandige Fahrstreifen mit einer bombierten Grasnarbe in der Mitte und so schmal, daß zwei Fahrzeuge nur an wenigen Stellen aneinander vorbeikamen. Die genügten aber, da man auf dem baumlosen Hang die gesamte Strecke einsehen konnte und so den Entgegenkommenden auf weite Entfernung wahrnahm. Es blieb somit genügend Zeit, eine dieser Verbreiterungen aufzusuchen und sich für eine halbe Stunde einzuparken, denn so lange dauerte es im Schnitt, bis das andere Fahrzeug da war. Der Hochleitenweg war nämlich zusätzlich mit Schikanen in Form von sechs Tör’ln, also Toren, ausgestattet, die in Gestalt und Bauart völlig variierten, aber die gemeinsame Eigenschaft besaßen, ein schnelles Fortkommen zu verhindern. Pro Tor hieß es jedesmal stoppen, Handbremse ziehen, aussteigen, Tor öffnen, einhängen oder abspreizen, damit es nicht wieder zufiel, während man sich gerade auf der Durchfahrt befand, drei Meter weiterfahren, stoppen, Handbremse, Tor schließen, einsteigen, Handbremse lösen, weiterfahren. Sechs solcher Hindernisse in einer Richtung bedeuteten hin und zurück nach Adam Riese zwölf und waren somit mit vierundzwanzigmal Aus- und Einsteigen verbunden. Der damit verbundene Lustgewinn blieb klarerweise meistens unter der Nachweisgrenze.
Dazu kam, daß der Abstand zwischen manchen Toren lediglich ein paar hundert Meter betrug und die Technik des Öffnens sich vielfach als kräfteraubend erwies. Besonders das erste Tor nach der Abzweigung von der Landstraße war ein bösartiges und gefährliches Exemplar. Seine ältesten Holzteile dürften noch aus den Bodenbrettern der Arche Noah gefertigt worden sein, und so, wie jede Generation einer anständigen Bauerndynastie danach trachtet, zum bestehenden Besitz etwas zuzuerwerben, dürfte der Ehrgeiz der Hochleitnerischen Familiensaga darin bestanden haben, sich jedes Mal in diesem Holztor zu verewigen. Es war unheimlich schwer, dabei wackelig in der Aufhängung, und ein besonderer Geist hatte diesem Ungetüm eine nutzlose Garnierung aus mittlerweile völlig verrostetem Stacheldraht verpaßt, der lose mit seinem viel zu langen Ende herumbaumelte und jedem Ankömmling ins Gesicht zu schlagen versuchte. Als ich einmal kekkerweise versucht hatte, mich nach der praktischen Bedeutung dieses Mordinstrumentes zu erkundigen, erntete ich nur ratlose Gesichter und die erschöpfende Auskunft, das wäre schon seit dem Großvater so.
Als ich schließlich schweißgebadet die letzte Kuppe genommen hatte und auf den Hof einfuhr, kam die Hochleitnerin in ihrer blauen Kleiderschürze heraus und deutete den Hang weiter aufwärts: „Griaß Gott, Herr Dokta! Sie müass’n da auffi, zum Scherm (das bezeichnet einen kleinen, hüttenartigen Unterstand für das Vieh), mir hab’n die Kalbin da drob’n. Da Mann und da Schwiegersohn wart’n schon!“
Meine Laune sank beängstigend. „Da auffi“ führte kein Fahrweg mehr und bedeutete somit einen Fußmarsch mit der kompletten Geburtsausrüstung über vierhundert Meter steile Wiese in der Mittagssonne.
„Hätten Sie die Kalbin nicht rechtzeitig heruntertreiben können?“ knurrte ich, meinen Unwillen deutlich zeigend.
„Oh mei“, jammerte die Bäuerin, „in der Fruah war noch gar nix zum Kennen, und wia da Mann vor einer Stund’ nachschau’n geht, schau’n hint’n schon die zwoa Füaß aussa!“
Seufzend kramte ich die nötigen Utensilien aus dem Wagen. Als ich mich eben auf den Weg machen wollte, erschien die Hochleitnerin erneut: „Nehmen S’ zur Sicherheit gleich den Eimer Warmwasser mit!“
Da ich sowieso schon bepackt war wie eine Ein-Mann-Safari, starrte ich sie ungläubig an: „Und wie bitteschön soll ich den tragen?“
„I komm’ eh glei nach! Lass’n Sie einfach was da, was Sie vielleicht net am Anfang brauch’n, i bring’s schon!“
„Gut!“ Ich deponierte die Uteruspumpe und den Plastikkanister mit dem Granulat zur Erzeugung von künstlichem Fruchtschleim auf der Fensterbank, schnappte den Eimer und marschierte los.
Die Sonne brannte, der Geburtsmantel drohte dauernd, von der Schulter zu rutschen, und eine Horde fetter blutrünstiger Rinderbremsen gab mir treuen Geleitschutz, wobei sie sich ihren Lohn dafür vornehmlich aus meinen Waden saugte.
Schnaufend kam ich im Scherm an. Der Hochleitner saß auf einem Holzstück und paffte eine Zigarette. Ein junger, kräftiger Mann, offensichtlich der Schwiegersohn sprang herbei und nahm mir hilfreich Ballast ab, eine nette Geste, aber unnötig, den letzten Meter im Stall hätt ich auch noch geschafft.
Dann war noch die Burgi da, die siebzehnjährige Hochleitnertochter, die, wie sie mir einmal gestanden hatte, später auch Tierärztin werden wollte.
Als mein Blick auf die Hauptperson, die Kalbin fiel, erhöhte sich meine Stimmung keineswegs. Zwei ziemlich große Füße mit dicken Klauen ragten ein Stück hinten heraus, und das vergebliche Pressen der Jungkuh war von Stöhnen begleitet.
„Wann ist denn die Fruchtblase gesprungen?“ fragte ich.
Der Hochleitner zuckte bloß die Schultern.
Ich schlüpfte in den Geburtsmantel und schüttete reichlich Desinfektionsmittel in das mitgebrachte Warmwasser, mit dem ich die Scham der Kalbin akribisch zu säubern begann. Dann unterzog ich meine Arme der gleichen Prozedur und ging sachte daran, die Situation im Becken zu erkunden. Die Schultern des Kalbes befanden sich noch hinter dem Rand des knöchernen Beckens, und es würde mit Sicherheit eine enge Sache werden, aber es müßte meiner Einschätzung nach gehen. Das Zucken der Nüstern zeigte mir, daß das Kalb noch lebte, nur die Schleimhäute der Geburtswege waren bereits ziemlich ausgetrocknet. Offensichtlich war das Wasser doch schon vor längerer Zeit gebrochen. Gut, daß die Hochleitenbäuerin gleich mit dem Schleimpulver nachkommen würde.
Endlich verdunkelte ihre imponierende Silhouette die sonnige Türöffnung. Mit Genugtuung stellte ich fest, daß sie erheblich mehr keuchte als ich.
„So, los geht’s! Her mit dem Fruchtschleimkanister!“
Das hochrote Gesicht der Bäuerin wurde noch röter: „Pff, was für ein, ächz, Kanister?“
Ich bekam langsam Schleier vor den Augen: „Der weiße Plastikkanister! Und die Pumpe! Die, die ich auf’s Fensterbrett gelegt habe und die Sie nachbringen würden!!!“ Karin saß mit knurrendem Magen daheim, von meinem wollte ich gar nicht reden.
Die Hochleiterin lehnte sich ins Eck an die Wand und pfauchte stoßweise, aber nicht vor Wut, sondern aus Sauerstoffmangel: „Des hab’ i’ ganz vergess’n!“
Die Burgi rettete die Situation: „I’ hol’s schon!“, und mit Behendigkeit, die man gemeinhin den Gazellen nachsagt, hüpfte sie die steile Leiten hinunter, während ich die Geburtsstricke an den Kälberbeinen befestigte und Querhölzer zwecks besseren Griffes daran band. In bewundernswert kurzer Zeit war die Burgi wieder retour und strahlte mich, heftig atmend, an: „Da, bitt’schön, Herr Dokta!“
Nachdem es schon einige Zeit her war, daß mich eine Siebzehnjährige, wenn auch nur beruflich, angestrahlt hatte, strahlte ich zurück: „Besten Dank!“, und schüttete das körnige Pulver in einen Eimer mit zirka zwei Litern Wasser, wo es sich unter ständigem Rühren in eine schlüpfrige Masse verwandelte.
Die Uteruspumpe, einer Fahrradpumpe nicht unähnlich, wurde in den Kübel gestellt, und während ich den Gummischlauch in die Gebärmutter der Kalbin führte, wies ich den Hochleitner an, kräftig zu pumpen. Der künstliche Fruchtschleim strömte stoßartig in den Beckenraum und machte das Kalb samt Umgebung genügend glitschig.
Dann zog ich den Schlauch heraus, legte die Pumpe ab und kommandierte die versammelte Geburtshilfegruppe: „So, jetzt jeder einen Strick in die Hand und abwechselnd ziehen, aber langsam! Ja nicht reißen! So ist’s richtig! Zuerst der linke Fuß, jetzt halt, gespannt halten, jetzt der rechte Fuß! Gut so!“ Ich spürte, wie das Kalb in Bewegung geriet und die Schultergelenke über den Knochenrand des Beckens glitten. Die Kalbin stöhnte gottserbärmlich, aber es geschah nur zu ihrem Besten. Der Kopf erschien allmählich im Vulvaausschnitt, und während ich mit den Händen den Dammschutz bewerkstelligte, befahl ich lautstark: „Linker Fuß, rechter, zum Kuckuck, nicht gleichzeitig, ja jetzt wieder links …!“ Zentimeter für Zentimeter erschien ein prächtiges Kalb auf der Bildfläche, zuerst der Kopf, dann die Schultern, der Brustkorb, der Bauch, beim Becken gab es noch eine leichte Verzögerung, die Hochleitnerfamilie zog keuchend und schwitzend mit aller Kraft, und plötzlich flutschte auch der Hinterkörper des Neugeborenen heraus. Sofort war ich über dem Kalb, das leblos dalag, und begann mit der Reanimation! Akupunkturnadel in den Nasennotfallpunkt, Ausstreifen des eingeatmeten Fruchtwassers aus dem Maul, Kreislaufspritze, Herzmassage! Verdammt, das Tier sprach schlecht an. Natürlich war diese Geburt eine schwere gewesen, und die Lufttemperatur im Raum, nicht zuletzt durch die Anstrengung mehrerer Leute, hatte mittlerweile saunaähnlichen Charakter angenommen – ich selbst troff vor Schweiß! „Kaltes Wasser über den Kopf, schnell!“ brüllte ich. Zugegeben, ich hatte mich in der Eile unpräzise ausgedrückt. Die Burgi ergriff den Eimer, überlegte kurz und entschied sich dann für den offensichtlich Erbarmungswürdigeren von uns beiden, denn sie kippte mir das eiskalte Naß schwungvoll über den Schädel.
„Nicht mir, dem Kalb!“ brüllte ich, aber da machte das Neugeborene die ersten Atemzüge.
Ein weiterer Guß, diesmal an den richtigen Adressaten holte das Tier endgültig in die rauhe Wirklichkeit zurück. Schweratmend, noch ein bißchen röchelnd lag es da und schaute verwundert im Kreis umher.
Ich nahm klatschnaß die Gratulationen entgegen und verabschiedete mich. Kleinere Wasserpfützen hinter mir lassend, stiefelte ich den Hang hinunter, wo mein Auto stand. Na, während der Fahrt mit all den Toren würde ich schon wieder trocken werden.
Bei der Abfahrt vom Hof wiederholte sich die endlose Prozedur des Gatteröffnens und -schließens, bis ich genervt dem letzten Tor, dem mit dem morschen Stacheldraht, einen ordentlichen Tritt versetzte, daß es mindestens drei Mal hin- und herschwang. Daß sich dabei ein Stück dieses Drahtes gelöst hatte, merkte ich erst, als bei der Durchfahrt vom linken Hinterreifen her ein scharfes Zischen zu hören war. Ich stieg aus und betrachtete verbittert den Patschen, ehe ich das Werkzeug hervorkramte. Die Halteschrauben des Reserverades, das sich intelligenterweise unter dem Wagen in einem Gitterkorb befand, waren natürlich durch Dreck ziemlich festgefressen und ließen sich auch mit Korrosionsspray nur mühsam herausdrehen.
Inzwischen kam der Hochleitner auf seinem Traktor gemächlich den Hang heruntergerattert, wobei ihm die mitfahrende Burgi beflissen die Tore öffnete und schloß. Als er auf meiner Höhe angelangt war, hielt er quietschend an, musterte kritisch meine ölverschmierten Hände und rief vorwurfsvoll durch den Motorlärm: „Die Gatter hätt’n S’net alle wieder zuamach’n brauch’n, san eh koane Viecher auf’n Hang, und mi hat das jetzt Zeit g’kost, no’ dazua bei dera Hitz!“
In dem Moment hätte ich viel für einen Kübel Schmutzwasser gegeben, den ich ihm hätte aufsetzen können, nach dem Motto: „Erfrischung gefällig?“
Selbst ist der Mann, wenn er der Tierarzt ist
Jedesmal, wenn der Schartnerbauer anruft, bekomme ich ein Zucken des linken Augenlids, denn das bedeutet mit schöner Regelmäßigkeit Ärger.
Der Schartner ist ein breitschultriger Mann mittleren Alters und mit einer Bierruhe ausgestattet, die andere glatt in den Wahnsinn treiben konnte.
Schon die erste Begegnung bald nach meiner Praxiseröffnung verlief auf äußerst skurrile Art. Ich war noch unterwegs, als um halb acht Uhr abends das Telefon brummte, eine Uhrzeit, die, wie ich später leidvoll erfahren mußte, für den Schartner absoluten Frührekord bedeutete (wahrscheinlich sein Einstandsgeschenk): „Ja Herr Dokta! I bin’s! Der Schartner! Bei mir is’ a Kaibl krank! Wann S’ so liab san und no auffaschau’n! Aber bittschön net vor Neune, weil i’ bin no net dahoam!“ Im Hintergrund waren Gläserklirren und Stimmen zu hören, also eine typische Wirtshauskulisse.
Ich versuchte den Tadel mit Ironie zu würzen: „Da brauchen Sie keine Angst zu haben, ich hab’ noch eine schöne Liste vor mir, nachdem heute noch andere auf den Gedanken gekommen sind, erst so spät anzurufen!“
Die einzige Reaktion des Schartner war ein befriedigtes Schnaufen und ein „Dankschön!“, mit dem er auflegte.
Da es bereits Herbst war, näherte ich mich um Viertel nach neun dem Schartnergut in völliger Dunkelheit. Ein leichter Nieselregen machte die Windschutzscheibe schmierig und den Weg rutschig.
Plötzlich tauchte vor mir das alte Bauernhaus auf. Zuerst glaubte ich, ich wäre an der falschen Adresse gelandet, denn alle Fenster waren stockfinster, aber nach der Wegbeschreibung konnte ich mich nicht geirrt haben. Ich rollte langsam durch die schmale Einfahrt zwischen Hauswand und Böschung und blieb etwas ratlos vor dem ebenso finsteren Stallgebäude stehen. Es war vollkommen still, nur das leise Trommeln des Regens auf dem Autodach war zu hören. Auch auf mein Hupen änderte sich nichts an der Situation. Da ich hier schlecht bis zum Frühstück sitzen konnte, mußte ich wohl oder übel versuchen, irgend jemanden aufzutreiben. Ich ließ die Schweinwerfer brennen, um Licht zu haben, und stiefelte über den Platz. Oberhalb der Haustüre hing in leichter Schieflage ein Schild mit den eingeschnitzten Worten SCHARTNERGUT, ERBHOF.
Kein Zweifel, ich befand mich, im Gegensatz zum Bauern, an der verabredeten Stelle.
Da es keine Glocke gab, klopfte ich heftig gegen die massive Holztür, aber außer meinen Fingerknöcheln reagierte niemand darauf. Ich drückte die Klinke runter, und die Türe öffnete sich knarrend in ein stockdunkles Vorhaus. „Hallooo!“ rief ich in die Nacht, „hallooo, der Tierarzt ist hier! Sonst auch noch jemand?“
Ich lauschte. Stille! Irgendwo knackte ein Holzbalken. „Heeeeeeh!“ brüllte ich aus Leibeskräften. Der Ruf verhallte.
Wütend schlug ich die Haustüre zu und machte mich auf den Retourweg zum Auto. Na dem Schartner werde ich morgen etwas erzählen! Als ich ein paar Schritte weit gekommen war, vernahm ich das Knarren in meinem Rücken, das anzeigte, daß die Türe soeben wieder geöffnet wurde. Wie in einem Gruselfilm! Ich drehte mich um. Wenn jetzt ein Skelett herauskommen würde, wäre mir das im Moment auch recht gewesen, Hauptsache ein Ansprechpartner! Aber niemand erschien. Statt dessen ertönte aus der Finsternis ein krächzendes Komando: „Faß!“, und eine kurzbeinige Promenadenmischung schoß knurrend mit gebleckten Zähnen heraus und auf mich zu. Ich gestehe, daß dies das erste Mal in meinem Leben gewesen war, daß jemand seinen Hund auf mich gehetzt hatte, nicht einmal mein Bankdirektor hat angesichts des letzten Kontostandes zu dieser Maßnahme gegriffen. Reglos verharrte ich, die beste Methode gegenüber einem angreifenden Hund, leider nicht immer die zielführende. Der Kläffer stürmte auf mein Hosenbein zu, stutzte, schnupperte daran und begann, mich freundlich wedelnd zu umkreisen. Offensichtlich reinster Theaterdonner. Erleichtert hockte ich mich nieder, worauf er sich sofort auf den Rücken warf und sich den Bauch kraulen ließ: „Na, du gehst wohl auch im Fasching als Pitbull verkleidet, was?“ Zur Bestätigung klopfte er mit dem Schweif auf den Boden.
Ich lief nochmals zum Hauseingang, riß die Türe auf und schrie hinein: „Sie sind wohl deppert, was?“
Wieder blieb alles still. Der Zombie, der offensichtlich der Ansicht war, sein Kampfdackel würde mich sowieso auslösen wie eine Schweinsschulter, und daher auf eine Fortsetzung des Besuches nicht gefaßt schien, hatte sich wieder in die Anonymität zurückgezogen. Da ich nicht die geringste Lust verspürte, in einem fremden und stockdunklen Haus einem Psychopathen nachzuspüren, warf ich krachend das Haustor zu.
Obwohl es eigentlich total verrückt war, beschloß ich, noch einen Blick in den Stall zu riskieren, vielleicht fand ich das kranke Kalb von selbst. Der Hund wuselte noch immer um mich herum, und die einzige Gefahr, die von ihm ausging, bestand darin, über ihn zu stolpern. Nach längerem Umhertasten fand ich den Lichtschalter und drehte auf. Fünf Kühe lagen auf ihrem Strohbett und blinzelten mich verschlafen an. Ich ging durch die Stallgasse und schaute in den Verschlag an ihrem Ende, wo ein einsames Pinzgauerkalb neugierig herausglotzte. Es machte einen überaus gesunden Eindruck. Andere Kälber konnte ich nicht entdecken, auch nicht im Nebenraum, wo ich ein fettes Schwein aus dessen süßen Träumen von einer vegetarischen Menschheit riß, was es mit unwilligem Grunzen quittierte.
Offensichtlich war heute nichts mehr auszurichten, daher verabschiedete ich mich von meinem neuen Freund, dem „Killerköter“, mittels Pfotenschütteln und fuhr nach Hause.
Da am nächsten Tag beim Schartner niemand zu erreichen war, erkundigte ich mich bei einem Nachbarn über die seltsamen Verhältnisse auf diesem Hof. Der grinste und sagte: „Ojeh, da is’ er wieder im Wirtshaus hängengeblieben!“
„Und wer hat versucht, mir den Hund auf den Hals zu hetzen?“
„Das war der Vater! Der hat sein Wirtshaus dahoam!“ Dabei ahmte der die globalisierte Handbewegung des Trinkens nach.
Eine Woche später, ich wollte gerade aus der Garage fahren, kletterte ein Mann in grauer Lodenknickerbocker aus einem dreckbespritztem Pickup und baute sich vor mir auf: „I’ möchte zahl’n!“
„Dann umso herzlicher willkommen“, sagte ich, „aber wer sind Sie und was wollen Sie bezahlen?“
„I’ bin der Schartner und möcht’ mei Kaibl zahl’n, des tuat wieder guat!“
„Na prima, daß ich Sie einmal kennenlerne, nachdem Sie mich damals am Abend schön versetzt haben und Ihr Vater den Hund auf mich gehetzt hat!“ Meine Verärgerung brach sich Bahn.
„Ah der Lumpi! Der is’ harmlos!“ Der Schartner konnte ein leichtes Lächeln nicht unterdrücken: „Da Vater moant immer, der Hund is’ scharf, weil er einmal nach eam selbst im Reflex g’schnappt hat, nachdem er eam auf’n Schwoaf g’stieg’n is’! Was bin i’ jetzt für’s Kaibl schuldig?“
„Nix“, antwortete ich, „ich hab’ kein Kalb behandelt, weil kein krankes da war!“
„Ah so“, sagte der Schartner, „da hat mir der Vater wieder was Falsches derzählt! Nachher Dankschön, Herr Dokta!“ Er stieg ein und fuhr weg. Ich starrte ihm nach. Der Gedanke, daß ich ihm die Visite schon verrechnen hätte können, kam mir zu spät.
Ein Jahr darauf starb der Vater, und der Schartner hauste danach allein und weiterhin unbeweibt auf dem Hof. Da ich ihn mittlerweile gut kannte, darf ich allen Frauen dieser Welt meine Solidarität versichern. Obwohl an und für sich ein netter Kerl, war er der unzuverlässigste Mensch, den man sich vorstellen konnte.
Schon allein die Besamungen, die ich ohne seine Hilfe, da er ja, trotz Versprechen, nie da war, an den Kühen durchführen mußte, glichen jedes Mal einem Rodeo. Seine Rindviecher erwiesen sich als menschenscheu und daher wesentlich gefährlicher als der arme Lumpi. Sie hüpften natürlich hin und her, schlugen mit den Schwänzen, traten mit den Füßen.
Obwohl ich ihn jedes Mal gebeten hatte, mir wenigstens vorher die jeweilige Ohrmarkennummer, die ich für den Besamungsschein brauchte, auf einem Zettel zu deponieren, mußte ich hinterher regelmäßig die dreckigen Ohrmarken mühsam mit den Fingernägeln unter heftigen, schüttelnden Abwehrbewegungen der beleidigten Kuh abkratzen und dabei den spitzen Hörnern ausweichen.
Jedesmal, wenn ich ihn darauf bei seinem nächsten Anruf zusammenstauchte, gab er sich zerknirscht und gelobte Besserung. „Das nächstemal, Herr Dokta, ganz g’wiß!“ Aber egal, ob ich schimpfte, drohte, ja sogar bettelte und an sein menschliches Mitleid appellierte, er war nie anwesend und die Ohrmarkennummern ebenfalls nicht. Gegen die Beharrlichkeit des Schartner erschien ein Flakturm formbar wie ein Plastilinstangerl.
Vor einigen Wochen teilte er mir, selbstverständlich am Abend, mit, daß er einen Notfall habe, weil ein Kalb schon seit Tagen an Durchfall leide, den er mittels Heidelbeertee und Edelweißabsud, sonst bewährte Hausmittel, nicht in den Griff bekomme. Da Kälberdurchfälle, vor allem wenn sie länger bestehen, lebensbedrohlich sein konnten, beschloß ich, trotz der fortgeschrittenen Stunde, den Besuch nicht auf morgen zu verschieben.
Dem Schartner schien dies tatsächlich zu beeindrucken: „Dank’ vielmals, daß Sie heut’ noch kommen, i’ bin zwar net dahoam, aber des Kaibl is’ eh alloan in der Box!“
Als ich den Stall betrat, traute ich meinen Augen nicht! Von Notfall keine Spur! Das „Kaibl“ erwies sich als mindestens halbjährige, etwas struppige Kalbin, die in einem Metallgehege stand, das mich in seinen Ausmaßen an eine Kindergehschule erinnerte. Die Seitengitter gingen mir bis zur Hüfte. Die Szenerie erinnerte stark an einen Pottwal im Goldfischteich.
Offensichtlich war das Jungrind stark verwurmt, da genügte eine Spritze. Aber wie an das Tier herankommen? Es war ja nicht blöd, denn in dem Moment, als ich mühelos mit gezückter Nadel die niedere Umzäunung überstieg, hüpfte es auf der anderen Seite heraus und floh quer durch den Kuhstall.
Gut, daß war’s dann für heute! Ich würde heimfahren und dem Schartner eine Nachricht hinterlassen, er möge mich wieder rufen, wenn das Kalb fixiert war. Im Geiste überschlug ich bereits, was ich ihm für den abendlichen Einsatz berechnen sollte, als ich bemerkte, wie die umherlaufende Kalbin fünf große Papiersäcke mit Kraftfutter entdeckt hatte, die in einer leeren Schweinebox aneinander gelehnt standen und an denen sie sich jetzt zu schaffen machte.
Kruzitürken, noch einmal, wenn das Vieh davon unbehelligt frißt, ist es morgen tot! Natürlich hätte ich den Standpunkt einnehmen können, die Schlamperei im Stall ging mich nichts an. Aber als Tierarzt, der die unausweichlichen Folgen kannte, durfte ich mich nicht so einfach russisch aus dem Staub machen. Ich verscheuchte die Kalbin und begann, die schweren Säcke nacheinander in den Nebenraum zu schleppen, wo sie eigentlich hingehörten. Dabei mußte ich mich gehörig beeilen, denn jedes Mal, wenn ich unterwegs war, fraß das Vieh bereits aus dem nächsten Sack.
Als ich endlich den letzten in der Kammer verstaut und die Tür verriegelt hatte, traute ich meinen Augen nicht. Die Kalbin stand wieder brav in ihrem Gehege, da es außerhalb offenbar nichts mehr Interessantes für sie gab, und glotzte mich an, ob wir das Spielchen nicht wiederholen könnten.
Ich knurrte aber nur „Mistvieh!“, bog mein schmerzendes Kreuz durch und drehte das Licht ab.
Zwei Tage später rief der Schartner an. Er wollte wissen, wo denn die Futtersäcke geblieben waren.
Mit deutlichem Ärger brachte ich zuerst mein Anliegen vor: „Herr Laubichler, wenn Sie mir schon ein altersmäßig überwuzeltes Rindvieh als Kalb unterjubeln, hätten Sie dann vielleicht die Güte, nächstes Mal dafür zu sorgen, daß es sich nicht nur symbolisch eingesperrt fühlt?“
Stille im Hörer! Nach einer halben Minute fragte ich: „Hallo! Sind Sie noch dran?“
„Aber sicher, Herr Doktor!“ Dann folgte wieder Schweigen!
Obwohl ich nicht erkennen konnte, ob sich diese Bestätigung darauf bezog, daß er anwesend war oder daß er meinen Vorwurf zur Kenntnis genommen hatte, beschloß ich großzügigerweise, letzteres anzunehmen und sagte ihm, wo er die verdammten Futtersäcke finden könnte.
„Also, das nächste Mal bitte das Tier anhängen!“
„Aber sicher!“
Es war Samstag nachmittag, vier Uhr, und ich bereitete mich seelisch bereits auf mein bevorstehendes kurzes Wochenende vor, da ich heute nur noch drei läppische Visiten zu absolvieren hatte und dann nach einer langen Woche Dauerdienst den Anrufbeantworter einschalten konnte und für Sonntag das Schicksal meiner Patienten vertrauungsvoll der Verantwortung des Vertretungskollegen überantworten durfte.
Ich war eben im Begriff, den Fahrersitz zu erklimmen, als mir Karin mit dem Telefon in die Garage nachgelaufen kam: „Der Schartner ist am Apparat, er möchte, daß du heute noch eine Kuh mit Panaritium auf der Alm behandelst!“ Damit streckte sie mir das Gerät entgegen.
Das hatte noch gefehlt! Die Schartneralm war eine von den ganz obersten, und der Weg hinauf eine Marter für Mensch und Auto. Da man wegen der schlechten Wegbeschaffung nur äußerst langsam fahren konnte, war jedes Mal mit einer Visite ein beträchtlicher Zeitaufwand verbunden.
„Ist die Kuh wenigstens im Stall?“ bellte ich ins Telefon.
„Aber sicher, Herr Doktor“, kam die seelenruhige Stimme des Bauern, als wäre das das Selbstverständlichste auf der Welt.
„Ich kann mich also darauf verlassen?“
„Sicher!“
Ich nahm also die Schartneralm in Angriff! Die Straße war auf weiten Strecken ausgewaschen, mit tiefen Schlaglöchern, teilweise lagen große Steinbrocken im Weg, um die man vorsichtig herumkurven mußte, dabei aber aufzupassen hatte, daß man mit den Rädern nicht über den Böschungsrand hinausgeriet. In der Mitte der Strecke führte eine höllisch schmale, altersschwache Holzbrücke über einen vom Berg herabschießenden Gebirgsbach, und an manchen Stellen hatten die Büsche die Fahrbahn bereits ziemlich überwuchert. Wenn der Schartner nicht bald etwas unternahm, würde die Alm in ein, zwei Jahren nur mehr zu Fuß zu erreichen sein.
Endlich kam das geduckte Dach der Almhütte hinter einer Wiesenkuppe in Sicht. Der Anblick, der sich mir bot, war kein erfreulicher: das große Flügeltor in den Stall gähnte weit offen und ließ deutlich erkennen, daß sich keine Kuh darinnen befand. In mir kroch die Wut hoch. Ich brachte den Wagen in einer hohen Staubwolke zum Stehen, stieg aus und ging um den Stall herum. Im geräumigen eingezäunten Vorgarten zwischen Kuhstall und eigentlicher Almhütte lag eine helle Fleckviehkuh im Gras und gab sich gelangweilt der Beschäftigung des Wiederkauens hin. Das war sie! Deutlich konnte ich ihren linken Hinterfuß sehen, den sie weit von sich gestreckt hatte und der doppelt so dick war wie normal. Ein Panaritium ist mit einer Nagelbetteiterung beim Menschen vergleichbar, kommt auf den Almwiesen durch Bodenbakterien sehr häufig vor, bereitet dem betroffenen Tier außerordentliche Schmerzen sowie Lahmheit und kann, unbehandelt, zu größeren und langwierigen Komplikationen führen.
Die Kuh bemerkte mit gespitzten Ohren mein Auftauchen und hüpfte wie von der Tarantel gestochen hoch, wobei sie das kranke Bein merklich schonte.
An sich war die Sache einfach. Ich müßte ihr nur eine Injektion mit einem bestimmten Antibiotikum verpassen, und die Schwellung samt dem Schmerz würde innerhalb von zwei Tagen verschwunden sein.
Das Problem hier war lediglich, daß das Medikament streng subcutan, also unter eine Hautfalte, zu spritzen war, und ich bezweifelte, daß die Kuh mir so lange Zeit lassen würde. Aber vielleicht konnte ich sie zurück in den Stall treiben?
Leider ist auch im Grünen alle Theorie grau!
Ich hatte bisher nicht gewußt, daß der Schartner Rennkühe züchtet. Trotz ihrer Behinderung raste das Rind in Bocksprüngen quer durch den Garten, immer sorgsam die Richtung offenes Stalltor meidend. Ich hinterher, aber als einzelner kann man schwer eine wilde Kuh einkreisen. Manchmal galoppierte sie nur auf drei Beinen, und als ich schon glaubte, sie zwischen Stallwand und Brunntrog in die Enge kanalisiert zu haben, warf sie sich ungestüm herum, rutschte aus und krachte in einen danebenstehenden Stapel häßlicher weißer Plastiksessel, die der sonntäglichen Almwanderer harrten. Die meisten Sessel gingen krachend zu Bruch, und einige flogen durch die Gegend, leider auch derjenige, über den ich fluchend stolperte. Die Kuh war ein paar Augenblicke früher als ich auf den Beinen, und der Status quo war wieder hergestellt, bloß mit einem Haufen Plastiktrümmern garniert.
Jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, die Aktion abzubrechen und nach Hause zu fahren, aber die Vorstellung, den ganzen Sauweg herauf am Montag nochmals wegen derselben Geschichte auf mich zu nehmen, ließ mich davon Abstand nehmen.
„Dich krieg ich schon!“ rief ich dem ebenfalls leicht echauffierten Rindvieh drohend zu und machte kehrt, um vom Auto das Abschleppseil zu holen. Ein anderer Strick von ausreichender Länge war auf der Schartneralm mit Sicherheit nicht zu erwarten.
Ich bastelte mir einen Lasso und kehrte in die Arena zurück. Die Kuh schaute gespannt zu mir herüber, und hätte sie zufällig einmal einen John-Wayne-Film gesehen, wäre sie angesichts meiner nun folgenden Einfangversuche vor Lachen zusammengebrochen.
Aber steter Tropfen höhlt den Stein. Plötzlich, nach sicher zwanzig erfolglosen Anläufen, bei denen die Schlinge entweder überhaupt nicht oder wenn, dann nur ein Horn traf, hatte sie das Seil plötzlich um den Hals.
Keine Ahnung, wer überraschter war!
Dann preschte sie los, ich im Laufschritt hinterher, das Seilende krampfhaft umklammernd. Ich wußte, wenn sie mir diesmal auskam, würde ich weder die physische noch die psychische Kraft aufbringen, es nochmals zu versuchen. Sie keuchte hörbar, denn die Schlinge schnürte ihr den wild schüttelnden Hals zusammen, aber für ein paar Extrarunden hatte sie noch genügend Luft.
Auf einer der letzten Runden schleifte sie mich erneut durch den wüsten Sesselfriedhof, aber mit der olympiareifen Eleganz eines Hürdenspringers meisterte ich auch dieses Hindernis. Endlich wurde ihr Schritt gebremster und schwankend, und als wir gerade beim Gartentor vorbeitrabten, schlang ich blitzschnell das Seilende mehrmals um einen Torpfosten.
So, jetzt hatte ich sie, vorausgesetzt, der Pfosten hielt besser als die Versprechungen des Schartner.
Es schien so! Unter Aufbietung der letzten Kräfte zog ich das pumpende Tier langsam näher an den Zaun heran, immer das Seil verkürzend, bis sie schließlich keuchend und pfeifend den Kopf ganz dicht am Holz hatte.
Ich verknotete den Strick und betrachtete traurig meine Handflächen. Viel Haut war nicht mehr übrig.
Da die Kuh mit ihrem gesamten Gewicht am Tor hing, ließ es sich nicht öffnen, und ich mußte, fertig und zittrig, wie ich war, um die Spritze aus dem Auto zu holen, über den spitzen Zaun klettern. Retour ebenfalls!
Während ich ihr endlich die Injektion mit tatterigen Händen und steifen Fingern unter die Halshaut gab, revanchierte sie sich mit einem saftigen Tritt ihres gesunden Fußes gegen mein Schienbein.
Ich band sie los, und wir trennten uns im synchronen körperlichen Zustand: keuchend und hinkend!
Na, dem Schartner werde ich was erzählen, nächste Woche!
Leider Fehlanzeige! Obwohl ich meine Wut, damit sie ja nicht verauchte, den Sonntag über sorgsam gehegt und gepflegt hatte wie ein Schrebergärtner seinen Zierrasen, hatte ich keine Gelegenheit, sie loszuwerden. Während der ganzen Woche ging der Schartner nicht ans Telefon, offenbar besaß er genügend Vorstellungskraft.
Aber meine zart keimende Hoffnung, daß ihn womöglich, zwecks höherer Gerechtigkeit, der Schlag getroffen haben könnte, zerstob in dem Augenblick, als mir Karin eines Morgens, als ich soeben aus dem Bad kam, mit unheilvoller Miene mitteilte, daß der Schartner angerufen habe, er hätte ein Stierkalb erworben, das unbedingt heute noch kastriert werden müsse, damit er es baldigst auf die Alm nachliefern könne.
„Der soll mir doch den Buckel runterrutschen!“ knurrte ich. „Und sich einen anderen Trottel suchen, der bei seinen Viechern Alleinunterhalter spielt!“
Karin schüttelte den Kopf: „Nein, ich habe ihm diesmal klipp und klar mitgeteilt, daß es nicht angeht, daß entgegen der Abmachung nie wer zum Helfen da ist und die Tiere frei herumlaufen! Er hat es ziemlich zerknirscht eingesehen und mich gebeten, dir auszurichten, er wäre heute am Vormittag garantiert zu Hause und würde auf dich warten!“
Mein höhnisches Lachen übertönte sogar das Mahlwerk der Espressomaschine: „Und das glaubst du? Was hat er denn gesagt? Vielleicht: aber sicher?“
Sie sah mich überlegen lächelnd an und nickte: „Er hat es mir hoch und heilig versprochen! Frauen üben bekanntlich in solchen Dingen einen anderen Einfluß aus, was dir offenbar bisher entgangen ist! Einige Kolleginnen haben das schon in Problemklassen, wo bisher alle männlichen Lehrer gescheitert waren, eindrucksvoll bewiesen! Das letzte pädagogische Seminar hatte diese Tatsache zum Thema!“
An sich hätte ich jetzt beeindruckt sein sollen, aber ich schlürfte den heißen Schwarzen in mich hinein und behielt die skeptische Linie bei: „Ob Frau oder Mann. Ich glaube, die seifenblasenartigen Versprechungen vom Schartner sind geschlechtsneutral!“
„Vertrau einfach der weiblichen Intuition!“
Als ich gegen halb elf am Schartnerhof eintraf, wurde ich tatsächlich bereits ungeduldig erwartet!
Allerdings nur vom grauen Hauskater, der mir um die Beine strich und sich etwas Milch erhoffte. Sonst war keiner da, außer einem schmierigen Zettel an der Stalltür. „Hab’ leider dringend weg müssen! Stierkalb ist in der Box!“
Voll böser Vorahnung stieß ich die Tür auf. Als einziges Vieh stand in der Gehschule ein Jungstier, gute fünf Monate alt, mit Muskelsträngen, vor denen sogar Muhammad Ali Respekt gehabt hätte!